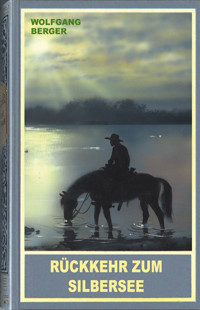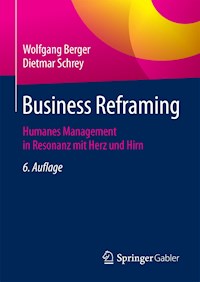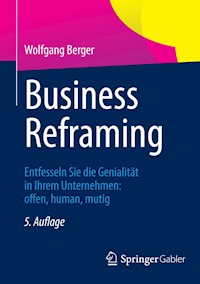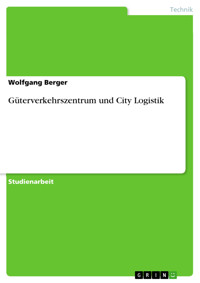Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Klekih-petra ist eine von Karl May erfundene Figur, die in den Romanen um Winnetou einen zwar nur kurzen, aber wichtigen Auftritt hat. Wolfgang Berger hat dabei schon immer interessiert, wie ein junger Deutscher zum Lehrer der Apatschen werden konnte. Eine mögliche Antwort auf diese Frage hat der niederbayerische Kabarettist, Moderator und Autor (Jg. 1971) nun als Roman niedergeschrieben, gleichsam als Vorgeschichte zu all den spannenden Abenteuern um den legendären Apatschen-Häuptling Winnetou. Hierin spielt auch dessen Vater Intschu tschuna bereits eine bedeutende Rolle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WEISSER VATER
DIE GESCHICHTEVON KLEKIH - PETRA
VON
WOLFGANG BERGER
Herausgegeben von Bernhard Schmid
© 2021 Karl-May-Verlag, Bamberg
Alle Urheber- und Verlagsrechte vorbehalten
Deckelbild: Klaus Lehmann
eISBN 978-3-7802-1632-8
Internetseite des Autors: www.faelscher-kabarett.de
Der Autor dankt Herrn Christian Strangmüller für die Vorab-Korrektur.
INHALT
1. Unruhen
2. Wasser, nichts als Wasser
3. Gottes Zorn
4. Meuterei
5. Gott, warum lässt du so etwas zu?
6. Auf dem Weg zum Mann
7. Tod
8. Rache
9. Sternenauge
10. Chickasaw und Mesipi
11. Keine Gnade
12. Verpflichtungen
13. Todeskampf am Trinitiy River
14. Frauenpower
15. Besorgniserregende Spuren
16. Hinterhältig
17. Mexiko
18. Zusammentreffen
19. Das Böse findet sich
20. Schlechte Aussichten
21. Belagerung
22. Gefangenschaft
23. Nicht schon wieder!
24. Aufgenommen
Epilog
1. Unruhen
„Nein“, sagte ich ganz entschieden, als ich auf dem Tisch im Bierkeller der ‚Roten Schänke‘ im sächsischen Waldenburg vor meinen Kommilitonen und einigen Schülern stand. Ich war einer der wenigen, die bereits im letzten Jahr des Studiums die jüngeren Jahrgänge unterrichten durften, weil ich selbst hervorragende Noten und außerdem ein gutes Händchen im Umgang mit den Schülern hatte. Mein besonderes Steckenpferd war die englische Sprache.
Durch das Gewölbe zog dicker Rauch, die Einrichtung war alt und die Tische zerkratzt. Trotzdem liebte ich diesen Ort, an dem ich mich zu Hause fühlte, an dem wir uns schon so oft getroffen hatten, um über Gott, die Welt und die Oberschicht zu diskutieren.
„Wir müssen uns endlich wehren. Ich lese in der Zeitung, dass man in Amerika die Sklaverei weiterhin aufrechterhalten will. Wollen wir etwa auch wie Sklaven sein? Ist der Adel etwa besser als das gemeine Volk? Sollen wir ewig die Unterdrückten bleiben? Wir haben von unseren Lehrern viel beigebracht bekommen und die Schulzeit auch erfolgreich absolviert. Wir fordern doch nicht viel von der Obrigkeit. Ich finde es beschämend, dass ich mich genau in diesem Moment strafbar mache, weil ich hier vor euch spreche. Was gibt es einzuwenden gegen die Redefreiheit oder ein Versammlungsrecht? Ich studiere, um mir eine Meinung zu bilden. Ich studiere, um mehr werden zu können als ein Knecht der Mächtigen. Ich habe doch ein Recht darauf, an nichts oder an etwas anderes zu glauben als die feinen, adeligen Herren. Warum haben sie uns unseren geliebten Freund und Lehrmeister Herrn Hoffmann weggenommen, nur weil er seine Meinung kundgetan hat? Wir schreiben das Jahr 1848, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Freunde, wir sollten uns bewaffnen und ihnen mutig entgegentreten. Sie gehen militärisch gegen uns vor und wollen uns so klein halten. Das dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen. Heute sitzen sie im Waldenburger Schloss und feiern und schlemmen. Es ist ihnen dabei völlig egal, wie es uns allen geht. Ich sage euch ganz deutlich, wir müssen schleunigst dagegen aufbegehren.“
In dem stickigen Bierkeller waren ungefähr 120 Menschen versammelt, die „Ja, wehren wir uns!“ riefen. Die meisten von ihnen kannte ich persönlich. In der vordersten Reihe standen mit erhobenen Fäusten meine treuesten Freunde Clemens, Ruppert und Konrad. Es war augenscheinlich nicht nur meine Rede, sondern auch eine erhebliche Menge des süffigen Biers gewesen, was sie zornig, mutig, aufrührerisch und schlussendlich zu Kämpfern meiner Worte gemacht hatte. Heute weiß ich, ich war damals noch sehr jung, ein Heißsporn mit einem großen Drang nach Freiheit, ständigen Zweifeln an der Existenz Gottes und leider auch noch ohne das nötige Verantwortungsbewusstsein anderen Menschen gegenüber.
Die Menschen skandierten in rhythmischen Parolen „Lasst Lehrer Hoffmann frei!“ und „Peter Berg, komm, führ uns an!“ Ich will es gar nicht beschönigen, ja, es machte mir wirklich Freude, als ich sah, dass ich etwas bewirken konnte mit meinem Talent, Menschen zu begeistern. Es war schon richtig, wir lernten, um zu verstehen und folglich etwas Besseres werden zu können als nur folgsame, dumme Dienstboten. Warum sonst hätte ich Geschichte, die englische Sprache und Philosophie studieren sollen?
Also marschierten wir mutig und angetrunken, mit Stöcken, Äxten und Mistgabeln bewaffnet, hinauf Richtung Schloss. Der steinige Weg, der durch die engen Gassen von Waldenburg führte, füllte sich langsam mit Menschen. Immer mehr schlossen sich uns an, die Parolen wurden lauter, aggressiver, die Menschen waren voller Zorn. Als wir um die letzte Wegbiegung kamen, erblickten wir das Schloss, die Zeit war also gekommen. Es ragte furchteinflößend vor uns auf, mit seinen steinernen Zinnen und dem riesigen, massiven Holztor, das aussah wie das gierige Maul eines Ungeheuers. Aber vor allem waren es die bewaffneten Soldaten, die sich mittlerweile in Reih und Glied vor uns aufgebaut hatten, die uns erschrecken ließen.
Wir formierten uns vor dem Herrschaftssitz, direkt gegenüber dem militärisch gut ausgebildeten Gegner. Wir nutzten Karren und umgeworfene Marktstände als Barrikaden zum Schutz vor dem mächtigen Feind. Ich wusste zwar, wie man Menschen zum Denken anregt, doch hatte ich keinerlei Kenntnisse von militärischen Strategien. Und genau das sollte uns schlussendlich zum Verhängnis werden.
Unser Aufstand war von Anfang an ein aussichtsloses Unterfangen. Als die Soldaten auf der Wehrmauer, angeführt von Major von Hüller, der uns allen nicht nur bekannt war, sondern von jedem auch gefürchtet wurde, mit ihren Flinten die erste Salve in den Pöbel krachen ließen, fielen Ruppert und Konrad leblos neben mir zu Boden. Die Nacht war plötzlich totenstill und eingehüllt von dichten Rauchschwaden. Rauch, der aus denselben Flinten hochstieg, die gerade so viele Leben beendet hatten. Im Nachhinein betrachtet, musste ich noch froh sein, dass meine Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lebten. Denn mir war klar, dass sich die Soldaten jeden vorknöpfen würden, der mir nahestand. Aber es war ohnehin niemand mehr da, ich war allein. Und in dem Moment, als die zweite Salve in die Menge fuhr, wusste ich, sollte ich dieses Gemetzel überleben, würde ich in Zukunft hier nie mehr sicher sein. Ich musste versuchen, schleunigst irgendwie von diesem Ort wegzukommen. Major von Hüller befahl die vorderste Reihe nach hinten und die nächste Linie seiner Untergebenen trat mit angelegten Flinten nach vorne.
Nach dem dritten Schuss suchten alle, die noch nicht getroffen waren, schnell das Weite, und ich war mitten unter ihnen. Wir stolperten und fielen in der Dunkelheit über mindestens fünfzig Tote und noch mehr Verletzte. Die im Todeskampf verzerrten Gesichter meiner gefallenen Freunde verfolgen mich seit jener Nacht in meinen Träumen.
Es würde keine Stunde vergehen, dann wüssten sie, wo „Peter Berg, komm führ uns an“ zu finden wäre. Schnell lief ich nach Hause, um einige Sachen aus meinem kleinen Zimmer in der Studentenpension zu holen. Ich überlegte, was mir von Nutzen sein könnte. Meine fünf Bücher, die mir Lehrer Hoffmann geschenkt hatte, meine Zeugnisse, die Geburtsurkunde, meine Kennkarte, mein Messer und etwas Kleidung. Ich besaß noch genau 37 Taler, die ich mein Eigen nennen durfte. Schnell stopfte ich meine Habseligkeiten in einen Rucksack, und als ich gerade durch die Haustür treten wollte, hörte ich eine Frauenstimme:
„Peter, warte.“
Ich drehte mich um und sah an der Ecke der angrenzenden Schmiede die Ehefrau unseres Lehrers Hoffmann stehen. Sie schlich zu mir herüber und sagte:
„Was ihr getan habt war leichtsinnig und dumm, doch treu gegenüber meinem Mann. Wie geht es den anderen?“
Mit Tränen in den Augen antwortete ich ihr:
„Die meisten sind tot und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll.“
„Hier hast du etwas Geld“, erwiderte sie, „es ist nicht viel, aber für eine Schiffspassage wird es wohl reichen. Mein Mann würde es sicher gutheißen, dass du es bekommst.“
Ich schaute etwas verdutzt und fragte sie:
„Schiffspassage, wohin denn?“
„Geh weg von hier, geh nach Amerika und beginne dort ein neues Leben. Es sind etwa 500 Kilometer bis Bremerhaven. Wenn du dich ranhältst, dann kannst du es schaffen, am 9. April die Reise anzutreten. An diesem Tag läuft ein Schiff nach New York oder Charleston aus, auf jeden Fall irgendwo an die amerikanische Ostküste. Fang ganz neu an! Wie ich gelesen habe, gibt es dort inzwischen auch einige deutsche Siedlungen. Aber jetzt geh ich lieber schnell nach Hause, denn die Soldaten werden sicherlich gleich hier auftauchen. Wenn ich an unserem Stall vorbeikomme, schließe ich das Tor auf. In der rechten Box steht eine Stute, die zwar ihre besten Jahre bereits hinter sich hat, aber den Weg bis Bremerhaven wird sie dich noch tragen. Verkaufe sie dort und denk in Amerika hin und wieder an uns Sachsen.“
Bevor sie ging, dankte ich ihr, umarmte sie so innig, wie ich vorher noch nie einen Menschen umarmt hatte, und sagte:
„Ich werde Euch nie vergessen und grüßt bitte Euren Mann von mir.“ Dann schaute ich ihr nach, wie sie lautlos die Gasse entlangschlich, bis sie hinter der Ecke des Fleischerhauses verschwunden war.
Mein nächster Gedanke war, dass ich unbedingt noch etwas Essbares auftreiben musste. Also ging ich in die Speisekammer, um mir einen Laib Brot zu holen. Dort angekommen, schrak ich zusammen, weil ich schwere Schritte hörte.
Ich verbarg mich flugs im Türrahmen, lugte ängstlich hervor und sah, wie eine hinkende Gestalt geradewegs auf mich zusteuerte. Hektisch keuchend flüsterte der Mann:
„Berg, hallo Berg, hallo Peter Berg, ich bin es, Clemens.“
Ich trat aus meinem Versteck.
„Clemens, du musst sofort von hier verschwinden, die Soldaten werden jeden Moment kommen.“
„Ich weiß“, entgegnete er, „sie sind schon auf dem Weg, ich habe sie von der Brücke aus gesehen. Auch du musst fliehen, sie haben mir einen Streifschuss an der Wade beschert, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll.“
Ich musste nicht lange überlegen:
„Komm mit mir, ich segle nach Amerika.“
Von diesem Moment an hatte ich einen Gefährten, dem ich noch sehr viel zu verdanken haben sollte. Mit einem Fetzen seines Hemdes versorgte ich notdürftig die blutende Wunde und dann marschierten wir los. Wie mir von Frau Hoffmann geheißen, gingen wir zum Stall, um die alte Stute zu holen. Unsere Gönnerin hatte Recht, das Pferd war die meisten Wege seines Lebens schon gegangen, die müden Augen tränten, das hellbraune Fell war bereits glanzlos. Es erinnerte an einen alten Ackergaul, und trotzdem schwangen wir uns dankbar auf den sattellosen Rücken und trabten los. Wir wussten, dass eine lange, schwierige Strecke vor uns lag und ritten deshalb in dieser Nacht, so weit der Klepper uns tragen konnte. Wichtig war für uns, die ersten Kilometer so schnell wie möglich zu bewältigen, danach würden wir an viele Dörfer und Siedlungen kommen. Wir hofften, dass die dort stationierten Polizisten von unserem Aufstand noch nichts erfahren hatten. Nach etwa einer Stunde waren wir an einem der Orte angekommen und versuchten, ihn nicht direkt zu passieren, sondern etwa 300 Meter unterhalb des offiziellen Brückenübergangs. Als wir durch einen Bachlauf gehen wollten, bemerkten wir eine Patrouille, die die Ostseite des Bachs kontrollierte. Wir verbargen uns hinter einem großen Felsen und hielten die Luft an, damit uns der Atemnebel in dieser feuchtkalten Nacht nicht verraten konnte. Die Pferdenüstern bedeckten wir mit einer unserer Jacken und warteten ab, bis die Wachen wieder verschwunden waren. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Zweimann-Wache sich so weit von unserem Standort entfernt hatte, dass sie uns beim Überschreiten der Gemeindegrenze nicht mehr entdecken konnte. Es war Ende März und es war noch kalt, sehr kalt. Aber vor Aufregung und Angst spürten wir weder die Kälte, noch nahm mein Freund Clemens die Schmerzen wahr, die von seiner verwundeten Wade ausgingen.
In dieser Nacht legten wir eine Strecke zurück, die ich dem alten Gaul niemals zugetraut hätte, zumal er mit uns beiden eine stattliche Last zu tragen hatte. Als am Morgen die Sonne aufging, hatten wir Schkölen erreicht, ein kleines, unscheinbares Dorf, in dessen Nähe wir in einer feuchten Höhle im Wald Unterschlupf fanden, uns mit Quellwasser und einem Laib Brot stärkten und anschließend eine zweistündige Pause gönnten. Auch das arme Pferd musste schließlich fressen und sich etwas ausruhen. Wir planten, hauptsächlich abseits der Straßen in den Wäldern zu reiten. Wenn wir weiter in diesem Tempo vorankämen, könnten wir Bremerhaven in einer Woche erreicht haben.
Nach kurzem, unruhigem Schlaf machten wir uns wieder zum Aufbruch bereit. Es war klar, dass mittlerweile überall mein Steckbrief hing. Deshalb rasierte ich mir vor der Weiterreise den Schnauzbart und meine kompletten Haare ab. Das stellte sich im Nachhinein als kluger Schachzug heraus. Clemens musste sein Äußeres nicht verändern, da ihn ohnehin niemand kannte. Wir wirkten auf die Menschen wie zwei Studenten, die einen Ausflug auf einem Pferd machten, was zu jener Zeit nicht ungewöhnlich war. Wenn da nicht der blutig-eitrige Verband an Clemens Wade gewesen wäre, der nun wirklich nicht zu übersehen war.
Kurz nach Mittag, als wir durch einen kleinen Wald bei Cölleda ritten, schrie Clemens plötzlich vor Schmerzen laut auf. Wir hielten an, stiegen ab und ich sah mir seine Wunde genauer an. Eine eitergefüllte Blase hatte sich über der etwa fünf Zentimeter langen und drei Zentimeter breiten Streifschusswunde gebildet.
„Clemens, es tut mir sehr leid, aber der Eiter muss heraus“, erklärte ich ihm. „Ich werde mit meinem Messer einen Längsschnitt in die Haut machen, den Eiter ablassen und danach die Wunde ausbrennen. Also brauchen wir ein kleines Feuer.“
Ich klaubte in dem dichten Wald etwas Brennholz zusammen, entfachte damit ein Lagerfeuer und hielt mein scharfes Messer in die heißen Flammen. Als die Klinge nach einiger Zeit anfing zu glühen, zwängte ich einen fingerdicken Fichtenast zwischen Clemens’ Zähne. Ich nahm das Messer fest an seinem Schaft und schnitt damit in die Wunde meines Freundes. Mir wurde speiübel, denn die glibberige, gelbliche Eitermasse stank bestialisch, noch nie zuvor hatte ich einen schlimmeren Geruch wahrgenommen. Augenblicklich, nachdem die zähe Flüssigkeit aus der Wunde getreten war, kauterisierte ich diese mit dem glühend heißen Messer. Clemens Schreie drangen ohrenbetäubend durch die Stille, bis er durch eine gnädige Ohnmacht von seinen Schmerzen erlöst wurde.
Seine Schreie, die durch den Wald hallten, machten wohl auf uns aufmerksam, denn plötzlich tauchte ein uniformierter Mann vor uns auf.
„Was ist passiert?“, wollte er neugierig wissen.
Ich war so erschrocken, dass ich erst gar nicht wusste, was ich sagen sollte. Doch meine Gehirnzellen gaben instinktiv den Befehl: „Verrate dich nicht!“ Auf der Stelle musste also eine unverfängliche Antwort her.
„Mein Freund wurde von einer Ratte gebissen“, log ich, „die Wunde fing an zu eitern, ich habe sie gerade behandelt und dabei ist er ohnmächtig geworden. Wenn er wieder aufwacht, wollen wir schnell weiter. Wir sind unterwegs auf einem Studentenausflug nach Bremerhaven, um uns die Schiffe anzuschauen und sie zu studieren.“
„Aha“, zeigte der Mann Verständnis, „passt nur auf, es ist ein Rebell und Aufwiegler aus Waldenburg unterwegs, der äußerst gefährlich ist.“ Dabei hielt er mir einen Steckbrief vor die Nase, auf dem deutlich eine Zeichnung von mir zu erkennen war.
„Ist der Gesuchte allein, oder müssen wir vor mehreren Bösewichtern Angst haben?“, wollte ich wissen. Ich war sehr erleichtert, als er sagte, dass der Aufrührer wohl allein und wahrscheinlich eher in Richtung Bayern unterwegs sei.
Diese Begegnung gab mir die Gewissheit, dass wir einigermaßen sicher waren, jedoch konnte ich erst erleichtert aufatmen, als sich der uniformierte und äußerst gesprächige Mann endlich verabschiedet hatte.
Das momentane Gefühl der Sicherheit war beruhigend und so konnte ich mich ohne Sorgen darum kümmern, etwas Essbares für uns aufzutreiben. Wenn Clemens wieder aufwachte, würde er etwas zur Stärkung brauchen. Bevor das Feuer ganz niedergebrannt war, legte ich morsches Fallholz nach und ging zurück zu dem Bauernhaus, an dem wir vor Kurzem vorbeigekommen waren. Ich erstand für einen halben Taler zehn Eier, und noch bevor Clemens aufwachte, briet ich Spiegeleier auf einem großen Stein, den ich zuvor in die Mitte des Feuers gelegt hatte. Ich hing meinen Gedanken nach, als mein Begleiter plötzlich die Augen aufschlug.
„Danke mein Freund“, waren seine ersten Worte, die mich zuversichtlich in die Zukunft blicken ließen.
Während wir unser einfaches Mahl hungrig hinunterschlangen, erzählte ich ihm von meiner Begegnung mit dem Fremden und die gute Kunde, dass keiner von ihm als meinem Weggefährten wusste. Sie suchten nach einem einzelnen Mann mit Schnurrbart und vollem Haar, ich aber war inzwischen glattrasiert und kahlgeschoren.
Nach weiteren acht Tagen und Nächten im Wald mit spärlichem Essen, kamen wir in Bremerhaven an und verkauften unsere alte Stute, die uns erstaunlich gute Dienste geleistet hatte. Die 20 Taler, die sie uns einbrachte, würde ich irgendwann meiner Unterstützerin, Frau Hoffmann, zurückgeben. Aber im Moment brauchten wir sie dringender. Eine Schiffspassage sollte 66 Taler kosten und für die Verpflegung auf der vierzehntägigen Reise benötigten wir zusätzliche 25 Taler. Außerdem rechneten wir noch eine kleine Summe dazu, die uns in Amerika als Startkapital dienen sollte. Wir mussten also in den nächsten drei Tagen noch einiges an Geld auftreiben, aber wie?
Clemens sprach von der Option, dass wir uns im Hafen als Gepäckjungen etwas verdienen könnten. Doch dort wimmelte es nur so von Gepäckjungen, also klapperten wir die örtlichen Gasthäuser ab und fragten nach Arbeit, aber ohne Erfolg. Bis ich die glorreiche Idee hatte, uns anheuern zu lassen, um auf der Überfahrt als Matrosen zu arbeiten. „Das Beste daran ist, wir werden auch noch verköstigt und brauchen nichts dafür zu bezahlen“, erklärte ich. Doch leider hatten diese Idee viele junge Burschen, die zudem meist auch noch deutlich kräftiger waren als wir.
Zwei Tage vor Abfahrt des Dreimasters ‚Hoffnung‘ und noch immer ohne Schiffskarten, saßen wir am Hafen auf einer Bank und ließen uns eine Portion Kraut schmecken, die wir in der Hafentaverne für einen halben Taler gekauft hatten. Nachdem unser Hunger einigermaßen gestillt war, holte ich eines der Philosophiebücher aus meinem Rucksack und las ein Zitat von Goethe vor: „Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren; seid stärker, mutiger, geschickter zu euerm Geschäft“, als plötzlich ein Mann vor uns stand.
Interessiert sah er mich an und fragte:
„Guten Tag meine Herren, mein Name ist Camillus Bauer, sind Sie etwa studierte Menschen?“
„Ja“, erwiderte ich, „ich habe viel Zeit auf das Studium der Philosophie, Geschichte und der englischen Sprache verwendet, warum fragen Sie?“
Der Mann nahm seinen Hut vom Kopf und setzte sich zu uns.
„Ich bin auf der Suche nach einem Hauslehrer für meine vier Kinder, wir sind unterwegs nach Arizona in Amerika und ich möchte, dass sie weiterhin eine gute, deutsche Bildung erhalten. Haben Sie nicht Lust, mit uns zu kommen?“
Ich lächelte und sagte:
„Lust hätten wir schon, aber das Geld für die Überfahrt fehlt uns leider.“
„Wenn Sie sich verpflichten, für mindestens ein Jahr meine Kinder zu unterrichten, dann werde ich Ihnen Ihre Schiffskarte bezahlen“, bot er mir an.
Er bemerkte sofort, dass ich seine großzügige Offerte gerne annehmen würde, aber da war noch Clemens, also fragte ich:
„Sehr gerne, aber nicht allein, ich fahre nur mit meinem Freund. Haben Sie auch für ihn eine Beschäftigung?“
„Nein, leider nicht, nur Ihre Dienste sind wichtig für mich. Aber wenn Sie die Hälfte des Geldes für die zweite Schiffspassage selbst aufbringen können, werde ich ihn als meinen Sekretär mitnehmen. Drüben in Amerika will ich eine Mission für die rothäutigen Wilden eröffnen. Dafür könnte ich noch einen guten, tatkräftigen, jungen Mann zum Registrieren der Indianer gebrauchen.“
Es dauerte nicht lange und wir waren uns einig. Wir besiegelten die Abmachung mit einem Handschlag und Herr Bauer besorgte die beiden zusätzlichen Schiffskarten. Dann formulierte er einen Vertrag, der uns beide für ein Jahr verpflichtete, unsere Schulden abzuarbeiten. Zufrieden setzten wir unsere unleserlichen Unterschriften auf das Papier.
„Ich bin Peter“, sagte ich, „und ihr neuer Sekretär heißt Clemens.“
Nach unseren Nachnamen fragte er nie.
Nach Erhalt der Schiffskarten, gab ich ihm die vereinbarten 33 Taler und wir waren überglücklich. In den nächsten Stunden kauften wir alles Nötige ein, das wir auf der Überfahrt brauchen würden. Wasser gab es genug auf dem Schiff, aber wir mussten uns ausreichend Verpflegung besorgen. Ständig hörten wir, man müsse auf der Hut sein vor der Krankheit Skorbut, die sich durch Mangel an frischen Früchten und Gemüse ausbreite. Deshalb gingen wir zum Markt und kauften Äpfel und Birnen von der letzten Herbsternte sowie Kraut, Möhren und Zwiebeln. Den Proviant verstauten wir in einer, auch teuer bezahlten, Holzkiste und brachten sie auf das Schiff.
Wir zeigten unsere Passagebelege, woraufhin uns ein Platz im Unterdeck zugewiesen wurde, der uns wohl für die nächsten vierzehn Tage als Unterkunft dienen musste. Wir beratschlagten, was für uns noch wichtig sein könnte: Blechteller, Trinkgefäße sowie lange haltbares Rauchfleisch und Schiffszwieback. Von unserem Geld blieb noch einiges übrig und so glaubten wir, für Amerika gut gerüstet zu sein.
Das Schiff war vom Hafen aus betrachtet schon sehr beeindruckend mit seinen hohen Masten, den riesigen Segeln, die aufgewickelt an den Querbalken angebunden waren, und dem zuversichtlichen Namen ‚Hoffnung‘. Aber als wir auf dem Schiff standen und die Abmessungen und den Platz für die Passagiere aus der Nähe sahen, waren wir doch etwas eingeschüchtert.
Da die Abfahrt am nächsten Tag schon für Sonnenaufgang geplant war, blieben wir die Nacht über bereits auf dem Schiff. Wir erschraken, als kurz vor der Abfahrt ein Trupp berittener Soldaten an der Anlegestelle eintraf. Es waren zehn Mann unter der Führung eines alten Bekannten, die mit leichtem Gepäck, aber schwer bewaffnet das Deck des Schiffs betraten. Der Mann war Major von Hüller aus Schloss Waldenburg. Angst erfüllte uns, denn wir konnten das Schiff jetzt nicht mehr verlassen oder uns in den nächsten vierzehn Tagen darauf komplett versteckt halten. Außerdem warf seine Ankunft gleich mehrere Fragen auf:
Zum Ersten, was will der hier in Bremerhaven, er hat doch hier wohl keine amtlichen Befugnisse? Zum Zweiten, ist er auf der Suche nach dem Rebellen Peter Berg, also nach mir? Zum Dritten, warum ausgerechnet dieses Schiff? Und zum Vierten, erinnert er sich an mein Gesicht? Unser einziger Lichtblick in diesem Moment war der Name des Schiffs – ‚Hoffnung‘.
Der Anker wurde gelichtet, wir verließen Deutschland und segelten der neuen Welt entgegen, auf zu unbekannten Abenteuern. Mit einem Gefühl der Angst vor der ungewissen Zukunft machten wir uns auf die lange Reise nach Amerika. Von nun an waren wir ganz offiziell „Forty-Eighters“. So wurden all diejenigen genannt, die den alten Kontinent infolge der Europäischen Revolution 1848/49 verlassen hatten, um in Amerika neu anzufangen.
2. Wasser, nichts als Wasser
Der erste Tag der Überfahrt war ein heilloses Durcheinander, ein typischer Apriltag mit starkem Wind und vereinzelten Regenschauern. Nach dem Auslaufen des Schiffs blickte ich noch lange auf das deutsche Festland zurück, Wehmut und Abschiedsschmerz überkamen mich. Natürlich mag auch die Angst vor dem Neuen überwogen haben, so genau kann ich das heute nicht mehr sagen.
Es waren circa 280 Menschen auf dem Schiff. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich der Major in dieser Menge bemerkte, war relativ gering. Genau in dem Moment aber ertönte seine Stimme hinter mir.
„Dich habe ich doch schon mal gesehen.“
Ich drehte mich um und da stand er, Major von Hüller in voller Lebensgröße.
„Nicht, dass ich wüsste“, log ich ganz frech, „ich bin der Hauslehrer von Herrn Camillus Bauer und seiner Frau. Ich werde hier auf dem Schiff und auch später in Amerika seine vier Kinder unterrichten.“
In seiner bestimmenden Art fragte er:
„Wie ist deine Name, Bursche?“
Dabei starrte er mich an, als würde mein Steckbrief an meiner Stirn kleben.
Ich schluckte und überlegte kurz. Ein Name schoss mir spontan durch den Kopf:
„Hoffmann, Peter Hoffmann.“
Gott sei Dank kam in diesem Augenblick ein Soldat seiner Truppe mit einem Anliegen auf ihn zu, woraufhin er von mir abließ und wohl dringendere Dinge zu regeln hatte. Wichtig war jetzt, Clemens schnell meinen neuen Namen mitzuteilen, damit ich nicht durch einen dummen Zufall in Verdacht geriet. Als ich Clemens gefunden hatte, erklärte ich ihm die Lage. Doch der hatte in diesem Moment ganz andere, und zwar üble Sorgen. Wir befanden uns seit ungefähr vier Stunden auf hoher See und seine Gesichtsfarbe erinnerte mich an die in Kreide geschriebenen Wörter an der Tafel der Universität, weiß mit einem leichten Stich ins Grüne. Mein Freund war seekrank geworden und verbrachte die überwiegende Zeit des ersten Tages damit, seinen Mageninhalt, weit über die Reling gebeugt, dem offenen Meer zu übergeben.
„Irgendwann einmal habe ich gehört oder gelesen, dass es zwei Tage dauern soll, bis sich der Körper an dieses Schaukeln gewöhnt“, versuchte ich ihn zu beruhigen. Eine Lüge zwar, aber in Anbetracht seines erbärmlichen Zustands tröstende Worte.
„Ich sehe Wasser, nichts als Wasser“, brachte er nur mehr hervor und sogleich ergoss sich aus seinem Mund wieder der gallefarbene Inhalt seines Magens und platschte lautstark ins Meer.
Am späten Morgen ließ Herr Bauer nach uns rufen und so nahmen wir die vereinbarten Tätigkeiten auf. Clemens nutzte die Zeit, um zusammen mit Bauer und seiner Frau Barbara Pläne zu zeichnen, wie die Mission aufgebaut werden sollte.
Dabei stellte sich heraus, dass Herr Bauer ein typisch deutscher Erbsenzähler war, ausgestattet mit einem übertriebenen Hang zu Ordnung und Gründlichkeit. Sie erstellten jede Menge Materiallisten, damit sie gut vorbereitet in den Läden, irgendwo in Amerika, alles Nötige einkaufen konnten und dabei ja nichts vergaßen. Bauer wusste in seiner Detailversessenheit sogar ganz exakt, wie viele Balken, Nägel oder Hämmer er jeweils für eine unterschiedliche Anzahl an Arbeitern benötigte.
Meine Aufgabe bestand darin, seine vier Kinder zu unterrichten. Mathematik, etwas Bibellehre und vor allem die englische Sprache standen dabei im Vordergrund. Englisch deshalb, weil in Amerika nur eine sehr verrohte Form davon gesprochen wurde. Ehrlich gesagt, fand ich persönlich die Bibellehre nicht so wichtig, weil ich schon seit geraumer Zeit mit Gott und dessen irdischem Gefolge im Zwist lag.
Die vier Bauer-Kinder hatten besonders in der englischen Sprache schon gute Grundlagen. Nebenbei fiel mir aber auf, dass sich die meisten der Auswanderer, die sich auf dem Schiff aufhielten, bis dato nicht auf das Neue, das vor ihnen lag, und schon gar nicht auf die fremde Sprache vorbereitet hatten.
Da am Bug der Wind sehr stark war, versammelten wir uns am Heck. Ich setzte mich auf ein Fass und begann meine erste Englischstunde für die vier Schüler abzuhalten. Wie schon erwähnt, war ich sehr angenehm überrascht, als ich feststellte, dass das Grundwissen der Kinder bereits ein gutes Niveau erreicht hatte. Also gingen wir schnell dazu über, englische Ausdrücke und Sätze für den täglichen Gebrauch zu lernen und zu üben. Grüßen, Einkaufen, nach dem Weg fragen und weitere bedeutsame Sätze, wie das einfache „I love you“.
Der jüngste Sohn der Familie Bauer hieß Jakob, er war mit seinen zehn Jahren bereits sehr aufgeschlossen und neugierig. Dann kam David, 14 Jahre alt und eher an praktischen Dingen interessiert, zum Beispiel, wie man in englischer Sprache eine Flinte kaufen konnte. Der älteste Sohn war Michael, der mit seinen 19 Jahren schon auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war und auf den Spuren Gottes wandelte. Das Mädchen in der Familie war die 17-jährige Anna, die mich anhimmelte, egal, was ich tat oder sagte. Machte ich einen plumpen Witz, lachte sie am lautesten. An meinen Fragen zur Schöpfung war sie sehr interessiert und auch bei den englischen Ausführungen zum Thema Liebe war sie am leidenschaftlichsten und übersetzte die Texte voller Inbrunst, während sie mir dabei Blicke zuwarf, die mir teilweise sehr unangenehm waren.
Da ich nur zwei Jahre älter war als Michael, hatten wir beide sehr schnell ein freundschaftliches Verhältnis und trafen uns häufig auch nach den Unterrichtsstunden auf ein Gespräch, zu lustigen Unterhaltungen oder hitzigen Diskussionen. Man könnte sagen, wir hatten schnell einen wirklich guten Draht zueinander gefunden.
Als wir am zweiten Tag mit dem Unterricht beginnen wollten, kam eine andere Familie zu uns ans Heck und fragte, ob sie sich dem Englischunterricht anschließen dürften. Sie hätten gestern einige Brocken meiner Unterweisung aufgeschnappt und dabei bemerkt, dass sie mit ihren dürftigen Englischkenntnissen nicht einmal in der Lage seien, sich ein Brot zu kaufen. Ich erklärte ihnen, dass ich darüber erst mit meinem Auftraggeber reden müsse, ob das für ihn auch in Ordnung sei. Und so machte ich mich auf, um mich mit Camillus Bauer zu besprechen. Ich war auf dem Weg ins Unterdeck, da trat mir Major von Hüller in den Weg.
„Ich habe die ganze Nacht gegrübelt, woher ich dich kenne, aber es wollte mir einfach nicht einfallen. Irgendwann komme ich schon noch drauf. Warum hast du eigentlich keine Haare?“
Mein Verstand schärfte mir ein, „verrate dich nicht“, und so erfand ich wieder eine einleuchtende Geschichte:
„Alle Männer in unserer Familie werden bereits in jungen Jahren von Haarausfall geplagt, ich bin da leider keine Ausnahme.“
Ganz ehrlich, mir war es sehr zuwider, dass ich erneut lügen musste. Bis vorgestern war ich eigentlich ein von Grund auf ehrlicher Mensch gewesen. Ich hatte in der Vergangenheit nur äußerst selten gelogen, da ich mögliche Konsequenzen scheute. Aber sicher nicht, wie viele andere, aus Angst vor der Strafe Gottes.
„Du unterrichtest auch die englische Sprache, habe ich gestern ganz nebenbei mitbekommen. Könnten meine Männer und ich zu euch stoßen, um von dir zu lernen, uns in Amerika besser zu verständigen?“
Ich gab ihm dieselbe Antwort wie gerade eben der Familie. Ich hoffte, Camillus Bauer würde nein sagen. Aber nachdem ich ihn gefragt hatte, meinte er zu meinem Missfallen:
„Ich bin der Überzeugung, jeder sollte Zugang zur Bildung erhalten, und als gottesfürchtiger Missionar will ich dafür Sorge tragen, dass allen Menschen Hilfe zuteilwird. Wenn meine Kinder dadurch nicht zu kurz kommen, dann, lieber Peter, lehre die Menschen ruhig die Grundlagen der englischen Sprache.“ Und schon widmete er sich zusammen mit Clemens wieder seinen immens wichtigen Listen.
Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass jeden Tag nach der Frühmahlzeit am Heck des Schiffs eine Lehrstunde stattfand. Zu den vier Bauer-Kindern gesellten sich nun zehn Soldaten, Major von Hüller selbst und ungefähr vierzig der Forty-Eighters, eine ausgesprochen große Klasse also. Viele davon konnten kein Wort Englisch und deshalb musste ich wieder zu den Grundlagen zurückkehren, wie den Farben, Tieren, Wochentagen oder Speisen. Zu Beginn einer jeden Stunde fragte ich das Gelernte vom Vortag ab. Von Hüller war dabei der Einzige, der mich weiterhin sehr misstrauisch beäugte. Ob er vielleicht schon Verdacht geschöpft hatte und mich in Verbindung zu den Unruhen vor Schloss Waldenburg brachte?
So vergingen die ersten Tage auf See, Clemens hatte sich mittlerweile an das Schaukeln und die wässrige Umgebung gewöhnt. Ich war mit Unterrichten und Abfragen beschäftigt genug, was mir aber nur bedingt half, das Hüller-Problem aus meinen Gedanken zu verdrängen. Nur die Besatzung der ‚Hoffnung‘ war nicht glücklich über unser ‚Klassenzimmer‘ am Heck, weil die Männer nicht reibungslos an uns vorbeikamen, um den Schiffsabfall ins offene Meer zu entsorgen. Für die Seemänner war der Schuldige dafür schnell gefunden, der war nämlich ich. Am sechsten Tag unserer Überfahrt, der Seegang war enorm hoch, wir saßen gerade wieder in unserem ‚Klassenzimmer‘, kam der Schiffskoch daher, alle nannten ihn nur ‚Warzen-Jupp‘. Aus Versehen rempelte ich ihn leicht an, als er die Abfälle über Bord kippen wollte. Er zog sofort sein Messer.
„Guter Mann, es tut mir leid, der Seegang war schuld, das war keine Absicht“, wollte ich ihn besänftigen. Doch der ungehobelte, mit einer schmutzigen Schürze bekleidete Mann wollte gar keine Entschuldigung hören, er war auf Streit aus. Augenblicklich ging er auf mich los und wollte mir sein langes, scharfes Küchenmesser in den Bauch rammen, als uns alle ein ohrenbetäubender Knall zusammenfahren ließ. Major von Hüller hatte den Koch mit einer gezielten Ladung in den Arm davon abgehalten, mir die Gedärme aus dem Leib zu schneiden. Es war nur ein Streifschuss am Oberarm, der zwar eine stark blutende Wunde verursacht hatte, jedoch keineswegs lebensgefährlich war. Warzen-Jupp schrie laut auf vor Überraschung und Schmerz, doch nach einer schier endlosen Fluchtirade verschwand er schließlich in seiner Kombüse. Alle, außer von Hüller, hatten währenddessen schnell das Weite gesucht, um nicht in diese gewalttätige Auseinandersetzung hineingezogen zu werden. Naja, Feigheit ist eben doch eine Eigenheit der Menschen.
Der Kapitän indes kam voller Wut auf uns zu und fing lautstark an mit Major von Hüller über den Vorfall zu diskutieren. Erst nachdem dieser ihm die genauen Vorkommnisse geschildert hatte, ging der Kapitän etwas genervt davon und führte im Anschluss in seiner Kajüte ein eingehendes Gespräch mit dem Koch. Ich bedankte mich beim Major für seine Hilfe.
„Diesem ungehobelten, gottlosen Gesindel muss man Manieren beibringen“, knurrte er zornig. „Ich denke, dass das, was Sie hier für uns leisten, mehr Wert besitzt als der Fraß, den dieser Raufbold in seinen schmutzigen Töpfen und Pfannen zusammenpantscht. Und wenn hier schon einer jemanden tötet, dann bin ich das. Im Übrigen weiß ich immer noch nicht, wo ich Ihr Gesicht einordnen soll, aber das wird mir auch noch einfallen. Ich denke die ganze Zeit an Ihren Namen, Hoffmann. Haben Sie Verwandtschaft in Waldenburg? Da haben wir vor Kurzem einen Hoffmann verhaftet. Sind sie etwa verwandt oder bekannt mit diesem Aufrührer?“
„Der Name Hoffmann ist doch in Thüringen verbreitet wie der Name Huber in Bayern“, führte ich schnell an. Er aber musterte mich eingehend, überlegte kurz und nickte, während ihm dabei ein kurzes Lächeln übers Gesicht huschte. Nach dieser Reaktion fiel mir der sprichwörtliche Stein vom Herzen.
Zum ersten Mal sah ich etwas freundlich Menschliches an dem Mann, dem alle sonst nur in Angst begegneten.
„Warum wollen Sie in die neue Welt?“, fragte ich ihn. „Wie ich das sehe, haben Sie doch sehr viel erreicht als Soldat in Deutschland; und mit der Obrigkeit haben Sie anscheinend auch keine Probleme, oder?“
Er aber verneinte beides:
„Wir Soldaten sind auch nur Leibeigene der sogenannten oberen Zehntausend, genau wie das gemeine Volk. Wir haben Befehle zu befolgen, ob wir sie nun gut finden oder nicht. Manchmal hätte ich denen da oben gerne gründlich die Meinung gegeigt, aber die Wahrheit zu sagen, kann sehr gefährlich sein. Das ist mir spätestens in dem Moment klar geworden, als ich diesen Hoffmann, über den ich vorhin gesprochen habe, am Tag vor unserer Abreise bestrafen musste. Nur weil er seine Sichtweise deutlich ausgesprochen hatte und daraus ein Aufruhr entstanden war, mussten wir ihn an der Burgmauer von Waldenburg durch ein Erschießungskommando hinrichten. Ich habe den Befehl dazu gegeben und sah seinen Körper leblos zu Boden sinken, nachdem ihn die Flintenkugeln getroffen hatten und sein Blut die Mauersteine hinter ihm rot färbte.“
Nach diesen Worten wurde er sehr still. Ich konnte eine gewisse Melancholie an ihm spüren. Ich selbst war ebenso berührt und versuchte, meine Tränen zurückzuhalten, da ich gerade vom Tod meines väterlichen Freunds erfahren hatte. Er sprach weiter:
„Wissen sie Herr Hoffmann, einige Männer meiner Truppe waren genauso verärgert über diese Vorgehensweisen und politischen Zustände. Als Anführer erkennt man es, wenn sich Unzufriedenheit, Unverständnis und Rebellionsgedanken in die Köpfe einschleichen. Die zehn Männer, die mit mir an Bord dieses Schiffes gegangen sind, stehen schon einige Jahre unter meinem Kommando, sie sind mir treu ergeben. Deshalb war die Auswahl meiner Begleiter auch schnell getroffen. Wir sind wie eine Familie, wir sind sehr vertraut miteinander und da habe ich sie eben gefragt, ob es ihnen auch so geht wie mir. Von allen zehn Männern habe ich ein eindeutiges ‚Ja‘ vernommen und daraufhin haben wir besprochen, was wir machen könnten, um etwas zu verändern. Natürlich haben auch wir auf den Anschlagtafeln die Worte gelesen, dass die neue Welt für jeden Platz hat. Die Idee nach Amerika zu gehen, finden wir alle gut. Gleich am Tag nach der Erschießung verlangten wir unsere Entlassung. Es waren lange Dispute, gegen uns wurden viele Drohungen und feindselige, bissige Worte ausgestoßen. Aber nun sind wir hier, weil man letztendlich doch anerkannt hat, dass wir lange Jahre gute und treue Dienste geleistet haben. Wir sind freie Männer. Uns alle hält nichts mehr in Deutschland. Wie ist es bei Ihnen, Herr Hoffmann?“
Ich antwortete ihm mit einer leisen Träne im Auge:
„Auch ich habe niemanden mehr, der mir das Weggehen schwer gemacht hätte.“
So saßen wir noch fast eine halbe Stunde auf unserem Unterrichtsplatz, schauten schweigend in die Ferne und hingen beide unseren Gedanken nach. Um uns herum nur Wasser, nichts als Wasser.
3. Gottes Zorn
Die Tage vergingen nur langsam auf der ‚Hoffnung‘. Meine Bartstoppeln begannen wieder zu sprießen, genauso wie die Haare auf meinem Schädel. Deshalb musste ich mich regelmäßig mit einem Messer und etwas Schmierseife scheren, um keinerlei Verdacht oder Fragen aufkommen zu lassen. Clemens, der sichtlich wieder guter Dinge war, half mir dabei. Er mochte seine Aufgabe als Sekretär, und seine Wunde am Bein war inzwischen auch gänzlich verheilt.