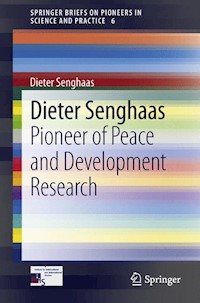14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Struktur der Welt ist seit langem durch extreme Hierarchisierung und Abschichtung gekennzeichnet. In vielen Dimensionen sind Zerklüftungen zu beobachten. So besteht zum Beispiel im Weltwirtschaftssystem eine dramatische Kluft zwischen der sogenannten OECD-Welt und dem »Rest der Welt«. Während erstere dicht und relativ symmetrisch unter sich vernetzt ist, ist die übrige Welt nach wie vor überwiegend asymmetrisch auf dieses Gravitationszentrum ausgerichtet. Diesem weiterhin weltpolitisch tonangebenden, in sich hoch koordinierten Gravitationszentrum (ca. 16 Prozent der Weltbevölkerung) steht bisher kein vergleichbar koordiniertes kollektives oder auch nur regionales Machtzentrum gegenüber. Die Zerklüftungen innerhalb der Nicht-OECD-Welt sind nicht weniger markant: Etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung leben unter den Bedingungen von »Staaten«, die zusammengebrochen sind oder deren Zerfall ernsthaft droht. 37 Prozent leben allein in zwei Makrostaaten: China und Indien, weitere 37 Prozent in ca. 130 Gesellschaften, die sich durch eine sogenannte begrenzte Staatlichkeit auszeichnen. Programmatiken über Weltordnung und Weltregieren müssen sich heute mit elementaren Sachverhalten dieser Art auseinandersetzen, ansonsten blieben sie weltflächig-abstrakt, folglich analytisch fragwürdig und letztlich praktisch irrelevant. Weltordnungsprogrammatiken bedürfen, sofern sie wirklich auf die gesamte real existierende Welt bezogen sind, einer problemadäquaten Kontextuierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Die Struktur der Welt ist seit langem durch extreme Hierarchisierung und Abschichtung gekennzeichnet. In vielen Dimensionen sind Zerklüftungen zu beobachten. So besteht zum Beispiel im Weltwirtschaftssystem eine dramatische Kluft zwischen der sogenannten OECD-Welt und dem »Rest der Welt«. Während erstere dicht und relativ symmetrisch unter sich vernetzt ist, ist die übrige Welt nach wie vor überwiegend asymmetrisch auf dieses Gravitationszentrum ausgerichtet. Diesem weiterhin weltpolitisch tonangebenden, in sich hoch koordinierten Gravitationszentrum (ca. 16 Prozent der Weltbevölkerung) steht bisher kein vergleichbar koordiniertes kollektives oder auch nur regionales Machtzentrum gegenüber. Die Zerklüftungen innerhalb der Nicht-OECD-Welt sind nicht weniger markant: Etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung leben unter den Bedingungen von »Staaten«, die zusammengebrochen sind oder deren Zerfall ernsthaft droht. 37 Prozent leben allein in zwei Makrostaaten: China und Indien, weitere 37 Prozent in ca. 140 Gesellschaften, die sich durch eine sogenannte begrenzte Staatlichkeit auszeichnen. Programmatiken über Weltordnung und Weltregieren müssen sich heute mit elementaren Sachverhalten dieser Art auseinandersetzen, ansonsten blieben sie weltflächig-abstrakt, folglich analytisch fragwürdig und letztlich praktisch irrelevant. Weltordnungsprogrammatiken bedürfen, sofern sie wirklich auf die gesamte real existierende Welt bezogen sind, einer problemadäquaten Kontextuierung.
Dieter Senghaas, geb. 1940, ist Senior Fellow am Institut für Interkulturelle und Internationale Studien (InIIS) der Universität Bremen. Er lehrte dort bis 2005 Friedens-, Konflikt- und Entwicklungsforschung. Letzte Veröffentlichungen im Suhrkamp Verlag: Zivilisierung wider Willen. Der Konflikt der Kulturen mit sich selbst (1998, es 2081); Klänge des Friedens. Ein Hörbericht (2001, es 2214); Zum irdischen Frieden (2004, es 2384). Herausgeber u.a. von Den Frieden denken (1995, es 1952); Frieden machen (1997, es 2000). Mitherausgeber von Vom hörbaren Frieden (2005, es 2401).
Dieter Senghaas
Weltordnung in einer
zerklüfteten Welt
Hat Frieden Zukunft?
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78330-6
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
I Welt-Analyse
1. »Eine Welt« oder vier Welten?
II Rückblick für die Zukunft
2. War der Kalte Krieg ein Krieg? Realitäten, Phantasien, Paradoxien
3. Abschreckung nach der Abschreckung
III Ordnungspolitik auf Weltebene
4. Welche Weltordnungspolitik in einer zerklüfteten Welt?
5. Wege aus der Armut. Entwicklungsgeschichtliche und aktuelle Lehren
6. Kulturelle Bruchlinien und die Zukunft der Menschenrechte
7. Vereinbarung, Versöhnung, Toleranz: Wie das Neue Gestalt gewinnen kann
IV Ausblick
8. Hat Frieden Zukunft?
Editorisches Nachwort
Anmerkungen
Literatur
Detailliertes Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes (1989/92), der beherrschenden weltpolitischen Konstellation nach 1945, hat die politische und wissenschaftliche Debatte über Weltgesellschaft, Weltordnung und Weltordnungspolitik verständlicherweise einen unvergleichlichen Aufschwung genommen. Global governance ist in den wissenschaftlichen Publikationen in aller Regel das leitende analytische bzw. programmatische Konzept. Es ist schillernd und meint Vielfältiges, meist jedoch politische Steuerungsmodalitäten auf globaler Ebene, die sich durch ein Zusammenwirken von staatlichen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren auszeichnen. Thematisiert wird dann ein Regieren in sogenannten Mehrebenensystemen, wie es jedoch bisher in einer relativ dichten Struktur nur im Kontext der Europäischen Union zu beobachten ist. Bei dieser analytischen Ausrichtung ist das zugrundeliegende Bild eines kooperationsoffenen Staates ebenso prominent wie das Eigengewicht transnationaler Aktivitäten von Wirtschaftsakteuren (wie multinationalen Konzernen) und zivilgesellschaftlichen Netzwerken.1
Global governance-Studien waren aber meist nicht nur auf eine Ist-Analyse ausgerichtet, sondern in aller Regel auch normativ motiviert. Dann wurde explizit oder implizit global governance qua Weltordnungspolitik zum Leitbegriff: Erfahrungswissenschaftliche Befunde auf einzelnen Politikfeldern (wie Menschenrechten, Rüstungskontrolle/Abrüstung, Entwicklungspolitik, Klima, Migration usf.) wurden bei einem solchen analytischen Ansatz in politisch-programmatische Imperative einer jeweils problemangemessenen und überdies überfälligen Politik auf Weltebene fortgeschrieben.2 »Internationale Politik als Überlebensstrategie« wurde zur Zielrichtung wissenschaftlicher Argumentation. Demgegenüber waren rein programmatische Entwürfe einer mit überzeugenden Argumenten begründbaren Weltordnungspolitik das Sonderangebot philosophischer Reflexion, insbesondere als Ergebnis einer scheinbar unerschöpflichen Kant-Exegese.
Von erfahrungswissenschaftlich-positivistischen Bestandsaufnahmen abgesehen ging es in all diesen Varianten der global governance-Debatte letztlich um Fragen der politischen Rahmenbedingungen einer zielführenden Weltordnungspolitik auf unterschiedlichen Ebenen. Merkwürdigerweise kam dabei die Makrostruktur der real existierenden Welt meist wenig oder gar nicht in den Blick. Eine Debatte, die ihren Ausgang in den Kernländern der OECD-Welt, also in den USA und in Westeuropa, nahm, extrapolierte vielfach unbewusst und implizit die eigene Erfahrungswelt einer im eigenen Umkreis allenthalben leidlich konsolidierten Staatlichkeit, überdies einer leidlich homogenen Wertegemeinschaft und insbesondere von tendenziell symmetrischen Austauschstrukturen zwischen den OECD-Gesellschaften auf die übrige Welt. Diese Nicht-OECD-Welt, in der mehr als vier Fünftel der Weltbevölkerung lebt, zeichnet sich jedoch durch ganz unterschiedliche Ausprägungen von politischen Ordnungsstrukturen (einschließlich Staatszerfall) aus; weiterhin durch Gesellschaften, die vielfach von tiefgründigen Kulturkampf-Konflikten ordnungspolitischer Natur gekennzeichnet sind und die sich überdies in einem weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Umfeld zu behaupten haben, das durch dramatische Machtasymmetrien und asymmetrische Austauschstrukturen geprägt wird.
Machtasymmetrien, asymmetrische Austauschstrukturen mit abgeschichteten Zentrum-Peripherie-Profilen, unterschiedliche Ausprägungen von Staatlichkeit und den ihnen zugrunde liegenden Gesellschaften, Kulturkonflikte: dies sind entscheidende Merkmale einer realiter zerklüfteten Welt. Sollte es nicht das Anliegen von global governance qua Weltordnungspolitik sein, diesen Zerklüftungen und den sich daraus ergebenden Konflikt- und Gewaltpotentialen gezielt entgegenzuwirken? Hierzu wäre allerdings ein realistisches, somit ein nicht nur auf einen leidlich gefälligen Ausschnitt der Welt fixiertes Bild ebendieser Welt erforderlich – eine Aufgabe, die sich einer zeitgemäßen global governance-Forschung heute mit wachsender Dringlichkeit erst eigentlich stellt.3
Vielleicht sind die jüngsten Turbulenzen auf dem Weltfinanzmarkt mit sämtlichen Folgeerscheinungen für eine solche Reorientierung der global governance-Debatte hilfreich. Dieses Politikfeld samt dem ihm zugeordneten Wirtschaftsbereich entwickelte sich in den vergangenen 20 Jahren nicht unter ordnungspolitischen Prämissen, die global governance-Verfechter für wünschenswert und funktional notwendig halten, sondern genau umgekehrt unter der Bedingung eines politisch bewusst inszenierten Abbaus von Regulierungen bzw. der Nichtregulierung von neuen, sogenannten innovativen Finanzprodukten bei weitgehender Haftungsbeschränkung in einem regulierungsfreien Raum. Deren dramatisches, jedoch nur kurzfristiges Wachstum ließ im Hinblick auf mittel- und langfristige Konsequenzen die Hauptakteure in der Finanzwelt, aber auch in der Politik schlichtweg blind werden. Denn dieser Finanzmarkt, mit Schwerpunkt in der OECD-Welt aber erheblichen Konsequenzen für alle Welt, entwickelte geradewegs beispielhaft eine von der Realwirtschaft abgehobene Selbstreferentialität oder Eigendynamik, wie es sie weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene in anderen Politik- bzw. Wirtschaftsfeldern jemals gab.4Neben trickreichen Manipulationen der von den Finanzakteuren selbst leidlich akzeptierten, aber letztlich nicht sanktionierbaren Modalitäten einer dürftigen Selbstregulierung des Finanzmarktes trug ein blinder Glaube an die segensreiche Wirkung nichtregulierter Märkte maßgeblich zu dieser katastrophalen Entwicklung des Weltfinanzmarktes bei.
Bemerkenswerterweise hatte dieses Politikfeld bzw. Segment der Weltwirtschaft auch in global governance-Analysen erstaunlich wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen, obgleich manche Analytiker, meist Außenseiter der Szene, frühzeitig auf die dysfunktionalen Entwicklungen, insbesondere auf die in der Handhabung »innovativer Finanzprodukte« angelegte Blasenentwicklung, aufmerksam gemacht haben. Nachträglich geben sich alle klüger, gerade auch jene »Experten«, die noch vor wenigen Jahren ganz andere, nämlich uneingeschränkt marktgläubige Lagebeurteilungen propagierten als nach dem eingetretenen Debakel der Finanzmärkte. Zu Recht müssen sich inzwischen die einstigen wissenschaftlichen und journalistischen Verfechter einer Deregulierung um ihrer selbst willen als »Blindgänger« etikettieren lassen.5
Vielleicht vermag jedoch gerade die Zuspitzung einer katastrophalen Entwicklung in einem unterregulierten bzw. bewusst nicht regulierten Segment der Weltwirtschaft (aber oft auch der Finanzmärkte innerhalb einzelner Ökonomien) einen Sinn für die Erfordernisse von Regulation wiederzubeleben. »Bringing the state back in«: das war vor vielen Jahren eine rein innerakademische Forderung, die darauf zielte, in der Analyse internationaler und nationaler Politik Staat und Staatlichkeit nicht heuristisch bzw. analytisch zu marginalisieren.6 Angesichts des Debakels auf weithin von staatlichen Rahmenbedingungen entkoppelten Finanzmärkten gewinnt dieser Slogan eine ganz neue Bedeutung. Wobei durchaus zu betonen ist, dass wie in anderen global governance-Politikfeldern nicht jedwede Regulierung als solche schon sinnvoll ist, sondern Regulierungen sich jeweils im Lichte konkreter Problemlagen in einzelnen Politikbereichen im Hinblick auf spezifische Problemlösungen als zielführend erweisen müssen.
Weltordnungspolitik hat also nach den dramatischen Erfahrungen einer durchlebten und durchlittenen weltweiten Finanzmarktkrise die Chance, nicht nur in wissenschaftlichen Debatten, sondern auch in der politischen Praxis ernster eingestuft zu werden als bisher.
Dabei sollte man nicht davon ausgehen, dass die Orientierung an globalgovernance nun in Analyse und Praxis ein Selbstläufer wird.7 Denn andere Weltordnungsmodelle bieten sich als mächtige interessenbesetzte Alternativen an: so beispielsweise ein inzwischen zwar rhetorisch abgefederter, jedoch weiterhin durchaus operativ wirksamer USA-Unilateralismus; oder ein Mächtekonzert der G 7/8, nunmehr zunächst fassadenhaft erweitert auf einen G20-Club; eventuell aber auch ein G20-Club, in dem mit der Zeit einigen »emerging powers« wie den sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) und wenigen weiteren (wie Südafrika) auf operativer Ebene politisches Gewicht zuwächst. Vorstellbar sind jedoch auch regionale Blockbildungsprozesse, die nicht in ein weltpolitisch relevantes Konzert regionaler Vormächte, ein Mächtegleichgewicht neuer Prägung, münden würden, sondern in eine tendenziell multipolar-antagonistische Struktur. Zuspitzen würde sich eine solche Entwicklung, wenn sich erneut eine bipolar-antagonistische Konstellation (USA-China) mit sämtlichen Begleiterscheinungen (ideologischer Systemantagonismus, Rüstungsdynamik, Embargopolitik usw.) herausbildete.
Demgegenüber hätte global governance einen Multilateralismus von globaler Reichweite zur Voraussetzung, der vor allem den nicht in G 7/ 8 bzw. G20 versammelten Staaten eine eigene politische Bühne bieten würde – eine Plattform, die asymmetrisch zugunsten der bisher weltpolitisch Marginalisierten strukturiert sein müsste, gewissermaßen im Sinne von »affirmative action«. Dafür wäre aber eine neue Selbstorganisation der letztgenannten Gruppierung unabdingbar. Denn nur dann würde global governance als global ausgerichtete Weltordnungspolitik eine Chance erhalten. Auch die Wissenschaft kann zu einer solchen wünschbaren Entwicklung beitragen, indem sie sich bemüht, dem OECD-bias der bisherigen global governance-Debatte entgegenzuwirken.8 Dieses Buch möchte hierzu einen Beitrag leisten.
Es werden darin einige wesentliche Zerklüftungen in der Welt diagnostiziert sowie weiterführende Entwicklungsperspektiven umrissen. Ausgangspunkt ist jeweils eine erfahrungswissenschaftlich ausgerichtete Analyse. Diese ist jedoch nicht Selbstzweck, sondern Grundlage einer konstruktiven friedenspolitischen Argumentation im jeweiligen Problembereich. Dabei sind der Entwicklungsproblematik und der Auseinandersetzung über politisierte Kulturkonflikte jeweils eigene Kapitel gewidmet. Andere weltpolitisch relevante Problembereiche werden weniger ausführlich in den Kapiteln umrissen, in denen Weltordnungspolitik nicht bereichsspezifisch, sondern aus einer Gesamtperspektive analysiert wird.
In zwei Kapiteln dieses Buches wird bewusst auf die vergangene Ost-West-Konfliktkonstellation zurückgeblickt. Dies geschieht nicht aus historischem Interesse, sondern als Rückblick für die Zukunft. Sollte nämlich verhindert werden, dass sich in Zukunft erneut eine Konfliktkonstellation vergleichbaren Zuschnitts oder auch nur in abgefederten Formen einer antagonistischen Konstellation zwischen Regionalmächten herausbildet, dann ist ein solcher Rückblick nicht abwegig, denn die Ost-West-Konfliktkonstellation war, weltgeschichtlich betrachtet, von beispielloser Zuspitzung sowohl hinsichtlich des ideologischen Systemantagonismus als auch der unvergleichlich monströsen Zerstörungspotentiale. Deren immer noch erhebliche Größenordnung droht allmählich aus dem Gedächtnis zu entschwinden – eine problematische Entwicklung, denn aus dieser vergangenen zugespitzten weltpolitischen Konstellation ist bleibend viel zu lernen.
Bekanntlich gleiten anfängliche Konflikte leicht in eine Eskalationsspirale über. Dann inszenieren sich die Teufelskreise, und mögliche Ansätze zu »Engelskreisen«, d.h. zu konstruktiver Konfliktbearbeitung, werden, wo vorhanden, zunichte gemacht. Diese Erfahrung in Rechnung stellend, hat auch dieses Buch zur Leitperspektive: Si vis pacem, para pacem. Doch die bange Frage bleibt: Hat Frieden Zukunft?
I Welt-Analyse
1. »Eine Welt« oder vier Welten?
Weltpolitik, Weltgesellschaft, Weltwirtschaft, Weltökologie aber auch Weltordnungspolitik (global governance) und Weltethos – diese und andere Welt-Begriffe haben, obgleich in aller Regel seit langem in wissenschaftlicher und politischer Semantik gebräuchlich, nach dem weltpolitischen Umbruch 1989/92 und im Zusammenhang mit der Globalisierungsdiskussion eine markante Akzentuierung erfahren. Diese Beobachtung gilt natürlich besonders im Hinblick auf den Begriff der »Globalisierung«, der seit den 1990er Jahren weltweit in das Zentrum des politischen und auch des wissenschaftlichen Diskurses gerückt ist.
Aus der Geschichte öffentlich wirksam gewordener Begriffe weiß man, dass ein solcher Vorgang immer reale Veränderungen widerspiegelt. So gibt es empirisch triftige Beobachtungen, die darauf aufmerksam machen, dass die heute mit einer gewissen Emphase benutzten Welt-Begriffe und insbesondere der Globalisierungsdiskurs vier Sachverhalte reflektieren: die Intensivierung globaler Interdependenzen, die Ausweitung globaler Netzwerke, die Beschleunigung globaler Prozesse und die zunehmenden Folgewirkungen der sich globalisierenden Strukturen und Prozesse auf sämtliche Lebensbereiche.1 Diese Sachverhalte sind an und für sich nicht neu; davon zeugen schon lange vor 1989/92 eingesetzte Diskussionen über einen ausdimensionierten Interdependenzbegriff, einschließlich einer Reflexion über die Interdependenz von Interdependenzen im internationalen System, weiterhin die Diskussion über die Struktur »internationaler Gesellschaft«, insbesondere aber die Beiträge über »Akkumulation auf Weltebene« sowie die Konzeptualisierung von sozialwissenschaftlicher Forschung als Weltsystem-Analyse – all dies analytische Bemühungen seit den 1950er Jahren.2 Wenngleich dieser Vorlauf in der gegenwärtigen Diskussion inzwischen weitgehend ignoriert wird, stellt sich heute dieselbe Grundfrage wie vor 1989/92, vor dem Ende der weltpolitisch dominanten Ost-West-Konfliktformation bzw. der Bipolarität: Welche Vorstellungen von Welt liegen eigentlich den Welt-Begriffen zugrunde? Und vor allem: Welche Welt bzw. Globalität unterstellt der Diskurs über Globalisierung?
Diese Fragen sind umso berechtigter, als in dem Welt-Diskurs selten die real existierende Welt in ihrer durch Teilstrukturen und Abschichtungen gekennzeichneten Gesamtheit in konzeptueller, empirischer, aber auch in normativer Hinsicht wirklichkeitsgetreu zur Sprache kommt. Ein solches differenziertes Verständnis ist jedoch erforderlich, um einen ertragreichen Welt-Diskurs führen zu können. Dies setzt allerdings eine Steigerung analytischer Komplexität, nicht eine Reduktion derselben voraus: Solcher Diskurs über die »Welt« muss somit, wenn er in erfahrungswissenschaftlicher und in handlungsleitender Perspektive relevant sein soll, die real existierende Komplexität in sich aufheben und darf das Welt-Bild nicht übermäßig vereinfachen.
Zu fragen ist also: Mit welcher Welt bzw. welchen Welten bzw. Teilwelten haben wir es in der real existierenden Wirklichkeit und damit auch in der Welt-Analyse zu tun?
1.1 Die Teilwelten der Welt
Die OECD-Welt (Welt I)
An der Spitze der Weltgesellschaft sind zwischen den fortgeschrittenen Industriegesellschaften (OECD-Welt) Entgrenzungsprozesse zu beobachten, die in allen Dimensionen (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur) komplexe Interdependenzen entstehen lassen. Besonders markant zeigt sich dieser Vorgang, der als Denationalisierung bezeichnet wird,3 in der politisch forcierten, aber auch eigendynamisch vorangetriebenen ökonomischen Entwicklung des europäischen Binnenmarktes, der inzwischen durch eine freihändlerisch motivierte Mobilität der entscheidenden ökonomischen Faktoren gekennzeichnet ist. Die hier entstandenen Interdependenzen zeichnen sich durch Symmetrie und substitutive Arbeitsteilung aus, d.h., alle beteiligten Ökonomien produzieren tendenziell kapital-, wissens- und technologieintensiv; in den fortgeschrittenen, für die Dynamik der Ökonomie wesentlichen Sektoren sind sie vergleichbar wettbewerbsfähig; sie exportieren branchenübergreifend ein- und denselben Typ von Gütern mit hoher Wertschöpfung. Dies führt zu einem raumausgreifenden erheblichen und akzentuierten Wettbewerb und in der Folge, keineswegs paradoxerweise, sondern sachlogisch, zu grenzüberschreitenden integrierten Märkten. Da der Wettbewerb auf gleichem Kompetenzniveau stattfindet, kommt es zu dem, was man – aus einer weltweit vergleichenden Perspektive betrachtet – als »Globalisierung de luxe« bezeichnen könnte: einer symmetrisch gelagerten Durchdringung der Märkte mit vergleichbaren, eben substituierbaren Gütern. Bei diesem Typ von Arbeitsteilung gewinnen (allerdings mit Ausnahme der Natur) alle Beteiligten, einschließlich der Konsumenten. Das außenhandelstheoretische Theorem kosmopolitischen Wohlfahrtsgewinns in der Folge internationaler Arbeitsteilung gemäß komparativer Vorteile findet hier im regional begrenzten Rahmen und nur unter den angegebenen Bedingungen einigermaßen ein fundamentum in re – dies insbesondere im Rahmen des EU-Binnenmarktes.
Der Sachverhalt – substitutive Arbeitsteilung auf symmetrischer Grundlage – ist von erheblicher Bedeutung, weil er die betroffenen Gesellschaften integrationsgeneigt macht. Wie weit die Integration über den wirtschaftlichen in den politischen Bereich hinaus vorangetrieben wird, bestimmt allerdings nicht allein die Ökonomie: Das Ausmaß an Europäisierung lässt eine Situation entstehen, in der nationale Interessen sich immer mehr als unentrinnbar verflochtene Interessen darstellen. Das Management dieser Verflechtungsdynamik entwickelt sich in aller Regel schrittweise durch ein Zusammenspiel von Politik, Recht, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, was bei entsprechenden Verdichtungen der regionalen Interdependenzen zur Herausbildung eines postnationalen Mehrebenensystems politischer Willensbildung, Entscheidungsfindung und Implementation führt. Die pluralistisch-liberale politische Szene der einzelnen demokratischen Verfassungsstaaten erweitert sich dabei, wenn auch mit legitimatorischen, insbesondere wohlfahrtsstaatlichen Defiziten, auf die europäische Ebene: In entscheidenden Bereichen wird aus nationaler eine europäische Innenpolitik.
Solche symmetrisch gelagerten, auf Gewinn ausgelegten Handelsstaaten (»trading states«) sind in ihrer politischen Kultur in der Tendenz universalistisch orientiert, was sie aus ihrem Kontext heraus verständlicherweise zu einem unbekümmerten freihändlerischen Globalisierungsdiskurs verleitet. Dabei wird die eigene spezifische Erfahrung, eine »Win-win«-Konstellation, aus dem Kontext genommen und blindlings verallgemeinert, d.h. auf ganz anders gelagerte, beispielsweise asymmetrische Konstellationen projiziert.
Die emergenten Strukturen dieses Ausschnitts der OECD-Welt führten in frühen Beschreibungen zu neuen Begriffen, die den Unterschied zur Welt der klassischen machtfixierten und machtbesessenen Staaten, der Staatenwelt, markieren sollten. So wurde schon in den 1970er Jahren in Erweiterung zu einer seinerzeit beobachteten Internationalisierung von Außenpolitik, beispielsweise vermittels internationaler Organisationen und internationaler Regime, eine zunehmende »Transnationalisierung« der Außenbeziehungen diagnostiziert. Der Prozess selbst verdichtete sich im Laufe der Zeit, so dass in Ergänzung zum Begriff der »Staatenwelt« die Begriffe »Wirtschaftswelt« und »Gesellschaftswelt« sich aufdrängten.4 In beiden Begriffen reflektieren sich die zahllosen grenzüberschreitenden Interdependenzen von Wirtschaftsakteuren und gesellschaftlichen Akteuren, wie sie sich immer mehr außerhalb der regulären diplomatischen Beziehungen von Staat zu Staat entfalten. Dieser Sachverhalt betrifft zwar nicht nur die OECD-Welt, doch ist er hier, und wiederum vor allem im EU-Kontext, besonders dicht gelagert und in der Folge strukturbestimmend.
Dabei wird dem EU-Kontext in ordnungs- und friedenspolitischer Hinsicht eine paradigmatische Bedeutung zugeschrieben, weil sich hier nach dem Zweiten Weltkrieg eine stabile Friedenszone herausbildete. In ihr ist es im Laufe der Zeit nicht nur gelungen, Nichtkrieg zu organisieren, sondern eine dauerhafte Friedensstruktur aufzubauen: »Rendre la paix perpétuelle« – eine alte, meist für illusionär gehaltene Leitperspektive oder regulative Idee wurde politische Realität. iSe wird dadurch definiert, dass zwischen den sie konstituierenden Mitgliedern im Hinblick auf die weiterhin bestehenden und künftig zu erwartenden Interessen- und ggf. auch Identitätskonflikte weder in den Planungen noch in den Handlungen gewaltorientierte Strategien eine Rolle spielen. Was innerhalb der die europäische Friedenszone aufbauenden demokratischen Verfassungsstaaten im Prinzip eine Selbstverständlichkeit geworden ist, wurde nunmehr auch zu einer Selbstverständlichkeit zwischen diesen. Und indem ebendiese Staaten die verlässlich gewaltfreie Bearbeitung von politischen Konflikten politisch, rechtlich und institutionell, aber auch mit der sich entwickelnden politischen Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung, untermauern und absichern, d.h. eine Politik der tendenziell sich ausdifferenzierenden und sich erweiternden Integration betreiben, erreicht dieser Prozess vielleicht gar einen point of no return; er kann bei entsprechenden anhaltenden institutionellen, materiellen sowie sozialpsychologisch wirksam werdenden Impulsen unumkehrbar werden.
Unter friedenstheoretischen Gesichtspunkten kommt dieser europäischen Friedenszone eine geradezu paradigmatische Bedeutung zu. Mehrere erfahrungswissenschaftlich fundierte friedenspraxeologische Entwürfe, die im Folgenden kurz rekapituliert werden, verdeutlichen die Relevanz dieser gerade auch für die Geschichte Europas exzeptionellen Erfahrung. Vielleicht könnten diese Friedensentwürfe einmal auch für außereuropäische Kontexte bedeutsam werden:
Ein erster solcher Entwurf5 postuliert fünf Elemente einer Friedensstruktur, die mit folgenden Stichworten zu kennzeichnen sind: positive Interdependenz, annähernde Symmetrie, Homologie, Entropie und gemeinsame Institutionen. Positive Interdependenz meint Beziehungen von hoher wechselseitiger Relevanz, so dass potentiell konfrontatives Verhalten einer Seite nicht nur, wie beabsichtigt, zur Schädigung der anderen führen würde, sondern auch zu einer erheblichen Selbstschädigung. Annähernde Symmetrie bedeutet vergleichbare Kompetenzen und Chancen der Wertschöpfung in der Produktion und Vermarktung von Wissen und Waren sowie deren Austausch, also substitutive Arbeitsteilung. Homologie bedeutet die Existenz einer vergleichbaren politischen, sozialen und ökonomischen Struktur diesseits und jenseits der Grenzen, was vergesellschaftete Außenbeziehungen (im breiten Sinne des Begriffes) und also nicht nur zwischenstaatliche überhaupt erst ermöglicht. Entropie bedeutet die Nichtreglementierung dieser Beziehungen und also vielfältige Kreuz- und Querbezüge (das Gegenteil von Gleichschaltung) im grenzüberschreitenden Verkehr, ein erhebliches Maß an Selbstregulierung ohne exklusiv etatistisch-zentralistische, hierarchischabgestufte Vorgaben. Mit gemeinsamen Institutionen ist ein institutioneller Rahmen gemeint, der für das Gesamtgeschehen als Rückversicherung für Erwartungsverlässlichkeit und Erwartungsstabilität bürgt.
Ergänzende, z.T. auch überschneidende Kriterien finden sich in einem zweiten friedenspraxeologischen Entwurf,6 in dem Frieden als kollektiver Lernprozess der politischen Gemeinschaftsbildung begriffen wird. Zehn Erfahrungswerte stehen dabei im Zentrum der Überlegungen: 1. die Vereinbarkeit von hauptsächlichen Werten; 2. die Erweiterung von grenzüberschreitenden Kommunikations- und Transaktionsvorgängen, die auf beiden Seiten an Bedeutung gewinnen (s.o.); 3. »responsiveness«, d.h. die Aufgeschlossenheit stärkerer Partner für die Belange anderer, insbesondere die Bereitschaft, auf die Nöte von Schwächeren einzugehen; 4. akzentuiertes Wachstum und die Erwartung von gemeinsamen Vorteilen (»win-win«); 5. die Steigerung der Fähigkeit, Probleme zu lösen; 6. Kerngebiete mit Zugpferd-Funktion, also Aktionspole mit Ausstrahlungskraft (»core areas«); aber auch 7. Rollenwechsel bzw. Rollenrotation vor allem im Hinblick auf die Vermeidung von rigid-fixierten Rollenzuschreibungen hinsichtlich Mehrheiten und Minderheiten von großen und kleinen Staaten; 8. die Erweiterung der Eliten im Sinne einer erfahrbaren Chance für Aufwärtsmobilität mit der Folge der Entwicklung neuer Loyalitäten hinsichtlich der entstehenden größeren Gemeinschaft; 9. Chancen eines neuen Lebensstils: Die neue, den jeweiligen einzelstaatlichen Kontext übergreifende Umwelt wird zu einem selbstverständlichen Teil von Sozialisationsprozessen mit erweitertem Horizont; 10. Voraussagbarkeit der Motive für das Handeln und des tatsächlichen Verhaltens, d.h. Erwartungsverlässlichkeit und Erwartungsstabilität (das pure Gegenteil des klassischen Sicherheitsdilemmas unter den Vorzeichen der Staatenanarchie).
Ein dritter friedenspraxeologischer Entwurf7 konzentriert sich auf das Profil der Staaten moderner Prägung, jener Akteure, von denen überhaupt kollektive Lernprozesse für eine sie partiell oder insgesamt transzendierende neue politische Gemeinschaftsbildung zu erwarten sind. Sechs Elemente sind hier von Bedeutung (»zivilisatorisches Hexagon«): die Existenz eines Gewaltmonopols und seiner rechtsstaatlichen Kontrolle, die Herausbildung eines arbeitsteilig-differenzierten innergesellschaftlichen Sozialkörpers samt der aus differenzierten Interdependenzstrukturen resultierenden Affektkontrolle, eine tendenziell auf Inklusion ausgelegte Demokratisierung, Verteilungsgerechtigkeit sowie eine politische Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung, die sich in entsprechenden Tiefenbindungen (»Ligaturen«) niederschlägt.
Gleichgültig, ob man argumentativ von einer friedenszuträglichen Binnenstruktur ausgeht (»zivilisatorisches Hexagon«), dann zu den Erfordernissen kollektiver Lernprozesse bei gelingenden Vergemeinschaftungsprozessen fortschreitet, um schließlich auf einer abstrakteren Ebene die formalen Bedingungen einer Friedensstruktur zu bezeichnen oder wie in der hier erfolgten Darstellung in umgekehrter Reihenfolge argumentierend verfährt: Eine Friedenszone, wie sie heute die EU-Region darstellt, lässt sich nicht durch eine bi- oder multivariate Logik erfassen, da sie, redundant verursacht, ein konfigurativ konstituiertes Gebilde darstellt. Der Sachverhalt – konfigurative Kausalität – wird in einer weiteren, vierten, sich ebenfalls durch Komplexität auszeichnenden Friedensstrategie nicht anders gesehen,8 so wenn dort die folgenden Imperative postuliert werden: Abbau der Anarchie des internationalen Systems durch die Kooperation der Staaten in systemweiten internationalen Organisationen; Egalisierung der Machtfigur durch eine größere Verteilungsgerechtigkeit der gesellschaftlichen Entwicklungs- und Entfaltungschancen aller Beteiligten; Demokratisierung der Herrschaftssysteme, damit die Anforderungen der Gesellschaft unverfälscht in die Entscheidung des politischen Systems gelangen können und insbesondere der Zugang von Interessengruppen zum außenpolitischen Entscheidungsprozeß transparent wird; die Möglichkeit, komplexe Interaktionen regionaler oder globaler Reichweite durch moderne Regierungsformen (»governance«) und durch die Bildung von internationalen Regimen zu steuern; schließlich die Verbesserung der handlungsstrategischen Kompetenz der Akteure.
Geht man die vier Kriterienkataloge der diversen erfahrungswissenschaftlich inspirierten friedenspolitischen Komplexprogramme durch, so zeigen sich auch im EU-Kontext noch Defizite. Die Erfolgsgeschichte dieser Zone des Friedens ist eine relative; sie ist durchaus noch verbesserungs- und vertiefungsbedürftig, auf jeden Fall optimierbar, wie die langanhaltenden Diskussionen über die Finalität dieses Gebildes seit den 1950er Jahren und heute vor allem die immer noch kontroversen Debatten über eine Europäische Verfassung dokumentieren. Doch weltweit betrachtet, lässt sich eine Alternative, die eindrucksvoller wäre, nicht feststellen. Deshalb ist es sinnvoll, unter wirklichkeitswissenschaftlicher Perspektive diese europäische Erfahrung der vergangenen 60 Jahre in all ihren Dimensionen (materiell, normativ, institutionell, voluntaristisch) als friedenspolitischen Referenzrahmen zu begreifen, ohne sich dem Vorwurf eines fragwürdigen Eurozentrismus aussetzen zu müssen. Denn diese Erfahrung ist das Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses allerjüngsten Datums; sie ist keineswegs repräsentativ für die lange leidvolle Geschichte Europas; vielmehr gleicht sie einem einst nicht prognostizierbaren Bruch mit ebendieser Geschichte. Sie ist das Ergebnis einer grundlegenden Zäsur.
Im Lichte dieses Referenzrahmens erscheinen die transatlantischen Beziehungen – ein zweites Segment der OECD-Welt – in ökonomischer Hinsicht als unproblematisch, denn diese sind sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht (substitutive Arbeitsteilung) seit vielen Jahren einigermaßen symmetrisch gelagert. Problematisch ist die hier existierende asymmetrische Machtfigur, die heute im Wesentlichen militärisch definiert ist. Problematisch ist auch die Unwilligkeit der USA, an der atlantischen Gegenküste ein vereinigtes Europa zu akzeptieren. Erschwerend kommt hinzu, dass das amerikanische Außenverhalten nicht erst neuerdings einem »Multilateralismus à la carte« folgt, was nichts anderes bedeutet als die diplomatische Umschreibung von im Wesentlichen unilateral ausgerichteter Interessenpolitik von tendenziell globaler Reichweite.
Gegenüber den vergleichsweise mäßig defizitären transatlantischen Beziehungen stellen sich die Beziehungen zwischen den USA und Japan (im weiteren Sinne auch Ostasien) – also im dritten Segment der OECD-Welt – schon auf ökonomischer Ebene defizitär dar. Hier gibt es quantitative und qualitative Ungleichgewichte: Geradezu chronisch sind die ökonomischen Ungleichgewichte zugunsten Ostasiens, und besonders gravierend sind die qualitativen Ungleichgewichte zuungunsten der USA. Anders als im transatlantischen Verhältnis liegt hier kein breiter symmetrischer Austausch hochwertiger Güter auf der Grundlage substitutiver Arbeitsteilung vor. Überdies werden die bilanzmäßigen Defizite zugunsten Ostasiens bestehen bleiben, wenn sich Chinas take-off in die Weltwirtschaft ungebrochen fortsetzt. Die chinesische Exportoffensive wird dann erneut Deindustrialisierungsfolgen in den USA und möglicherweise auch in Europa provozieren, die in den 1970er und insbesondere den 1980er Jahren vor allem von japanischer Seite ausgingen und zu entsprechenden Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt der Altindustrieländer führten. Wie immer schon in der Geschichte wird dann diese Herausforderung die Neigung zu offenen bzw. versteckten und indirekten protektionistischen Gegenmaßnahmen verstärken und ein entsprechendes Krisenmanagement auf weltwirtschaftlicher Ebene erforderlich machen.
In ordnungs- und friedenspolitischer Hinsicht ist also auch innerhalb der OECD-Welt, der Triade, die EU-Komponente von paradigmatischer Bedeutung. Hier, im EU-Raum, wurde das typische Profil der modernen »westfälischen« Staatenwelt überwunden: der auf Staatsräson, Machtpolitik, egoistische Interessendefinition und Machtdurchsetzung sowie der auf merkantilistische Außenwirtschaftspolitik fixierte autokratische Machtstaat, wie er seit dem 17. Jahrhundert von der diese Realität abbildenden Theorie (»Realismus«) beschrieben und zumeist auch gerechtfertigt wurde. Jene Machtstaaten, die wirklich Macht besaßen (die sogenannten »großen Mächte«) zeichneten sich dabei durch eine Souveränitätsbesessenheit aus, einschließlich einer Fixierung auf das Nichteinmischungsprinzip, das allerdings in der Realität nur für sie selbst Gültigkeit hatte, nicht aber für die schwächeren Mitglieder der Staatenwelt, also die mittleren und kleinen »Mächte«, ganz zu schweigen von den Räumen, die kolonialisiert wurden.
Das Prinzip der Souveränität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten kennzeichnet immer noch die UNO-Charta, und damit wird belegt, wie weit diese noch immer von der postmodernen Realität vom Typ der EU-Friedenszone entfernt ist: Souveränität ist in dieser Zone (und nur hier) extrem relativiert. Einmischung findet auf institutionalisierter Basis ständig und auf immer mehr Politikfeldern statt. Spezifische Ingredienzien des modernen Staates – eine exklusiv-nationale Gesetzgebung, die exklusive Orientierung der richterlichen Gewalt an nationalen Gesetzen, eine eigene nationale Währung, militärische Geheimhaltung usf. – sind entweder in einem postnationalen politischen Mehrebenensystem aufgehoben, erodiert oder regelrecht abgeschafft worden.
Die Vorgeschichte dieser heute exklusiv existierenden Friedenszone während ihrer »modernen Phase« seit dem 16./17./18. Jahrhundert dokumentiert jedoch unmissverständliche Sachverhalte, die nicht vergessen werden sollten: die in aller Regel autokratische Natur der politischen Systeme, die sich nur in Ausnahmefällen evolutionär zur modernen Demokratie entwickelt haben und in den schlimmsten Fällen durch Phasen zivilisatorischer Regression gekennzeichnet waren; die lange Zeit allenthalben eher partikularistisch orientierte politische Kultur (z.B. »deutsche Werte« versus »westliche Zivilisation«); eine Kultur, die allermeist eine universalistische Orientierung nur als schöngeistige Aspiration kannte; heterogene ökonomische Profile, die sich erst langsam, letztlich erst nach 1950-60 auf hohem Kompetenzniveau homogenisierten, weshalb in der europäischen Geschichte neomerkantilistische Außenwirtschaftsstrategien einschließlich ihrer politisch-aggressiven und oft militärischen Implikationen die außenpolitische Szene durchgängig mehr prägten als eine in aller Regel nur branchenspezifisch-freihändlerische Orientierung. Insbesondere kam es vor dem Hintergrund von unterschiedlichen Wachstumsraten und der Herausbildung von neuen weltwirtschaftlich führenden Leitsektoren zu ökonomischen und technologischen Kapazitätsverschiebungen, die in der überkommenen modernen Staatenwelt fast regelmäßig zu politischen Verwerfungen geführt haben (»Hegemoniekrisen-Problematik«).
Festzuhalten ist allerdings: Weder auf der Ebene der Altindustrieländer (der »großen Mächte«) noch der Staaten mittlerer und kleiner Größenordnung wäre es – ungeachtet aller politischen Willensäußerungen und dramatischer Erfahrungen durch zwei Weltkriege – zu einer dauerhaft erfolgreichen, auf Kooperation und Integration ausgerichteten Politik gekommen, wenn die Wirtschaftsprofile der betroffenen Staaten nicht infolge eines qualitativen Schubes, d.h. eines Reifungsprozesses der kapitalistischen Gesellschaften, ein vergleichbares Produktivitäts- und Kompetenzniveau erreicht hätten. Denn nur dieses ist die potentielle Grundlage für substitutive Arbeitsteilung und damit – von subventionsträchtigen Randbereichen abgesehen – für eine durchgängige Symmetrisierung der Beziehungen und für eine nachhaltige Politik der Integration. Und Integration wird sich folglich nur so lange aufrechterhalten lassen, als dieses qualitativ und überdies auch quantitativ hochstehende symmetriezuträgliche Niveau bewahrt wird bzw. sich mehr oder weniger über die alten, inzwischen bedeutungslos gewordenen nationalen Grenzen hinweg synchronisiert weiterentwickelt. Dramatische Einbrüche in dieses Profil würden sofort gewissermaßen politisch-instinktmäßig protektionistische und neomerkantilistische Defensivreaktionen altbekannter Art auslösen. Sie aber könnten Sprengsätze gegen integrative Politik sein. Dies lehren die neuzeitliche europäische Geschichte und vielfältige Erfahrungen in der weiten Welt der Gegenwart, vor allem die in aller Regel nicht gerade erfolgreichen Integrationsversuche außerhalb Europas, die angesichts einer meist extrem heterogenen Ausgangslage der beteiligten Ökonomien und damit auch der Gesellschaften und Staaten kaum nachhaltig erfolgreich sein können (s.u.).
Die neue Zweite Welt (Welt II)
Nachdem die ehedem Zweite Welt des sog. Realsozialismus (mit Ausnahme von China, Nordkorea, Vietnam und Kuba) mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der osteuropäischen Regime von der ideologischen, weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Bildfläche verschwunden ist und nun als Sammelsurium von Transformationsgesellschaften offiziell zu dem Entwicklungsgebiet geworden ist, das sie realiter immer schon war, ist es durchaus sinnvoll, kategorial einen neuen Typ von Gesellschaft als »neue Zweite Welt« zu bezeichnen. Hier handelt es sich neben den derzeitigen Staaten der EU-Erweiterung im östlichen Teil Europas im Wesentlichen um ostasiatische, vermutlich in naher Zukunft auch um einige südostasiatische Gesellschaften, die aufgrund ihrer nach innen breitenwirksamen und ihrer weltwirtschaftlich auf Wettbewerb ausgerichteten Entwicklungsdynamik Schritt für Schritt zum Profil der OECD-Welt aufgeschlossen haben bzw. in absehbarer Zukunft aufschließen werden.
Diese Entwicklung ist der früheren Situation in Teilen Europas vergleichbar. Sie erfolgte, wie vor allem am Beispiel Taiwans und Südkoreas zu beobachten, unter den Rahmenbedingungen autokratischer Regime. Sie gewann ihre Wirtschaftsdynamik durch eine staatsinterventionistisch gesteuerte Mischstrategie von selektiv-freihändlerischer Orientierung bei gleichzeitiger breitgefächerter Protektion zur Erschließung der eigenen Binnenmärkte. Eine sich erweiternde »Importsubstitutionsindustrialisierung«, d.h. die lokale Produktion von zuvor importierten Industriegütern, und eine korrespondierende Exportorientierung gingen dabei Hand in Hand. Ausgehend von komplementärer Arbeitsteilung (quasi-kolonialen Typs) kam es auf diesem Wege zur allmählichen Erschließung der Entwicklungspotentiale für substitutive Arbeitsteilung, also zu einem upgrading der ökonomischen Profile. Erkennbar wird dieser Prozess auch an dem allmählichen Übergang von einem ehedem heterogenen Wirtschaftsprofil zu einem sich homogenisierenden Profil, das im Übrigen seit mehr als zwei Jahrzehnten schon durch Werte gekennzeichnet ist, die das durchschnittliche OECD-Profil charakterisieren.9
Parallel zu einem breitenwirksamen Erschließungsprozess des eigenen Wirtschaftspotentials und einem weltwirtschaftlichen upgrading erfolgte, wie nicht anders vorstellbar, ein dramatischer sozialer Wandel, der sich nunmehr in einer modernen Sozialschichtung dokumentiert. Aus der dabei entstehenden Bürgergesellschaft kamen schließlich die Forderungen nach demokratischer Partizipation, die nach Rückschlägen tatsächlich zu einer Demokratisierung führten, was in der Regel, anders als in der europäischen Entwicklungssequenz, erst danach der Forderung nach Rechtsstaatlichkeit (rule of law) Nachdruck verlieh. So wurden z.B. aus Taiwan und Südkorea als »newly industrializing countries« (NICs), allerdings nicht ohne zwischenzeitlich gravierende Verwerfungen, schrittweise »newly democratizing countries«, also tendenziell moderne demokratische Verfassungsstaaten, die in ihrer ökonomischen Orientierung als neue, tendenziell hochqualifizierte »Handelsstaaten« charakterisiert werden müssen – Ergebnis eines fulminanten Entwicklungsprozesses im Zeitraffertempo.
Dass sie wie jedes sich modernisierende und moderne Staatswesen Probleme zu bewältigen haben, wie sie (abgesehen von dem Spekulationsangriff) beispielsweise am Ende der 1990er Jahre in der sogenannten »Asienkrise« offenkundig geworden sind, kann nicht überraschen. Aber Krisen der genannten Art (die beispielsweise aus einem inzwischen kontraproduktiv gewordenen exzessiven Staatsinterventionismus resultieren oder aus einem immer noch tendenziell klientelistisch organisierten, keiner soliden Kontrolle unterliegenden Bankenwesen u.ä.) sind nicht Symptome eines gravierenden Zusammenbruchs, sondern als der weiteren Entwicklung förderliche Reinigungskrisen zu verstehen.
Dass auf politisch-programmatischer Ebene aus dieser neuen Zweiten Welt, wenngleich nicht flächendeckend, werbewirksam eine Wertedebatte inszeniert wurde (so insbesondere in Singapur und Malaysia), die sich in Einzelfällen antiwestlich geriert, kann nicht überraschen: Sie ist als transitorische Programmatik einer mehr oder weniger politisch verordneten kollektivistischen Orientierung typisch für aufwärtsmobile Gesellschaften und Ökonomien. Denn solche Gesellschaften und Ökonomien wären bei der Inszenierung ihrer Aufwärtsmobilität niemals erfolgreich, würden sie nur universalistischen Konzepten (wie einer freihändlerischen Orientierung pur und simpel) folgen und nicht partikularistischen, auf die eigenen Bedürfnisse bezogenen, letztlich jedoch im Laufe der Zeit pragmatisch-flexibel inszenierten Leitperspektiven.10
Eine solche partikularistische Orientierung, die der »nachholenden Entwicklung« dient, verliert an Boden und Glaubwürdigkeit, je erfolgreicher die qualitative Profilsteigerung, also das upgrading und die Eingliederung in die internationale Arbeitsteilung, sind und je selbstverständlicher letztlich der politische Pluralismus akzeptiert wird, der auf politischer Ebene die Folge eines tiefgreifenden sozialen Wandels, eines breitgefächerten Modernisierungsprozesses und akzentuierter politischer Konflikte ist. Defensivreaktionen von der Art der »asiatischen Werte« behalten noch einen gewissen Stellenwert mit lokalem Kolorit (denn à la longue führt ein erfolgreicher Modernisierungsprozess zu einer postmodernen Kulturszene); aber im Zug ihres Erfolgs verliert eine solche Orientierung ihren zunächst durchaus funktionalen Stellenwert. Gegebenenfalls verkommt eine solche kulturalisierte politische Orientierung zur bloßen Herrschaftsideologie; dann allerdings wirkt sie kontraproduktiv auf die weitere Entwicklungsdynamik.
Noch ist die neue Zweite Welt Ostasiens (Welt II) ungleich zusammengesetzt: Japan unterliegt immer noch einem langsamen, insbesondere kulturellen Modernisierungsprozess. Spektakulär sind seine »Reinigungskrisen« in den vergangenen Jahren, deren erfolgreicher Ausgang unsicher ist. Unproblematisch sind demgegenüber eher die nachfolgenden »Tigerstaaten« der ersten Generation, also Korea und Taiwan, die ein klassisches Szenario nachholender Entwicklung (nach dem sogenannten »Gänseflug-Muster«, anfänglich mit Japan an der Spitze) durchlaufen haben. Singapur ist vor allem im Bildungswesen auf dem Weg, einen weiteren Modernisierungsschub zu durchlaufen, ohne den es die Innovationspotentiale nicht erreichen wird, die angesichts der Herausforderungen einer sich wandelnden internationalen Arbeitsteilung (Rolle Chinas!) absolut erforderlich sind.
Die eigentlich spannende Frage in der ostasiatischen neuen Zweiten Welt betrifft die Zukunft Chinas. Wird China in den kommenden Jahrzehnten seine sich heute akzentuierende interne Heterogenität zwischen dem »blauen«, weltwirtschaftlich orientierten Küsten-China und dem »gelben«, binnenorientierten China mildern, eventuell sogar einebnen können, was schon in den 1980er Jahren in der sogenannten Kulturfieber-Debatte zur Diskussion stand? Ist ein auf Homogenisierung ausgerichteter Entwicklungsprozess in einem Land von der alle Maße sprengenden Größenordnung Chinas (Bevölkerung und Fläche) realistischerweise überhaupt zu erwarten? Und ist damit zu rechnen, dass sich ein Land von solcher Größe selbst unter günstigsten Bedingungen in einen regional-governance-Rahmen von der Struktur der EU einfügen könnte und würde? Sind nicht angesichts der Existenz von Japan als Weltwirtschaftsmacht und der anhaltenden Präsenz der USA in diesem Raum Konflikte als Folge hegemonialer Aspirationen zu erwarten? Und wie wird es der Weltwirtschaft gelingen, das absehbar wachsende Wirtschaftspotential Chinas und die daraus folgenden Exportoffensiven zu verkraften? Obsiegte das »blaue China« und ließen sich die Probleme des »gelben China« abfedern, so wäre die Beantwortung dieser Fragen einfacher, als wenn man ein politisch konvulsives und darüber möglicherweise nationalchauvinistisch werdendes China unterstellt. Die Beobachtung Chinas und seiner weiteren inneren, auch politisch-kulturellen Entwicklung und seiner Positionierung in der Weltwirtschaft gehört deshalb zu den analytisch faszinierendsten und weltpolitisch besonders relevanten Aufgaben der absehbaren Zukunft.
Die friedenspolitische Problemlage Ostasiens ist also einerseits genuin weltpolitisch: Sie betrifft Japan, China und die USA. Sie stellt sich aber auch im Hinblick auf die Entwicklung einer regional governance-Architektur, für die sich in ökonomischer Hinsicht gute Voraussetzungen entwickeln; diese allerdings werden von der genannten Hegemonieproblematik durchkreuzt. Die regional- und auch weltpolitischen Folgen dieser Gemengelage sind nicht prognostizierbar.
Demgegenüber ist die europäische neue Zweite Welt einfacher gelagert: Durch den EU-Osterweiterungsprozess werden Gesellschaften an die OECD