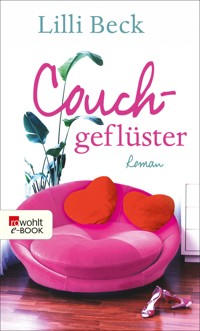9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er gibt ihr ein Versprechen. Er will sie immer lieben, immer für sie da sein. Doch dann kommt alles anders ...
Deutschland 1947: Nora wird von ihrer Freundin zu einer deutsch-amerikanischen Silvesterfeier eingeladen und ist überwältigt, als sie dort den attraktiven US-Officer William kennenlernt. Lange versucht sie, die frisch entflammte Liebe vor ihrem Vater geheim zu halten, doch als sie ein Kind erwartet und William in die USA zurückbeordert wird, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Farbe zu bekennen. Ihr Vater ist außer sich, hat aber bald eine Lösung parat, die Nora zu einer wohlhabenden Frau werden ließe und für die Familie finanzielle Vorteile hätte. Nora, die nicht daran denkt, in den Plan einzuwilligen, flieht mit ihrem Sohn nach München, wo ihr auf der Straße eine fiebrige, verwirrt wirkende junge Frau begegnet. Sie begleitet Celia nach Hause, zur Villa der wohlhabenden Wagners, und ahnt nicht, dass ihr Schicksal eine überraschende Wendung nehmen wird ...
Weitere Romane von Lilli Beck bei Blanvalet:
1. Glück und Glas
2. Wie der Wind und das Meer
3. Mehr als tausend Worte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Deutschland 1947: Nora wird von ihrer Freundin zu einer deutsch-amerikanischen Silvesterfeier eingeladen und ist überwältigt, als sie dort den attraktiven US-Officer William kennenlernt. Lange versucht sie, die frisch entflammte Liebe vor ihrem Vater geheim zu halten, doch als sie ein Kind erwartet und William in die USA zurückbeordert wird, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Farbe zu bekennen. Ihr Vater ist außer sich, hat aber bald eine Lösung parat, die Nora zu einer wohlhabenden Frau werden ließe und für die Familie finanzielle Vorteile hätte. Nora, die nicht daran denkt, in den Plan einzuwilligen, flieht mit ihrem Sohn nach München, wo ihr auf der Straße eine fiebrige, verwirrt wirkende junge Frau begegnet. Sie begleitet Celia nach Hause, zur Villa der Wagners, und ahnt nicht, dass ihr Schicksal eine überraschende Wendung nehmen wird …
Autorin
Lilli Beck wurde in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in München. Nach der Schulzeit begann sie eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau. 1968 zog sie nach München, wo sie von einer Modelagentin in der damaligen In-Disko Blow up entdeckt wurde. Das war der Beginn eines Lebens wie aus einem Hollywood-Film. Sie arbeitete zehn Jahre lang für Zeitschriften wie Brigitte, Burda-Moden und TWEN. Sie war Pirelli-Kühlerfigur und Covergirl auf der LPMit Pfefferminz bin ich dein Prinz von Marius Müller-Westernhagen.
Weitere Informationen unter: https://lilli-beck.de/
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
LILLIBECK
WENNDIEHOFFNUNGERWACHT
ROMAN
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright © 2021 by Lilli Beck © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, MünchenISBN978-3-641-26278-5V002www.blanvalet.de
Die Gegenwart ist die Summe der Vergangenheit.
Gerhard Uhlenbruck
1
Regensburg, Mittwoch, den 31. Dezember 1947
BEHUTSAMSTECKTENORAden Nagellackpinsel zurück in das Fläschchen, um die frisch lackierten Fingernägel nicht zu ruinieren, und drehte es ordentlich zu. Anschließend streckte sie beide Hände aus und betrachtete ihr Werk; das warme Rot sah richtig schick aus, sogar ein bisschen verwegen.
»Jetzt bloß nichts anfassen, sonst machst du Kratzer in den Lack«, mahnte ihre Freundin Hedi. »Richtig trocken ist er nämlich erst nach zwanzig Minuten. Kannst ein bisschen pusten, dann geht es schneller.«
Vorsichtig pustete Nora über den glänzenden Lack. Es waren die ersten roten Nägel ihres Lebens, für den ersten Ball ihres Lebens. Wenn ihr Vater davon erführe, würde er sie trotz ihrer knapp zwanzig Jahre vermutlich in den Keller sperren wie ein kleines Mädchen und erst an Heiligdreikönig wieder rauslassen. Doch weder er noch die Mutter hatten den leisesten Schimmer, wo sie um Mitternacht tanzen würde. Sie hatte glaubwürdig genug von einer geplanten Silvesterfeier bei Hedi geschwärmt und schließlich die Erlaubnis bekommen, der Freundin schon am Nachmittag bei den Vorbereitungen zu helfen und bis ein Uhr morgens zu bleiben.
»Ich kann es kaum erwarten, bis wir endlich losgehen«, sagte Nora zehn Minuten später. Sie war ganz zappelig vor Ungeduld und gleichzeitig so aufgeregt wie als Kind zu Weihnachten, als noch Spielsachen unterm Christbaum lagen und nicht nur nützliche Kleidungsstücke wie in den letzten Kriegsjahren. Als ihr Vater keine Ansprachen von Hitler im Radio versäumt und bei jeder Mahlzeit mit großer Bewunderung über den Führer gesprochen hatte, bevor der und seine Gefolgschaft die Welt in Schutt und Asche gelegt hatten.
»Ich würde am liebsten sofort losgehen, aber es ist erst vier Uhr nachmittags, es dauert also noch«, riss Hedi sie aus ihren Gedanken. »Teste mal mit der Zungenspitze an einem Nagel, ob es ein wenig brennt. Wenn nicht, ist der Lack trocken. Hat mir eine unserer Köchinnen verraten, die früher mal Kosmetikerin war.«
Nora legte die Zunge vorsichtig auf den Daumennagel. »Brennt nicht«, verkündete sie und sah die Freundin erwartungsvoll an.
Hedi deutete auf den Schrank mit dem eingelassenen Spiegel in der Tür, in dem ihre Kleider auf Holzbügeln hingen.
»Wie wär’s mit einer Generalprobe? Wenn irgendwas nicht passt oder sitzt, hätten wir noch genug Zeit, um es zu ändern.«
Nora stimmte begeistert zu. Nachdem sie sich umgezogen und der Freundin bei dem rückwärtigen Reißverschluss geholfen hatte, betrachtete sie sich in dem blank geputzten Kristallspiegel. Er reflektierte zwei Mädchen, die ungleicher nicht hätten sein können. Ihre dunkelhaarige Freundin mit dem runden Gesicht, den braunen Augen, dem lasziv geschwungenen Mund, der ein wenig zu stark geschminkt war, trug ein Kleid aus moosgrünem Taft, das sich um ihre üppigen Kurven schmiegte. Neben der aufreizend wirkenden Hedi empfand sich Nora oft als etwas unscheinbar. Doch das neue Kleid aus dunkelblauem Brokat mit dem engen Oberteil, der schmalen Taille und dem weit schwingenden Rock betonte vorteilhaft ihre zierliche Figur. Die Seitenpartien ihres goldblonden Haars hatte sie mit Kämmen hochgesteckt; der Rest fiel in weichen Wellen auf ihre Schultern. Die dichten getuschten Wimpern betonten ihre veilchenblauen Augen, und auf den Lippen schimmerte ein sanftes Rot, passend zu den Nägeln.
»Ich finde, wir sehen wie Filmstars aus«, sagte Hedi und kommandierte: »Umdrehen, Nähte kontrollieren.«
Nora drehte sich bereitwillig um. Hedi hatte heißbegehrte Nylons mit Naht organisiert, die absolut gerade sitzen mussten, um das Bein zu betonen. Nora gefiel, was sie sah. Was ihr weniger gut gefiel, waren ihre kleinen Brüste. Doch das geschickt drapierte Oberteil täuschte wenigstens etwas Fülle vor. Dennoch würde sie niemals so beachtet werden wie Hedi, deren üppiger Busen stets die Blicke aller Männer auf sich zog. Obwohl ihr Bewunderung an diesem Tag nicht so wichtig war. Sie freute sich aus einem ganz anderen Grund auf die Silvesterfeier.
Nach einem Stück Fußweg und einer kurzen Fahrt mit der Straßenbahn gelangten sie von der Kreuzgasse, wo Hedi bei ihren Eltern lebte, ins noble Westenviertel. Und zwar zum Anwesen einer ehemaligen Nazigröße, das die amerikanische Militärregierung beschlagnahmt hatte.
Staunend betrachtete Nora die imposante Gründerzeitvilla, deren Eingang von zwei schlanken Säulen flankiert und von einem Balkon überdacht war. In den links und rechts aufgestellten Blumenkübeln steckten Fackeln, deren rotgoldenes Licht die Fassade erhellte. Nora vermochte nicht die kleinste Spur von Luftangriffen an der Villa zu erkennen, als hätten die Alliierten das oberpfälzische Regensburg weiträumig umflogen.
Ich würde alles dafür geben, in so einem Palast zu leben, dachte sie, weit weg von meinem einengenden Zuhause.
Hedi, die als Küchenhilfe im amerikanischen Offizierscasino Gemüse putzte und Geschirr spülte, war das Kunststück gelungen, zur Silvesterfeier eingeladen zu werden. »Die Besatzer leiden unter Frauenmangel, und junge deutsche Mädchen sind hochwillkommen«, hatte sie erklärt. Nora hatte dennoch gezögert, nicht nur, weil ihr ein passendes Kleid gefehlt hatte, sie fürchtete auch ihren Vater, der jeden ihrer Schritte kontrollierte. Der ihr rigoros verboten hatte, mit »Amis« auch nur ein Wort zu wechseln. Obwohl das Fraternisierungsverbot schon im Oktober 1945 aufgehoben worden war, predigte er bei jeder Gelegenheit: »Diese Soldaten haben nichts anderes im Sinn, als unsere anständigen deutschen Frauen mit starken Schnäpsen wehrlos zu machen und dann zu schänden.« Bislang hatte Nora sich von den GIs ferngehalten, nicht auf ihr Winken und ihre »Hallo Frowlein«-Rufe reagiert und wäre niemals in einen Jeep eingestiegen. Doch als Hedi von der Silvesterfeier schwärmte: »Du kannst essen und trinken, bis du platzt, und musst keinen Pfennig bezahlen«, hatte sie ihre Bedenken weggewischt wie lästige Fliegen. Zu verlockend war der Gedanke, einmal nicht mit Magenknurren einschlafen zu müssen. Zu Hause war der Hunger Dauergast, Weihnachten hatten sie wegen fehlender Zutaten keine Plätzchen backen können, und heute, am letzten Tag des Jahres, hatte nur ein armseliger falscher Braten auf dem Mittagstisch gestanden. Zubereitet aus Haferflocken, weich gekochten Linsen und etwas Wurzelgemüse. Echtes Fleisch oder richtige Wurst waren noch immer absoluter Luxus, und die Zuteilung von vierzehn Gramm pro Person und Tag entsprach gerade mal einer Scheibe Wurst. Nach wie vor bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften, weil man nur auf Lebensmittelkarten einkaufen konnte. Hamsterfahrten und Stromsperren waren ebenso an der Tagesordnung wie kriminelle Bäcker, die Gipsmehl oder Sägespäne in den Brotteig mischten. Es herrschte immer noch Krieg, auch wenn nicht mehr geschossen wurde, niemand mehr die Nächte wegen der Luftangriffe im Keller verbringen musste und tatsächlich Männer aus der Gefangenschaft zurückkehrten.
»Nora, hast du etwa Angst?« Hedi ergriff ihre Hand und zog sie durch die eiserne Gartenpforte. »Der hinterfotzige Obernazi ist längst über alle Berge. Und vor den GIs muss dir nicht bange sein. Wenn die schöne Mädchen wie uns sehen, werden sie zahm wie junge Hunde und wedeln auch mit den Schwänzchen«, endete sie laut lachend.
»Ich bin nur wegen des Essens hier«, erinnerte Nora die Freundin und folgte ihr durch den Garten.
Schneereste knirschten unter Noras dünnen Sohlen, feine Flocken wirbelten durch die Nachtluft, und eine Windböe schubste sie vorwärts wie eine freundliche Hand, die sie in ein Wunderland führen wollte. Weit weg vom rückständigen katholischen Regensburg, in ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo Träume wahr und Tellerwäscher angeblich zu Millionären werden konnten. In ein Leben ohne Not und Trümmerberge, obgleich ihre Heimatstadt Regensburg längst nicht so zerstört worden war wie Berlin oder München, wovon Radionachrichten und Zeitungen ausführlich berichtet hatten.
Fünf Eingangsstufen führten zu einem schweren Eichenportal, das nur angelehnt war. Vorsichtig traten Nora und Hedi ein und gelangten in ein weitläufiges Vestibül.
»Welcome«, begrüßte ein junger Soldat sie mit einem freundlichen Lächeln, nahm ihnen die Mäntel ab und wünschte augenzwinkernd: »Have fun!« Mit ausgestrecktem Arm deutete er auf eine halb offene Doppeltür, aus der flotte Swingrhythmen drangen. »This way.«
»Wir kommen viel zu spät, die Party ist längst in vollem Gange«, zischelte Nora ihrer Freundin zu, als sie einen halben Schritt nach ihr einen saalartigen Raum betrat.
»Keine Sorge, die Amis sind nicht so förmlich, hier gibt es keine mürrischen Gesichter, wenn man etwas später kommt. Und Büfett bedeutet, dass den ganzen Abend was auf dem Tisch steht.«
»Hoffentlich«, entgegnete Nora leise, während ihr Blick auf einen gigantischen Weihnachtsbaum fiel, der am anderen Ende des Raumes erstrahlte. Welch eine Pracht! Noch nie hatte sie solch einen schönen, mächtigen Baum gesehen: eine Blautanne, die bis zur Decke reichte, dicht mit bunten Kugeln, knallroten Kerzen und silbern glitzernden Girlanden geschmückt. Dagegen war die kümmerliche Fichte im heimischen Wohnzimmer nur ein armseliger Versuch, Weihnachten nach Hause zu holen.
Hedi hakte sich unter, flüsterte aufgeregt: »Hier werden wir uns bestens amüsieren«, und zog sie mit sich durch den Raum.
Fröhliche Pärchen hatten es sich auf dick gepolsterten Sofas und breiten Sesseln bequem gemacht. Gesprächsfetzen mischten sich mit hellem Lachen und dem Klirren von Gläsern. Grauweiße Rauchkringel schlängelten sich durch die aufgeheizte Luft.
Staunend bemerkte Nora die unzähligen Aschenbecher, gefüllt mit halb gerauchten Zigaretten. Was für eine Verschwendung, dachte sie und musste sich beherrschen, nicht zur Diebin zu werden. Alfred, ihr großer Bruder, würde sich mächtig darüber freuen, aber die Kippen einfach zu klauen war ganz und gar unmöglich. Neugierig blickte sie sich um. Auf dem blank polierten Parkett drehten sich die Paare zu flotter Musik. An der Stirnseite des Raumes war ein kleines Podest aufgebaut, darauf spielte eine Fünf-Mann-Kapelle Rum and Coca Cola von den Andrew Sisters. Unlängst hatte ein Radiosprecher des AFN berichtet, die Künstlerinnen würden in den Uniformen der weiblichen Armeeangehörigen auftreten. Der amerikanische Soldatensender funkte über UKW für die Truppen im Ausland und war auch für die einheimische Bevölkerung problemlos zu empfangen. Nora besaß ein eigenes kleines Radio, lauschte abends in ihrem Zimmer auf dem Bett liegend dem Programm, übte beim Zuhören die englische Sprache und träumte davon, eines Tages in dieses Land zu reisen, in dem allein schon die Musik so viel aufregender war als die langweilige deutsche Volksmusik mit ihren oft traurigen Liedtexten. Dagegen fuhr ihr der Rhythmus des mitreißenden Hits der Andrew Sisters direkt in die Beine. Möglichst unauffällig, damit niemand sie für ein armes Mauerblümchen hielt, das unbedingt aufgefordert werden wollte, wippte sie mit den Füßen.
Aber so sehr sie diese fröhliche Musik mochte, war sie doch hauptsächlich wegen des kostenlosen Essens hier. Und ihr Magen forderte lautstark, es schnellstens zu finden.
Wo ist denn nun das sagenhafte Büfett?, dachte sie und blickte sich um.
Aus der offenen Tür eines angrenzenden Nebenzimmers sah sie zwei Uniformierte kommen, die sich ungeniert die Finger ableckten. Nora verpasste Hedi einen dezenten Schubs mit dem Ellbogen.
»Hunger«, zischte sie ihr leise zu, und endlich zog Hedi sie in Richtung Nebenzimmer.
Tatsächlich war dort eine lange Tafel aufgebaut, die sich unter Schüsseln voller Mayonnaisesalat, kalten Platten mit Käse, Schinken, Salami und kunstvoll getürmten kleinen Kuchen mit buntem Zuckerguss bog. Nora blinzelte mehrmals, um sicherzugehen, dass sie nicht träumte. Als sie den appetitanregenden Duft einatmete, den die Speisen verströmten, meldete sich ihr Magen erneut mit leisem Knurren.
Hedi deutete auf eine Schüssel mit goldbraunen, fettig glänzenden Kartoffelstäbchen. »Probier die da, die heißen Pommes frites. Sie werden in Öl frittiert und schmecken einfach göttlich.«
Nora hatte schon davon gehört, aber sich solch einen Überfluss wie schwimmendes Fett vorzustellen, gelang ihr einfach nicht. Ein Löffel Butter wäre schon der reinste Luxus. Ihre Mutter würde ehrfürchtig das Kreuz über der Brust schlagen, könnte sie diese Köstlichkeit sehen.
»Du musst sie auf einen Teller geben, dazu Ketchup nehmen und die French fries, wie die GIs sie nennen, darin eintauchen«, erklärte Hedi, die im Casino nicht nur einen geheizten Arbeitsplatz hatte, sondern dort auch täglich eine warme Mahlzeit erhielt.
Nora folgte Hedis Anweisungen, spießte ein Kartoffelstück auf die Gabel, tunkte es in Ketchup und probierte. Es schmeckte nach Fett und Kartoffeln, nach Salz und das Ketchup ein wenig süß. Noch nie hatte sie solch eine ungewöhnliche Mischung probiert, die derart köstlich war. Hauptsächlich aber schmeckte sie nach Friedenszeiten, in denen es keinen Hunger gab.
Wenig später probierte sie zum ersten Mal einen Hotdog. Das längliche Brötchen, gefüllt mit einem warmen Frankfurter Würstchen und bestrichen mit Ketchup, war gewiss im Schlaraffenland erfunden worden. Allein schon das Würstchen entsprach mindestens einer Monatsration. Wenn Vater das wüsste, dachte Nora, und während sie noch am letzten Bissen kaute, hörte sie ihn in Gedanken meckern: »Wir Deutschen müssen mit der Hungerkarte auskommen, von armseligen zwölfhundert Kalorien pro Tag zehren, aber die Sieger« – das Wort betonte er jedes Mal mit sichtlicher Abscheu – »leben wie die Maden im Speck. Sie müssen sich weder beschränken noch auf irgendetwas verzichten. Wenn sie wollten, könnten sie uns verhungern lassen.«
Ungeniert leckte Nora sich nun ebenfalls die Finger ab. Diesen Genuss würde sie niemals vergessen, selbst in hundert Jahren nicht. Dafür hatte es sich gelohnt, eine Tube Krätzesalbe, eine Schachtel Schmerztabletten und eine kleine Flasche Augentropfen aus der Apotheke ihres Vaters zu stibitzen und mächtigen Ärger zu riskieren, falls er es bemerkte.
Die heißbegehrten Medikamente hatte sie im Hinterzimmer-Schwarzmarkt des Gasthofs zum Schwarzen Schwan gegen den dunkelblauen Brokatvorhang mit silbernen Blüten getauscht, aus dem sie sich das Kleid genäht hatte. Es schien, als sähe sie sehr hübsch aus in dem halblangen Cocktailkleid im »New-Look-Stil« des Modeschöpfers Christian Dior. Jedenfalls den Blicken des dunkelblonden GIs nach zu urteilen, der einige Schritte entfernt lässig an der Wand lehnte und sie eindringlich musterte.
Nora senkte die Lider. Normalerweise war sie nicht schüchtern, in der Apotheke wurden ihr häufig freche Blicke zugeworfen, die sie manchmal auch erwiderte. Aber einen Mann direkt anzulächeln wagte sie nicht. Mädchen hatten sich sittsam zu verhalten, und einem Soldaten eindeutige Signale zu senden war anstößig. Obwohl ihr der stattliche Mann ausnehmend gut gefiel, der in der kleidsamen Ausgehuniform wie ein Filmstar aussah und nicht so abgemagert wie die deutschen Kriegsheimkehrer war, die teilweise einen Arm oder ein Bein verloren hatten oder gar erblindet waren. Aber schamlos zu flirten gehörte sich nun mal nicht. In diesem Punkt stimmte sie ihrem Vater zu, der diese Regel oft genug predigte.
Die Kapelle spielte Bei mir bist du shein, als ein uniformierter schwarzer Hüne auf Hedi zustürmte.
»Hello, my sweetheart …«, sagte er und strahlte die Freundin mit seinen unfassbar weißen Zähnen an. »Come on, honey, let’s dance …«
Ehe Nora, die wenig Lust hatte, alleine zwischen den GIs rumzustehen, protestieren konnte, lag Hedi in den kräftigen Armen des dunkelhäutigen Soldaten und wirbelte über das glänzende Parkett. Sie wusste, dass ihre Freundin sich schon länger mit diesem Oberst traf und bis über beide Ohren in ihn verliebt war. »John ist ein fantastischer Liebhaber«, schwärmte Hedi in den höchsten Tönen. »Du machst dir ja keine Vorstellung, wie wundervoll es ist, mit einem Mann zu schlafen … Was der alles mit dir machen kann … der absolute Wahnsinn … Na, du weißt schon, was ich meine.« Nora hatte keine Ahnung, wovon Hedi sprach, denn im Gegensatz zu ihr war sie noch Jungfrau. Vor einem Jahr war sie mehrmals mit Herbert ausgegangen, dem Sohn einer Drogistenfamilie. Zwar hatte ihr Vater den Verehrer akzeptiert, aber dennoch hatte er nie versäumt, ihr eine Drohung mit auf den Weg zu geben: »Wenn du einen unehelichen Bankert heimbringst, schlage ich dich tot.« Wie albern, hatte Nora nur gedacht, es gab doch Fromms Präservative. Unter den Nazis waren die »Pariser« zwar verboten gewesen, ihr Vater hatte sie dennoch all die Jahre, in dezent grauem Papier verpackt, unterm Ladentisch bereitgehalten. Dieses lukrative Geschäft hatte er sich nicht entgehen lassen wollen. Und es war allgemein bekannt, dass die Fromms nicht nur vor ungewollten Schwangerschaften, sondern auch vor allen möglichen Krankheiten schützten. Oft hatte Nora beobachten können, wie junge Männer verschämt nach Salben gegen das Brennen beim Wasserlassen gefragt hatten. Trotz der leicht verfügbaren »Lümmeltüten«, wie ihr Bruder Alfred sie bezeichnete, würde sie sich nie im Leben auf so ein Liebesabenteuer einlassen. Selbst auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht nie erfuhr, was der »absolute Wahnsinn« war. Herbert hatte versucht, sie zu verführen, doch sie hatte ihm nur ein paar Küsse gewährt. Ohne Trauschein schwanger und womöglich nicht geheiratet zu werden bedeutete in einer erzkatholischen Stadt wie Regensburg die gesellschaftliche Ächtung. Ihr Vater würde sie zwar nicht zu Tode prügeln, aber todsicher aus dem Haus werfen, darauf traute Nora sich zu wetten.
Hedi hingegen forderte das Schicksal direkt heraus. »Wenn John mir einen Braten in die Röhre schiebt«, scherzte sie gerne, »nimmt er mich mit nach Amerika. Ein Baby ist die Fahrkarte in ein unbeschwertes Leben. Damit entkomme ich diesem Albtraum aus Hunger und Trümmern.«
Lange Zeit hatten die Militärregierungen ihren Soldaten nicht erlaubt, deutsche Frauen zu heiraten. Inzwischen hörte man jedoch immer wieder, dass Ehen zustande kamen und die Frauen tatsächlich nach Amerika mitgenommen wurden. Nora hätte zu gerne gewusst, wie es ihnen dort drüben erging. Ob sie glücklich waren an der Seite eines Siegers. Ob sie zwischen den Wolkenkratzern tatsächlich ein Leben ohne Not führten. Ob sie es im Winter mollig warm hatten, jederzeit Nylonstrümpfe kaufen konnten und in Autos fuhren, die groß wie Schiffe waren. Was auch immer Hedi in diesem fremden Land erwartete, dort drüben würde sie garantiert keine Steine für den Wiederaufbau klopfen müssen und konnte sich stattdessen die Nägel lackieren.
Leise seufzend nahm Nora einen Schluck von der süßen Cola-Rum und genoss das angenehme Prickeln im Mund. Sie musste achtgeben, nicht zu viel von diesem Cocktail zu trinken, denn sie spürte schon die Wirkung, und ihr Vater sollte auf keinen Fall recht behalten mit seiner Behauptung, die Amis würden sie nur betrunken machen wollen. Dennoch wünschte sie, die Zeit möge stehen bleiben, wenigstens bis der Winter vorbei war. In so einer gut geheizten Traumvilla zu leben, alle Probleme vergessen zu können und vor allem nicht mit ihrem Vater über ihren angeblich mangelnden Fleiß in der Apotheke zu streiten, wäre das reinste Paradies.
»Darf ich die schönste Frau im Raum zum Tanzen auffordern?«
Nora erschrak ein wenig, als sie eine warme Stimme vernahm, die völlig akzentfreies Deutsch sprach. Sie wunderte sich über die ungewöhnliche, mit einem Kompliment gepaarte Aufforderung. Es war der dunkelblonde GI, der sie vorhin schon beobachtet hatte. Jetzt lächelte er sie an. Er war viel größer als sie, Nora musste den Kopf in den Nacken legen, um ihn ansehen zu können. Aus der Nähe wirkte er noch attraktiver, sein voller Mund stand im Kontrast zu dem kantigen Kinn, und der warme Blick aus seinen braungrünen Augen war wie eine sanfte Liebkosung.
»William Bowman, Captain der US Air Force«, sagte er, als sie nicht antwortete.
»My name …«, begann sie spontan auf Englisch, wie sie es mit Hedi geübt hatte, verbesserte sich aber sofort: »Ich heiße Nora Längsfeld.« Dabei überlegte sie, warum er so gut Deutsch sprach. Seine Uniform war eindeutig die der US-Armee, also war er doch Amerikaner.
»Freut mich sehr, Nora«, sagte William und streckte ihr eine Hand entgegen, als hätte sie Ja gesagt.
Nora wollte sehr gerne tanzen, wo Alfred ihr doch in den letzten Tagen die Grundschritte einiger Tänze beigebracht hatte. Hilflos blickte sie auf das Getränk in ihrer Hand. Wohin damit?
William nahm ihr das Glas kommentarlos aus der Hand und stellte es in einer Fensternische ab. Schnellen Schrittes, als könnte er es nicht erwarten, führte er sie in die tanzende Menge und zog sie sanft in seine Arme.
Im selben Moment wechselte die Musik zu einem langsameren Song. Nora erkannte die Stimme von Perry Como, der Surrender sang, und zitterte ein wenig, als William sie noch fester an sich drückte. Aber es gefiel ihr, es gefiel ihr sogar sehr.
Als wären sie ein Liebespaar, legte sie den Kopf an seine Brust. Wie sie beobachtet hatte, schien es vollkommen normal zu sein, so eng zu tanzen. Alle Frauen schmiegten sich ganz ungeniert an ihre Tanzpartner.
Nora schloss die Augen und wünschte sich, diese Silvesternacht möge niemals enden. Sie vermochte sich nicht zu erinnern, wann sie das letzte Mal dieses aufregende Kribbeln in ihrem Magen verspürt hatte, das so viel angenehmer war als das Hungergrummeln, das sie die meiste Zeit des Tages quälte. Ein unbekanntes Gefühl des Wohlbefindens packte sie. Es begann als leiser Schauer auf ihrem Rücken, steigerte sich zu einem erregenden Prickeln und erfasste schließlich ihren ganzen Körper wie eine sanfte Welle.
Als William sie noch näher an sich zog und sein Kinn an ihren Kopf lehnte, wünschte sie sich, dass in dieser letzten Nacht des Jahres 1947 etwas Wundervolles geschehen würde. Etwas, das dem von ihren Eltern vorgezeichneten Lebensweg – nämlich einen anständigen Mann zu heiraten und Kinder zu bekommen – eine überraschende Wendung gäbe. Dass diese Silvesternacht ein Abenteuer für sie bereithielte.
2
München, einige Stunden zuvor
AMNACHMITTAGVERLIESSWolf Wagner seine Villa, zog den Hut aus weicher Kaschmirwolle noch tiefer in die Stirn und schlug den Pelzkragen seines Kamelhaarmantels hoch, um nicht von den Nachbarn erkannt zu werden.
Ein Pärchen flanierte dicht an ihm vorbei. »Eier?«, flüsterte der Mann ihm zu.
Wolf schüttelte unmerklich den Kopf und lief weiter.
An der nächsten Ecke lehnte ein junger Mann am Gartenzaun, der einen Apfel von einer Hand in die andere gleiten ließ. Das stumme Zeichen eines Apfelhändlers. Natürlich hatte er die Ware nicht bei sich, sondern irgendwo versteckt. Interessenten nickten im Vorbeigehen, und der Apfelhändler zeigte mittels einer knappen Kopfbewegung die Richtung an, in der sich die Ware befand.
Diese verborgenen Gesten dienten der Vorsicht, denn die Gefahr von Razzien war auch an einem milden Silvesternachmittag nicht zu unterschätzen, an dem in der Möhlstraße reger Verkehr herrschte. Wollte die Polizei nach Schwarzhändlern fahnden, wäre dieser Tag ein Fest für die Ordnungshüter. Hunderte Passanten spazierten mit leeren oder bereits prall gefüllten Akten- und Einkaufstaschen durch die Gegend. Darin verborgen vielleicht massive Goldketten, feines Porzellan oder Silberleuchter, um die nutzlosen Schätze gegen zwei, drei Flaschen Sekt, gute Butter, etwas Schinken, echten Bohnenkaffee, ein Päckchen Sil-Waschpulver, amerikanische Zahnpasta oder Seife einzutauschen.
Auch Wolf war mit einer Aktentasche unterwegs, in der sich ein wertvolles Erbstück befand. In den andauernden Zeiten der Zwangsbewirtschaftung wurde es zunehmend unwichtiger, sich mit Juwelen zu schmücken, über handgeknüpfte Teppiche zu laufen oder von Meißner Porzellan zu speisen. Leere Teller stillten keinen Hunger, und wenigstens am letzten Tag des Jahres wollte man vergessen, dass die Läden nur selten das anboten, was die Lebensmittelkarten versprachen. Wehe den Alliierten, wenn sie die prekäre Lage nicht bald in den Griff bekamen. Irgendwann würden die Massen erneut aufbegehren, wie schon im vergangenen März, als es zu Hungerdemonstrationen und Tumulten gekommen war.
An der Ecke Höchelstraße hielt Wolf Ausschau nach Benno Trebitsch, genannt der »Schlesier«, konnte ihn aber nirgends entdecken. Sein Stammhändler hielt sich wahrscheinlich in seiner Baracke auf.
Mühsam kletterte Wolf über einen Trümmerberg, umrundete diverse Matschpfützen, eine Folge der unerwartet milden Temperaturen, und gelangte schließlich über einen Bretterweg an sein Ziel: ein etwa vier mal vier Meter großer, behelfsmäßiger Verschlag, gezimmert aus Abfallholz und rostigen Nägeln, der unverdrossen zwischen den Trümmern herausragte. Auf den ersten Blick wirkte die Hütte, als würde sie den nächsten Sturm nicht überleben, und tat es dennoch seit dem Winter 1945.
Als Wolf die windschiefe Tür aufstieß, hörte er Trebitsch sagen: »Ein Ei, mehr kann ich nicht geben, gute Frau. Im Winter legen die Hühner schlecht, da steigen auch die Preise.«
Wolf kannte die Eierpreise nur zu gut. Fünf Zigaretten pro Ei oder sieben Reichsmark, wobei die offizielle Währung längst ihren Wert verloren hatte und auf dem Markt vorwiegend mit Zigaretten oder Ware gegen Ware gehandelt wurde.
»Aber der Ring … Er ist echtes Gold«, widersprach eine raue Stimme leise.
Wolf betrat die düstere Bretterbude, und wie er nun sah, schacherte Trebitsch mit einer alten Frau um deren schlichten goldenen Ehering, den er zwischen Daumen und Mittelfinger hielt.
Wolf zog den Mantel enger um sich. Obgleich es nicht so kalt war, fröstelte er beim Anblick der Kundin, die einen dünnen Staubmantel, ein durchscheinendes Tuch um den Hals und sommerliche Schnürschuhe trug.
»Hier, Mutterl, haste noch hundert Gramm Zucker, die kannste bestimmt gegen ein Ei tauschen«, sagte Trebitsch und drückte der Frau ein braunes Papiertütchen in die Hand.
Manchmal, so dachte Wolf, hatte der Schlesier mildtätige Anwandlungen, denn Zucker war heißbegehrt und pro fünfhundert Gramm stolze fünfundachtzig Reichsmark oder zehn Zigaretten wert. Offenbar tat die alte Frau, die sich nun zum Gehen wandte, dem Händler leid.
»Servus, Schlesier«, begrüßte Wolf den hageren Fünfzigjährigen, der eine abgetragene graue Lodenjoppe und dazu einen speckigen Hut trug, in dessen Band eine weiße Taubenfeder steckte. Trotz seiner regelmäßigen »Einkäufe« wusste Wolf lediglich, dass der Schlesier den Beruf des Goldschmieds erlernt hatte, was dessen Vorliebe für kostbare Juwelen erklärte. Im Januar 1945 war er mit seiner Familie nach Bayern geflohen, außerdem war er in Besitz einer Anmeldung für gewerblichen Handel. Trebitsch’ Geschäfte mit Edelmetallen und Edelsteinen waren also von offizieller Stelle genehmigt, und er musste keine Razzien fürchten.
»Tach«, erwiderte der Händler.
Wolf griff in die Innentasche seines Kamelhaarmantels, fischte eine Anstecknadel in Form eines Schmetterlings heraus und reichte sie Trebitsch.
»Massives Gold und lupenreine Diamanten, ein Erbstück meiner Frau aus dem Familienschatz derer von Leonberg«, erklärte Wolf.
Begehrlich griff Trebitsch nach dem Schmuckstück, drehte und wendete es, langte schließlich in die Tasche seiner Lodenjoppe und förderte eine kleine Lupe zutage, die er sich ins rechte Auge klemmte. Dann hielt er die Brosche in das spärliche, durch ein winziges Fenster einfallende Licht und begutachtete die Tauschware ausgiebig. »Mein lieber Scholli … So was sieht man selten.«
»Und, was sagst du?«, hakte Wolf nach, als ein weiterer Kommentar ausblieb.
»Erstklassige Arbeit.«
»Nichts anderes erwartet man von Cartier«, bemerkte Wolf und fügte hinzu, dass Ricarda von Leonberg, seine verstorbene Schwiegermutter, dieses Stück um die Jahrhundertwende in Paris erworben habe. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie teuer die Brosche seinerzeit gewesen war, aber selbst wenn sie ein Vermögen gekostet hatte und Ricarda sich im Grabe umdrehen würde angesichts des Verkaufs, war sie heute hoffentlich wertvoll genug für Champagner, Butter, Käse und Eier.
»Drei Flaschen Sekt«, sagte der Händler.
»Wir hatten französischen Champagner ausgemacht«, erinnerte Wolf den Mann.
»Ist nicht auf dem Markt.«
»Gut, dann aber fünf Flaschen von dem Sekt.«
Trebitsch antwortete nicht, sondern begutachtete das Schmuckstück abermals, als suchte er nach Fehlern, die den Wert schmälerten. Als die Tür knarrend geöffnet wurde, gab er Wolf die Brosche zurück und wandte sich ab.
Ein junges Pärchen mit einem Kind auf dem Arm trat ein. »Guten Morgen«, grüßte der Mann.
»Bin sofort bei Ihnen«, erwiderte der Schlesier.
»Fünf Flaschen«, forderte Wolf erneut.
»Drei«, antwortete Trebitsch unnachgiebig.
»Sieh dir das gute Stück noch mal ganz genau an«, drängte Wolf. »Fünf ist es doch mindestens wert.«
»Harter Hund«, raunte Trebitsch.
»Halsabschneider«, erwiderte Wolf wie üblich und drückte Trebitsch die Anstecknadel wieder in die Hand.
Damit war der Handel abgeschlossen. Zumindest für Trebitsch. Wolf verstaute drei Flaschen Sekt in der Aktentasche, die anderen beiden in den Innentaschen seines Mantels und verabschiedete sich mit kurzem Nicken. Er würde ein, zwei Stunden benötigen, um die restlichen gewünschten Delikatessen zu finden, und zwei oder drei von den Sektflaschen für sie eintauschen.
Abends lehnte Wolf sich zufrieden in dem dick gepolsterten dunkelbraunen Ohrensessel zurück, griff nach der handgearbeiteten Dose aus Teakholz auf dem Marmortisch, nahm eine Camel heraus und zündete sich die Verdauungszigarette an. Ein höchst verwerfliches Vergnügen, Schwarzmarkt-Währung »zu verbrennen«. Doch für ihn war es wie eine Beschwörung einer nahen Zukunft ohne Zwangsbewirtschaftung. Irgendwann würde, musste dieses Elend doch vorbei sein. Und ohne eine Zigarette nach dem delikaten Silvesterbüfett wäre der letzte Abend des Jahres nur der halbe Genuss.
Wie üblich hatte Friederike, seine hochgeschätzte Köchin, gefüllte Eier, Schinkenröllchen, geräucherten Fisch, Käsehäppchen und vor allem den delikaten Kartoffelsalat mit selbst gemachter Mayonnaise und Essiggurken zubereitet. Seiner Meinung nach der perfekte Jahresabschluss, wie ihn schon seine Eltern, Gott hab sie selig, gefeiert hatten. Nun führte er diese Tradition mit seiner eigenen Familie fort. Ein klein wenig drückte ihn das Gewissen, denn er und seine Lieben lebten in der von den Eltern hinterlassenen, unversehrten Villa, und er besaß genug Schmuck und andere Wertgegenstände, um auf dem Schwarzmarkt alles zu beschaffen, was zum Leben nötig war. Anders als die meisten Bürger der Stadt. Trotz Kriegsende litten die Menschen unter der Geisel der Zwangsbewirtschaftung, hungerten sich von einem Tag zum anderen, und Millionen Vertriebene verschärften die Situation zusätzlich. Seine Familie musste den Gürtel jedoch nur ein wenig enger schnallen, ihnen erging es nicht wie den ausgebombten Menschen, die in eiskalten Kellern hausten, deren fehlende Fensterscheiben durch Holzlatten oder Pappe ersetzt wurden. Auch das Anstehen in diversen Geschäften blieb seiner Haushälterin erspart. Dank des Schlesiers und diverser Kontakte aus den für ihn durchaus lukrativen Kriegszeiten war die Speisekammer stets gut gefüllt. Konrad, sein Chauffeur, Gärtner und Friederikes Ehemann, kümmerte sich um die Holzscheite für den Kamin, die eine heimelige Stimmung verbreiteten.
»Verdauungsschnäpschen?« Wohlwollend blickte er zu Helene, deren schwarzes Cocktailkleid ihre Porzellanhaut vorteilhaft betonte. Seine geliebte Gattin hatte es sich mit einem Brokatkissen auf dem breiten Chesterfieldsofa bequem gemacht. Neben ihr saß Elvira, seine ältere Schwester, und in dem Sessel am anderen Ende des niedrigen Marmortisches Luis, ihr energiegeladener Sohn. »Ich könnte die erste Flasche Sekt köpfen.« Wolf sah auf seine goldene Armbanduhr. »Gut zwei Stunden bis Mitternacht, aber wenn euch jetzt schon danach gelüstet, ich bin dabei.«
»Ich auch«, bekräftigte Neffe Luis, der für jede Feier zu haben war. »Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, heißt es doch.« Er erhob sich und meinte: »Ich hol ’ne Pulle aus dem Eis.«
»Und ich kümmere mich um die Gläser«, erbot sich Elvira.
Wolf nickte seiner Schwester zu und lächelte seine Gattin an. »Helene, meine Liebe, wonach steht dir der Sinn?« Lässig strich er sich über das akkurat gestutzte Menjou-Bärtchen. In den Anfangswochen ihrer Ehe war es das geheime Zeichen gewesen, dass er sie später gern in die Arme nehmen und lieben wollte, wenn sie es ihm erlaubte.
Doch Helene reagierte nicht, starrte apathisch an ihm vorbei in eine Zimmerecke. Wolf verstand. Sie würde ihn auch heute wieder nicht erhören, was er notgedrungen akzeptierte. Sein eheliches Recht mit Gewalt zu beanspruchen käme ihm niemals in den Sinn. Er war kein Barbar, und wenn er im gemeinsamen Schlafzimmer nicht willkommen war, konnte er sich andernorts entspannen.
Helene war nicht ohne Grund so teilnahmslos. Sie trauerte um Johannes und Heinrich, ihre über alle Maßen geliebten Zwillingssöhne, die sie unter großen Schmerzen geboren hatte. Die mit neunzehn Jahren in diesen gottverdammten Krieg geschickt worden und nicht zurückgekehrt waren. »Heldenhaft für Volk und Vaterland gefallen«, stand in der Nachricht, die ihrer beider Hoffnungen wie eine verheerende Brandbombe vernichtet hatte. Keine einzige Nacht war seit jenem Tag im Januar 1945 vergangen, in der Helene nicht um ihre Söhne weinte. An dem sie das Schicksal nicht verfluchte und sich wünschte, selbst bei einem der schweren Fliegerangriffe auf München umgekommen zu sein. Ganze Straßenzüge waren von den Alliierten in Trümmerfelder verwandelt worden, warum nicht auch die Möhlstraße. Selbstverständlich war Wolf ebenfalls in tiefer Trauer. Nur zu gut erinnerte er sich daran, welch ein Glücksgefühl die Geburt der Zwillinge in ihm ausgelöst hatte. Seine geliebte Frau hatte ihm gleich zwei Stammhalter geschenkt. Und dieser elende Krieg hatte ihm beide genommen. Viele Male hatte er sich seitdem gewünscht, er könnte all sein Hab und Gut, das Haus und sein gesamtes Vermögen gegen seine Söhne eintauschen. Freudig würde er in einer kalten Kammer ohne schützendes Fensterglas hausen, wenn dies das Schicksal ändern könnte. Aber es war unmöglich. Geschehenes ließ sich nicht rückgängig machen. Es hatte keinen Sinn, mit der Vergangenheit zu hadern. Die Überlebenden waren dazu verdammt weiterzumachen. Niemand kümmerte sich um die Verluste Einzelner. Man war gezwungen, nach vorne zu schauen, weiterzumachen, das Leid zu ertragen. Das Leben nahm keinerlei Rücksicht auf Tränen oder Trauer. Notgedrungen hatte er gelernt, damit umzugehen. Es war sinnvoller, sich in die Arbeit, in neue Aufgaben zu stürzen und sich den Herausforderungen zu stellen, die der Frieden mit sich brachte. Und er war mehr als bereit dazu mitzuhelfen, das Land wiederaufzubauen.
»Wie es Celia wohl geht?«, unterbrach Helene seine Betrachtungen. »Sie hätte doch mal schreiben oder anrufen können. Irgendein Lebenszeichen schicken können.« Müde sah sie ihn mit ihren wunderschönen grünen Augen an. Als wüsste er mehr als sie. Als besäße er eine magische Kugel, die verriet, wie es ihrer einzigen Tochter ging, die nach Berlin geheiratet hatte.
»Sicher ist sie wohlauf, meine Liebe«, beschwichtigte Wolf seine Gattin und lächelte ihr aufmunternd zu. »Mach dir nicht so viele Gedanken, bestimmt kommt bald Nachricht. Auf die Post ist doch immer noch kein Verlass. Celias letzter Brief war wochenlang unterwegs gewesen, wenn du dich erinnern magst. Du weißt ja, die Alliierten haben in Berlin keinen Stein auf dem anderen gelassen, und es geht nun mal nicht so schnell, die Telefonverbindungen vollständig wieder herzustellen. Weiß der Kuckuck, wie lange es dauert, das gesamte Land in den Normalzustand zu versetzen.« Ganz so prekär war die Lage zwar nicht, und auch Briefe wurden inzwischen schneller befördert, aber die kleine Schwindelei beruhigte Helene, das sah er an ihrem Aufatmen.
»Ach, Wolf …« Seufzend strich sie über das dunkelblaue Lederkästchen, in dem sie die Eisernen Kreuze der Zwillinge verwahrte und das sie nur selten weglegte. »Ich wünsche mir so sehr ein Enkelkind. Ein Baby, als Zeichen der Hoffnung.«
»Gewiss, gewiss«, stimmte Wolf ihr zu. »Aber wir sollten uns noch ein wenig gedulden. Celia ist doch erst seit ein paar Monaten verheiratet, so schnell schießen die Preußen eben nicht.« Er lachte laut über seinen Scherz, gönnte sich einen tiefen Zug aus der Zigarette und blies gekonnt einige Rauchkringel in den herrschaftlich möblierten Wohnraum. Hoffentlich hat der preußische Herr Schwiegersohn genug Munition im Lauf, um das sehnlichst erhoffte Enkelkind zu produzieren, feixte er im Stillen. So ein süßes Wickelkind würde Helene aus ihrer Lethargie reißen, ihr nach beinahe zwei Jahren tiefer Trauer wieder neuen Lebensmut und Zuversicht verleihen. Er wünschte sich natürlich auch einen Erben, aber noch mehr, dass seine Frau endlich aufhörte zu trinken, wieder mehr auf ihre Erscheinung achtete und nicht den lieben langen Tag im Dämmerzustand verbrachte.
Euphorisch hatte er am Nachmittag registriert, dass Helene sich von Elvira das dunkelblonde Haar hatte frisieren lassen und den abscheulichen geblümten Morgenrock gegen ein wenn auch schwarzes Cocktailkleid getauscht hatte. Er selbst trug einen maßgeschneiderten Smoking, wie Neffe Luis. Seine Schwester hatte ein smaragdgrünes Taftkleid gewählt, das zu ihren dunklen Haaren sehr apart aussah.
Im Hause Wagner wurden Weihnachten und Silvester seit jeher auf großbürgerliche Art und Weise gefeiert. Auch während der Kriegsjahre war im Salon ein prächtiger Tannenbaum geschmückt worden. Trotz der vorherrschenden Zwangsbewirtschaftung hatte er am vergangenen Heiligabend alle reich beschenken können. Anschließend hatten sie sich wie jedes Jahr Forelle schmecken lassen und das Mahl mit gut gekühltem Riesling begossen. Am ersten Feiertag war eine Weihnachtsgans in Begleitung von Knödeln und Blaukraut serviert worden, gekrönt von Rotwein aus den eigenen Vorräten. Und zum nachmittäglichen Kaffee hatten sie an Friederikes selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen geknabbert. Französischer Champagner am letzten Tag des Jahres war eigentlich ein festgeschriebenes Ritual. Der popelige Sekt war natürlich kein gleichwertiger Ersatz.
Luis kam mit einer Flasche im Eiskübel und einer zweiten unterm Arm zurück. »Jubel, Trubel, Heiterkeit …«, scherzte er launig.
Elvira folgte ihrem groß gewachsenen Sohn mit einem Silbertablett, auf dem sie vier Sektschalen balancierte.
Seine Schwester und ihr Sohn waren im Dezember 1944 beim schwersten Luftangriff auf München ausgebombt worden; fast zeitgleich hatte Elvira auch noch die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhalten. Seitdem wohnte sie mit Luis in der Villa. Wolf hatte die beiden nur zu gerne aufgenommen. Platz genug war vorhanden, zudem glaubte er, dass seiner resoluten Schwester mit der Zeit doch noch das Kunststück gelingen könnte, Helene aufzumuntern. Das frisch ondulierte Haar seiner Gattin war für ihn ein erster Lichtblick.
Luis übernahm geschickt das Entkorken der Flasche, schenkte ein und verteilte die Sektschalen.
Wolf erhob sein Glas und blickte Helene direkt in die Augen. »Auf eine bessere Zukunft! Mögen unsere Träume wahr werden und meine Zeitschrift Millionen von Lesern begeistern.« Es drängte ihn, mit seiner Frau über die Pläne für die Illustrierte zu diskutieren, hatte sie ihm doch versprochen, mit ihm durch gute wie auch schlechte Zeiten zu gehen.
Helene lächelte jedoch nur müde. »Auf unsere liebe Celia!«
Luis erhob sein Glas. »Nie wieder Krieg, immer einen vollen Teller und gerne ein volles Glas!« Übermütig tupfte sich der bald Neunundzwanzigjährige einen Tropfen Sekt hinters Ohr.
»Darauf ein verdammtes Amen«, fügte Elvira lachend hinzu.
Wolf wusste, dass sie seit dem Tod ihres Mannes nur noch an den Teufel glaubte. Gott war für sie zu einer boshaften Märchenfigur geworden, eine, die lediglich die Schurken und Verbrecher begünstigte.
Wolf nahm einen kräftigen Schluck und genoss das Prickeln im Mund. Das Platzen der kleinen Bläschen empfand er stets als erfrischenden Genuss.
»Wie wär’s jetzt mit dem jährlichen Bleigießen?« Fragend blickte er in die Runde.
Luis hatte sein Glas geleert, stellte es mit einem »Ganz exquisit« auf den graugrünen Marmortisch und zuckte mit den Schultern. »Ich muss passen, bin bei Freunden eingeladen. Wenn ihr mich entschuldigt.« Er vollführte eine übertriebene Verbeugung, wobei er gleichzeitig mit der Hand wedelte, als befände er sich am Hofe Ludwigs des XIV. »Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Gesund und munter, versteht sich.« Er strich sich eine vorwitzige Strähne seiner kastanienbraunen Haare aus der Stirn, zupfte den gut sitzenden Smoking zurecht und verließ den Salon.
Elvira hatte kaum am Silvestersekt genippt. Sie knabberte an einem der Krapfen, die sie zusammen mit Friederike zubereitet und in schwimmendem Schmalz ausgebacken hatte. »Ich mache gerne mit, aber meinetwegen muss es nicht sein.«
»Wie steht es mit dir, meine Liebe?«, wandte Wolf sich an seine Frau.
Helene stellte ihr Glas ab, das sie hastig ausgetrunken hatte. »Ich hätte gern noch etwas Stärkeres, vielleicht ein Gläschen Eierlikör, und würde danach ins Bett gehen, ich bin sehr müde. Feiertage sind doch immer recht anstrengend.«
»Schade, sehr schade, meine Liebe«, entgegnete Wolf ehrlich bedauernd. Er geduldete sich schon so lange und wünschte sich mit jeder Faser seines Herzens, Helene möge endlich aus ihrem Trauerloch hervorkommen. Ihre erneute Zurückweisung und ihr Desinteresse an seinen Zukunftsplänen empfand er heute als besonders schmerzlich. Dabei war der letzte Tag des Jahres doch wie geschaffen, um Pläne zu schmieden. Aber darüber noch länger nachzudenken würde nichts an der Abfuhr ändern. »Nun, wenn das so ist, spendiere ich die zweite Flasche den Templins, wenn du erlaubst.« Selbstverständlich benötigte er Helenes Einverständnis nicht, schließlich war er der Herr im Haus, aber mit dergleichen Alltäglichkeiten versuchte er ihr Interesse für ihre Hausfrauenpflichten wieder zu wecken. Obgleich seine Schwester den Haushalt zu seiner vollsten Zufriedenheit an sich gerissen hatte, war dies doch kein Dauerzustand.
Helene nickte ihm zu. »Eine wunderbare Idee, mein Lieber. Bestelle liebe Grüße und auch von mir einen guten Rutsch.«
Wolf erhob sich aus seinem Sessel und küsste Helene auf die Stirn. »Ich werde es ausrichten«, versprach er und lächelte ihr zu. Er schnappte sich die Sektflasche, strich seiner Schwester im Hinausgehen liebevoll über die Schulter und wünschte den Damen eine angenehme Nachtruhe.
Über eine Treppe und durch eine grüne Tür, die direkt in die geräumige Küche führte, gelangte Wolf zu den Wirtschaftsräumen im Souterrain. Dahinter lag die nach Norden weisende Speisekammer, daneben das Waschhaus mit Wäschekammer sowie ein weiteres Dienstbotenzimmer mit eigenem Kanonenofen, das für Extrapersonal bei großen Festivitäten gedacht war, momentan aber von Friederike und ihrem Mann Konrad als Schlafraum genutzt wurde.
Normalerweise lebten die Templins in der ausgebauten Remise, doch in den kalten Wintermonaten wohnten sie auf seine Bitte hin im Haus, da Heizmaterial schwieriger zu beschaffen war als Brot. Die Militärregierung beanspruchte Unmengen an Kohle für die beschlagnahmten Villen, in denen die Regierungsgeschäfte abgewickelt wurden, und selbstredend auch für ihre privaten Unterkünfte. Zur Hölle mit der Rationierung, fluchte er lautlos, während er durch die penibel geputzte Küche zur Schwingtür eilte, die den Aufenthaltsraum abtrennte. Er klopfte und wartete einen Moment, bevor er eintrat. Das Ehepaar saß vor dem gusseisernen Ofen, in dem ein Feuer prasselte.
»Einen wunderschönen Abend und einen guten Rutsch wollten ich und meine Frau wünschen«, grüßte er an der Schwelle und hielt die Sektflasche hoch. »Vor allem möchte ich mich für den delikaten Kartoffelsalat bedanken, liebe Friederike. Ohne den wäre es kein Silvester.«
Konrad Templin, ein hagerer, großer Mann mit breiten Schultern, sprang aus dem plüschigen Sessel auf und zog seine dunkelgraue Wolljacke glatt. Mit einer routinierten Handbewegung fuhr er sich über das kurze, ordentlich gescheitelte Haar, das seit den Kriegsjahren von reichlich Silberfäden durchzogen war.
»Besten Dank auch, Chef, das tut doch nicht nötig.«
»Doch, doch«, meinte Wolf und überreichte seinem Chauffeur die Sektflasche.
Friederike, die ehemals rundliche Köchin, war durch die Sorge um ihren in Gefangenschaft geratenen Sohn schmal geworden, aber heute glänzten ihre dunklen Augen. Sie erhob sich aus dem Polstersessel, wobei ihr ein Briefkuvert vom Schoß fiel. Flink hob sie es auf und presste es an ihre Brust.
»Sehr freundlich, Chef. Ein Glück, dass Sie Eier für die Mayonnaise organisieren konnten, sonst hätten Sie mit einem nackerten Kartoffelsalat feiern müssen. Erdäpfel ham wir noch genug, auch wenn die seit Oktober auf zehn Kilo pro Kopf und Monat rationiert worden sind«, sagte sie, und Tränen liefen über ihr schmal gewordenes Gesicht. »Zum Überleben täten sie aber langen …«
»Das würden sie, liebe Friederike, das würden sie«, stimmte Wolf seiner Köchin zu und streckte dann seinem Chauffeur die Hand entgegen. »Auf ein besseres neues Jahr, mein Guter.«
Konrad schüttelte die Hand seines Arbeitgebers, neigte dabei den Kopf ein wenig und murmelte ergriffen: »Das wird es werden, Chef, das wird es.«
Verwundert blickte Wolf wieder zu Friederike, die immer noch schniefte und deren Augen feucht schimmerten. »Aber dann gibt es doch keinen Grund zum Weinen, oder?«
Friederike nickte beflissen, zog ein Taschentuch aus der seitlich versteckten Tasche ihres dunkelblauen Wollrocks und putzte sich geräuschvoll die Nase.
Konrad schüttelte den Kopf. »Friedelchen ist nur so aufgelöst, weil …«
Friederike strahlte jetzt übers ganze Gesicht. »Weil doch unser Bub bald heimkommt«, rief sie und schwenkte übermütig das Kuvert durch die Luft. »Er ist schon so lange in Gefangenschaft und durfte uns jetzt endlich schreiben. Ach, Herr Wagner, ich kann es noch gar nicht glauben …« Erneut kullerten Tränen über ihre eingefallenen Wangen. »Erst wenn der Bub vor mir steht …«
Wolf spürte einen stechenden Schmerz in der Brust. »Was für eine wunderbare Nachricht«, sagte er und freute sich für seine treuen Angestellten. Gleichzeitig musste er daran denken, dass seine Söhne niemals heimkehren würden. Der Verlust brannte wie Feuer in seinen Eingeweiden, wie jedes Mal, wenn ihm die Endgültigkeit bewusst wurde.
»Benötigen Sie den Wagen noch, Chef?«
»Ja, aber ich fahre selbst. Holen Sie ihn bitte nur aus der Garage, ich würde sonst garantiert irgendwo dagegenfahren«, antwortete er bemüht heiter. Er wollte den beiden nicht die Zweisamkeit verderben, obwohl Konrad ihn aus Dankbarkeit jederzeit überall hingefahren hätte. Im Winter 1944 hatte man Konrad, den guten Geist seines Hauses, noch zum Volkssturm einziehen wollen. Doch mithilfe seiner Kontakte war es Wolf gelungen, diesen Schwachsinn zu verhindern.
»In Ordnung, Chef, der Wagen steht sofort bereit«, antwortete Konrad.
Wolf sah seinem Chauffeur deutlich an, dass er sich freute, nicht mehr aus dem Haus zu müssen. Er selbst hatte es eigentlich auch nicht geplant, ursprünglich wollte er sich ins Büro zurückziehen, um an dem Konzept für die geplante Illustrierte zu tüfteln und zu überlegen, über welche Kontakte er an das nötige Papier käme. Infolge der katastrophalen Knappheit hatte die Militärregierung die Auflage und den Umfang sämtlicher Zeitungen begrenzt. Münchens beliebte Süddeutsche Zeitung hatte sich bereits auf wöchentliche zehn Seiten beschränken müssen. Doch dieses Problem erschien ihm plötzlich banal. Die freudige Nachricht der Templins hatte sein mühsam bekämpftes Schmerzensfeuer wieder auflodern lassen, und das konnte nur an einem Ort gelöscht werden.
3
LUISSCHLEUDERTEDASSmokingjackett auf das von ihm ordentlich zugedeckte Bett, zerrte ungeduldig an der Fliege, knöpfte Hemd und Hose auf und entledigte sich erleichtert des »Kostüms«. Auch wenn das Verkleiden während seiner Zeit als Komparse bei der UFA in Berlin sein Broterwerb gewesen war, fühlte er sich in diesem offiziellen Abendanzug unwohl. Es war nämlich ein gewaltiger Unterschied, ob man für Filmaufnahmen in eine feine Pelle schlüpfte oder mit der Familie gesittet am Tisch saß, dabei das Besteck auf die vorgeschriebene Art und Weise benutzte und sich um locker-leichte Konversation bemühte. Selbstredend waren er und Mama zutiefst dankbar, bei Onkel Wolf in der Villa wohnen zu dürfen. Wolf hatte sie auch nicht in den Keller zum Personal verfrachtet, sondern ihnen komfortabel eingerichtete Gästezimmer in der ersten Etage überlassen. Seines verfügte zusätzlich über einen Schreibtisch mit Armlehnenstuhl und einer hellen Stehlampe, damit er bis in die Nacht arbeiten konnte. Obendrein wurden sie verköstigt, ohne dass der Onkel auch nur eine Reichsmark oder sonstige Gegenleistungen verlangte. Und das, obwohl er momentan kein Einkommen hatte und »an der Substanz knabberte«, wie er selbst einmal gescherzt hatte. Luis war überglücklich gewesen, sich unlängst mit zwei Kinokarten revanchieren zu können. Bis auf Weiteres blieb ihm nur, bei der Scharade um Tante Helene mitzuspielen, indem er gute Laune verbreitete, um die angebliche Familienidylle aufrechtzuerhalten. Angeblich lenkte das die Tante von ihrer Trauer ab, obwohl sie wie eine Untote durchs Haus geisterte und kaum auf Anwesende oder ihre Umgebung reagierte. Sie hatte nicht einmal die Mundwinkel verzogen, als er den Kalauer zum Besten gegeben hatte, über den zurzeit die ganze Stadt lachte: »Was gibt’s zu essen?«, fragt der Ehemann seine Frau. »Kartoffelbrei«, antwortet sie. »Und was gibt’s dazu?«, fragt der Mann weiter. »Einen Löffel«, erwidert sie. Zu komisch war das!
In der Villa herrschte keine Not, trotz der streng rationierten Lebensmittel, auch nicht an Zigaretten, von denen er jetzt gerne eine rauchen würde. Den Onkel darum zu bitten versagte er sich, das wäre unverschämt. Zudem hatte seine Mutter ihm eingeschärft, Bescheidenheit und Zurückhaltung seien die einzige Garantie, auch weiterhin ein Dach über dem Kopf zu haben. Selbstredend hielt er sich daran, und die ersehnte Zigarette würde er in Kürze durch den Tausch gegen eine Portion von Friederikes Kartoffelsalat erlangen. Von dem satt machenden Salat war reichlich übrig geblieben, und die Köchin konnte seinem Charme nicht widerstehen, das hatte er nicht nur an den selbst gestrickten Fäustlingen bemerkt, die sie ihm unter den Christbaum gelegt hatte.
Luis begab sich in das hellgrün gekachelte Gästebad, das er sich mit seiner Mutter teilte: ein wahrer Luxus. Ebenso die Lavendelseife, mit der er sich Hände und Gesicht wusch. Noch einige Tropfen der Rasierlotion, das Weihnachtsgeschenk von Onkel Wolf, auf Kinn und Hals verteilen, und er war bereit für die fröhliche Silvestersause bei seinen Freunden.
Aus der übersichtlichen Anzahl seiner Kleidungsstücke im Schrank wählte er den guten Wollstoffanzug mit den Umschlägen an den Hosenbeinen. Der Anzug hatte mit wenigen anderen Stücken die Brandbomben überlebt und stank inzwischen auch nicht mehr nach Rauch. Darüber noch den Tweedmantel mit Fellfutter, den er auf dem Schwarzmarkt gegen sein Fahrrad eingetauscht hatte, den von Mama selbst gestrickten Schal, den speckig gewordenen Filzhut, und er war bereit für die letzte Nacht des Jahres. Vorher hatte er aber noch eine Kleinigkeit im Souterrain zu erledigen.
Nach kurzem Anklopfen betrat er den Aufenthaltsraum der Templins. Er liebte die Wirtschaftsräume, die geräumige Küche mit dem doppelt breiten gusseisernen Herd, dem blank gescheuerten Arbeitstisch in der Mitte und ganz besonders die appetitanregenden Düfte, die einen stets empfingen, wenn Friederike etwas brutzelte. Er nahm den Hut ab und grüßte freundlich: »Wunderschönen guten Abend, die Herrschaften.«
»Ja, Luis, wollen S’ denn so spät noch ausgehen?«, fragte die Köchin und musterte ihn neugierig aus dunklen Augen.
»Am letzten Tag des Jahres will ich noch mal auf die Pauke hauen, liebe Friederike. Ich bin bei einem Kollegen eingeladen und treffe dort einige Freunde«, erzählte er gut aufgelegt, weil die mütterliche Köchin gern an seinem Leben Anteil nahm. »Aber ich wollte Ihnen noch einen guten Rutsch und ein besseres neues Jahr wünschen. Und mich dafür bedanken, dass Sie uns immer so gut versorgen.« Er schüttelte den beiden die Hände.
»Herzlichen Dank, Herr Luis«, sagte Konrad und berichtete aufgeregt von den Neuigkeiten.
»Wie wundervoll, ich freue mich für Sie«, entgegnete Luis von Herzen. »Sobald Ihr Sohn zurück ist, schieße ich ein Foto von der wiedervereinten Familie, um diesen glücklichen Tag für alle Zeit festhalten.«
»Das würden Sie tun?«, fragte Konrad und sah Luis ungläubig an. »Ist so eine private Aufnahme nicht unter Ihrem Stand? Wo Sie doch sonst nur Filmstars vor der Linse haben.«
Luis hatte dem Ehepaar von seiner Komparsenzeit in Babelsberg, seiner späteren Anstellung als junger Fotograf bei der UFA und dem jetzigen Posten als Standfotograf bei der Bavaria Film erzählt. Sein letzter Auftrag waren Fotos für den ersten Nachkriegsfilm Zwischen gestern und morgen gewesen, der von April bis in den Sommer dieses Jahres gedreht worden war. Dass er so berühmte Schauspieler wie Winnie Markus, Viktor de Kowa oder Willy Birgel fotografieren durfte, hatte Konrad mächtig beeindruckt. Und über die zwei Karten für die Premiere Anfang Dezember 1947 war er schier aus dem Häuschen geraten.
»Es würde mir Freude machen, außerdem fotografiere ich gern schöne Frauen«, versicherte Luis und zwinkerte Friederike zu.
»Ach, gehen S’ weiter«, kicherte die Köchin geschmeichelt und huschte aus dem Raum.
»Ich spendiere auch einen hübschen Rahmen dazu, als nachträgliches Weihnachtsgeschenk«, wandte Luis sich an Konrad.
Friederike kam mit einer Papiertüte zurück, die sie Luis entgegenhielt. »Ein paar Plätzchen für Ihre Freunde. Kartoffelsalat wär auch noch da, aber den können S’ nicht in der Tüte rumtragen. Ihr Mantel tät gewaltig durchfetten …«
»Ach was, dem würde das nichts ausmachen«, lachte Luis und hoffte, dass die liebe Friederike ihm doch eine Portion einpackte, damit er zu seiner Silvesterzigarette kam.
»Wenn’s Ihnen nicht geniert, mit dem Henkelmann durch die Gegend zu spazieren, mach ich eine ordentliche Portion zurecht.«
»Friederike, Sie sind die Beste«, sagte Luis, umarmte die hagere Köchin und bedankte sich herzlich.
»Aber den Henkelmann dürfen S’ net verlieren«, mahnte sie, als sie ihm kurz darauf den einen Liter fassenden Blechkübel übergab. »Sonst kann ich meinem Konrad keine Suppe mehr mitgeben, wenn er den Chef durch die Nacht chauffiert.«
»Ich werde den Topf bis zum letzten Blutstropfen verteidigen und heil zurückbringen«, scherzte Luis, als er den wertvollen Behälter entgegennahm. Dann drückte er den Hut auf sein Haupt, zwinkerte der Köchin fröhlich zu und verließ die Villa durch den Lieferanteneingang.
Über den matschig gewordenen Gartenpfad gelangte er zu der kleinen Pforte, die sich zu einer Nebenstraße öffnete. Als er um die Ecke bog, sah er gerade noch, wie der Onkel in der schwarzen Mercedes-Benz-Limousine davonfuhr. Er ahnte, welches Ziel Wolf ansteuerte, denn nicht zum ersten Mal verließ er noch zu so später Stunde das Haus.
Schade, dass ich ihn verpasst habe, ärgerte sich Luis, denn der Onkel hätte ihn gewiss ein Stück mitgenommen. Vielleicht erwischte er eine Straßenbahn in der Ismaninger Straße, ansonsten müsste er laufen.
Entschlossen schritt er aus. Sein Ziel war der Max-Weber-Platz, etwa eine halbe Stunde Fußweg. Eigentlich keine große Sache, aus seiner Berliner Zeit war er weitere Strecken gewohnt, doch seit dem Wetterumschwung von Eiseskälte zu Frühlingswärme herrschte fieses Matschwetter, vereinzelt aber auch gefährliche Glätte. Seine durchgelaufenen Halbschuhe eigneten sich trotz der eingelegten Pappsohlen nicht für eine Wanderung über Eisschollen und durch Schneematsch.
Mit gesenktem Kopf und auf der Hut vor Regenpfützen in Schlaglöchern marschierte er durch die Nacht, vorbei an grauen Schneeresten auf Trümmerbergen und ehemaligen Prachtbauten, von denen oft nur noch Gerippe übrig waren. Ein trauriges Bild, Grau in Grau. Der noch vor vier Tagen hell strahlende Vollmond hatte sich hinter einer dicken Wolkendecke verzogen, und die Straßenbeleuchtung funktionierte nur sporadisch. Es fehlte an Glühlampen, wie unlängst berichtet worden war. Luis störte es nicht, so blieb ihm der quälende Anblick des zerstörten Münchens erspart. Ruinen und Trümmerberge waren nun mal keine Stimmungskanonen.
Zügig marschierte er die Ismaninger Straße entlang – von einer Trambahn keine Spur. Regelmäßiger Betrieb war auch an ganz normalen Werktagen Glückssache, weil nicht genügend Züge vorhanden waren. Gut möglich, dass an Silvester, noch weniger zum Einsatz kamen.
Die Strecke führte ihn Richtung Krankenhaus Rechts der Isar. Das Klinikum war während des Krieges heftig bombardiert und weitgehend zerstört worden, wurde aber bereits fleißig wiederaufgebaut. Allerorts versuchte man den Schuttbergen mit Schaufeln und oft sogar den bloßen Händen Herr zu werden, klopfte Mörtelreste von noch verwertbaren Steinen und war entschlossen, den Mut nicht zu verlieren. Weiterzumachen und trotz der allgegenwärtigen Verwüstung das verlorene Zuhause mit aller Kraft wiederaufzubauen. Luis konnte sich gut in die Menschen hineinversetzen, er wusste, wie es sich anfühlte, alles verloren zu haben.
Das gesuchte Gebäude am Max-Weber-Platz wirkte verfallen, an der Fassade prangten unzählige kleine Löcher, Erinnerungen an umherfliegende Granatsplitter, und die Treppe ins Untergeschoss war übersät mit Schutt. Die Wände schienen zu bröckeln. Auch gut, dachte Luis fatalistisch: Den Krieg habe ich als »unabkömmlich« gestellter Komparse und Fotograf der UFA überlebt, aber wenn diese Bruchbude heute Nacht zusammenfällt, sterbe ich zumindest bei einem flotten Tänzchen. Ein schöneres Ende konnte man sich doch kaum wünschen.
Er verdrängte den unerquicklichen Gedanken und freute sich auf seine Freunde, mit denen er ins neue Jahr tanzen würde.
Laute Musik, ein einsamer, etwas schrumpeliger Luftballon und eine halbe Luftschlange an einer Holztür zeigten an, wo bereits ausgelassen gefeiert wurde.
Ohne anzuklopfen, trat er ein und wurde von fröhlichem Gelächter und tanzenden Paaren in einer Rauchwolke empfangen. Das war ein Fest nach seinem Geschmack, eine Nacht, in der man alle Sorgen, die Ungewissheit der Zukunft und auch die Frage, wie lange man noch bei Onkel Wolf würde wohnen dürfen, einfach vergessen konnte. Wo solche Gelage stattfanden, war nicht von Belang. Mit den richtigen Leuten amüsierte man sich in einem dunklen, kargen Souterrain genauso gut wie in einem hell erleuchteten, prächtigen Ballsaal – vielleicht sogar noch besser, weil hier niemand Wert auf Etikette legte.
»Hallooo, da kommt er ja endlich, der dolle Luis. Wir dachten schon, du wärst zurück zur UFA nach Berlin gegangen«, begrüßte ihn eine dunkelhaarige Schönheit, deren Kurven von einem sehr engen lilafarbenen Taftkleid betont wurden.
»Servus, Lola«, begrüßte er sie. »Falls es dir entgangen ist, die UFA wurde vier Wochen vor Kriegsende von den Russen besetzt und ist Geschichte. Da läuft nichts mehr – jedenfalls vorerst. «
»Und falls es dir entgangen ist, ich heiße Ursula.« Beleidigt verzog sie den rot geschminkten Schmollmund, wobei sie ihm einen lasziven Blick zuwarf.
»Seit wann?«, gab er gespielt überrascht zurück.
»Schon immer, und das weißt du genau«, zischte sie verschnupft.
Luis vollführte eine seiner übertriebenen Verbeugungen, die längst zu seinem Markenzeichen geworden waren. »Tut mir unendlich leid, ich hätte geschworen, du bist die fesche Lola aus dem Blauen Engel.«
Ursula verpasste ihm einen freundschaftlichen Knuff in den Arm. »Das war Marlene Dietrich, du Hornochse.«
»Nun sei mal nicht so, Urselchen, in unserer Branche ändern die Leute doch andauernd ihre Namen«, beschwichtigte Luis sie und erinnerte sich an seine eigene Namensänderung. Seinen Geburtsnamen Ludwig Koch hatte er schon in der Volksschule gehasst, als die Mitschüler ihn mit einem saublöden Vers ärgerten: »Ilsebilse, keiner willse, kam der Koch, nahm sie doch.« In Berlin, während der Fotolehre bei Hermann Doll, einem Vetter seines Vaters, hatte sich die Namensänderung ohne große Mühe einfach so ergeben. Manche Kunden hielten ihn für Hermanns Sohn, sprachen ihn als »der junge Herr Doll« oder »Doll junior« an, und so wurde er zu Luis Doll – ganz ohne absichtliches Zutun.
Luis zog Hut und Mantel aus und warf beides über den Mantelberg auf einen Sessel, der als Garderobe diente. Dann hielt er Ursula die Tüte hin. »Magst ein Plätzchen? Selbst gebacken.«
Im Nu war er umringt von den Anwesenden, und die Tüte war schnell geleert. Einige der Gäste zählten zu seinen besten Freunden: die fesche Ursula, ein Techtelmechtel des letzten Sommers und eine hoch begabte, momentan arbeitslose Werbezeichnerin, die nun ihr Brot als Telefonistin in den Studios verdiente. Der rothaarige Fritz Feldmann mit den Sommersprossen, ein aufstrebender Schauspieler und Freund aus der gemeinsamen Komparsenzeit bei der UFA. Jochen, gelernter Schreiner und Kulissenbauer, ebenfalls in den Studios der Bavaria Film tätig. Die frisch verlobten Maskenbildner Erich und Elisabeth, die für ihre Hochzeit sparten und jedem, der mit amerikanischen Zigaretten bezahlen konnte, einen ordentlichen Haarschnitt verpassten. Und nicht zuletzt Kameramann Viktor Ebeling, dem er bei der UFA assistiert hatte und nun den Posten in der Bavaria verdankte. Dazu noch einige Schauspieler, die ihm nur vom Sehen bekannt waren.
Den Henkelmann stellte er auf dem langen, mit einem vergilbten Laken bedeckten Biergartentisch ab. Jeder hatte im Rahmen seiner mageren Möglichkeiten etwas mitgebracht: Wein, Sekt und Selters. Schüsseln mit Nudelsalat, einen Korb mit ziemlich trocken aussehenden Brotscheiben und einen Topf Linsensuppe. Gabeln und Löffel lagen daneben. Wer Hunger bekam, aß zwanglos aus Schüssel oder Topf. Er und seine Freunde legten wenig Wert auf gesellschaftlichen Firlefanz, für sie zählten Treue und Zuverlässigkeit mehr als geschliffene Manieren. Aber wenn es drauf ankam, wussten sie sich natürlich zu benehmen, inklusive Handkuss.
»Hast du in den nächsten Tagen ein paar Stunden Zeit?«, fragte Fritz, als sie sich eine Zigarette teilten.
»Na klar, brauchst du ein neues Foto für die Schauspielagentur?«
»So ähnlich. Ich möchte mit ein paar Freunden eine freie Theatergruppe gründen. Die Menschen sind so ausgehungert nach unzensierter Unterhaltung, mit leichten Stücken kriegt man jede Bude voll. Spielen könnten wir in Wirtshäusern, Kantinen oder auch Turnhallen, da ließe sich was verdienen.«
»Großartige Idee«, stimmte Luis seinem Freund zu. »Ich denke, wir könnten draußen in einem der unbenutzten Bavaria-Studios …«
»Na, ihr zwei Plaudertaschen«, mischte Ursel sich in die Unterhaltung ein. »Wann kommt denn nur der Gottbegnadete?«
»Psst …«, zischte Luis beschwörend. »Willy Birgel möchte nicht mehr so genannt werden. Es ist nicht seine Schuld, dass Josef Goebbels ihn zum Staatsschauspieler ernannt und auf diese unsägliche Gottbegnadeten-Liste gesetzt hat.« Auf dieser Liste hatten all jene Künstler gestanden, die für Goebbels’ Propagandafilme hatten herhalten müssen.
Amüsiertes Gemurmel wurde laut.
»Hinterher sind immer alle unschuldig.«
»Keiner hat von nix was gewusst.«
»Und jeder hat einem Juden geholfen oder ihn unterm Bett versteckt.«
»Kinder«, ertönte eine sonore Stimme von der Tür her. »Heute ist Silvester, da ist Politisieren streng verboten.«
Es war Willy Birgel in Begleitung von Viktor de Kowa und Winnie Markus.