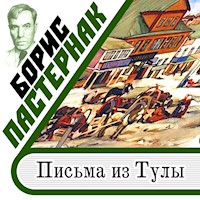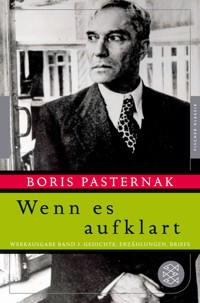
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der dritte und finale Band »Wenn es aufklart« der von Christine Fischer edierten Werkausgabe zeigt Boris Pasternak in seinen verzweifeltsten Stunden: Stalinismus, politische Verfolgung und der Tod seiner Seelenverwandten Ossip Mandelstam und Marina Zwetajewa führen zu Rückzug und Isolierung. Zu dieser Zeit verfasste er seine großen Übersetzungen von Shakespeare und Goethe und begann heimlich mit seinem Meisterwerk »Doktor Shiwago«. Die zahlreichen Gedichte und Briefe dieses Bandes fangen die Widersprüche ihrer Entstehungszeit, des »Jahrhunderts der Wölfe«, auf und zeigen, dass das ›Hauptwerk dieses genialen (…) Dichters nicht in seinem Roman besteht, sondern in den Gedichten.‹ (Emmanuel Lifschiz). Die ersten beiden Bände der Werkausgabe »Meine Schwester-das Leben« und »Zweite Geburt« sind ebenfalls bei FISCHER Klassik erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Boris Pasternak
Wenn es aufklart
Werkausgabe Band 3. Gedichte, Erzählungen, Briefe
Über dieses Buch
Der dritte und finale Band »Wenn es aufklart« der von Christine Fischer edierten Werkausgabe zeigt Boris Pasternak in seinen verzweifelsten Stunden: Stalinismus, politische Verfolgung und der Tod seiner Seelenverwandten Ossip Mandelstam und Marina Zwetajewa führen zu Rückzug und Isolierung. Zu dieser Zeit verfasste er seine großen Übersetzungen von Shakespeare und Goethe und begann heimlich mit seinem Meisterwerk »Doktor Shiwago«. Die zahlreichen Gedichte und Briefe dieses Bandes fangen die Widersprüche ihrer Entstehungszeit, des »Jahrhunderts der Wölfe«, auf und zeigen, dass das ›Hauptwerk dieses genialen (…) Dichters nicht in seinem Roman bestünde, sondern in den Gedichten.‹ (Emmanuel Lifschiz).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490291-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Gedichte
Die Gedichte des Juri Shiwago
Hamlet
März
In der Karwoche
Weiße Nacht
Wegelosigkeit im Frühling
Erklärung
Sommer in der Stadt
Der Wind
Hopfen
Spätsommer
Hochzeit
Herbst
Märchen
August
Winternacht
Trennung
Wiederbegegnung
Stern der Geburt
Tagesanbruch
Das Wunder
Die Erde
Schwere Tage
Magdalena 1
Magdalena 2
Der Garten Gethsemane
Wenn es aufklart
Am Ruhm kann ich [...]
Seele
Eva
Ohne Benennung
Veränderung
Frühling im Wald
Juli
In den Pilzen
Stille
Heuschober
Lindenallee
Wenn es aufklart
Brot
Herbstwald
Frühfrost
Nachtwind
Goldener Herbst
Regenwetter
Gras und Steine
Die Nacht
Der Wind
(Vier Skizzen über Block)
Der Weg
Im Krankenhaus
Musik
Nach der Pause
Erster Schnee
Wenn es schneit
Spuren im Schnee
Nach dem Schneesturm
Bacchanal
Hinter der Wegbiegung
Alles hat sich erfüllt
Nach dem Pflügen
Die Reise
Frauen in der Kindheit
Nach dem Gewitter
Winterfeste
Der Nobelpreis
Gottes Welt
Einzige Tage
Prosa
Chopin
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Menschen und Standorte. Autobiographische Skizze
Kindheit
Skrjabin
Neunzehnhundert
Vor dem Ersten Weltkrieg
Drei Schatten
Abschluss
Briefe [1]
Briefe nach Georgien
An Tizian und Nina Tabidse
An Paolo Jaschwili
An Besso Shgenti
An Tizian Tabidse
An Tizian Tabidse
An Tizian und Nina Tabidse
An P.M. Foljan
An Tizian und Nina Tabidse
An Tizian Tabidse
An Tizian Tabidse
An Tizian und Nina Tabidse
An Tizian und Nina Tabidse
An Tamara Georgiewna Jaschwili
An Nina Alexandrowna Tabidse
An G.N. und J.A. Leonidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Tanit Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Georgi Leonidse
An Nina Tabidse
An Tanit Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Simon Tschikowani
An Simon Tschikowani
An Simon Tschikowani
An Simon Tschikowani
An Nina Tabidse
An Simon und Marijka Tschikowani
An Simon Tschikowani
An Nina Tabidse
An Simon Tschikowani
An Georgi Leonidse
An Simon Tschikowani
An Nina und Lado Gudiaschwili
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Marijka Tschikowani
An Besso Shgenti
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Simon Tschikowani
An Nina Tabidse
31.12.1949
An Natalia Watschnadse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Raissa K. Mikadse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Georgi Leonidse
An Georgi und Jewfimia Leonidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Georgi Leonidse
An Nina Tabidse
An Simon und Marijka Tschikowani
An Fatma Antonowna Twaltwadse
An Simon und Marijka Tschikowani
An Fatma Antonowna Twaltwadse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Georgi Leonidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina und Lado Gudiaschwili
An Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Simon Tschikowani
An Nina Tabidse
An Simon Tschikowani
An Nina Tabidse
An G.W. Bebutow
An Nina Tabidse
An Konstantin Lordkipanidse
An Mark Slatkin
An Lado Gudiaschwili
An Tschukurtma Gudiaschwili
An Georgi Margwelaschwili
An Tanit und Nina Tabidse
An Nina Tabidse
An Nina, Lado und Tschukurtma Gudiaschwili
An Tschukurtma Gudiaschwili
Aus Pasternaks Briefwechsel mit Olga Freudenberg
Briefe [2]
Aus Pasternaks Briefwechsel mit Ariadna Efron
Aus Pasternaks Briefwechsel mit Renate Schweitzer
Boris Pasternak an Kurt Wolff
Emanuel Lifschitz: Abschied von Pasternak
Anhang
Anmerkungen
Die Gedichte des Juri Shiwago
Wenn es aufklart
Zur Prosa
Chopin (Šopen)
Menschen und Standorte (Ljudi i položenija)
Zu den Briefen:
Briefe nach Georgien
Aus Pasternaks Briefwechsel
Verwendete russische Ausgaben der Werke Boris Pasternaks
Quellen und Nachweise der Übersetzungen
Gedichte
Erzählungen
Briefe
Boris PasternakLeben und Werk 1945–1960:
Nachwort
Gedichte
Die Gedichte des Juri Shiwago
übersetzt von Christine Fischer
Hamlet
Lärm … dann Stille: Ich betrat die Szene.
Ich, gestützt vom Pfosten einer Tür,
Kann als fernen Widerhall vernehmen,
Was zu meiner Zeit geschieht mit mir.
Schon kann ich als nächtlich-dunkle Leere
Tausende von Operngläsern sehn.
Abba, Vater, wenn es möglich wäre –
Lass den Kelch an mir vorübergehn.
Alles liebe ich, was Du ersonnen;
Auch zu diesem Part war ich bereit,
Doch ein andres Drama hat begonnen:
Gerne wär ich dieses Mal befreit.
Fest steht längst die Handlung; ich muss fassen,
Dass mein Ende naht auf dieser Welt.
Pharisäer rings … ich bin verlassen …
Leben ist kein Weg durch freies Feld.
1946
März
Alles wärmt die Sonne fast zu kräftig;
Übermütig spielt die Schlucht verrückt.
Wie die dralle Viehmagd ist geschäftig
Auch der Frühling, dem jetzt alles glückt.
Nur der Schnee scheint blutleer zu durchziehen
Das Geäst der Adern, blau und wund,
Und nach Leben dampft es von den Kühen,
Jede Heugabel ist kerngesund.
Nächte!.. Welche Tage, welche Nächte!..
Mittags trommeln Tropfen froh vom Dach;
Nur dem letzten Eis geht’s immer schlechter,
Rastlos murmelt vor sich hin der Bach.
Offen steht der Stall für Vieh und Pferde,
Wenn im Schnee die Taube Hafer frisst:
Er, der neu belebt die ganze Erde,
Riecht nach herrlich frischer Luft – der Mist.
1946
In der Karwoche
Ringsum noch immer tiefe Nacht:
So früh ist dieser Morgen;
In grenzenloser Lichterpracht
Hält der gestirnte Himmel Wacht,
In Träumen ruht die Erde sacht
(Sie weiß nichts von der Osternacht),
Im Psalmenvers geborgen.
Ringsum noch immer tiefe Nacht:
So früh, dass Welten schweigen,
Solang die Ewigkeit bewacht
Den Platz, die Kreuzung, Dach um Dach;
Noch tausend Jahre – und die Macht
Des Lichtes wird sich zeigen.
Noch ist die Erde kahl und tot,
Lässt keine Glocken klingen;
Die ganze Nacht galt das Verbot,
Ein frohes Lied zu singen.
Am Donnerstag brach er das Brot …
Noch bis zum Samstagabend
Zerspringt die Flut in ihrer Not,
Am Ufer ruhlos grabend.
Die Wälder sind noch nackt und kahl,
Bezeugen Christi Leiden,
Wie Betende in großer Zahl
Stehn Kiefern in den Weiten.
Und in der Stadt, auf engem Raum
Versammeln sich Gesichter:
Stumm blickt durchs Fenster Baum um Baum
In helle Kerzenlichter.
Die Bäume stehen angstgequält,
Und groß ist ihre Klage,
Denn alle Zäune sind gefällt,
Es schwankt die Ordnung dieser Welt:
Heut trägt man Gott zu Grabe.
Sind schemenhaft dort drinnen nicht
Das dunkle Tuch, das Kerzenlicht,
Die Trauernden zu sehen?
Still treten aus der Tiefe vor,
Die um Erbarmen flehen,
So dass die Birken dicht am Tor
Beschämt zur Seite gehen.
Die Trauernden, im Leid vereint,
Ziehn um den Hof benommen;
Sie nehmen in die Gruft hinein
Die Freude und den Sonnenschein,
Den leichten Duft nach Brot und Wein
Und alle Frühlingswonnen.
Mit Schnee bewirft der März im Spiel
Die Kranken auf dem Hof gezielt,
Und jemand öffnet im Gewühl
Den Schrein, so segensreich gefüllt,
Um alles zu verschenken.
Am Morgen schweigt der Chor noch nicht;
In ihrer Trauer lenken
Die Schritte ins Laternenlicht
Vereint Apostel und Psalmist,
Um wortlos zu gedenken.
Was lebt, verstummt um Mitternacht,
Von Frühlingsduft umgeben;
So warte, warte, halte Wacht:
Bezwungen ist die Todesmacht,
Und neu ersteht das Leben.
1946
Weiße Nacht
Wie ein Traumbild erscheint mir Verlorenes:
Petersburg, unser Heim in der Ferne;
Du, im ärmlichen Landhaus Geborene,
Bist aus Kursk und magst Kurse so gerne.
Deine Anmut weckt männliche Liebesglut.
Weiße Nacht … Still betrachten wir beide,
Auf die Simse uns stützend im Übermut,
Aus dem Hochhaus die schimmernde Weite.
Falter, gasförmig, schwirren im Lichterschein,
Sanft berührt vom erbebenden Morgen.
Du allein bist in zärtlichen Flüsterein
Wie in schlafenden Fernen geborgen.
Du und ich sind in scheuer Beständigkeit
An ein teures Geheimnis gebunden;
Schau, St. Petersburg hat die Unendlichkeit
Der Newa ausgestaltet tief unten.
In der Nacht, der taghellen, lebendigen,
In den träumenden Reichen des Waldes
Ist das Nachtigalllied kaum zu bändigen:
Durch die ruhenden Ebenen schallt es.
In den Klängen verbirgt sich Verwegenes.
Zartes Vöglein mit magischer Stimme:
Du verzauberst bewaldete Gegenden,
Du verwirrst, du begeisterst die Sinne.
Und die Nacht, die barfüßige Wanderin,
Schleicht an Zäunen entlang bis zur Pforte;
Spuren ziehn sich an Simsen und Kanten hin,
Längst belauscht sind die innigsten Worte.
Das belauschte Gespräch findet Widerhall:
In den Gärten, von Mauern umgeben,
Kleiden Kirschen und Obstbäume überall
Sich in weiße und zarte Gewebe.
Bäume drängeln sich, schimmernden Geistern gleich,
Auf den Wegen mit ihren Gespielen.
Lange nehmen sie Abschied und gestenreich
Von der Nacht – sie ist Zeugin von vielem.
1953
Wegelosigkeit im Frühling
Das Licht verglomm am Himmelsbogen.
Durch Wälder, wegelos vom Schlamm,
War bis in den Ural gezogen
Auf seinem müden Pferd ein Mann.
Es gluckerte im Bauch des Pferdes,
Sein Hufschlag schmatzte mehr und mehr;
Das Wasser strömte aus der Erde
Und jagte gurgelnd hinterher.
Die Zügel in den Händen ruhten.
Der Mann ritt langsamer, im Schritt;
Ganz nah ergossen sich die Fluten,
Sie rissen donnernd alles mit.
Und manche weinten, manche lachten,
Als Stein um Stein zu Sand zerfiel,
Als Bäume in den Strudel krachten –
Mit Ästen, Wurzeln, Stumpf und Stiel.
Vom Abend blieben Ascheflocken.
In fernen Zweigen, schwarz und kahl,
Sang eindringlich, sonor wie Glocken,
Hingebungsvoll die Nachtigall.
Die Weide war vom Leid gezeichnet
Und neigte hin zur Schlucht ihr Haupt.
Der Vogel pfiff in sieben Eichen –
Ein Räuber, wenn man Märchen glaubt.
Entfachte Qual, entfachte Liebe
Das Feuer seiner Stimmgewalt?
Wen wollte er mit Schrot durchsieben
Im undurchdringlich tiefen Wald?
Als Baumgeist konnte ihn erahnen
Manch Sträfling, der entflohen war;
Er zeigte sich auch Partisanen,
Dem Fußvolk wie der Reiterschar.
Und Himmel, Erde, Wälder, Weiten
Erfüllte jener Klang allein:
Uns wurden zugeteilt vor Zeiten
Ekstase, Trauer, Glück und Pein.
1953
Erklärung
Unerwartet kam zurück das Leben,
Seltsam abgebrochen einst im Leid;
Wieder find ich mich auf alten Wegen,
Sommer ist es, um dieselbe Zeit.
Gleich sind noch die Menschen, gleich die Klagen,
Und der gleiche Abendschein brennt hell,
Von der Nacht des Todes angeschlagen
An die Wand, mit spitzen Nägeln, schnell.
Schlichte Kleider tragen noch die Frauen;
Ihre Schuhe trappeln in der Nacht,
Bis man heimlich sie vor Morgengrauen
Kreuzigt auf den Speichern unterm Dach.
Schon tritt auf die Schwelle, halb benommen,
Eine müde, wankende Gestalt;
Kaum aus ihrem Kellerloch gekommen,
Überquert sie langsam den Asphalt.
Wieder will ich lahme Worte äußern,
Wieder ist mir vieles ganz egal …
Unsre Nachbarin streicht um die Häuser,
Lässt uns dann alleine – noch einmal.
Nicht weinen, nicht den Mund verziehn
Und nicht die Lippen schürzen …
Der Frühling fährt darüber hin,
Der Schorf bricht auf, bestürzend …
Nimm deine Hand von meiner Brust,
Wir sind vom Strom getroffen,
Noch einmal führt uns zwei die Lust
Zusammen: Lass uns hoffen.
Auch du gehst bald die Ehe ein;
Was war, wirst du vergessen.
Welch Schritt ists, eine Frau zu sein,
Welch Tat, zutiefst zu fesseln!
Hals, Rücken, Schulterblatt und Hand
Sind Wunder; nur mit Wehmut
Bin sie zu ehren ich imstand
Für alle Zeit – in Demut.
Die Nacht will mich zu einem Ring
Aus reiner Trauer schmieden,
Mich, dem zuletzt die Flucht gelingt,
Der Streit ersehnt, nicht Frieden.
1947
Sommer in der Stadt
Leises Wort der Verständigung,
Von der Eile geboten:
Rasch die Haare noch bändigen
Zum gewundenen Knoten …
Heute wird auch das Kämmen schwer,
Denn behelmt ist das Köpfchen;
Ins Genick fliegen kreuz und quer
Strähnen, kunstvolle Zöpfchen.
Draußen kündet die glühende
Nacht vom schweren Gewitter,
Und Spaziergänger, fliehende,
Lenken heimwärts die Schritte.
Donner hallt durch die Ebenen,
Abgehackt, laut und schneidend;
Und im jäh sich erhebenden
Wind wehn Stores an den Scheiben.
Wenn die Töne verklungen sind
In der lastenden Schwüle,
Treiben Blitze verschlungene,
Wilde, wütende Spiele.
Wenn es tagt, schenkt das Sonnenlicht
Neue Schwüle den Wegen,
Bis das Wasser zerronnen ist,
Nachts gespendet vom Regen.
Manche blicken bekümmert drein,
Sind am Morgen todmüde …
Alte, duftende Lindenreihn
Stehn noch immer in Blüte.
1953
Der Wind
Ich bin gestorben, du noch nicht.
Der Wind will weinend alles biegen,
Will Haus und Wald aus Klage wiegen.
Nicht nur die Kiefern rührt sein Weinen,
Nein, alle Bäume, dicht an dicht;
Er wiegt die grenzenlosen Weiten,
Die Segelboote und die Gischt,
Die ganze Bucht von allen Seiten.
Aus Wagemut wiegt er sie nicht,
Und blinde Wut verspürt er keine;
Nein, Trauer atmet im Gedicht,
Im Wiegenlied für dich alleine.
1953
Hopfen
Diese Weide, im Efeu versteckt,
Kann im heftigen Regen uns nützen,
Wenn der Mantel die Schultern bedeckt
Und zugleich meine Arme dich schützen.
Ich hab unrecht: Kein Efeu ist das,
Sondern Hopfen im Dickicht der Weiden.
Komm, wir legen den Mantel ins Gras,
Um ein Lager für uns zu bereiten.
1953
Spätsommer
Das Johannisbeerblatt ist noch kräftig;
Lachen, Klirren erfüllt unser Heim:
Eingekocht, mariniert wird geschäftig;
Nelken würzen den Sud zart und fein.
Doch der Wald, dieser launische Spötter,
Wirft den Klang an den steinigen Hang,
Und versengt ist vom sonnigen Wetter,
Wie durch Feuer, der Nussstrauch schon lang.
Hin zum Moor fällt der Weg immer weiter;
Traurig stimmt mich der leblose Stamm –
Und der Herbst trägt zerschlissene Kleider,
Fegt die Blätter hinab in die Klamm.
Ich seh endlose kosmische Räume
(So viel schlichter, als mancher versteht),
Ich seh Wasser, sich spiegelnde Bäume –
Und erkenne, dass alles vergeht.
Sinnlos heben und senken sich Lider,
Kalte Asche hat alles durchsetzt.
Herbstlich schimmernder Ruß sinkt hernieder,
Spinnwebzart ist das Fenster benetzt.
Und der Fußpfad bricht ab an der Pforte,
Zwischen Birken verliert er sich bald …
Frohes Treiben und heitere Worte
Hallen wider in Wiesen und Wald.
1946
Hochzeit
Gäste strömten überlaut
Auf den Hof in Massen,
Zogen nachts ins Haus der Braut,
Sangen ausgelassen.
Durch die Tür, mit Filz besetzt,
Hörte man von drinnen
Gegen sieben Uhr zuletzt
Klänge, Worte, Stimmen.
Allzu schnell verging die Nacht!
Schlafen, schlafen ohne Pause!..
Das Akkordeon, hellwach,
Kam vom Fest nach Hause.
Alles gab der Musikant
Ausgezeichnet wieder:
Beifallsrufe, Schmuck und Glanz,
Tanz und Lärm und Lieder.
Wieder, wieder, krumm und schief,
Drang ins Ohr der Schlager,
Sprang zu jedem, der noch schlief,
Riss ihn hoch vom Lager.
Weiß wie Schnee erschien die Frau –
Tosendes Entzücken! –
Sie, erlesen wie ein Pfau,
Wiegte sich berückend.
Grüßend nickte die Gestalt,
Scheu die Rechte hebend,
Schwebte pfauengleich alsbald,
Schwebte fort ins Leben.
Da verlor das Spiel die Kraft,
Sank im Takt des Reigens,
Wie von Fluten hingerafft,
In das Land des Schweigens.
Denn der Hof erwachte schon –
Voll von unerhörtem,
Echogleichem Alltagston,
Der das Lachen störte.
Bis zum fernen Himmelssaum
Tanzten bunte Flecken:
Tauben flogen, leicht wie Flaum,
Aus den Taubenschlägen.
Rastlos hob die Vogelschar
Die noch müden Schwingen,
Ausgesandt zum Hochzeitspaar,
Um ihm Glück zu bringen.
Kurz ist unsres Lebens Lauf:
Wir, die bald zerfallen,
Lösen uns in andern auf,
Leben fort in allen.
Und die Hochzeit brach herein
Durch das Glas ins Zimmer,
Nur ein Schemen, nur ein Reim –
Und die Taube schimmert.
1953
Herbst
Zu Hause ist es still geworden,
Verstreut im Wind sind die Gefährten …
Nur Einsamkeit an allen Orten,
In meinem Herzen und auf Erden.
Mit dir leb ich in einer Kate.
Auf Wälder senkt sich Leere nieder.
Halb überwuchert sind die Pfade,
Du kennst sie ja, die alten Lieder.
Bedauernd blickt das Holz; von Rissen
Gezeichnet sind die Bretterwände:
Wir, die an Schranken scheitern müssen,
Gehn offen unsern Weg zu Ende.
Von eins bis drei ruhn wir am Morgen,
Dann lese ich, du stickst – zwei Wesen,
Im Kuss vereint; uns bleibt verborgen,
Wenn wir uns voneinander lösen.
Ihr Blätter, wirbelt, tanzt wie Flitter,
Verströmt euch wie ein Regenschauer!
Schon gestern war der Kelch sehr bitter,
Doch bitterer ist heut die Trauer.
Vertrautheit, Nähe, Anmut, Staunen!
Lass im Septemberwind uns fliegen!
Vergrab dich tief in seinem Raunen!
Nur sterben, nur dem Wahn erliegen!
Dein Kleid fällt nieder, meine Freude,
Wie dort im Hain das Laub der Bäume …
Du sinkst in meine Arme; Seide
Hüllt dich, mit Zierrat an den Säumen.
Du bist das Heil im Schritt zur Sünde,
Mag ich mein Leben auch verfluchen;
Die Schönheit, die auf Mut sich gründet,
Bewirkt, dass wir einander suchen.
1949
Märchen
Lang, sehr lang, vor Zeiten,
In der Märchenwelt,
Zog durch Steppenweiten
Und Gestrüpp ein Held,
Ritt, zur Schlacht gerufen,
Durch den Steppensand;
Wald in dunklen Stufen
Grenzte ab das Land.
Schmerz empfand der Reiter
Und verlor die Kraft:
Wasser sollst du meiden,
Zieh den Sattel straff.
Er flog ungezügelt,
Flog in vollem Lauf
Auf den Waldeshügel
(Niemand hielt ihn auf),
Änderte die Richtung
Erst am Hünengrab,
Streifte eine Lichtung,
Ritt den Berg hinab,
Kam in eine Senke,
Folgte Fährten nur,
Fand die kleine Tränke
Auf geheimer Spur.
Taub, wenn jemand riefe,
Blind vor Wagemut,
Stieg er in die Tiefe
Mit dem Pferd – zur Flut.
Dort war eine Grotte
Und davor ein Steg,
Schwefel an der Pforte
Brannte unentwegt.
Alles hatten Schwaden
Purpurrot verhüllt,
Doch von fernen Klagen
War der Wald erfüllt.
Und der Mann, erzitternd,
Stand am Felsenhang,
Lenkte dann die Schritte
Hin zu jenem Klang.
Rasch zur Lanze greifend
War er kampfbereit,
Sah den Drachen geifern,
Sah sein Schuppenkleid.
Feuerrote Zungen
Spuckten hellen Glanz;
Dreimal war geschlungen
Um die Frau der Schwanz.
Sie, bedrängt vom Drachen,
Fühlte arge Not,
Denn von seinem Rachen
Drohte ihr der Tod.
Damals wählten Leute
Oft ein Mädchen aus,
Für das Tier zur Beute,
Das im Walde haust.
Denn der schwache Haufen
Musste Land und Gut
Sich von ihm erkaufen
Durch vergossnes Blut.
Es umwand die Kehle
Und die Hand sofort,
Dass die Frau sich quäle
Endlos vor dem Mord.
Da erbat der Reiter
Sich vom Himmel Trost,
Nahm als tapfrer Streiter
Seinen Speer erbost …
Lider, die sich schließen,
Hoher Wolkenzug …
Fluten, Furten, Flüsse –
Wandel wie im Flug …
Und der Held – geschlagen,
Ohne Helm, zerstört …
Furchtlos trat den Drachen
Mit dem Huf das Pferd.
Pferd und Drache – beide
Liegen leblos da.
Held und Mädchen leiden,
Einer Ohnmacht nah.
Blau des wunderbaren
Mittags, sanft und lind …
Tochter eines Zaren?
Fürstin? Erdenkind?
Manchmal Glücksgefühle,
Und ein Sturzbach fließt,
Manchmal Traum der Stille,
Und das Herz vergisst.
Manchmal stark für Stunden,
Manchmal ohne Kraft,
Und aus tiefen Wunden
Strömt der Lebenssaft.
Ihre Herzen schlagen,
Beide, Frau und Mann,
Schlafen schon seit Tagen,
Träumen tief und lang.
Lider, die sich schließen,
Hoher Wolkenzug …
Fluten, Furten, Flüsse –
Wandel wie im Flug.
1953
August
Die Sonne hielt, was fest versprochen war:
Sehr früh beschien durch Stores ihr Schimmer
Als safrangelber Strahl – durchbrochen, zart –
Das Sofa und das ganze Zimmer.
Wie ockerfarbne Gluten leuchteten
Im nahen Wald die kleinen Orte,
Mein Bett, mein Kissen, das durchfeuchtet war,
Ein Teil der Wand, die Bücherborde.
Da fiel mir wieder ein, was heut geschah,
Weshalb aufs Bett die Tränen rannen:
Mir träumte, dass im Wald ich Leute sah,
Die alle von mir Abschied nahmen.
Ihr kamt am sechsten Achten massenhaft,
Und jemand nannte mit Verehrung,
Was uns der Glaube hinterlassen hat:
Der Tag hieß einst Christi Verklärung.
Dann strömt ein flammenloser Lichterschein
Zumeist vom Tabor-Berg hernieder;
Der ahnungsvolle Herbst tritt schlicht herein
Und zieht auf sich die starren Lider.
Ihr kamt durch ärmliches, erschauerndes
Gehölz in kargen Erlengründen,
Durch ingwerroten Forst, durch trauerndes
Gesträuch, gebrannt wie Festtagsprinten.
Den Bergeshöhn, den stillen Gegenden
Benachbart war der Himmel gerne;
Im Hähnekrähn lag etwas Schwebendes
Und auch im Widerhall der Ferne.
In dichten Wäldern, im Verborgenen,
Vermaß der Tod den Gottesacker,
Sah in mein Antlitz, das erstorbene,
Und hob mir aus mein letztes Lager.
Die Menschen hatten neue Lebenskraft
Allein aus einem Wort gewonnen;
Und meine Stimme klang prophetenhaft
Wie einst – sie war zurückgekommen.
Leb wohl, verklärende Unendlichkeit,
Die nichts als goldne Fülle spendet;
Durch zarte Hände sei gebenedeit
Die Bitternis an meinem Ende;
Lebt wohl, ihr Jahre voller Grausamkeit!
Und du, die aller Qual auf Erden
Entgegensetzt ihr tiefes Frauenleid:
Ich will für dich zum Schlachtfeld werden.
Leb wohl, weit ausgespanntes Flügelpaar,
Du Flugbahn, starrsinnig mitunter,
Du Welt, die mir im Wort gefügig war,
Du Kunst des Schaffens und der Wunder!
1953
Winternacht
Die Stürme wehten dicht an dicht
Durch alle Lande.
Die Kerze brannte auf dem Tisch,
Die Kerze brannte.
Im Sommer flog das Mückenheer
In helle Flammen,
Im Winter klebte nass und schwer
Der Schnee am Rahmen.
Und Kreise, Pfeile malten sich
Auf Glas und Kante.
Die Kerze brannte auf dem Tisch,
Die Kerze brannte.
Empor zur Decke drang ihr Schein,
Zwei Schatten bebten,
Die Glieder wie zum Kreuz vereint –
Ein Kreuz, zwei Leben.
Zwei Schuhe fielen wie von weit
Mit dumpfem Klopfen;
Und Wachs floss nieder auf das Kleid
Als Tränentropfen.
Die Welt entschwand durch Schnee und Gischt
Ins Unbekannte.
Die Kerze brannte auf dem Tisch,
Die Kerze brannte.
Auf einmal wollte Eiseshauch
Die Glut erreichen –
Da formten Flügel sich im Rauch
Zum Kreuzeszeichen.
Der Februar ergab sich nicht,
Zog durch die Lande.
Die Kerze brannte auf dem Tisch,
Die Kerze brannte.
1946
Trennung
Der Mann steht in der Tür – allein.
Fremd werden ihm die Zimmer.
Nach ihrer Flucht erscheint sein Heim
Verlassen, ja zertrümmert.
Welch Chaos herrscht in jedem Raum!
Doch er bemerkt durch Tränen
Das ganze Ausmaß jetzt noch kaum,
Im Schutze der Migräne.
Ein Rauschen hört er, seit es tagt.
Träumt er, ist er bei Sinnen?
Weshalb nur muss er ungefragt
Sich stets ans Meer erinnern?
Als ob am Fensterglas der Frost
Den Blick ins Licht verwehre,
Ist seine Trauer – ohne Trost,
Unendlich wie die Meere.
Sie war ihm teuer und verwandt
In allen Wesenszügen,
So nah, wie sich am Meeresstrand
Bei Flut die Wellen wiegen.
Nach Stürmen ist von Gischt und Schlick
Das Schilf noch lange trunken;
Genauso sind ihr Leib, ihr Blick
Ihm tief ins Herz gesunken.
In Terrorjahren, angsterfüllt,
In allerschwersten Stunden,
Schien sie von Wogen angespült
Und ihm allein verbunden.
Sie überwand unsagbar viel,
Bezwang Gefahrenstellen;
Getragen wurde sie ans Ziel,
Getrieben von den Wellen.
Nein, dieser Abschied, grade jetzt,
Ist freiwillig kaum möglich.
Sie beide sind zutiefst verletzt:
Ein solcher Schlag ist tödlich.
Des Mannes Blick erkennt nicht mehr,
Wo unten ist, wo oben …
Die Truhen sind durchwühlt und leer –
Und alles liegt am Boden.
Er müht sich, bis die Nacht beginnt,
Legt, nach und nach bewusster,
Was ihr gehört hat, in den Spind,
Die Stoffe, Schnitte, Muster.
Auf einmal spürt er einen Stich:
Die Nadel steckt im Linnen.
Er glaubt, er sehe ihr Gesicht –
Und seine Tränen rinnen.
1953
Wiederbegegnung
Der Schnee liegt auf den Wegen
Und deckt die Dächer zu.
Ich will nach draußen gehen –
Vor meiner Tür stehst du.
Allein, zu leicht gekleidet,
Vom Scheitel bis zum Fuß.
Du bist nervös und leidest,
Kaust Schnee im Überfluss.
Die Bäume an den Zäunen
Ziehn in die Dunkelheit.
Allein stehst du und träumend
Am Eck, wirst zugeschneit.
Das Kopftuch ist durchfeuchtet,
Der Ärmel nass und rau.
In deinen Haaren leuchtet
Der Schnee wie reiner Tau.
Und Strähnen, die sich lösen,
Umwehen dein Gesicht,
Dein Tuch, dein ganzes Wesen,
Den Mantel, herbstlich schlicht,
Die Wimpern, eisig schimmernd,
Den trauervollen Blick:
Dein Antlitz bleibt für immer
Geschnitzt aus einem Stück.
Das Eisen wird beim Schmieden
Mit Antimon benetzt;
So bist du eingeschnitten
Im Herzen – bis zuletzt.
Die Demut deiner Züge
Ist tief darin verwahrt.
Ich will der Welt mich fügen,
Die grausam ist und hart.
Zweimal so schön, so glänzend
Erstrahlt die Winternacht.
Auf unser beider Grenzen
Geb ich nicht länger Acht.
Wer sind wir, hier auf Erden,
Wenn über Zeit und Ort
Bald andre Menschen reden?
Wo sind dann wir? – Weit fort.
1949
Stern der Geburt
Der Winter war hart.
Der Steppenwind quälte
Das Kind in der Krippe mit eisiger Kälte,
Am Steilhang, am Kar.
Der Atem des Ochsen umwehte es zart;
Bald kam eine Sippe
Von Tieren zur Krippe,
Und Wärme verströmte die schnaubende Schar.
Das Hirtenvolk schüttelte eilig die Streu
Der Nacht aus den Pelzen
Und blickte vom Felsen
Hinaus in die Dunkelheit, furchtsam und scheu.
Tief waren der Acker, der Friedhof verschneit,
Mit Gräbern und Zäunen
Und Deichseln, die träumten –
Darüber die leuchtende Nacht, endlos weit.
Dort strahlte ein Stern, anfangs zaghaft und schlicht,
Kaum mehr als ein Flämmchen,
Ins Fenster der Menschen:
Die Richtung nach Bethlehem zeigte sein Licht,
Wie flackernde Garben, vom Himmel getrennt,
Von Gott nicht gehalten,
Wie Glut sich entfaltend,
Wenn irgendein Vorwerk, ein Scheunendach brennt.
Er glich einem lodernden Schober voll Klee
Und Stroh; er belebte
Das Weltall – es bebte
Aus Angst, der Komet bringe Kummer und Weh.
Sein wachsender Strahlenkranz leuchtete rot,
Ein Wunder verheißend;
So kamen die Weisen
Aus Morgenland, wie es das Feuer gebot,
Gefolgt von Kamelen mit wertvoller Last
Und winzigen Eselchen; eins nach dem andern
Trat langsam zum Steilhang und stolperte fast.
Als ferne Vision von ergreifender Macht
Erstanden die Zukunft mitsamt den Gedanken
Der Zeiten, die Sehnsucht, zum Ausdruck gebracht
In sämtlichen Kunstgalerien und Museen,
Die Streiche der Zauberer, Scherze der Feen,
Der Christbaum, die kindlichen Träume bei Nacht.
Die schimmernden Kerzen mit Ketten und Flitter,
Geheimnisvoll, strahlend, erhaben und bunt …
… Der Steppenwind wehte erbost und verbittert …
… Die Äpfel und Kugeln, vergoldet und rund …
Der Weiher, versteckt unter Erlengeäst,
War dennoch zum Teil ohne Mühe zu sehen
Durch knorrige Wipfel mit Nestern von Krähen.
So konnten die Hirten die Esel erspähen
Und auch die Kamele am Staudamm zuletzt.
»Beeilt euch! Bestimmt ist ein Wunder geschehen!«
Sie zogen die Gürtel der Felljacken fest.
Wie Blätter aus Glimmer erstrahlte die Spur
Erfrierender Füße am Stall der Geburt.
Da knurrten, als wären es glühende Scheite
Und flackernde Dochte im Leuchten der Weite,
Die Hunde, und Sternenlicht hüllte die Flur.
In frostiger Winternacht, schön wie ein Märchen,
Kam immerzu jemand (fast ohne Kontur,
Durch Berge von Schnee), der vom Wunder erfuhr.
Rasch schlichen die Hunde, ganz nah an den Pferchen,
Zum Schäfer; dies alles erschreckte sie nur.
Und Engel betraten die Wege der Gegend,
Im Menschenstrom gingen sie unsichtbar mit,
Bewegten sich körperlos, schemenhaft, schwebend –
Und doch hinterließ einen Abdruck ihr Schritt.
Schon drängten am Stein sich die Leute in Scharen.
Es tagte. Die Zedern erschienen so bleich.
»Wer seid ihr?«, begrüßte die Gäste Maria.
»Die Hirten. – Uns sandte das himmlische Reich,
Um euch zu verehren, euch beide zugleich.«
»Nicht alle auf einmal! Ihr müsst draußen warten!«
Der Morgen war grau, wie in Asche gehüllt.
Es konnten sich Treiber und Hirten nicht leiden,
Die Fußgänger stritten erregt mit den Reitern;
Bald schrien die Kamele, zum Wassertrog schreitend,
Bald bockten die Eselchen, störrisch und wild.
Es tagte. Das Morgenlicht fegte verspielt
Die Sterne wie Staubkörner einfach zur Seite.
Maria ließ nur die drei Sterndeuter heute
Zur Öffnung im Felsen … welch friedliches Bild:
Er schlief, in aus Eiche gezimmerter Krippe,
Er leuchtete, wie in ein Astloch der Mond;
Statt Schafpelzen war er die wärmende Lippe
Des Esels, die Nüstern des Ochsen gewohnt.
Sie standen im Schatten, von Nebel umwoben.
Sie flüsterten, fast ohne Sinn und Verstand.
Ein Sterndeuter fand sich zur Seite geschoben,
Behutsam, von einer nicht menschlichen Hand.
Er drehte sich um: Strahlend blickte von oben
Zur Jungfrau der Stern der Geburt – unverwandt.
1947
Tagesanbruch
Durch dich erhielt mein Leben Sinn.
Dann wurden wir vom Krieg getroffen,
Und viele Jahre gingen hin –
Auf Nachricht konnte ich nicht hoffen.
Sehr lange waren wir getrennt,
Als deine Stimme mich berührte;
Ich las spät nachts dein Testament,
Bis ich mich selber wieder spürte.
Könnt ich ein Teil der Menschen sein,
Mit ihnen jeden Tag begrüßen!
Dann würde alles Große klein,
Und alle lägen mir zu Füßen.
Die Treppenstufen nehme ich,
Als sähe erstmals ich die Straße;
Verwandelt hat im Winter sich
Die stille, ausgestorbne Gasse.
Licht, Wärme, eine Tasse Tee …
Schon hasten alle zu den Bahnen.
Die Stadt versinkt in Eis und Schnee,
Ist beinah nicht mehr zu erahnen.
Der Sturm hat bald um jedes Haus
Ein zartes weißes Netz gesponnen …
Das Frühstück fällt für viele aus:
Nur nicht zu spät zur Arbeit kommen!
Ich lebe wie in fremder Haut,
Durchleide all die fremden Nöte;
Ich selber bin der Schnee, der taut,
Der finstre Blick der Morgenröte.
Die Namenlosen um mich her,
Die Bäume, Kinder, Alten, Jungen
Besiegten mich (es war nicht schwer) –
Nur so hab ich den Sieg errungen.
1947
Das Wunder
Er machte sich auf von Bethanien her,
Der Weg nach Jerusalem wurde ihm schwer.
Der Dornbusch verdorrte am Hang in der Wüste,
Der Rauch auf den Dächern stand reglos (er schlief),
Das Schilfrohr erstarb an der glutheißen Küste,
Die Ruhe des Meeres, das tot ist, war tief.
In Bitternis – Salzwasser schmeckt nicht so bitter –
Zog er, nur von Wolken begleitet, dahin
Und legte in Herbergen abends sich nieder:
Die Stadt mit den Jüngern erwartete ihn.
Still dachte er über das Kommende nach,
Das Feld schien von Wermut und Traurigkeit trunken;
Er war ganz allein, in sich selber versunken,
Die schlafende, leblose Gegend lag brach.
Eng hatten sich Wärme und Wüste verbunden,
Die Eidechsen, Quellen, der rinnende Bach.
Am Wegesrand wurde ein Feigenbaum groß,
Doch wuchs keine Frucht in den grünenden Zweigen.
Er fragte: »Was kannst du mir nützen, du trägst keine Feigen,
Was hast du zu geben an Freude, an Trost?
Mich hungert und dürstet … es kümmert dich nicht,
Du bist wie Granit, wirst mich niemals beschenken,
Und jede Begegnung mit dir wird mich kränken,
So bleib ohne Frucht bis zum Weltengericht!«
Der Baum, schon verworfen, erbebte zuletzt,
Wie funkelnde Blitze an Leitungen beben –
Und hatte sich völlig zu Asche zersetzt.
Kein einziger freier Moment war gegeben
Den Wurzeln, dem Stamm und dem Laub im Geäst.
Was kann ein Naturgesetz hier noch bewegen?
Das Wunder ist Gott, der im Wunder erscheint.
Selbst uns, die verzweifelt an Abgründen leben,
Erreicht es; ganz unverhofft sucht es uns heim.
1947
Die Erde
Der Frühling stürzt in Haus und Heim,
Ganz Moskau fügt sich seinen Späßen;
Die Motte, einst im Schrank vergessen,
Hat Sommerhüte angefressen,
Und alle Pelze packt man ein,
Sobald auf hölzernen Balkonen
Ein bunter Blumentopf erscheint,
Bepflanzt mit winzig kleinen Sonnen;
Die Stube ist vom Duft benommen,
Der Speicher staubig und nicht rein.
Die Straße möchte sich vertragen
Mit all den Fenstern, noch beschlagen;
Der Fluss vereint an langen Tagen
Den Abend und die Weiße Nacht.
Und du erahnst in jenen Zeiten
Im Korridor den Klang der Weiten;
Manch zufällige Einzelheiten
Bespricht mit Tropfen der April.
Er kennt Geschichten, tausend Seiten,
Von allem, woran Menschen leiden;
Das starre Abendrot muss scheiden:
Es steht am Zaun und redet viel.
Welch Feuer und welch Schauder keimen
In freien wie in engen Räumen!
Verändert ist die Luft und frisch …
Welch zarte Zweige an den Bäumen,
Mit Weidenkätzchen, die in Träumen
Das Fenster und den Kreuzweg säumen,
Die Straße und den Arbeitstisch!
Das Land im Nebel weint – weswegen?
Der Humus atmet Bitterkeit.
Dies ist Bestimmung mir im Leben:
Von Sehnsucht werde frei die Gegend
Jenseits der Städte, weit und eben;
Die Erde finde Trost im Leid.
In hellen, lauen Frühlingsnächten
Versammeln sich die Freunde bald:
Wir feiern Abschied und Gedächtnis,
Und jedes Fest ist uns Vermächtnis …
Wenn doch die Leiden Wärme brächten
In unser Leben, arm und kalt!
1947
Schwere Tage
Ihm blieb keine Woche zum Leben,
Als er nach Jerusalem ging;
Sie liefen ihm jubelnd entgegen,
Mit Palmzweigen grüßten sie ihn.
Doch wurde die Ablehnung stärker,
Verschmäht war sein Liebesgebot;
Er las in den Mienen nur Ärger
Und ahnte das Ende, den Tod.
Schon schlichen, um ihn zu belangen,
Voll List Pharisäer herbei.
Das Himmelszelt, schwer und verhangen,
Lag über den Höfen wie Blei.
Da lieferten finstere Mächte
Des Tempels ihn aus an den Mob;
So inbrünstig war er geächtet,
Wie früher verehrt und gelobt.
Dicht neben dem Tor stand die Menge
Und folgte dem Schlussakt verzückt;
Das wogende, wilde Gedränge
Ergoss sich bald vor, bald zurück.
Er hörte geflüsterte Worte,
Es standen Gerüchte im Raum;
Die Flucht nach Ägypten, die Orte
Der Kindheit … war alles ein Traum?
Die hohen, erhabenen Wände,
Die Wüste, der Abhang, die Schlucht:
Dort hatte mit Allmacht zu blenden
Ihn Satan vergeblich versucht.
Die Hochzeit, in Kana gefeiert,
War längst durch sein Wunder bekannt;
Und Wasser, von Nebeln verschleiert,
Durchschritt er wie trockenes Land.
Die Armen, in Hütten verborgen,
Der Weg in die Tiefe hinab;
Das Kerzenlicht, jäh hingestorben –
Als Er auferstand aus dem Grab.
1949
Magdalena 1
Die Nacht beginnt, mein Dämon wacht –
Nun muss ich für Vergangnes zahlen.
Vergangenes von großer Macht
Bereitet mir im Herzen Qualen.
Den Männern hab ich Lust gebracht,
Ich war zu Willen ihnen allen,
Auf Straßen schlief ich Nacht für Nacht.
Noch kurze Zeit, dann ist es still,
Denn Dich wird man zu Grabe tragen;
Sie kommen bald … es ist erfüllt …
Mein Leben bricht, ich werd nicht klagen,
Es gleicht dem Kelch, der überquillt –
Ich selber will’s vor Dir zerschlagen.
Sehr tief gesunken wär ich heut,
Du mein Erlöser, Du mein Lehrer,
Doch sah in meiner Dunkelheit
Ich Deine heilge Ewigkeit,
Sie lag in meinem Netz bereit,
Als wär sie einer der Verführer.
Erklär mir, was mag Sünde sein?
Was Hölle, Tod und Schwefelschauer?
Wir sind vor aller Welt vereint,
Wie mit dem Baum verwächst der Keim,
Verknüpft uns grenzenlose Trauer.
Geliebter Jesus, ja, ich muss
Dir einmal noch die Füße waschen,
Dem Kreuzesbalken gilt mein Gruß,
Ich stürze hin, halb unbewusst,
Zu deinem Leib, um erst am Schluss,
Um erst am Grab Dich zu verlassen.
1949
Magdalena 2
Schon zum Fest gerüstet sind die Leute,
Ich bin ausgeschlossen, bin allein,
Deine reinen Füße salb ich heute
Nur mit Myrrhe und mit Spezerein.
Nirgends finde ich für Dich Sandalen,
Und vom Weinen seh ich nicht mehr klar.
Schleiergleich ist vors Gesicht gefallen
Mir das lange, aufgelöste Haar.
Jesus, ich umfange Deine Füße
Und benetze sie mit meinem Leid;
Fühlst Du nicht die heißen Perlen fließen?
Sei umhüllt von meinem Haar und Kleid.
In die Zukunft sehen darf ich heute,
Die Du für mich anzuhalten weißt;
Prophezeien kann ich, kann verstehen,
Bin erfüllt von der Sybille Geist.
Morgen werden alle es erleben,
Wie der Vorhang reißt, des Tempels Zier,
Wie die Erde anfängt zu erbeben,
Weil sie Mitleid fühlen wird mit mir.
Nur Soldaten werden Dich begleiten,
Schon hat sich formiert das Reiterkorps.
Wie ein Windstoß in die Himmelsweiten
Ragt hoch über uns das Kreuz empor.
Nieder falle ich an seinem Ende,
Hilflos, wundgebissen schweigt mein Mund.
Ausgebreitet hast Du Deine Hände
Aller Welt in Deiner Todesstund.
Wer auf Erden könnte Deiner Größe,
Könnte Deines Opfers würdig sein?
Willst Du jedes Menschenkind erlösen,
Alle Dörfer, jeden Fluss und Hain?
Doch drei Tage müssen erst vergehen,
Ohne Sinn und voller Ungemach,
Daran wachsend werde ich verstehen,
Deine Auferstehung kommt – danach.
1949
Der Garten Gethsemane
Die Sterne leuchteten voll Gleichmut, schweigend,
Und eines Pfades Biegung traf ihr Strahl;
Der Weg verlief am Ölberg steil und steigend,
Tief unten floss der Kidronbach zu Tal.
Ein leerer Abgrund unterbrach die Wiesen.
Das Sternenband erhob sich aus der Kluft,
Und alte, silbergraue Ölbaumriesen
Versuchten ihm zu folgen durch die Luft.
Dahinter etwas Erde und ein Garten.
Er bat die Schüler draußen vor dem Tor:
»Bleibt hier, um einen Augenblick zu warten,
Mein Herz ist so verzagt wie nie zuvor.«
Er war bereit, in Demut hinzugeben,
Als wärens Dinge, die geliehen sind,
Allmacht und Wundertaten, selbst das Leben,
Um so zu sein wie wir: ein Erdenkind.
Die dunkle Weite kannte keinen Morgen,
Nur Tod, Vernichtung und Vergangenheit …
Der karge Garten hielt ihn noch geborgen
Im Angesicht der Nacht für kurze Zeit.
Schon sah er sich vor jener Tiefe stehen,
Die niemals endet, weil sie nie begann …
»Lass diesen Kelch an mir vorübergehen«,
Rief er in Todesnot den Vater an.
Gestärkt durch sein Gebet, doch sterbensmüde,
Verließ er bald darauf den stillen Hain.
Er fand die Schüler vor dem Gitter liegend,
In tiefem Schlummer auf dem Wiesenrain.
Er sprach: »Mein Vater hat euch aufgetragen
In meiner Zeit zu leben, doch ihr schlaft.
Des Menschensohnes Stunde hat geschlagen,
Von Mörderhand wird er dahingerafft.«
Er sprach es aus, da nahte schon die Meute
Mit Schwertern und mit Fackeln, schwarz von Ruß,
Ganz vorne hatte Judas leichte Beute,
Verübte den Verrat mit falschem Kuss.
Nur Petrus wollte sich noch widersetzen,
Traf ein Soldatenohr mit seinem Schwert.
Er hörte: »Groll erlaubt nicht zu verletzen,
Leg deine Waffe weg, wie ich gelehrt.
Glaubst du denn nicht? Es stünden Legionen
Von Engeln meinem Vater zu Gebot.
Die ärgsten Feinde würden mich verschonen
Und sich zerstreun, von Seiner Macht bedroht.
Doch öffnet sich im Lebensbuch die Seite,
Die heilig ist und gültig immerdar.
Was Gottes Wille ist, erfüllt sich heute,
Ja, es geschehe, Amen, es sei wahr …
Du siehst Epochen gleichnishaft sich wenden,
Die manchmal leuchten wie ein helles Band;
Um ihretwillen werd am Kreuz ich enden,
Hinuntersteigen bis ins Totenland
Und wieder auferstehen aus dem Grabe:
Aus tiefer Nacht, wie Hölzer auf dem Fluss,
Erscheinen mir am Ende aller Tage
Die Menschenalter, die ich richten muss.«
1949
Wenn es aufklart
übersetzt von Christine Fischer
Un livre est un grand cimitière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.
Marcel Proust
In allem will ich, wenn ich kann,
Zum Tiefsten dringen,
In Mühsal, auf der Lebensbahn,
In Herzensdingen,
Das Wesen der Vergangenheit
Will ich verstehen,
Will Anfang, Wurzelwerk der Zeit
Und Herzstück sehen,
Will immer das Geflecht am Grund
Des Lebens greifen …
Sein, denken, fühlen, lieben – und:
Gestalten, reifen.
Ja, hätte ich dazu die Kraft
(Nicht oft – zuweilen),
Ich schriebe von der Leidenschaft
Acht ganze Zeilen,
Von Anarchie und Sündenfall,
In Hetzjagd endend,
Von Überraschungen, von Qual,
Ellbogen, Händen.
Ich stellte Ursprung und Gesetz
Genau zusammen,
Ich wiederholte bis zuletzt
All ihre Namen.
Die Dichtung wäre wie ein Hain:
Mit feinsten Adern
Erblühten dort die Lindenreihn
Hintereinander.
Den Vers durchzögen Rosenduft
Und Minzeblätter,
Schilf, frisches Heu und Wiesenluft,
Gewalt der Wetter.
So war Chopin einst auserwählt,
Dem Puls des Lebens
Von Vorwerk, Gräbern, Park und Feld
Gestalt zu geben.
Doch im Triumph hab ich erkannt
Das Spiel aus Schmerzen,
Den Bogen, allzu sehr gespannt,
Kurz vor dem Bersten.
1956
Am Ruhm kann ich nichts Schönes finden,
Weil er uns Menschen nicht erhebt.
Und niemand soll Archive gründen,
Der nur für Manuskripte lebt.
Denn Kunst entsteht aus Selbsthingabe,
Braucht weder Beifall noch Erfolg.
Ich, der ich kaum Bedeutung habe,
Bin allen Vorbild – ungewollt.
Und leben sollten wir bescheiden,
So leben, dass wir einst am Schluss
Die Liebe fühlen aus den Weiten,
Wenn uns erreicht der Zukunft Gruß.
Für immer werden Lücken bleiben,
Im Schicksal, nicht auf dem Papier:
Das Buch des Lebens muss ich schreiben
Auf Feldern – klar und detailliert.
Danach will ich Vergessen trinken;
Mit jedem Schritt fall ich zurück,
Wie Dörfer in den Nebel sinken,
Den nie durchdringt des Menschen Blick.
Doch deinen Weg geht jemand weiter,
Etappenweise, bis ans End;
Es seien niemals Sieg und Scheitern
Durch deinen Urteilsspruch getrennt.
Dein Inneres sei unverdorben,
Unangetastet dein Gesicht:
Nur leben, leben heut und morgen,
Nur leben bis zuletzt – mehr nicht.
1956
Seele
Du meine Seele, Weinende
Um alle ringsumher,
Im Grabe jene Einende,
Die litten allzu schwer.
Du, zärtlich Balsamierende,
Weihst Leichen dein Gedicht;
Den Lyraleib Berührende –
Dein Klagen endet nicht.
Die Hast der Welt Erfahrende,
Für Furcht und Redlichkeit
Stehst du, als Grab Bewahrende
Den Staub für alle Zeit.
Aus Mitgefühl dich Quälende,
Wie beugte dich die Not!
Von Asche nur Erzählende –
Dich brandmarkte der Tod.
Du meine Seele, Klagende,
Zu viel hab ich gesehn …
Du mahlst es, still Ertragende,
Zu schwerem dunklem Lehm.
So mahle, du Begleiterin,
Was ich erlitten hab,
Nach vierzig Jahren weiterhin
Zu Staub im Friedhofsgrab.
1956
Eva
Am Wasser stehn die Bäume dicht;
Der Mittag schleudert Wolkenfetzen
Vom steilen Abhang in die Gischt:
Sie gleichen großen Fischernetzen.
Das Himmelszelt ist ganz durchtränkt,
So dass in sein Geflecht geraten
Mann, Frau und Kinder … wie versenkt
Sind alle Menschen, die dort baden.
Fünf, sechs der Frauen gehn ans Land,
Wo schlanke Weidenruten wachsen,
Und trocknen auf dem warmen Sand
Die triefend nassen Badesachen.
Wie Nattern winden sich so oft
Der goldne Ring, die runde Spange,
Als läg verführerisch im Stoff
Versteckt die teuflisch-falsche Schlange.
Geliebte Eva, keinesfalls
Macht mich dein Angesicht verlegen,
Doch allzu sehr verkrampft mein Hals,
Wenn mich Empfindungen bewegen.
Dein Wesen scheint mir erst skizziert
Und einem andern Buch entnommen;
Du bist, wie ich im Traum gespürt,
Aus meiner Rippe einst gekommen.
Doch du entziehst dich meiner Hand
Und willst Umarmungen vermeiden,
Du bist Verworrenheit und Angst,
Du bringst den Männern nichts als Leiden.
1956
Ohne Benennung
Unantastbar, unhörbar, allein,
Bist du dennoch ganz Feuer, ganz Funkeln.
Lass es zu – und ich schließe dich ein
Im Palast des Gedichts, tief im Dunkeln.
Schau, verwandelt sind, fast wie im Traum,
Durch die Glut aus des Lampenschirms Falten
Unsre Hütte, das Fenster, der Raum,
Unsre Schatten und unsre Gestalten.
Auf dem Sofa ruhst du, allzu schlicht
Und ein wenig zusammengekauert,
Gleichst dem Kind, das bei Nacht wie im Licht
Flüchtig zustimmt und flüchtig bedauert.
Deine Hand spielt mit Fäden verträumt
Und fügt Perlen zu schimmernden Bändern.
Doch dein Auge ist trauerumsäumt,
Karg die Sprache; es wird sich nicht ändern.
Dir scheint »Liebe« ein sinnleeres Wort –
Ich will neu ihren Namen bestimmen,
Ich verwandle die Welt fort und fort,
Will für dich neue Wörter ersinnen.
Offenbart mir dein Anblick das Erz
In den schimmernden Adern: die Seele,
Und die leuchtende Scheibe: das Herz?
Warum müssen die Augen sich quälen?
1956
Veränderung
Zu armen Menschen zog es mich,
Nicht um mich sittlich zu erheben,
Nein, tief im Herzen spürte ich,
Nur dort geschieht das wahre Leben.
Mit Herren war ich zwar bekannt,
Ihr Publikum empfahl mich wärmstens;
Doch weil ich Kriecher eklig fand,
War ich der Freund der Allerärmsten.
Ich wünschte Freundschaft mir so sehr
Mit Menschen, die nur Arbeit kennen;
Ja, dafür wurde ich verehrt:
Ich selbst gehörte fast zu jenen.
Und greifbar, Phrasen längst entwöhnt,
Stand die Beschaffenheit mir offen
Von Kellern, schlicht und ungeschönt,
Von Speichern, nicht verhängt von Stoffen.
Doch mich veränderte die Zeit,
Sobald die Sünde sie berührte,
Sobald als Schande galt das Leid,
Sobald man Bürger nur verführte.
Von Freunden, mir vertraut zuvor,
Bin ich schon lange abgefallen,
Ich, der den Menschen einst verlor,
Als er abhanden kam uns allen.
1956
Frühling im Wald
Das Wasser hemmt der strenge Frost
Von Tag zu Tag verzweifelter.
Der Frühling, später zwar als sonst,
Ist dafür umso eifriger.
Am Morgen kräht der Hahn verzückt:
Sein Hühnervolk entkommt ihm nicht;
Die Kiefer, die nach Süden blickt,
Schützt blinzelnd sich vorm Sonnenlicht.
Es brodelt, dampft im Überschwang –
Noch warten die verlorenen,
Erstarrten Wege wochenlang,
Die schwärzlich braun gefroren sind.
Und Abfall, Reisig liegt im Wald,
Wie letzter Schnee vermuten lässt.
Schon werden Pfützen größer, bald
Vom Licht, bald von der Flut durchnässt.
Der Himmel liegt im Wolkenflaum;
Fängt der Morast zu fließen an,
Verharrt das Blau sehr still im Baum:
Die Wärme fördert Müßiggang.
1956
Juli
Im Haus geht ein Gespenst spazieren,
Gleich über uns, tagein, tagaus.
Am Dachstuhl kann man Schatten spüren:
Es streift ein Geist durch unser Haus.
Er redet taktlos, unvermittelt,
Sich einzumischen ist sein Ziel,
Er schleicht zum Bett, trägt schlichte Kittel,
Er reißt das Tischtuch ab im Spiel,
Vergisst, die Füße abzustreifen,
Betritt die Wohnung wie der Wind,
Er fliegt, im Tanz den Vorhang greifend,
Zur Zimmerdecke hoch geschwind.
Wer ist der wilde Schelm dort oben,
Ein Doppelgänger, nein, ein Geist?
Ins Landhaus ist er eingezogen,
Nur für den Sommer zugereist.
Sein Urlaub wird nicht lange dauern;
So leihen wir ihm unser Heim.
Mit Juliluft und Julischauern
Wird er der neue Mieter sein.
Dem Juli haftet an den Hemden
Stets Löwenzahn- und Klettenflaum,
Der Juli kommt nach Haus durchs Fenster,
Und seine Stimme füllt den Raum.
Er ist ein Steppenkind, zerschlissen,
Verbreitet Dill- und Lindenduft,
Und an Kartoffelkraut, an Wiesen
Erinnert uns die Juliluft.
1956
In den Pilzen
Ja, Pilze sammeln wir
An Straßen, Bäumen, Gräben,
An Pfählen, die sich hier
Bald links, bald rechts erheben.
Der Weg wird schmal und rau,
Er führt in dunkle Wälder;
Im knöcheltiefen Tau
Sucht jeder für sich selber.
Das Licht will immer mehr
Auf bittre Reizker fallen,
Erhellt vom Waldrand her
Die Finsternis mit Strahlen.
Am Baumstumpf wächst ein Pilz,
Ein Vogel lässt sich nieder.
Das eigne Schattenbild
Zeigt uns die Richtung wieder.
Doch den Septembertag
Wird bald die Nacht bezwingen;
Der Abendschein, noch zag,
Kann kaum ins Dickicht dringen.
Gefäße bersten fast;
In Körben, die sich biegen,
Liegt unsre reife Last:
Steinpilze überwiegen.
Wir treten aus dem Wald:
Schon gleicht er starren Wänden;
Ein Tag, der hell erstrahlt,
Muss unerwartet enden.
1956
Stille
Der Wald – in Sonnenlicht getaucht,
Die Strahlen – staubkornzarte Säulen;
Der Elch tritt häufig, wie man glaubt,
Hervor, wo sich die Wege teilen.
Im Wald herrscht Stille, niemand spricht;
Es scheint, im Hohlweg sei das Leben
Verzaubert nicht vom Sonnenlicht:
Nein, andre Gründe muss es geben.
Nicht weit entfernt von hier verharrt
Alsbald die Elchkuh zwischen Bäumen;
Sie wirken reglos und erstarrt.
So liegt der Wald in stillen Träumen.
Wie gern die Elchkuh Keime frisst!
Schon nagt sie knirschend an den Trieben.
Verspielt streift ihren Widerrist
Die Eichel, sich am Zweige wiegend.
Antonius-, Johanniskraut,
Gras, Wachtelweizen und Kamille:
Gebannt steht jeder Halm und schaut
Aus den Gehölzen … tiefe Stille.
Im ganzen Wald tönt nur der Bach.
Die reine Quelle, kaum zu sehen,
Verkündet uns bald klar, bald schwach
Noch nie vernommenes Geschehen.
Mit Klang erfüllt der Bach die Schlucht,
Den Wald, den Holzschlag allerorten:
Er will erzählen und versucht
Zu sprechen wie mit Menschenworten.
1957
Heuschober
Libellen funkeln hell seit Tagen,
Und Hummeln summen weit und breit.
Froh lachen Mädchen von den Wagen,
Die Schnitter eilen: Erntezeit.
Sie müssen gutes Wetter haben,
Um Heu zu wenden und zu mähn,
Bis viele Schober gegen Abend,
Wie kleine Häuser, endlich stehn.
Sobald es dunkelt, wird ein Ballen
Zum Zufluchtsort dem müden Gast;
Ich seh die Nacht ins Kleefeld fallen,
Gebettet auf gemähtes Gras.
Die Schober bieten bis zum Morgen
Dem Mond, dem Wanderer, ein Dach.
Nachts fühlt er sich im Heu geborgen –
Darin vergraben wird er wach.
Schon tagt es: All die Wagen fahren
Durch grüne Weiten, dicht an dicht;
Zerzaust, mit Halmen in den Haaren,
Erhebt vom Lager sich das Licht.
Erneut ziehn bis zum Himmelsbogen
Die Schober wie ein Wolkenband;
Die Erde ist von Duft durchzogen
Nach Aniswodka, frisch gebrannt.
1957
Lindenallee
Halbrunde Tore – und dahinter
Nur Hügel, Wiesen, Wald und Feld,
Ein Park, gezeichnet noch vom Winter,
Ein Haus, wie nicht von dieser Welt.
Dort wachsen hohe Lindenkronen,
Die in den dunkelnden Alleen
Schon seit zweihundert Jahren wohnen
Und ganz verschämt ihr Fest begehn.
Welch weiter Raum, den sie umschließen:
Der Blumengarten ist noch kahl,
Und Pfade führen über Wiesen,
Die schnurgerade sind und schmal.
Wie Keller wölben sich die Linden;
Im Sand erscheint kein heller Fleck.
Nur schwer lässt sich der Ausgang finden:
Von fern fällt Licht auf unsern Weg.
Doch bald erblüht der stille Garten,
Die Linden, eingefasst vom Zaun,
Verströmen Duft aus ihren Schatten,
Unsagbar köstlich, weit im Raum.
Passanten tragen Sommerhüte
Und seufzen im Vorübergehn;
Den reinen Duft der Lindenblüte
Kann nur die Bienenschar verstehn.
Zuweilen mag er sich verdichten,
Wenn er zum Grund des Herzens dringt,
Gleich einem Buch, reich an Geschichten,
Dem Park und Beet der Einband sind.
Von schwer beladnen Bäumen hängen
Die Dolden bis zur Häuserwand;
Wie Wachs verbrennen Blütentränen,
Vom Regen immer neu entflammt.
1957
Wenn es aufklart
Der große See gleicht einer Schale,
Dahinter – Wolken, dicht gedrängt,
Und weißes Eis beschwert sie alle:
Die Gletscher lasten schwer und streng.
Sobald die Helligkeit sich ändert,
Verwandelt sich im Wald das Licht,
Das ihn entflammt und schwarz umrändert;
Der Ruß aus Schatten nimmt die Sicht.
Die Regentage gehn zur Neige,
Wenn durchs Gewölk der Himmel blickt:
Wie festlich kann sein Blau sich zeigen,
Wie ist das feuchte Gras beglückt!
Die Weite glänzt, es schweigt das Wetter,
Die Erde ist von Licht durchstrahlt;
Es flutet durch die grünen Blätter:
Ein Bildnis, wie auf Glas gemalt.
So blicken auch von Kirchenfenstern
Zur klaren Ewigkeit empor,
Nach langer Nacht, in Strahlenkränzen
Mönch, Heiliger und Zar im Chor.
Und wie ein Gotteshaus von innen
Erscheint die Welt; ins Fenster klingt
Ein leises Echo ferner Stimmen,
Das an mein Ohr zuweilen dringt.
Natur, Welt, Kosmos, du geheimer,
Den langen Gottesdienst für dich –
In tiefer Ehrfurcht bebend, weinend
Vor reinem Glück – bestehe ich.
1956
Brot
Du sammelst beinah fünfzig Jahre
Nur Schlüsse – und schreibst sie nicht auf.
Doch bist du im Herzen kein Sklave,
Gewinnst du Erkenntnis zuhauf.
Die Arbeit erkennst du als Segen,
Führst Ruhm auf Gebote zurück.
Ein Fluch ist dir müßiges Leben,
Entsagung erkennst du als Glück.
Noch unverehrt, unentdeckt träumen
(Kein Ritter, kein Held halten Wacht),
Die Reiche der Gräser und Bäume,
Das Tierreich, die heimliche Macht.
Es bleibt, was sich einst offenbarte,
Verbunden mit Leben und Tod:
Von Urahnen sorgsam bewahrtes,
Vor Zeiten gewachsenes Brot.
So rufen uns Roggen und Weizen
Zur Ernte – doch dies nicht allein:
Ein Vorfahr beschrieb über Seiten
Dein eigenes Leben als Keim.
Jetzt kannst du sein Wort dir erklären,
Das niemals Gehörtes enthält –
Den ewigen Kreislauf auf Erden,
Wie alles entsteht und verfällt.
1956
Herbstwald
Der Herbstwald ruht für eine Weile …
Im stillen Schatten schläft das Laub.
Ob Eichhörnchen, ob Specht, ob Eule –
Sie wecken seinen Schlaf nicht auf.
Die Wege herbstlich. Sie durchstreifend
Kommt abends erst die Sonne her,
Lässt aufmerksam die Blicke schweifen,
Denn jede Falle schreckt sie sehr.
Im Wald sind Schluchten, Espen, Hügel,
Und Erlenholz, von Moos bedeckt,
Doch hinterm Sumpfland lebt Geflügel:
Ein Hahn im Dorf kräht aufgeweckt.
Er kräht zuerst aus voller Kehle,
Dann schweigt er wieder still für lang,
Als ob ihn ein Gedanke quäle:
Welch einen Sinn hat sein Gesang?
Und irgendwo in weiter Ferne
Kräht jetzt der Nachbar hocherfreut;
Als hielte Wacht er allzu gerne,
Kräht schon der erste Hahn erneut.
Nein, niemals wird das Echo schweigen,
Denn Hahn um Hahn stimmt ein sofort,
So dass die Kehlen lauthals zeigen
Uns Ost und Westen, Süd und Nord.
Von frohem Hähnekrähn begleitet
Tritt nun der Wald zurück am Saum,
Er sieht die Erde hingebreitet,
Die Felder und den Himmel: blau.
1956
Frühfrost
Am kalten Morgen steigt die Sonne
Als Feuersäule, rauchumhüllt.
Mich, falsch belichtet aufgenommen,
Erkennt man nicht auf diesem Bild.
Solang noch dichte Nebel wehen
Und sich das Gras am Teich erwärmt,
Bin ich für Bäume schwer zu sehen:
Das Ufer ist recht weit entfernt.
Der Fremde ist vorbeigegangen,
Versinkt, zu spät erkannt, im Dunst.
Den Frost hat Gänsehaut umfangen,
Die Luft gleicht Schminke, falscher Kunst.
Auf deinen Weg ist Reif gesunken
Wie feines Flechtwerk, weiß und zart.
Die Erde, von Kartoffeln trunken,
Will endlich rasten – und erstarrt.
1956
Nachtwind
Lieder, trunkener Lärm klingen aus;
Viel zu früh heißt es aufstehn am Morgen.
Dunkel ruhen die Hütten; nach Haus
Ziehn die Scharen vom Fest ohne Sorgen.
Nur der Wind streift umher, ganz allein
Auf den alten, bewachsenen Pfaden:
Mit der Jugend spazierte er heim
Von der Fete am heiteren Abend.
Er bleibt draußen, sein Kopf ist gesenkt.
Er hält nichts von so späten Disputen.
Er, zutiefst von der Nacht noch gekränkt,
Will den Ärger beenden im Guten.
Gegenüber sind Gärten, ein Zaun …
Nacht und Wind hörst du immer noch streiten;
Ihrem Zwist lauscht gebannt Baum um Baum
Und betrachtet vom Wegrand die beiden.
1957
Goldener Herbst
Herbst. Welch magischer Palast,
Allen Augen offen stehend …
Schneisen neigen überrascht
Ihren Blick in klare Seen.
Wie in einem Bildersaal:
Säle, Säle, Säle folgen,
Ulmen, Eschen ohne Zahl,
Und auch Espen schimmern golden.
Eine Linde, goldbekränzt,
Ist die Braut der Hochzeitsfeier;
Das Gesicht der Birke glänzt
Transparent in zartem Schleier.
Und die ganze Erde ruht,
Tief im Laubwerk kaum zu ahnen.
Gelber Ahorn schmückt das Gut
Wie ein goldner Bilderrahmen,
Wo in der Septemberflur
Bäume sich zu Paaren binden
Und der Abend eine Spur
Bernstein malt auf ihre Rinden,
Wo man keine Schlucht betritt,
Da nicht alle wissen müssen,
Wie es klingt bei jedem Schritt –
Dürres Laub zu unsern Füßen;
Dort, wo an Alleen dicht
Widerhall den Hang durchflutet
Und der Kirschenleim aus Licht
Schnell erkaltend nicht mehr blutet.
Herbst. Welch heimliches Versteck
Alter Schriften, Waffen, Kleider …
Buch der Schätze; unentdeckt
Blättert schon die Kälte weiter.
1956
Regenwetter
Wege sind verschlammt vom Regen.
Eis zerbricht wie Glas – der Wind
Will ins Tuch der Weiden fegen,
Bis sie kahl geschoren sind.
Blätter, die am Boden liegen …
Mancher fährt vom Friedhof heim.
Nur der Traktor schwitzt beim Pflügen
Mit acht Rädchen, scharf und fein.
Schwarz sind die gepflügten Fluren,
Blätter fallen in den Teich,
Hinterlassen bunte Spuren,
Werden kleinen Booten gleich.
Regen prasselt wie durch Seiher,
Wenn der Frost den Druck verstärkt.
Alles hüllt die Scham in Schleier,
Nichts als Schande bringt der Herbst.
Alles zeugt von Schmach und Rüge:
Elsternscharen, Blätterfall,
Regen, Stürme, Wolkenflüge –
Tobende Naturgewalt.
1956
Gras und Steine
Visionen, verbunden mit Seiendem,
Gewächse, verbunden mit Stein …
Georgien war und bleibt weiterhin
In vielem mit Polen vereint.
Mariä Verkündigung, Freudenfest;
Welch Segnungen geben bekannt
Die Erde im spröden Gemäuerrest,
Das Gras an der brüchigen Wand.
All ihre Versprechen bekräftigen
Natur wie auch menschlicher Fleiß
Und dies, womit Künste beschäftigt sind –
Das Handwerk zu fördern, den Geist.
All jenes, was lebt und gestalten will,
Die alten Ruinen im Land,
Die Erde im Haus, das verfallen ist,
Das Gras an der brüchigen Wand.
Essenzen aus Mühe und Nichtigkeit,
Das Wort, das sich sprudelnd ergießt,
Gespräche von äußerster Wichtigkeit
Und Plausch, der bedeutungslos fließt.
Das endlose, wogende Weizenfeld,
In dem selbst die Stirne versinkt,
Die Erde im Riss, den der Stein enthält,
Das Gras, das ins Dielenbrett dringt.
Der duftende Farn der Jahrhunderte,
Der beinah die Wipfel erreicht,
Bis wie das Vergangne umwunden ist
Die Schönheit der künftigen Zeit.
Der zweifach erblühende Fliedertraum,
In Weiß und in Lila gemalt,
Der bunt zwischen Wänden im Innenraum
Zerfallender Burgen erstrahlt.
Wo Mensch und Natur eng verbunden sind,
Natur mit dem Menschen sich eint,
Wo Erde in Mauern gefunden wird
Und Gras vor den Haustüren keimt.
Mickiewicz, der niemals vergessene,
Verlieh seiner Lyra den Ton
Georgischer Prinzen, Prinzessinnen,
Vernommen in Kammer und Dom.
1956
Die Nacht
Die Nacht zieht still vorüber
In ungestörtem Lauf.
Tief schläft die Welt. Ein Flieger
Steigt zu den Wolken auf.
Schon hüllen ihn die Nebel
Mit Schwaden, eisigkalt.
Als Kreuzchen im Gewebe
Erscheint er, wie gemalt.
Clubs liegen in der Ferne
Und manche fremde Stadt,
Die Heizer und Kaserne,
Station und Züge hat.
Des Flügels Silhouette
Senkt sich zum Wolkenmeer,
Es tanzt die wirre Kette
Der Sterne ringsumher.
Gefährlich auf die Seite
Hat sich auf ihrem Weg
In fremde Himmelsweite
Die Galaxie gelegt.
Im Kosmos tobt entfesselt
Ein wahrer Weltenbrand:
Der Heizer schürt die Kessel,
Hat niemals Schlaf gekannt.
Paris. Geschützt von Dächern
Liest Venus oder Mars
In Flyern; sie versprechen
Die allerneuste Farce.
Doch jemand ist zu finden
In schöner, fremder Nacht,
In einem Haus mit Schindeln,
Der auf dem Speicher wacht.
Er sieht Planeten oben
Und fühlt, das Himmelszelt
Ist mit dem Grund verwoben,
Weshalb er sich so quält.
Sei nicht dem Schlaf ergeben,
Halt ihn durch Arbeit fern,
Sei ihm nicht unterlegen,
Sei Flieger du und Stern.
Du, Künstler, darfst dich beugen
Nicht Schlaf, noch Schläfrigkeit –
Musst Ewiges bezeugen,
Gefangen in der Zeit.
1956
Der Wind
(Vier Skizzen über Block)
Wer lebt, überschüttet mit Ehren,
Wer stirbt, noch verunglimpft im Tod?..
Ein Kriecher allein kann das lehren;
Sein Einfluss bringt alles ins Lot.
Vielleicht hätte niemand verstanden,
Was Puschkins Bedeutung entspricht –
Zum Glück setzten bald Doktoranden
Sein Wirken ins richtige Licht.
Doch Block, Gott sei Dank, ist uns lieber,
Von ihm sind wir andres gewohnt:
Er stieg nicht vom Sinai nieder
Und wählte sich niemand zum Sohn.
Man rühmte ihn nicht in Programmen,
Er zählte zu keinem System,
Es baute ihn niemand zusammen,
Verordnet war er – nirgendwem.
Als windiger Wind weht er weiter:
So ist auf dem Gut unverzagt
Der sagenumwobene Reiter
Vorm Sechsergespann hergejagt.
Einst lebte dort ein Jakobiner,
Die Seele so rein wie Kristall;
Sein Enkel ist windig noch immer
Und ebenso sehr radikal.
Der Wind spürt tief unter den Rippen
Die Seele auf – und mit der Zeit
Besingen ihn zahlreiche Lippen,
Bescheren ihm Ehre und Leid.
Der Wind weht im Haus, allerorten,
In Dörfern, im Regen, im Wald,
Im dritten Gedichtband, in Worten
Der Zwölf und im Tod – überall.
In Weiten, in endlosen Weiten
Sind Wiesen verstreut und ein Bach.
Die Ernte hat Trubel und Freuden,
Hat Mühe und Arbeit gebracht.
Die Schnitter am Fluss mähen eilends
Und sind auf nichts andres bedacht.
Dies waren für Block frohe Zeiten;
Er schwang seine Sense nur schwach –
Fast wurde ein Igel zur Beute,
Zwei Nattern, geköpft, lagen flach.
Doch unfertig wirkte sein Schreiben,
Schien Müßiggang, Faulheit zu zeigen.
Du Kindheit! Du Schule der Leiden!
Das Singen der Mädchen klingt nach …
Wenn Wolken am Himmelszelt gleiten
Aus Osten, beginnt bald die Nacht.
Der grausame Wind, nie verweilend,
Wird stärker und fährt bis zum Schaft
In Sense und Schilfrohr, trifft heute
Mit gnadenlos schneidender Kraft.
Du Kindheit! Du Schule der Leiden!
Das Singen der Mädchen klingt nach …
In Weiten, in endlosen Weiten
Sind Wiesen verstreut und ein Bach.
Der Himmel erscheint wie zerschlissen;
Am Abend zerfließt seine Glut
In offenen Wunden und Rissen;
Am Fuß eines Schnitters klebt Blut.
Der Himmel scheint rau und zerklüftet,
Orkane und Not stehn bevor;
Nach Wasserdampf riechen die Lüfte,
Nach rostigem Eisen, nach Moor.
Hoch über den Schluchten und Straßen,
Den Höfen und Dörfern, dem Wald
Ziehn Wolken und Blitze – sie rasen:
Ein Unglück ereilt uns schon bald.
Wenn selbst in der Hauptstadt der Himmel
In purpurner Röte entflammt,
Dann droht dieser Welt ein Getümmel:
Orkane erfassen das Land.
Block konnte die Zeichen verstehen.
Der Himmel verlieh ihm die Macht,
Zukünftige Stürme zu sehen,
Gewitter, Zyklone – die Nacht.
Block konnte den Umsturz erkennen,
Und niemals verblasst jener Strich
Aus brennender Sorge und Sehnen