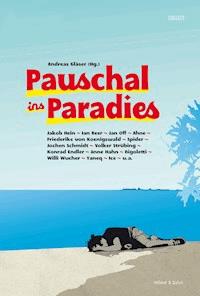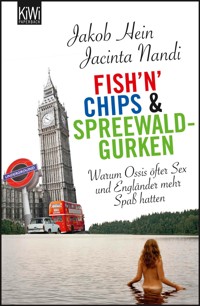19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bisschen Gras, ein genialer Coup und das Wunder von Bayern. Jakob Heins herrlich abgedrehter Roman über einen Milliardencoup – mit einem der entspanntesten Helden der Literatur. Nicht im Traum wäre sein Chef darauf gekommen, dass ausgerechnet Grischa, dieser schüchterne Assistent der Plankommission, zu Subversion neigt und einen – zugegeben – ziemlich genialen Plan ausheckt, wie ihr maroder Laden an eine neue, überraschend gut sprudelnde Finanzquelle gelangt. Wobei 'Laden' in diesem Fall für ein ganzes Land steht. Vielleicht lag es daran, dass Grischa einen etwas eigenwilligen Filmgeschmack hat, in dem sich amerikanische Drogenmafia-Thriller mit sozialistischen Heldenepen kreuzen? Jedenfalls: Grischas Chef kommt aus dem Staunen nicht raus, und mit ihm staunen alle möglichen greisen Minister im Zentralkomitee. Am meisten staunt allerdings kurz darauf der Polizeichef von Westberlin, als sich am Grenzübergang Invalidenstraße tumultartige Szenen abspielen, und zwar auf der falschen (!) Seite. Hunderte junge Leute wollen nach drüben, in den Osten, als wäre Magie im Spiel. Als die Regierung in Bonn Wind davon bekommt, wird die Lage brenzlig. Doch da macht der Osten dem Westen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jakob Hein
Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jakob Hein
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jakob Hein
Jakob Hein arbeitet als Psychiater. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter Mein erstes T-Shirt (2001), Herr Jensen steigt aus (2006), Wurst und Wahn (2011), Kaltes Wasser (2016) und Die Orient-Mission des Leutnant Stern (2018). Sein Buch Hypochonder leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis (2020) stand nach Erscheinen wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Zuletzt erschien sein Roman Der Hypnotiseur oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken im Frühjahr 2022.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein bisschen Gras, ein genialer Coup und das Wunder von Bayern
Nicht im Traum wäre sein Chef darauf gekommen, dass ausgerechnet Grischa, dieser schüchterne Assistent der Plankommission, zu Subversion neigt und einen – zugegeben – ziemlich genialen Plan ausheckt, wie ihr maroder Laden an eine neue, überraschend gut sprudelnde Finanzquelle gelangt. Wobei ‚Laden‘ in diesem Fall für ein ganzes Land steht.
Vielleicht lag es daran, dass Grischa einen etwas eigenwilligen Filmgeschmack hat, in dem sich amerikanische Drogenmafia-Thriller mit sozialistischen Heldenepen kreuzen?
Jedenfalls: Grischas Chef kommt aus dem Staunen nicht raus, und mit ihm staunen alle möglichen greisen Minister im Zentralkomitee. Am meisten staunt allerdings kurz darauf der Polizeichef von Westberlin, als sich am Grenzübergang Invalidenstraße tumultartige Szenen abspielen, und zwar auf der falschen (!) Seite. Hunderte junge Leute wollen nach drüben, in den Osten, als wäre Magie im Spiel. Als die Regierung in Bonn Wind davon bekommt, wird die Lage brenzlig.
Doch da macht der Osten dem Westen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann!
Inhaltsverzeichnis
Gera Hauptbahnhof
Leipziger Strasse
Fünfter Stock
Stragula
Hühner-Gust’l
Der Afghanistan-Plan
Frühling
Polylux
Tonkinokoffer
Scheremetjewo
Shakar Dara
Teepavillon
Podmoskovnye vechera
Freundschaft
Invalidenstrasse
Puschkinplatz
Sandkrugbrücke
Tulpenfeld
Scharfenstein
Mehringhof
Fortschrittlich eingestellt
Frau Reznicek
Der Bauarbeiter
Held der Arbeit
Eine Lage
Schaumburg
Loya Dschirga
Alpenrose
Schlechtenbergalm
Wildgulasch
Zwanzig Gramm
Nichtstun
Verdammt sind sie alle
Mast 43
Letzte Instanz
Held der Arbeit
Wazir Akbar Khan
Köhlfleet
Dank
Liste verwendeter Abkürzungen
Gera Hauptbahnhof
Es war Grischa reichlich peinlich, seine Eltern da so vor seinem Abteilfenster stehen zu sehen, er musste immerhin nach Abfahrt des Zuges fahrplanmäßig noch drei Stunden und dreizehn Minuten mit seinen Mitreisenden im Abteil zubringen, während seine Eltern ohne weiteres Aufsehen vom Bahnhof nach Hause laufen konnten – sie hatten sich beide sogar extra einen freien Tag genommen. Aber da war jetzt nichts zu machen. Deswegen versuchte er, zumindest ein bisschen wie Fernando Rey in Brennpunkt Brooklyn zu wirken, als dieser Gene Hackman von der U-Bahn aus zuwinkt – aufmunternd und voller Zuversicht –, um seinen Eltern zu signalisieren, dass er schon alles irgendwie hinbekommen würde.
Mutti, die sowieso immer feuchte Augen hatte, wenn sie ihm vom Bahnsteig aus zuwinkte, egal, ob er ankam oder abfuhr, weinte an diesem feuchtkalten Augustmorgen einfach hemmungslos. Wenn das einer aus dem Kombinat gesehen hätte, wie ihre Kaderleiterin hier heulend auf Bahnsteig 3, Gera Hauptbahnhof, stand! Ausgerechnet Renate Tannberg, »die eiserne Renate«, schluchzte völlig aufgelöst von ihren mütterlichen Emotionen und schien ihren im Zug sitzenden Sohn Grischa anzuhimmeln wie eine außer Kontrolle geratene Teenagerin ihren Lieblingssänger. Sein Vater Wolfgang stand steif daneben und wirkte, als habe er einen Kloß im Hals, er schien fast erstarrt in seinem Bemühen, mit würdevoller Distanz die schamlose Zurschaustellung von Mutterliebe durch seine Frau zu konterkarieren.
Aber Grischa konnte die beiden auch verstehen. Denn obwohl er in den acht vergangenen Jahren unzählige Male im Ex 100 von Gera gesessen hatte, war es genau dieser Moment, der das endgültige Ende der Kindheit von Grischa Tannberg bedeutete. Er war jetzt auch kein Soldat mehr, der vom Heimaturlaub zurück zur Kaserne fuhr, und kein Student, der mit Einweckgläsern und sauberer Wäsche zurück zur Karlshorster Hochschule fuhr, sondern Grischa war nun Absolvent der Hochschule für Ökonomie Bruno Leuschner, Sektion Außenwirtschaft, und würde in der kommenden Woche seine berufliche Laufbahn beginnen.
Solange Grischa noch im Studium war, hatte nach Hause fahren bedeutet, zu den Eltern nach Gera zu fahren. Doch jetzt fuhr er in die entgegengesetzte Richtung nach Hause, in seine Neubauwohnung in der Leipziger Straße in Berlin, und er würde am Montag seine Arbeit als Jungaktivist in der Staatlichen Plankommission anfangen, die nur ein paar Meter die Leipziger Straße hinunter ihren Sitz hatte. Sein Zuhause war nun endgültig die Hauptstadt. Klar, dass der junge Genosse Tannberg diese Wohnung nur aufgrund seiner Stelle bei der Staatlichen Plankommission bekommen hatte. Und klar, dass er die Stelle nur bekommen hatte, weil er einer der besten Absolventen des Jahrgangs 1981 der Bruno Leuschner gewesen war. Und klar, dass Grischa überhaupt nur an die Leuschner gekommen war, weil seine Eltern gute und einflussreiche Genossen waren, Vati als 2. Sekretär der Geraer Bezirksleitung und Mutti als Kaderleiterin im Kombinat VEB Zellstoff- und Papierfabrik. Und klar, dass nur ein Mitglied der Partei der Arbeiterklasse überhaupt infrage kam, unter die Besten des Jahrgangs gewählt zu werden. Überhaupt waren alle Studenten der Hochschule Parteimitglieder, auch wenn einige in der Bauernpartei oder der CDU waren, aber das machte im Grunde keinen Unterschied.
So hing also alles zusammen, und doch fühlte es sich ungewohnt frei an, dass Grischa nun ganz allein im zuschlagspflichtigen Städteexpress Elstertal mit direkter Verbindung nach Berlin-Lichtenberg saß, über sich zwei Taschen mit allem Wichtigen aus der Heimat verstaut. Seine Fahrkarte war nicht mehr das kleine Rechteck aus Pappe, sondern ganz modern vom neuen MFA auf Druckerpapier erstellt worden, denn die Mikroelektronik hatte jetzt auch bei der Deutschen Reichsbahn Einzug gehalten. Nach Weihnachten wollten ihn die Eltern mit dem Auto nach Berlin bringen, dann würde er noch ein paar Dinge für die neue Wohnung in den Kofferraum ihres Moskwitsch 1500 packen.
Gute Ratschläge hatten sie ihm gestern schon genauso reichlich serviert wie Mutzbraten und Klöße. Einen Monat zugucken, einen Monat mitmachen und dann erst mit den Veränderungen anfangen. Die anderen Genossen nur in der Parteiversammlung duzen, sonst gilt das »Sie«, es sei denn, ein älterer Genosse bietet das »Du« an. Keine Fragen stellen, das bringt einem schnell den Vorwurf des Sektierertums ein, stattdessen lieber Erkundigungen auf die tschekistische Art einholen, durch stille Nachforschung und kluge Beobachtung. Und so weiter und so fort.
»Mutti, ich werde sicher nicht übermorgen den neuen Fünfjahrplan vorlegen müssen«, hatte Grischa seine Eltern zu beruhigen versucht. Seine Eltern taten ganz so, als wäre er gleich auf eine Leitungsfunktion gesetzt worden.
Leipziger Strasse
Paulikowski, einer von den Philosophen an der Leuschner, hatte sich mal auf einer Fete abfällig über Neubauwohnungen geäußert. »In einer normierten Platte mit normierter Deckenhöhe und normiertem Stellplatz für die Schrankwand und den Fernseher kann man keinen Gedanken von Relevanz entwickeln.« Grischa erinnerte sich daran, weil es in seiner Familie stets als äußerst erstrebenswert gegolten hatte, in einer Neubauwohnung zu leben: Fahrstuhl bis vor die Wohnungstür, Badezimmer mit Wanne, Küche mit Durchreiche, ein Balkon und sogar ein Müllschlucker auf der Etage direkt neben dem Fahrstuhlschacht. Das heißt, der Müll fiel auf demselben Wege nach unten, wie man selbst nach oben gekommen war. Die Flure waren hell beleuchtet und die Fußböden sauber mit PVC beklebt, was eine gründliche Reinigung problemlos ermöglichte. Im Winter musste man nur die Heizkörper aufdrehen und die ganze Wohnung war geheizt.
Auch in Filmen kamen die Neubausiedlungen in der Regel nicht gut weg. Im sowjetischen Neujahrsklassiker Ironie des Schicksals von 1975 lässt sich der völlig betrunkene Schenja mit dem Taxi in seine Wohnung 12 in der »3. Straße der Bauarbeiter«, Nr. 25 fahren. Alles passt, sogar sein Schlüssel, nur leider wacht Schenja einige Stunden später in der falschen Stadt auf.
Grischas Tante und seine Cousine mütterlicherseits wohnten jedenfalls in einer Wohnung im zweiten Stock einer alten Villa in der Gagarinstraße in Gera, und das war ganz schrecklich. Die Räume viel zu hoch und ewig kalt, die Treppe mit dem verschnörkelten Metallgeländer und den Holzstufen im dunklen Hausflur wirkte unheimlich und durfte nicht einfach mit Fitwasser gewischt werden, sondern musste mit Bohnerwachs behandelt und danach Stufe für Stufe poliert werden. Die Fenster waren riesige Monstren, die kaum zu öffnen und dann nur mit äußerster Mühe zu schließen waren und jeweils aus mehreren Scheiben bestanden, was bedeutete, dass Tante Gesine nicht nur viermal, sondern achtmal so viele Fenster wie Mutti putzen musste. Die Wohnung war ganz ungünstig geschnitten und in jedem Zimmer gab es einen Ofen, der an jedem Wintermorgen mit Kohlen geheizt werden musste, so wie auch der Badeofen, sollte einer aus der Familie einmal baden wollen. Vielleicht konnte man in einer Neubauwohnung in Plattenbauweise keinen Gedanken von Relevanz entwickeln, eine Altbauwohnung hielt ihre Bewohner ständig so auf Trab, dass sie gar keine Zeit mehr zum Denken hatten.
Seine Zweiraumwohnung in der Leipziger Straße gefiel Grischa jedenfalls außerordentlich gut. Eigentlich hätte ihm natürlich nur ein Zimmer zugestanden, aber die zuständige Mitarbeiterin der Wohnraumlenkung hatte ihm zugezwinkert, dass ein junger Mann wie er ja wohl nicht lange allein bleiben würde und bei einem Genossen der Staatlichen Plankommission würde man nicht wollen, dass er seine wertvolle Zeit mit Wohnungsumzügen verschwendete.
Die Staatliche Plankommission, genannt PlaKo, war im Gebäude des ehemaligen Preußischen Landtags untergebracht, einem durchaus beeindruckenden Prunkbau vergangener Zeiten. Grischa meldete sich an der Pforte. Durch die Glasscheibe mit der ovalen, aluminiumeingefassten Durchsprechvorrichtung, die nur von innen zu öffnen war, und der kleinen Durchreiche für Unterschriften und Schlüssel konnte man den Arbeitsbereich der Pförtner vollständig einsehen. An der hinteren Wand hingen sämtliche Schlüssel für das Gebäude, an der rechten Stirnseite war ein Fenster zur Straße, dem gegenüber die Eingangstür sowie ein kleines Waschbecken. In der Mitte des Raumes stand ein kleiner hellgrüner Holztisch, auf dem Zeitungen lagen und mehrere Frühstücksdosen. Der Kaffee, dessen Geruch im ganzen Eingangsbereich wahrnehmbar war, wurde offenbar mit dem kleinen Tauchsieder neben dem Waschbecken zubereitet.
Am Tisch saßen drei Männer und mampften ihre Frühstücksbrote, als wäre das eine sehr wichtige Angelegenheit. Mitarbeitern, die an ihnen vorbei ins Gebäude gingen, nickten sie nur mechanisch zu. Ihre nierenförmigen Brotdosen waren aus unlackiertem Aluminium, die drei Kaffeetassen verzierte jeweils ein breiter grüner Streifen und neben der Kaffeekanne stand eine Blechbüchse mit Kondensmilch. Neben einem Platz lag Butterbrotpapier, die anderen hatten ihre Stullen entweder ohne Papier mitgeführt oder es in der Dose verstaut.
In Berlin, das wusste Grischa, sagte man Stulle und nicht Schnitte wie daheim, das lernte man so schnell wie den Umstand, am Sonnabend keine rote und schon gar keine rot-weiße Kleidung zu tragen, wenn man in der Stadt unterwegs war. Die beiden Fußballvereine der Hauptstadt hatten jeweils ein anderes Rot als Vereinsfarbe und wenn man am Wochenende auf betrunkene Männer traf, denen das Rot nicht gefiel, das man zufällig gerade trug, dann konnte es Schläge setzen. Grischa war ein paarmal mit Freunden bei Wismut im Stadion der Freundschaft gewesen, aber kannte sich viel zu wenig mit Fußball aus, um sich in solchen Gefahrenbereichen zu bewegen.
Dass er nun auf die Glasscheibe zuging und erkennbar ein Anliegen an das Kabinenpersonal hatte, löste dort keine Begeisterung aus. Die Stullenesser trugen untereinander einen Kampf mit Blicken aus, dessen Verlierer sich ächzend aus seinem Stuhl hochschraubte und die zwei Schritte zur Durchsprechvorrichtung mit gequältem Gesichtsausdruck machte. So ein Bengel hatte ihm gerade noch am Montagmorgen gefehlt. Wahrscheinlich hatte der Pförtner das ganze Wochenende im Garten geschuftet und sich auf der Arbeit endlich einmal erholen wollen. Das ging ja gut los! Er öffnete das kleine Fenster. »Ja?«
»Tannberg mein Name. Ich fange heute hier an. Mir wurde mitgeteilt, Genosse … Burg ist zuständig.«
»Burg?« Der Pförtner sprach den Namen aus, als hätte er ihn noch nie gehört. Auch die Kollegen am Tisch signalisierten völlige Ahnungslosigkeit.
»Ja.« Grischa kramte das Schreiben heraus. »Es steht hier.«
Der Pförtner streckte wortlos die Hand aus, damit Grischa ihm den Brief durch die Luke steckte. »Burg, hmm? … Ach Burg!« Er drehte sich zu seinen Kollegen: »Ralf Burg! Aus der 42.« Jetzt wussten auch die Kollegen bescheid: »Ralfe! Warum sagen Sie das nicht gleich?«
»Aber …«
»Augenblick«, sagte der Pförtner streng, schloss die Luke und ging zu seinem Telefonapparat. Er suchte eine Nummer aus einem kleinen Telefonverzeichnis raus und wählte eine dreistellige Nummer. »Pforte hier. Ja, Sabine, kannst du mir mal Ralfe an die Strippe holen? Ja, hier ist jemand für ihn. Ja. Was? Keine Ahnung. Was? Ja, sag ich ihm.«
Der Pförtner legte auf, kam wieder zur Scheibe zurück und gab Grischa seinen Brief zurück. »Sie sollen hier warten.« Danach ließ er sich erschöpft wieder an seinen Tisch fallen, vermutlich war sein Tagwerk für heute erledigt.
Fünfter Stock
Ein paar Minuten später kam ein Mann die Treppen herunter, dessen Gesicht noch etwas zerknautschter war als sein Anzug. Er war sicher schon fünfzig Jahre alt, hatte blaue Augen und so wie seine Kleidung brachten auch seine Haare zum Ausdruck, dass ihm Äußerlichkeiten unwichtig waren. Als er Grischa sah, war er nichtsdestotrotz um ein Lächeln bemüht, weil sich das so gehörte.
»Sie sind der junge Tannberg? Freut mich! Ralf Burg.« Er schüttelte seine Hand nachdrücklich. »Na dann kommen Sie mal mit.«
Sie fuhren mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock, während Burg Grischa eine Einführung gab. »Der ganze erste Stock ist Industrie, im zweiten ist die Landwirtschaft, der ganze dritte ist nur für die SU, der vierte ist für den RGW und Rohstoffe. Hier im fünften Stockwerk sind die kleineren Bruderländer – also so was wie Angola, Mosambik, Vietnam oder eben Afghanistan. Und dann haben wir hier noch wissenschaftliche Entwicklung und Forschung. Im sechsten und siebten sind dann BRD und das restliche NSW. Ganz oben, damit sie im Angriffsfall als Letzte dem Gegner in die Hände fallen.«
Sie stiegen aus und liefen durch einen langen Gang, bis sie zu einer Tür mit der Aufschrift »Afghanistan – Leitung Gen.R. Burg« kamen. »Das hier ist mein Büro und Sie haben Ihr Reich direkt nebenan.«
An der nächsten Tür hing ein Wimpel mit der afghanischen Flagge. »Den habe ich beim Freundschaftstreffen bekommen und dachte, das wäre eine schöne Begrüßung für Sie. Machen Sie sich doch mit Ihrem neuen Büro vertraut und richten sich ein bisschen ein. Ich hole Sie dann 11.30 Uhr zur Mittagspause ab.« Burg gab Grischa noch einen kleinen Klaps auf den Oberarm, dann war er weg.
Ein Schreibtisch, ein Stuhl, eine Lampe, eine kleine Schrankwand. Grischa wusste schlicht nicht, was genau er jetzt tun sollte, um sich einzurichten. Um nicht unhöflich zu wirken, ließ er eine Stunde verstreichen, dann tat es ihm so leid um die Verschwendung seiner Arbeitskraft, dass er doch wagte, noch einmal bei Burg anzuklopfen. »Genosse Burg?«
»Ah Tannberg – kommen Sie ruhig herein. Finden Sie sich so weit gut zurecht?«
»Danke, alles bestens, Genosse Burg. Ich wollte nur fragen, ob ich mich schon mal einarbeiten kann. Vielleicht ein paar Unterlagen lesen, mich auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten, so was?«
Burg schaute ihn forschend an. »Es war klar, Tannberg, dass wir dieses Gespräch führen würden. Aber ich dachte, dass es nach einer Woche, und hoffte, dass es nach einem Monat passieren würde. Dass Sie hier nach einer Stunde stehen, spricht für Ihr Engagement und Ihre Einsatzfreude. Schauen Sie: Am 21. Mai dieses Jahres war Generalsekretär Babrak Karmal zu Besuch bei uns in der DDR.«
»Das weiß ich natürlich.«
»Natürlich wissen Sie das.«
»Dabei wurde der Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet.«
»Völlig richtig, Tannberg. Und wissen Sie, wie die Zusammenarbeit vorher zwischen der DDR und der Demokratischen Republik Afghanistan aussah?«
»Nein.«
»Dann wissen Sie auch schon genug. Denn vorher gab es praktisch keine Zusammenarbeit zwischen uns und den Afghanen. Die Brüder haben uns ein paar Hundert Afghanen geschickt, die wir hier zu Facharbeitern ausgebildet haben, aber das lief eben direkt über die SU.«
»Doch jetzt gibt es Freundschaft und Zusammenarbeit.«
»Ja, das gibt es jetzt offiziell. Wir haben jetzt sogar eine Botschaft in Kabul. Ich war bei der Eröffnung dabei und von diesem Besuch habe ich den Wimpel mitgebracht, der jetzt an Ihrer Tür hängt.«
»Gut.«
»Ja, gut«, sagte Burg und schwieg danach. »Das Problem besteht aber darin, dass ich mich in Kabul mit Kollegen getroffen habe und dass wir uns natürlich auch ein bisschen in der Hauptstadt umgeschaut haben.«
»Ja.«
»Ja.«
»Und?«, fragte Grischa.
»Und – nichts. Wortwörtlich nichts. Die Afghanen haben nichts. Man könnte es so zusammenfassen: Die wollen alles und haben nichts. Die hätten von uns gern Bücher und Maschinen und Fahrzeuge und Konsumgüter und Dünger und alles, was wir sonst noch produzieren. Aber sie haben: nichts.«
»Könnten sie die Dinge vielleicht bezahlen?«
»Na ja, sie würden uns so viele Afghani geben, wie wir wollen, so heißt die Währung dort, aber die ist nicht konvertierbar. Das heißt, das Geld könnten wir uns auch gleich selber drucken, nutzen wird es uns sicher nichts.«
»Was ist da passiert?«
»Na ja, der lange Krieg. Eigentlich befindet sich Afghanistan seit seiner Gründung 1747 im Krieg. Das Land liegt im Einflussbereich aller Weltmächte und das ist schon seit über hundert Jahren so. Früher waren es die Briten und die Russen, heute sind es die Amis und die SU.«
»Aber von irgendwas müssen die Menschen dort doch leben?«
»Vom Krieg leben viele.«
»Aber das ist doch keine schöpferische Wirtschaft. Krieg, Armeen und Soldaten verbrauchen doch Geld, sogar Valuta. Woher kommt dieses Geld?«
»Zum größten Teil von außen.«
»Und was ist mit dem anderen Teil? Womit verdient Afghanistan selbst Geld?«
Burg holte tief Luft. »Im Wesentlichen mit Landwirtschaft.«
»Das ist doch hervorragend«, sagte Grischa. »Damit können wir doch gut handeln. Wir exportieren die gewünschten Industriegüter und kaufen ihnen die landwirtschaftlichen Produkte ab. Da müssen Lieferketten aufgebaut werden, damit die oft verderblichen Landwirtschaftsprodukte in vertretbarer Zeit ausgeliefert werden. Dafür gibt es Beispiele, das habe ich alles in einem Seminar gehabt.«
»Das mag sein«, sagte Burg. »Nichts gegen Ihre Seminare. Aber: Die landwirtschaftlichen Produkte des Landes sind, sagen wir mal, problematisch.«
»Bauen die Hirse an? Das kann man problemlos durch Weizen für den internationalen Handel ersetzen. Das wurde in Mosambik erfolgreich so gemacht.«
»Nein, Tannberg. Die bauen Drogen an: Schlafmohn und Cannabis.«
»Oh.«
»Ja: Oh.«
Grischa hatte eine Idee. »Könnte man denen nicht zeigen, wie man stattdessen Weizen oder Roggen anbaut?«
»Ich habe das mit den Genossen vor Ort besprochen und immerhin viel Heiterkeit geerntet. Mit den Drogen verdienen die Bauern wertvolle Dollar, die werden nicht anfangen, für nicht konvertierbare Rubel Weizen anzubauen. Mit Mohn und Hanf kennen die sich aus, das hat eine lange Tradition und die Erträge sind sehr gut. Die fangen jetzt nicht an, eine Infrastruktur für Weizen aufzubauen. Das schätzen die Kollegen vor Ort als völlig aussichtslos ein. Abgesehen von den Einkommensmöglichkeiten gibt es da viel zu wenig Wasser für unsere Art der Landwirtschaft.«
»Oh.«
»Ja: Oh. Und darum, Tannberg, sitzen wir hier in unseren Büros und überlegen, was wir als Staatliche Plankommission wohl so planen könnten mit unserem Bruderland Afghanistan.«
»Aber sind nicht schon Dinge geliefert worden? Ich glaube, ich habe davon in der Zeitung gelesen.«
»Ja, wir liefern alles Mögliche: Schulbücher, Industriegüter. Aber das passiert im Rahmen von Solidaritätsaktionen. Das läuft meistens über die FDJ. Mit einer staatlichen Planung, mit uns, hat das nichts zu tun.«
»Oh.«
»Und darum, mein lieber Tannberg, werden Sie sich in den ersten Wochen Ihrer beruflichen Tätigkeit mit einem sehr wichtigen Teil von angestellter Tätigkeit vertraut machen müssen: dem kunstvollen Warten.«
»Was heißt das?«
»Sie warten darauf, dass etwas zu tun ist, und bleiben dabei in innerer Spannung. Keinesfalls dürfen Sie aber Ihren Kollegen zu erkennen geben, dass Sie kunstvoll warten, denn dann werden Sie mit Arbeit überschüttet.«
»Aber das wäre doch gut!«
»Aus Ihnen spricht der dynamische Jungaktivist und das gefällt mir. Aber glauben Sie bitte Ihrem erfahrenen Vorgesetzten: Die Arbeit, die man von den Kollegen bekommt, weil man gerade nichts zu tun hat, ist die Arbeit, die niemand machen möchte. Sie dürften das für sich selbst anders entscheiden, aber für mich dürfen Sie das nicht entscheiden und da ich Ihr Vorgesetzter bin, sage ich, wo es langgeht. Schauen Sie: Ohne kunstvolles Warten wären Sie gar nicht hier.«
»Wie darf ich das verstehen?«, fragte Grischa.
»Na ja, die Kollegen wurden misstrauisch: Was macht der Burg denn überhaupt in der Afghanistan-Abteilung, da gibt es doch nichts zu tun? Und da habe ich eben das gemacht, was man in dieser Situation tun soll. Ein alter Trick von Seidel, meinem Chef aus der LPG Tierproduktion Thomas Müntzer damals noch in Ruhla. Ich habe gesagt: Ich brauche noch eine Planstelle. Der Alte hat natürlich nicht schlecht gestaunt, theoretisch müsste er ja wissen, was ich zu tun habe und was nicht, also hat er praktisch so getan, als wüsste er, dass ich ziemlich viel zu tun habe in der neu gegründeten Afghanistan-Abteilung, und dann hat er geantwortet: ›Ralfe – können wir gern drüber reden, aber es muss eine Stelle für einen Jungaktivisten sein, die FDJ hat uns mal wieder angezählt.‹
›Gerd‹, habe ich zu ihm gesagt, ›nichts ist mir lieber als das.‹
So habe ich meinen Wunsch und Sie Ihre Stelle bekommen, Genosse Tannberg.«
Grischa musste das alles erst mal auf sich wirken lassen.
»Und jetzt«, sagte Ralf Burg, »zeige ich Ihnen mal unsere Kantine. Denn die ist Weltniveau und einer der besten Orte für kunstvolles Warten.«
Stragula
Die Kantine der Staatlichen Plankommission war in der Tat ein beeindruckender Ort. Ein bestimmt fünf Meter hoher Saal mit riesigen, deckenhohen, kassettengeschmückten Bogenfenstern. Den Kontrast dazu bildeten der Stragula-Fußboden und der lang gezogene Sprelacart-Tresen an der Wandseite mit dazu passenden Tischen, an denen jeweils vier mit Kunstpolster bezogene Metallstühle aufgestellt waren. Ab einem bestimmten Punkt konnte man die Kantine finden, indem man einfach dem Lärm folgte, den die vielen Menschen verursachten, die Tabletts aufnahmen, Stühle zurechtrückten, Besteck fallen ließen, Kaffeetassen abstellten und sich laut unterhielten.
Grischa machte es einfach wie Burg, nahm sich ein Tablett, ein Schälchen mit Rohkost, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und ein großes Glas Brause. Damit gingen sie dann zur Kasse durch, wo Burg für beide bezahlte. »Lassen Sie mal stecken. Schließlich habe ich keine Blumen für Sie besorgt.«
Dann suchten sie freie Plätze, wobei Burg links und rechts die Kollegen und wenigen Kolleginnen grüßte.
»Ralfe«, winkte sie ein Mann zu sich heran. »Kommt doch hierher!«
Burg steuerte auf seinen Tisch zu, Grischa in seinem Schlepptau. »Gleich am ersten Tag beim großen Chef am Tisch. Nicht, dass unser Jungaktivist davon einen Schock bekommt.«
»Ach, quatsch doch nicht, Ralfe, setzt euch hier mal hin!« Der Mann, der das sagte, trug einen hellgrauen Anzug und ein hellgrünes Hemd, beide erkennbar durchgeschwitzt. Am Revers trug er selbstverständlich das Parteiabzeichen, um den Hals hing schlaff eine breit gemusterte Kurzkrawatte in bunttrüben Farben. Er hatte seine mittellangen weißen Haare akkurat zurückgekämmt, was seine hohe Stirn noch betonte, unter der seine hellgrauen Augen irgendwie wässrig hervorschauten. Im Gegensatz zu seinem von Grau dominierten Äußeren gab er sich leutselig und bestens gelaunt.
»Na, und, wie läuft’s, junger Kollege? Zeigt Ihnen Genosse Burg alles, was Sie wissen müssen? Wir sind ja froh, hier mal wieder etwas Jugend herzubekommen. Obwohl wir natürlich noch lieber ein Mädel gehabt hätten, was Schönes, Knackiges. Aber damit können Sie nicht dienen, was?« Obwohl er die ganze Zeit Fragen stellte, erwartete er keine Antworten. Dabei schaufelte er unablässig einen Brei aus Blutwurst, Salzkartoffeln, Sauerkraut und Soße in sich hinein, den er auf dem Teller vor sich zusammengequetscht hatte.
»Na ja, Sie werden sich schon einfinden, oder? Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach zu mir. Mein Büro werden Sie schon finden? Aber sicher können Sie schon eine Menge mit dem Genossen Burg klären, was? Du behandelst ihn doch gut, oder, Ralfe?«
Abrupt stand er auf. »Na ja, war schön, mit euch gequatscht zu haben, ich muss dann auch mal wieder. Ihr kommt zurecht, ja?«
Nachdem er weg war, schwiegen Grischa und Burg ein paar Sekunden wie nach einem Feuerwerk. Es gab nichts zu sagen und die Ruhe am Tisch inmitten des sie umgebenden Lärms war wohltuend. Burg beugte sich zu ihm herüber: »Das war Schürer.«
Grischa riss die Augen auf. »Gerhard Schürer? Der Chef?«
»Der Chef«, bestätigte Burg.
»Ein freundlicher Mensch«, sagte Grischa unsicher.
Burg beugte sich zu ihm herüber. »Das – ist er ganz bestimmt nicht. Er ist immer gut informiert, er kann geradezu hellseherisch erkennen, wenn ihm jemand Unsinn erzählen möchte, er kann Mengen saufen, von denen würden zehn Kosaken tot umfallen. Er ist alles, aber er ist sicher kein freundlicher Mensch. Er ist ein misstrauischer, missgünstiger, intriganter und bösartiger Mensch und wenn er wüsste, dass ich das von ihm sage, würde er sich tief in seinem Herzen freuen und mir eigenhändig den Hals umdrehen. Nehmen Sie sich in Acht, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.«
»Aber er hat mir sogar angeboten, ich könnte in seinem Büro vorbeikommen.«
»Das würde ich nur machen, wenn Sie Spaß daran haben, gevierteilt zu werden.«
»Aha.« Grischa lief rot an, sein Wohlbefinden war plötzlich massiv gesunken.
Schweigend aßen sie auf. An den anderen Tischen tranken ein paar Leute Rotwein, praktisch alle, die gerade nicht aßen, rauchten. Nach dem Essen brachte Grischa die Tabletts weg und kehrte mit zwei Tassen Kaffee zurück. Burg holte eine Schachtel Club aus der Jacketttasche und bot Grischa eine Zigarette an.
»Nein, danke.«
»Nichtraucher?«
»Ja.«
»Soll ja besser sein.«
»Es schmeckt mir einfach nicht.«
»Ist ja nicht weiter wild. Rauchen ist einfach nur eine der Arten des kunstvollen Wartens.«
Am nächsten Morgen hatte Grischa immerhin schon einen Betriebsausweis und einen eigenen Schlüssel, sodass er nun wie die anderen Mitarbeiter mit routiniertem Nicken durch die Pforte gehen und auf seinen Fahrstuhl warten konnte. Burg unterschrieb ihm einen Anforderungsschein für eine Schreibmaschine, die er sich gleich in der Materialbeschaffung abholen konnte, wo er auch Papier und sogar eine ganze Packung Barock-Kohlepapier erhielt, das draußen schwer zu bekommen war.
Dann ging er in die Bibliothek der Plankommission, die sich in der Nähe des Tagungssaals im Erdgeschoss befand, und kehrte mit einigen Büchern zurück, in die er sich vertiefte. Irgendwann spannte er das erste Blatt in seine Schreibmaschine und begann zu tippen. Grischa liebte Schreibmaschinen und die Geräusche, die sie machten. Wenn er daran schrieb, kam er sich immer vor wie Orson Welles in Citizen Kane.
Mittags kam sein Vorgesetzter ihn im Büro besuchen. »Was machen Sie denn da, Tannberg?«
»Besonders kunstvoll warten.«
»Sehr gut, sehr gut«, lobte ihn Burg. »Aber jetzt machen wir Mittag. Denn wer nicht Mittag macht, macht sich verdächtig.«
In den folgenden Wochen schrieb und tippte Grischa unaufhörlich. Burg hätte es egal sein können, denn er war froh, dass der überengagierte junge Mann irgendetwas gefunden hatte, mit dem er sich beschäftigte. Da Burg als deren Leiter sicher wusste, dass es nichts in der Afghanistan-Abteilung der Staatlichen Plankommission der DDR zu tun gab, hatte er auch keinerlei Sorge, dass Grischa sich irgendwie ungeschickt anstellen könnte. Gleichzeitig bemerkten die Kollegen den Bienenfleiß des neuen Mitarbeiters, was wiederum der Behauptung, die Afghanistan-Abteilung hätte sehr viel zu tun, große Glaubwürdigkeit verlieh. Es hätte ewig so weitergehen können.
Hühner-Gust’l
Eine Stelle in der Hauptstadt zu ergattern, war allgemein als Hauptgewinn anerkannt. Nicht einmal jeder Berliner bekam nach Studium oder Ausbildung eine Stelle in seiner Heimatstadt, viele mussten in die Provinz ziehen. Menschen gingen allerlei Kompromisse ein, nahmen Arbeitsplätze, für die sie überqualifiziert waren, oder heirateten flüchtige Bekannte, nur um in der Hauptstadt sein oder bleiben zu können.
Für die Menschen in Gera, Rügen und Schwerin war Berlin fast schon ein Mythos. Hier gab es alles, was es sonst nicht zu kaufen gab, hier gab es Punker, Popper und Skinheads, hier konnte man Musikkassetten, Jeans und Lederjacken kaufen, wenn man nur die richtigen Leute kannte. Überhaupt war alles in Berlin unendlich cool und aufregend, die erste Stadt des Westens, die noch im Osten lag. Die Straßen der Hauptstadt galten als heißes Pflaster, es konnte einem passieren, dass man hier Stars begegnete oder Menschen aus der ganzen Welt, Afrika, Westdeutschland oder sogar Amerika!