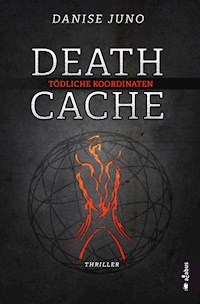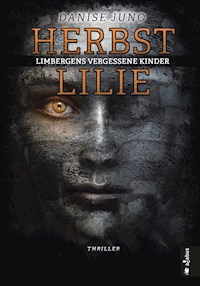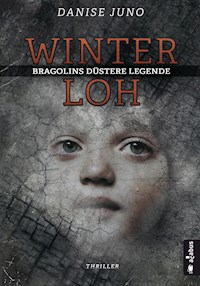
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1938: Von seiner letzten Seereise bringt Kapitän Konrad Ockenfels aus Venedig zwei Gemälde des Künstlers Bragolin mit. Nichts ahnend, dass es Dinge gibt, die man nicht malen darf … 2008: Auf der Flucht aus einer unglücklichen Ehe tritt Hannah Abel eine Stelle bei der wohlhabenden Familie Ockenfels in Remagen an. Sie ist sehr beeindruckt von der alten Rhein-Villa, doch hat sie Schwierigkeiten mit Helene Ockenfels. Die alte Dame glaubt, Hannah sei Teil einer Verschwörung und wolle sie bestehlen. Hannah gibt nicht auf und kann schließlich ihr Vertrauen gewinnen. Bald erzählt Helene ihr von ihrer Ehe mit Konrad Ockenfels, der scheinbar getrieben von Dämonen versucht habe, sie umzubringen. Doch alle Hinweise aus früheren Zeiten, die Hannah in der Villa findet, erzählen eine andere Geschichte. Leidet Frau Ockenfels an beginnender Demenz oder verbirgt sich mehr dahinter? Als das verstörende Gemälde eines weinenden Kindes auftaucht, häufen sich ungewöhnliche Vorfälle und Hannah beginnt, um ihr Leben zu fürchten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danise Juno
Winterloh
Bragolins düstere Legende
Thriller
Juno, Danise : Winterloh. Bragolins düstere Legende. Hamburg, acabus Verlag 2018
Originalausgabe
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-601-8
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-600-1
Print: ISBN 978-3-86282-599-8
Lektorat: Birthe Dauer, Laura Künstler, acabus Verlag
Satz: Laura Künstler, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © Vera Kuttelvaserova – Fotolia.com; pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Buch ein Roman und damit ein fiktives Werk ist. Auch wenn manchen Ereignissen wahre Begebenheiten und Legenden zugrundeliegen, so sind die Handlungen in diesem Roman lediglich durch diese inspiriert. Handlungen und Äußerungen der hierin auftretenden Personen, auch solcher, die nicht gänzlich der Phantasie der Autorin entsprungen sind, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder auch bereits verstorbenen Personen sind dem reinen Zufall geschuldet.
Kapitel 1
Remagen, 2008
Rheinromantik. Anders hätte ich es nicht bezeichnen können. Zum wiederholten Male wischte ich einen kleinen Teil des beschlagenen Zugfensters frei und blickte hinaus in die herabsinkende Dämmerung. Wilde Felsformationen huschten vorbei, sprangen hervor, um sich gleich darauf zu einem Tal zu öffnen. Ich sah herrschaftliche Villen im Schatten des Berges, deren Fensterfronten auf den Rhein gerichtet waren. Ich hatte von diesem unsteten Fluss gelesen. Begleitet von dem betörenden Gesang der Loreley, windet er sich durch das ursprüngliche Rheintal, flankiert von alten Burgen und Schlössern. Ein Zufluchtsort für Gestrandete.
Für mich, dachte ich. Hier wird er mich niemals finden. Der bloße Gedanke an Dennis ließ mich frösteln. Ich schmiegte mich enger in meinen Mantel, hielt die Arme vor der Brust verschränkt und ließ meinen Blick verstohlen durch das Abteil schweifen. Es saßen nur eine Handvoll Menschen in der zweiten Klasse. Eine ältere Dame mit einem Kind, das pausenlos plapperte, eine Frau mit zerzauster Frisur und zwei Jugendliche, die auf ihren Handys daddelten. Niemand beachtete mich und das war gut so. Je weniger ich auffiel, desto besser.
»Nächster Halt: Remagen. Der hintere Zugteil endet hier. Bitte steigen Sie in den vorderen Zugteil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts«, schnarrte eine Stimme aus dem Lautsprecher. Der Zug verlangsamte die Fahrt.
Ich stand auf, zog die alte Reisetasche aus dem Gepäckfach und stülpte die Wollmütze über meine widerspenstigen Locken, während wir in den Bahnhof einfuhren.
Der Zug hielt mit einem sanften Ruck. Die Türen öffneten sich leise zischend und ich stieg aus.
Remagen. Hier war ich nun, stand auf einem zugigen Bahnsteig und fühlte mich verloren unter den Menschen, die zielstrebig Richtung Ausgang strömten. Ich folgte ihnen eine Treppe hinab, eine Unterführung hindurch, auf die andere Seite der Gleise. Schließlich gelangte ich zur Vorderseite des Bahnhofgebäudes, das wirkte, als stamme es aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Vorplatz mündete in eine Pflasterstraße, die im gelblichen Schein der Laternen glitzerte. Große Schneeflocken segelten sanft zu Boden und verliehen der Szene etwas Malerisches.
Das cremefarbene Taxi wirkte seltsam deplatziert. Ich hielt darauf zu und erkannte zu meiner Erleichterung eine Frau hinter dem Steuer. Sie beobachtete meine Schritte und ihr Blick glitt zu meiner Reisetasche, die ich geschultert trug. Erst als es offensichtlich war, dass ich sie brauchte, stieg sie aus und grüßte mich höflich. Sie nahm mein spärliches Gepäck ohne Kommentar über den maroden Zustand in Empfang und verstaute es im Kofferraum.
Während sie die Fahrertür öffnete, fragte sie: »Wo darf ich Sie hinbringen?«
Meine klammen Finger tasteten nach dem zerknitterten Notizzettel in der Manteltasche. Ich fischte ihn heraus und begann abzulesen: »Haus Ockenfels …«
Ihre Brauen schnellten in die Höhe. »Sie wollen zur Wintervilla?«
Ich zog die Stirn kraus. »… Bundesstraße 9, Remagen«, beendete ich die Adresse.
Das Lächeln auf ihren Lippen erstarrte zu Eis. Eine feine senkrechte Linie furchte ihre Stirn. Die Frau sah mich an, als wäre sie einem Gespenst begegnet. Ihr Zögern war nicht zu übersehen. Dann schaute sie nach oben, als suche sie den Himmel nach einer göttlichen Inspiration ab und sagte schließlich: »Der Schneefall wird heftiger … Wissen Sie, vielleicht wäre es besser, wenn Sie auf den Manfred warten. Der fährt Sie bestimmt da rauf.« Sie nickte, wie um sich selbst zuzustimmen. Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich zum Heck des Wagens und lud meine Tasche wieder aus.
Vollkommen verdattert stand ich da. Ich war sprachlos.
Sie sah mir nicht in die Augen, und ich hatte den Eindruck, als hörte ich Ausflüchte, als sie erklärte, sie wäre noch unsicher mit dem Wagen.
Helle Scheinwerfer kamen auf uns zu und augenblicklich legte sich Erleichterung auf ihre Züge. »Da ist er schon.« Ihre plötzliche Fröhlichkeit wirkte aufgesetzt.
Das Taxi hielt hinter uns und sie trug meine Tasche zu besagtem Manfred. Dieser sah ihr entgegen und man konnte ihm deutlich ansehen, dass er nicht verstand, was hier vorging. Er ließ das Fenster herunter.
»Kannst du übernehmen? Ich hatte noch keine Pause«, sagte sie zu meiner Überraschung.
Er zuckte nur mit den Schultern, stieg aus und übernahm das Gepäck.
»Viel Glück«, murmelte die Frau, während sie sich abwandte. Für einen winzigen Augenblick hielt sie inne, dann schüttelte sie fast unmerklich den Kopf und ging an mir vorbei.
Als wir beide im Taxi saßen, sah Manfred in den Rückspiegel und fragte: »Wohin?«
Mit zitternder Stimme wiederholte ich die Adresse. Der Ledersitz knirschte leise, als er sich zu mir umdrehte und mich aufmerksam musterte. Er runzelte die Stirn. »Was haben Sie denn mit der alten Helene zu schaffen?«
»Ich werde dort arbeiten«, murmelte ich unsicher und begann mich zu fragen, ob das wirklich eine gute Idee gewesen war. Alles hatte sich zusammengefügt wie ein Mosaik. Die Anzeige in der Zeitung, das Telefonat, eine Anstellung mit Unterkunft und Verpflegung. Perfekt für meine Flucht in ein neues Leben. Warum reagierten die Menschen derart seltsam, beinahe ablehnend?
Er winkte ab. »Geht mich im Grunde nichts an«, brummte er, wandte sich wieder dem Steuer zu und startete den Motor.
Damit schien das Gespräch für ihn beendet. Ich ließ die Reaktionen der ersten beiden Menschen, denen ich hier begegnet war, Revue passieren. Der erstarrte Gesichtsausdruck der Fahrerin, die Weigerung, mich hinauf zu fahren. Wo rauf? Auf einen Berg? Wintervilla. War das die Bezeichnung einer der Rheinvillen? Vielleicht hatte sie ja tatsächlich nur Angst, mit dem Taxi durch den Schnee auf einen Berg hinaufzufahren. Ich konnte ihr diese Furcht nachfühlen. Ich würde so etwas auch nicht tun wollen. Im selben Augenblick fragte ich mich, ob Manfred wohl ein guter Fahrer war, doch er lenkte den Wagen derart souverän durch die Kurven, dass ich mir dessen schnell sicher war. »Es schneit ganz ordentlich«, sagte ich im Versuch, das Gespräch neu zu entfachen.
Sein zustimmendes Brummen wurde von dem schleifenden Geräusch des Scheibenwischers unterstrichen.
»Mir wurde gesagt, dass Frau Ockenfels eine nette, alte Dame sein soll«, sagte ich in der Hoffnung, dass seine Antwort meine Zweifel zerstreuen würde.
»Nett?«, platzte es aus ihm heraus, und er lachte bellend. »Wer hat das denn gesagt?«
»Frau Wilms, ihre Enkeltochter«, sagte ich kleinlaut und versank förmlich im Rücksitz.
»Interessant, denn ich habe noch nie jemanden gekannt, der die Alte als nett bezeichnet hätte. Ilona muss verzweifelt sein.«
Er kennt Frau Wilms. Er weiß, was für Leute das sind. Oh bitte, lass mich nicht hängen, dachte ich und schickte ein Stoßgebet an welchen Gott auch immer, solange er nur bereit war, mich zu hören. Ob ich Manfred darum bitten sollte, umzukehren und mich zurück zum Bahnhof zu bringen? Aber was sollte ich dann tun? Wo sollte ich hin? Zurück in mein altes Leben? Zu ihm? Konnte es überhaupt Schlimmeres geben als meine Vergangenheit an dem Ort, den ich zurückgelassen hatte? Diese Vorstellung war für mich grauenvoller als die Ungewissheit. Vielleicht war die alte Dame nur schwierig oder missverstanden, oder … Ich beschloss, mich an die vage Möglichkeit zu klammern, dass Remagens Taxifahrer einfach allesamt etwas schrullig sein könnten. Wirf deinen Ballast ab und stell dich deiner Aufgabe, du elender Feigling, schalt ich mich selbst.
Erst jetzt bemerkte ich, dass wir Remagen hinter uns gelassen hatten. Zu meiner Rechten sah ich die Wellen des Rheins im Mondlicht glitzern. Ich warf einen Blick auf die Armbanduhr. Sie zeigte kurz vor fünf. Gerade als ich fragen wollte, wie weit es sei, setzte Manfred den Blinker, bog linker Hand in ein Seitental ein und hielt unmittelbar vor einem gitterbewehrten Zufahrtstor. Ich zog meine Geldbörse aus der Manteltasche und wollte fragen, was ich ihm schuldete, da stieg er aus und schlenderte um den Wagen herum zu einer nur schwach beleuchteten Klingelanlage. Kaum hatte er den Knopf betätigt, hörte ich eine schnarrende Stimme aus der Sprechanlage, deren Worte ich jedoch aufgrund des laufenden Motors nicht verstand.
»Ich habe hier eine junge Frau im Wagen. Die will zu euch«, sagte der Taxifahrer, ohne sich vorzustellen.
Die Stimme antwortete, dann nickte er, kam zurück und ließ sich in den Sitz fallen. Er schlug die Wagentür zu und sagte an mich gerichtet: »Sie werden schon erwartet.«
Das Eisentor fuhr ratternd auf und gab den Weg zur Zufahrtsstraße frei. Sie glich eher einem verschneiten Waldweg. Manfred steuerte den Wagen die gewundene Strecke hinauf, die von vereinzelten Laternen gesäumt war. Ihr blassgelber Schein malte sanfte Ringe in den Schnee.
Vier Windungen später mündete der Weg in einen kleinen Platz am Fuß der Villa, die hoch über dem Rhein auf dem zerklüfteten Felsen thronte. Staunend betrachtete ich das alte Gemäuer, das von gelblichen Scheinwerfern in Szene gesetzt wurde. Das Gebäude glich eher einem Schloss, denn es besaß einen turmartigen Anbau, der von quadratischen Zinnen gekrönt wurde. Die linke Flanke des Baus lag verborgen unter verschneiten Kletterpflanzen, die ich als Efeu zu erkennen glaubte. Zu beiden Seiten des wuchtigen Eichenportals hingen zwei schmiedeeiserne Laternen, die aussahen, als stammten sie aus einem längst vergangenen Jahrhundert. Wäre ich in einer Kutsche vorgefahren, ich hätte augenblicklich vergessen, in welcher Zeit ich lebte.
»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, …«, brummte der Fahrer und wandte sich zu mir um, »… dann sehen Sie zu, dass Sie hier so schnell wie möglich wieder verschwinden.«
Ohne meine Antwort abzuwarten, stieg er aus und ging an meinem Fenster vorbei zum Kofferraum.
Ich gab mir alle Mühe, seinem Kommentar nicht allzu viel Bedeutung beizumessen, doch das mulmige Gefühl in der Magengegend blieb.
Das Eichenportal wurde geöffnet, und eine Frau mittleren Alters trat heraus. Ihre Jeans trug sie modisch in schwarzen Stiefeln, die ihr bis über die Waden reichten. Darüber einen dunklen Wollpullover, der alles andere als billig wirkte. Ihr kurzer Haarschnitt lag voll im Trend, auch wenn das helle Blond von vereinzelten grauen Strähnen durchwirkt war. Sie neigte den Kopf und spähte in den Wagen. Als sie mich entdeckte, lächelte sie und schritt die wenigen Stufen der opulenten Vortreppe herunter.
Ich zögerte nicht länger und stieg aus.
»Ilona Wilms«, stellte sie sich vor. »Wir haben telefoniert.« Sie streckte die Hand aus und musterte mich interessiert, aber freundlich.
»Hannah Abel«, sagte ich und hoffte inständig, dass sie mein Misstrauen nicht bemerkte. Ihre Hand fühlte sich zwischen meinen Fingern warm an.
»Herzlich willkommen. Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Ja, danke«, antwortete ich höflich.
Ihr Blick wanderte zum Himmel. »Bitte kommen Sie herein, wir werden uns beide erkälten bei dem Wetter.« Sie wies den Fahrer an, das Gepäck ins Haus zu bringen und zahlte, bevor ich widersprechen konnte.
Ich folgte ihr in eine weitläufige, mit einem marmornen Schachbrettmuster ausgelegte Halle. Die überhohen Wände waren zur Hälfte mit dunklem Holz vertäfelt, darüber spannte sich weinroter Stoff bis zum schneeweißen Deckenstuck. Aus der Mitte einer ovalförmigen Stuckrosette entsprang eine fast armdicke, bronzene Kette. An ihr hing ein gewaltiger Kronleuchter, dessen warmes Licht sich in tausenden von Bleikristallen brach und sich sanft in die Halle ergoss.
Frau Wilms war meinem Blick gefolgt und sagte: »Unglaublich kitschig, oder?«
Da ich wusste, dass mir vor Staunen der Mund offenstand, sprach ich meinen Eindruck laut aus: »Prachtvoll trifft es für mich eher.«
Als wäre es eine Fangfrage gewesen, lächelte Frau Wilms zufrieden. »Er stammt noch aus der Zeit, als mein Großvater zur See fuhr. Soweit ich mich erinnere, brachte er ihn aus Italien mit, aber das kann Ihnen meine Großmutter sicher genauer erzählen.« Sie runzelte die Stirn und sagte dann mehr zu sich selbst: »Vorausgesetzt, Sie sagen ihr zu.«
Ich sah die Sorge in ihrem Gesicht, das sich umwölkt hatte. Allem Anschein nach war ich unter falschen Voraussetzungen hergelockt worden. Worauf hatte ich mich nur eingelassen?
Noch bevor ich auf ihre Worte reagieren konnte, sagte sie: »Frau Beck wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Sie können sich einrichten und um achtzehn Uhr treffen wir uns im Speisesaal. Wir werden gemeinsam zu Abend essen und uns dann in aller Ruhe unterhalten. Einverstanden?«
Kaum hatte ich meine Zustimmung ausgesprochen, öffnete sich eine Flügeltür zu meiner Rechten, und eine adrett gekleidete Frau betrat die Halle. Nach ihrem Gesicht zu urteilen schien sie etwa Ende vierzig und damit nur unwesentlich älter als Frau Wilms zu sein. Ihr brünettes Haar hatte sie mit einer Spange hochgesteckt. Sie trug eine grau gestreifte Bluse. Um ihre magere Hüfte war eine Küchenschürze gebunden.
Sie trat auf mich zu, Ilona Wilms stellte uns vor und verabschiedete sich anschließend mit einem kurzen Nicken.
Ich folgte Frau Beck die breiten, mit einem dunkelroten Läufer belegten Stufen einer Eichentreppe hinauf, die sich über zwei Podeste, einen Halbbogen beschreibend, in das erste Stockwerk emporwand. Sie mündete in einen fast quadratischen Flur, der gespickt war mit dunkel gebeizten Zimmertüren. Wir wandten uns nach links und als Frau Beck eine von ihnen öffnete, staunte ich nicht schlecht. Dahinter lag ein Flur, der gut fünf Meter überwand. Kurz bevor der Gang um eine Ecke führte, blieb sie abrupt stehen und um ein Haar hätte ich sie umgerannt.
Sie ließ sich den Beinahezusammenstoß nicht anmerken, öffnete eine Tür, betätigte einen Lichtschalter und trat zur Seite. »Dieses Zimmer wurde Ihnen zugedacht, Frau Abel.«
»Vielen Dank.«
Ich wollte warten, bis sie gehen würde, doch sie blieb, wo sie war. Offenbar erwartete sie, dass ich mein Zimmer betrat. Ich tat ihr den Gefallen, ging hinein und wandte mich dann zu ihr um.
»Ich werde Sie gegen sechs in der Halle erwarten und zeige Ihnen dann den Weg zum Speisesaal.«
Abermals bedankte ich mich, doch ihr Gesicht zeigte keinerlei Regung, als sie sich von mir abwandte und die Tür schloss.
Endlich allein. Dies also sollte mein neues Zuhause sein. Im Gegensatz zur Halle konnte man die Einrichtung dieses Zimmers als schlicht bezeichnen, auch wenn es für meine Verhältnisse immer noch opulent ausgestattet war. Eine unaufdringliche, blassrosafarbene Blümchentapete zierte die Wände. In der Mitte der Zimmerdecke prangte eine kleine Stuckrosette. Der Raum hatte zwei hohe, mit Sprossen unterteilte Fenster. Darunter stand ein kompakter Schreibtisch mit einem dazu passenden Stuhl. Ich stellte meine Reisetasche vor dem wuchtigen Kleiderschrank ab, auf dessen Türen eine kunstvolle Malerei zu sehen war. Ich wandte mich dem übergroßen, schmiedeeisernen Bett zu. Weiße Stoffbahnen flossen wie Wellenkaskaden von der Decke herab und umwölkten es feinen Nebelschwaden gleich. Ehrfürchtig strich ich über die wattige Seidentagesdecke bis hin zu zwei Kissen am Kopfende, die mit obligatorischem Handknick in der Mitte aufrecht standen. Das Bett wurde auf der einen Seite von einer Stehlampe flankiert, auf der anderen von einem antiken Nachtschränkchen. Ich konnte nicht widerstehen, öffnete die Lade und warf einen Blick hinein. Ich fand darin ein Prospekt über Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins und eine abgegriffene Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Ich schloss die Lade und ließ mich auf das Bett sinken.
Was für ein Tag. Dies alles hier wirkte auf mich wie ein Kulturschock. Kein Vergleich zu der verranzten Wohnung, in der ich zuvor mit Dennis gehaust hatte. Mein Blick strich über die schweren, cremefarbenen Vorhänge. Kelchfalten, schoss es mir durch den Kopf und ich musste an einen Spielfilm denken, den ich einmal gesehen hatte. Vor ewiger Zeit, in meinem anderen Leben.
Plötzlich hallte ein Scheppern durch die Flure, gefolgt von lauten Schreien.
Erschrocken fuhr ich hoch.
Holz krachte, als hätte jemand eine Zimmertür zugeschlagen. Die Geräusche klangen allzu vertraut. Ich konnte sie körperlich fühlen. Mein ganzer Leib versteifte sich, als wappne er sich für den ersten Schlag. Erst als meine Lippen schmerzten, wurde mir bewusst, dass ich sie heftig zusammenpresste. Er kann nicht hier sein, er weiß nicht, wo ich bin, dachte ich und versuchte mich zu entspannen. Dennoch schlug mir mein Herz bis zum Hals, als ich lauschte.
Kapitel 2
Stille senkte sich über das Haus. Ich hörte ein leises, klapperndes Geräusch, dann Schritte, die sich näherten.
Er ist nicht hier!
Eine Tür wurde geschlossen. Allmählich wurde mir bewusst, dass mir keine Gefahr drohte. Ich war in Haus Ockenfels. Remagen. Woher sollte er das wissen? Und doch, Dennis war allgegenwärtig. Ich war vierundzwanzig Jahre alt und bekam das ganze Ausmaß seines zerstörerischen Werks zu spüren. Er hatte ein nervliches Wrack hinterlassen. Ich war zu einem Feigling geworden; zu einem unselbstständigen, ängstlichen Kind.
Ich atmete einmal tief durch, ballte die Hände zu Fäusten und flüsterte mir selbst Mut zu: »Reiß dich zusammen. Du schaffst das. Nichts kann so schlimm sein wie ein Leben mit ihm.« Mit Nachdruck wiederholte ich meine Worte: »Nichts kann so schlimm sein!«
Ich gab mir selbst einen Ruck und kam auf die Füße. Ich öffnete die Reisetasche und ärgerte mich über meine zitternden Finger. Fahrig packte ich meine Wäsche in den Kleiderschrank, stellte meinen Kulturbeutel auf das Nachtschränkchen und versuchte anschließend die Reisetasche in den Schrank zu quetschen. Das war leichter gesagt, als getan. Im untersten Fach lagen Handtücher, zwei Wolldecken und ein ungenutztes Federbett. Wie ich es auch anstellte, meine Tasche passte einfach nicht mehr hinein. Ich schnaubte unwillig und ließ meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Endlich hatte ich einen Einfall, ging auf die Knie und warf einen Blick unter das Bett. Genügend Platz für das olle Ding, dachte ich und schob sie kurzerhand darunter.
Inzwischen war es an der Zeit, mich meiner feuchten Klamotten zu entledigen und mich für das Abendessen umzuziehen. Meine Wahl fiel auf eine ausgeblichene schwarze Jeans und einen cremefarbenen Pulli.
Ich beäugte mich kritisch im Spiegel, der an der Innenseite der Schranktür befestigt war. Ich zwickte mir in die Wangen, um die Blässe zu vertreiben. Jetzt sah ich wenigstens nicht mehr ganz so mitgenommen aus. Dennoch, es war, als stünde mir der Schrecken immer noch ins Gesicht geschrieben. Meine wirren Locken täuschten auch nicht darüber hinweg. Zu allem Überfluss überfielen mich leichte Kopfschmerzen, die ich für gewöhnlich mit Vitamin C Tabletten bekämpfte, doch die Packung war leer. Es half nichts, ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass ich hinuntergehen musste. Ich sah den Zipfel eines Halstuchs, das unter den Socken hervorlugte. Beherzt zog ich es hervor und legte es mir um. Dann fuhr ich mir mit den Händen durchs Haar und versuchte, es ein wenig zu richten.
Den Rücken gestrafft, stand ich vor dem Spiegel. Das bunte Tuch brüllte mir eine Fröhlichkeit entgegen, die so gar nicht zu meiner Stimmung passen wollte. Dennoch versuchte ich ein Lächeln, griff in meine Schminktasche und tupfte etwas Abdeckstift unter die Augen. Es würde schon gehen. Es musste einfach.
Frau Beck erwartete mich bereits in der Halle. Sie führte mich durch einen langgezogenen Flur, der an einer üppig verzierten Flügeltür endete. Ich folgte ihr hindurch. Vor mir öffnete sich ein prachtvoller Saal mit jeweils zwei Säulen rechts und links. In dessen Mitte stand eine Tafel, flankiert von acht Stühlen und zwei weiteren an Kopf- und Fußseite.
Frau Wilms stand an einem der vier bodentiefen Fenster, die auf den Rhein gerichtet waren, wandte sich bei unserem Eintreten um und musterte mich abschätzend. In ihren Augen lag ein Ausdruck, den ich nicht deuten konnte. Schließlich sagte sie: »Hannah, bitte nimm Platz.«
Ich stutzte. Sie nahm sich einfach heraus, mich beim Vornamen zu nennen? Der Widerspruch lag mir auf der Zunge, doch ich wagte es nicht, ihn auszusprechen und würgte ihn hinunter.
Ihre Lippen kräuselten sich kaum merklich. Sie wies auf einen Stuhl an der oberen Flanke des Tisches und steuerte dann auf den mir gegenüberliegenden Platz zu.
Verwundert nahm ich zur Kenntnis, dass nur zwei Gedecke darauf standen. Offenbar sollte Frau Beck bei unserem Gespräch nicht anwesend sein.
Tatsächlich wartete Frau Wilms, bis die Haushälterin das Abendessen aufgetragen und den Speisesaal verlassen hatte.
»Bitte«, sagte sie und wies auf die Schüsseln, die vor uns standen. »Bedien dich.« Sie nahm ihre Serviette und legte sie auf ihren Schoß.
Wir begannen unser Mahl zunächst schweigend, bis sie schließlich fragte: »Ist das Steak nach deinem Geschmack?«
»Danke, ja. Es ist sehr gut«, antwortete ich förmlich.
»Wir haben ja bereits ausgiebig telefoniert, Hannah. Deine Zeugnisse sind hervorragend, auch wenn es dir an Berufserfahrung mangelt, doch dazu bist du ja nun hier. Ich will ehrlich zu dir sein. Meine Großmutter … wie soll ich es ausdrücken?« Ihr Blick glitt für einen Sekundenbruchteil an mir vorbei. »Sie befindet sich zurzeit in einer schwierigen Phase. Sie kommt nicht damit zurecht, rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen zu sein. Das äußert sich zuweilen durch recht heftige Wutausbrüche, wie du sicher bereits gehört hast.«
Sie sah mich prüfend an und mir dämmerte, wer Urheber des Aufruhrs gewesen war. Das Scheppern, die Schreie.
»Das war sie?«
Frau Wilms schwieg.
»Sie ist also keine nette, alte Dame«, stellte ich mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton fest. Unterbewusst hatte ich es geahnt, seit ich der Taxifahrerin begegnet war. Ich war einer Lüge aufgesessen.
Ihre Miene war ausdruckslos, ihre Gedanken nicht zu erraten, als sie sagte: »Vielleicht war sie das einmal.« Sie verzog die Mundwinkel. »Um ehrlich zu sein, ist es inzwischen schwierig geworden, jemanden zu finden, der bereit ist, sich längerfristig um sie zu kümmern. Ich wundere mich, dass Frau Beck noch nicht gekündigt hat. Meine Großmutter hätte man niemals als einfachen Menschen bezeichnen können. Ihr Starrsinn wird nur noch durch ihren Stolz übertroffen, aber sie ist in keinem Fall boshaft.«
Mir blieb beinahe der Bissen im Halse stecken. Alles andere, nur nicht boshaft? Sollte mich das etwa beruhigen? Warum passiert so was ausgerechnet mir? Es war wie ein Fluch. Ich räusperte mich und als ich meine Sprache wiedergefunden hatte, sagte ich zweifelnd: »Und Sie glauben, ich könnte mit ihr fertig werden?«
»Das ist meine Hoffnung. Du bist einfühlsam, von sanfter Natur …« Ein schiefes Lächeln huschte über ihre Lippen. »… beinahe unterwürfig. Damit besitzt du Eigenschaften, die in absolutem Gegensatz zu denen meiner Großmutter stehen.«
In diesem Augenblick wurde mir klar, warum sie mich aus heiterem Himmel geduzt hatte. Es war ein Test, den ich in ihren Augen glanzvoll bestanden hatte. Ärger kroch in mir hoch. Ich fühlte mich ausgenutzt. Sie hatte keine Ahnung, warum ich zu der Person geworden war, die sie da beschrieb. Für mich waren gerade diese Eigenschaften zu einer absoluten Notwendigkeit geworden, um des puren Überlebens willen.
Ihre Augen ruhten auf mir. Ich sah die Herausforderung darin und wusste, worauf sie wartete. Aufspringen sollte ich, meine Serviette auf den Tisch werfen und sagen, dass sie dieses Spiel mit jemand anderem spielen solle, nicht mit mir. Doch die Konditionierung durch Dennis zeigte ihre Wirkung und fesselte mich beinahe buchstäblich an den Stuhl. Mir wurde augenblicklich bewusst, dass ich im Grunde keine Wahl hatte. Wo sollte ich schon hin? In ein Hotel? Ich? Vielleicht hatte Frau Wilms Recht? Eventuell war ich genau die richtige Wahl. Wenn jemand Frau Ockenfels kannte, dann ihre Enkeltochter. Vielleicht würde ich tatsächlich mit der alten Dame zurechtkommen. Wenn sie mich aufgrund meiner Art mochte, könnte ich hier ein gutes Leben führen. Nichts kann so schlimm sein …
»Du wirst Unterstützung von Frau Beck erhalten, da ich bereits morgen abreisen muss«, ergriff Frau Wilms wieder das Wort.
Langsam begann ich zu begreifen.
»Sie ist bereits seit mehreren Jahren in diesem Haushalt beschäftigt und wird dir anfangs zur Hand gehen, bis Helene sich an dich gewöhnt hat.«
Ihren Worten folgend, versuchte ich zwischen den Zeilen zu lesen. Meine Gedanken kreisten um ihre Abreise. Einer Ahnung folgend, hakte ich nach. »Sie wohnen nicht hier?«
»Nein, ich lebe mit meiner Familie in Hannover.« Ihr Blick strich in die Ferne, dann sagte sie: »Es ist nicht leicht, diesen Haushalt im Auge zu behalten, wenn man nicht ständig zugegen sein kann.«
Die Worte des Taxifahrers hingen zwischen uns: Ilona muss verzweifelt sein. »Entschuldigen Sie bitte meine Frage, aber warum wird sie nicht in einem Heim gepflegt?« Sofort spürte ich die Röte in meine Wangen schießen. War ich zu unverblümt? Durfte ich überhaupt eine solche Frage stellen?
Frau Wilms schien sich jedoch nicht zu wundern. Ihre Antwort klang freimütig. »Wenn du sie erst kennengelernt hast, wirst du sicher verstehen, warum dies nicht so einfach ist. Meine Großmutter ist fest davon überzeugt, keine Hilfe zu benötigen. Das macht die Sache nicht unbedingt leichter.
Es kommt täglich eine Frau vom Pflegedienst ins Haus. Jeweils morgens eine Stunde und eine weitere am Abend. Die übrige Zeit fällt in deinen Aufgabenbereich.« Sie legte ihr Besteck zur Seite und tupfte sich die Lippen formvollendet mit der Serviette ab. »Nun sind wir bereits in den Details angelangt. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich hinaufgehen, damit ich dich vorstellen kann.« Sie sah auf die Wanduhr und nickte. »Frau Gerber dürfte ihren Dienst beendet haben.«
Augenblicklich wurden meine Hände feucht. Die pure Aufregung, versuchte ich mir einzureden, doch mein Körper wusste es besser. Vorsichtig legte ich mein Besteck auf den Teller, damit es nicht unnötig klirrte und Frau Wilms womöglich auf meine seelische Verfassung aufmerksam machen würde.
Wir erhoben uns und verließen gemeinsam den Speisesaal. In der Halle trafen wir erneut auf Frau Beck, die irgendwie verdrießlich dreinblickte und gerade im Begriff war, einige Putzutensilien im Schrank unter der Treppe zu verstauen. Unwillkürlich musste ich an den noch gedeckten Tisch denken und nahm mir fest vor, ihn selbst abzuräumen, sobald ich mit ihr allein in diesem Haus leben würde. Dieser Gedanke überraschte mich, zeigte er mir doch, dass ich begonnen hatte, mir ein Leben an diesem Ort vorzustellen. Die einzigen Dinge, die zwischen mir und dieser Zukunft standen, waren Helene Ockenfels und meine Furcht vor ihr.
Die Stufen knarrten unter unseren Schritten, als wir hinaufgingen. Im Flur wandte sich Frau Wilms nach rechts, öffnete die Tür zu einem weiteren dunklen Gang und schaltete das Licht ein. Vor einer massiven Zimmertür blieb sie stehen. Sie drehte sich zu mir um und sah mich an. »Bist du bereit?«
Ich hätte am liebsten Nein gesagt. Stattdessen nickte ich und versuchte, mir meine Furcht nicht anmerken zu lassen.
Sie drückte die Klinke, die Tür knarrte und schwang schließlich nach innen.
Ich folgte ihr in den düsteren Raum, der sich vor uns ausbreitete. Schwere Teppiche dämpften unsere Schritte. Die Vorhänge waren zugezogen. Gegenüber der Tür stand ein gewaltiges Bett. Ich hatte keinen Blick für die kunstvollen Intarsien. Meine Augen glitten über die Bettdecke. Darin eingewickelt lag eine Person, spärlich beleuchtet von einer kleinen Lampe auf dem Nachttisch, die ein diffuses Licht verströmte.
»Großmutter?« Ilonas Stimme klang wie ein heiseres Flüstern. Sie räusperte sich. »Großmutter?«
Der durchdringende Blick, der mich traf, fuhr mir bis ins Mark. Die Ähnlichkeit war frappierend. Harte blaue Augen, wie die von Dennis. In diesem Blick lag abgrundtiefer Hass.
Kapitel 3
Ich zwang mich, näher hinzusehen, die tiefen Falten um Helenes Augen wahrzunehmen, die von dem diffusen Licht weichgezeichnet wurden. Erst als ich die dunklen Ringe unter ihren Augen sah, ihren aschfahlen Teint mit ihrem Alter verknüpfte, löste sich das erschreckende Bild von Dennis’ stahlblauen Augen in Rauch auf. Dennoch konnte ich die Kälte, die von Helene ausging, deutlich spüren, und ein unangenehmes Kribbeln rieselte mir den Rücken hinab.
Helene stöhnte leise, als sie sich in die Kissen stemmte und vergeblich versuchte, sich aufzusetzen.
In diesem Augenblick wirkte die knorrige Frau auf mich derart klein und zerbrechlich, dass sie mein Mitleid erregte.
Ilona eilte ihr zu Hilfe. »Großmutter, ich möchte dir Hannah Abel vorstellen. Sie soll dir von nun an zur Seite stehen und dir helfen, wenn Frau Gerber nicht zugegen ist«, sagte sie.
Die alte Dame verzog mürrisch die Lippen, ihre Augen verengten sich, als sie mich musterte. Gleichzeitig schlug sie mit der Hand nach Ilonas Arm, als wollte sie eine lästige Fliege verscheuchen. Ihre Stimme klang wie ein jahrhundertealtes Reibeisen, als sie sprach: »Geh weg. Ich kann das durchaus noch allein.« Endlich rappelte sie sich auf, strich sich die wirren Haare aus dem Gesicht und sah mich unverwandt an. »Hast du es also am Ende doch noch geschafft?«
Ich verstand nicht. Was hatte ich geschafft? Wusste sie von meiner Flucht? Woher? All diese Fragen schossen mir in Sekundenbruchteilen durch den Kopf, während ich bemüht war, ihrem Blick standzuhalten, doch dann begriff ich, dass ihre Frage Frau Wilms gegolten hatte und nicht mir.
Diese seufzte und antwortete: »Ich kann nicht nachvollziehen, warum du mir unnötig Schwierigkeiten bereitest. Ich kann nicht hier in Remagen bleiben. Das weißt du.«
Ihr Blick entließ mich und richtete sich auf Frau Wilms. »Das musst du nicht, junge Dame. Sage mir geradeheraus, dass du zu faul bist, dich um mich zu kümmern, dann wirst du enterbt wie alle anderen. Dann habe ich meine Ruhe.«
»Sprich nicht so zu mir. Das ist unrecht. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um dir beizustehen.«
»Ich spreche, wie es mir passt und dein geschraubtes Gequatsche kannst du dir sparen. Du bist nichts Besseres als ich!«, ereiferte sich die alte Helene. »Was macht dich so sicher, dass diese kleine Maus da …«, sie nickte in meine Richtung, »… bleiben wird?« Wieder taxierte sie mich, dann erklang ein verächtliches Schnauben. »Sie wird genauso Reißaus nehmen wie all die anderen, die du angeschleppt hast. Da gehe ich jede Wette ein.«
Ich wagte gar nicht, mich einzumischen. Jedes noch so geringe Zittern in meiner Stimme würde mich verraten, denn so wie ich sie einschätzte, war sie eine sehr aufmerksame Beobachterin. Dessen war ich mir jetzt schon absolut sicher.
Die Alte legte den Kopf schräg und zog die Brauen zusammen. »Das wäre nun Ihr Auftritt gewesen, Fräulein Abel. Der Moment, in dem Sie mir Honig ums Maul schmieren, mir beteuern, dass Sie nicht vorhaben abzuhauen und dass wir sicherlich gute Freundinnen werden …« Helene lehnte sich kaum merklich vor, doch mir entging es nicht. »… aber Sie widersprechen mir nicht? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?« Ihre Augen verengten sich. »Ich habe Sie praktisch beleidigt und Sie sagen immer noch kein Wort?«
Ich fühlte mich wie ein in die Enge getriebenes Kaninchen, dem bewusst wird, dass der Fuchs nur noch nach der empfindlichsten Stelle sucht, um zuzubeißen.
Frau Wilms brach das erwartungsschwangere Schweigen und kam mir damit zu Hilfe. »Genau das ist der Grund, warum ich glaube, dass sie bleiben wird.« In ihrer Stimme schwang ein gewisser Triumph.
»Wir werden sehen«, sagte Helene und ließ sich zurück in die Kissen sinken. »Wir werden sehen.«
Damit waren wir entlassen. Ilona beugte sich über die alte Dame und strich die Bettdecke glatt, dann nickte sie mir zum Zeichen, dass es an der Zeit war zu gehen.
Ich überwand die wenigen Schritte zur Tür, setzte einen Fuß über die Schwelle, als ich erneut angesprochen wurde.
»Wie wäre es mit einer Wette, Fräulein Abel?«, klang es vom Bett herüber.
Frau Wilms zischte mir kaum hörbar zu: »Nicht darauf eingehen.«
Irritiert wandte ich mich zu Frau Ockenfels um, aber schwieg.
»Ich wette, dass Sie gleich morgen früh ihren Koffer packen.«
Wir sahen uns in die Augen, keine gab nach, und ich fühlte eine ungeahnte Stärke in mir wachsen. Diese alte Frau hatte doch keine Ahnung, was es für mich bedeuten würde, hier zu versagen. Ich konnte nicht zurück. Niemals. In einem Anflug von Wahnsinn sagte ich: »Was ist Ihr Einsatz?« Ich hörte neben mir das Seufzen von Frau Wilms, ignorierte es aber beflissentlich.
Die Brauen der alten Dame zuckten in die Höhe. In ihren Augen lag sanfter Spott, als sie den Mund zu einem breiten Grinsen verzog. Ich hörte ein schmatzendes Geräusch, dann sagte sie: »Ums Recht?«
Das Herz schlug mir bis zum Hals. »Das ist mir zu wenig«, sagte ich und verließ den Raum beinahe fluchtartig ob meiner Kühnheit.
Während Frau Wilms die Tür hinter uns zuschob, drang Helenes Ruf durch den Spalt: »Sie wären nicht die Erste, die Angst vor Geistern hat!«
Kapitel 4
Was war nur in mich gefahren? Hatte ich das wirklich getan? Ich bemerkte den kurzen Seitenblick von Frau Wilms, doch sie sagte kein Wort. Der Ruf der alten Dame ließ mir keine Ruhe.
»Wie hat sie das gemeint?«, fragte ich schließlich, als wir den Gang entlang in Richtung Treppenhaus schritten.
Sie winkte ab. »Ich sagte doch, geh nicht darauf ein. Es ist einer der ältesten Tricks der Menschheit. Pflanze die Saat der Angst in die Seele deines Gegners, und er wird ihr erliegen.«
Ich dachte über ihre Worte nach und als wir in das elektrische Licht des Flurs traten, sah ich, wie Frau Wilms mich betrachtete. Scheinbar machte ich auf sie nicht den Eindruck, als würde ich verstehen, worauf sie anspielte. Sie blieb mitten im Flur stehen und lächelte nachsichtig.
»Das ist psychologische Kriegsführung«, fuhr sie fort. »Sagt dir der Begriff selbsterfüllende Prophezeiung etwas?«
Kopfschüttelnd gab ich zu, dass ich davon noch nie etwas gehört hatte.
»Das Prinzip ist denkbar einfach. Prognostiziere eine abwegig erscheinende Situation, und sie wird durch die dadurch hervorgerufene Reaktion eintreten.«
Ich verstand nur noch Bahnhof.
»Was hat sie dir nachgerufen?«
»Dass es hier Gespenster gibt«, sagte ich zögernd.
Sie schnaubte. »Das ist es, wovon ich spreche. Sie hat nichts dergleichen gesagt. Der genaue Wortlaut war: Sie wären nicht die Erste, die Angst vor Geistern hat. Erkennst du die Diskrepanz?«
Verblüfft stellte ich fest, dass Helenes tatsächlicher Wortlaut und das, was bei mir angekommen war, unterschiedlicher nicht hätten sein können. Wie war das nur möglich? Ohne dass ich die Frage stellen musste, gab Frau Wilms mir die Antwort.
»Durch ihre Aussage hat sie nicht nur impliziert, dass es Geister gibt, sondern obendrein, dass sie in diesem Haus ihr Unwesen treiben. Und was hat sie damit erreicht?«
Langsam begriff ich, was sie meinte. »Dass ich diese Nacht in meinem Bett liegen und auf jedes Geräusch lauschen werde.«
»Korrekt. Auch wenn du nicht an Geister glauben solltest, wirst du dich nun fragen, was dich in der Nacht erwartet. Diese Erwartungshaltung führt dazu, dass du eine der schlimmsten Nächte in deinem Leben verbringen wirst. Das schließt jedes kleinste Geräusch, jeden knarrenden Dachbalken, das Pfeifen des Windes mit ein. Die Konsequenz daraus ist, dass du morgen deine Sachen zusammenpackst und uns verlässt, da du dich vor einer weiteren Nacht in diesem Haus fürchten wirst.«
»Und damit hat sie ihre Wette gewonnen«, fasste ich zusammen. Ich kam mir so unglaublich dumm vor. »Aber wieso macht sie so was? Ich verstehe das nicht. Sie kennt mich doch gar nicht.«
»Es geht nicht um dich persönlich«, sagte sie und es klang resigniert.
Ja, richtig. Ihr Einsatz verriet, worum es ging. »Sondern ums Recht.«
Frau Wilms nickte. »Abgesehen davon, dass sie keine Hilfe will, was du mit Sicherheit nicht übersehen hast, beschrieb ich sie dir bereits als starrsinnig.«
»Wie viele?«, fragte ich unvermittelt und erwischte Frau Wilms ganz offensichtlich auf dem falschen Fuß. Sie hob die Brauen und sah mich fragend an.
»Wie viele hat sie schon in die Flucht geschlagen?«
»In der ersten Nacht?« Sie zögerte, dann blickte sie zu Boden wie ein ertapptes Kind. »Drei. Zwei weitere hielten eine ganze Woche durch, bevor sie kündigten.« Sie sah zu mir auf, schien in meinem Gesicht nach Verständnis zu suchen.
Ich konnte die Verzweiflung in ihren Augen lesen.
Mit einem Seufzen fuhr sie fort: »Ich will Helene nicht im Stich lassen, aber wenn sie mich dazu zwingt, werde ich es müssen. Ich kann meine Familie nicht aufgeben.«
Mein erster Eindruck hatte mich getäuscht. Sie war nicht die überhebliche Arbeitgeberin, wie ich geglaubt hatte. Im Gegenteil. Ihre Situation war genauso eingefahren wie meine. Sie bemühte sich, eine Lösung zu finden und war bislang kläglich gescheitert. Hin- und hergerissen zwischen der Sorge um ihre Großmutter und der Liebe zu ihrer Familie, hatte sie offenbar keinen anderen Weg gesehen, als mich unter falschen Voraussetzungen hierher zu locken.
Es war Mitleid, das mich zu einem sanften Lächeln veranlasste. »Ich kann Sie verstehen. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nie an Geister geglaubt«, sagte ich, um sie zu beruhigen und wunderte mich über mich selbst, wie glatt mir diese Lüge über die Lippen geschlüpft war.
Erleichterung legte sich über ihre Gesichtszüge. »Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Du solltest dir trotzdem bewusst machen, dass Helene versucht hat, dich zu manipulieren. Vielleicht sollten wir gemeinsam noch einen Cognac zu uns nehmen, bevor wir den Abend schließen?«
Bei diesen Worten zuckte ich zusammen. In meinen Gedanken sah ich Dennis auf mich zuwanken, die Hand zu einer Faust geballt, hoch erhoben über seinem Kopf. »Ich trinke nicht«, sagte ich und augenblicklich wurde mir bewusst, wie harsch die Ablehnung in meinen eigenen Ohren klang. »Ich bekomme davon Sodbrennen«, beeilte ich mich zu erklären.
Ihr Blick verriet mir, dass sie mir nicht glaubte, aber es war ganz offensichtlich, dass sie entschied, nicht näher darauf einzugehen, denn sie zuckte mit den Schultern und wünschte mir eine gute Nacht. »Vergiss nicht: selbsterfüllende Prophezeiung, nichts weiter«, sagte sie, als sie die Treppe hinabging.
Ich ließ die Zwischentür geöffnet, tauchte in den schwach beleuchteten Gang ein, der zu meinem Zimmer führte und sann über Frau Wilms’ Worte nach. So, wie sich die Lage darstellte, hatte die alte Dame diese Psychospiele bereits an meinen Vorgängerinnen getestet. Wenn das zutraf, dann gab es keine Gespenster. Zumindest nicht hier.
Ich blieb vor meiner Zimmertür stehen, schüttelte den Kopf über meine eigene Naivität und drückte die Klinke.
Was für ein Gedankengang. Mit Logik hatte das jedenfalls nichts zu tun.
Die Tür rührte sich keinen Millimeter. Das Licht im Flur verlosch. Wie erstarrt stand ich auf der Schwelle, versuchte erneut, die Tür zu öffnen, doch sie weigerte sich nach innen zu schwingen. Ich drehte mich auf dem Absatz um und rief nach Frau Wilms. »Können Sie bitte das Licht wieder einschalten?«
Keine Antwort.
»Frau Wilms!«
Ich hörte Schritte in der Halle, doch da war noch etwas anderes. Ein scharrender Laut, rhythmisches Atmen. Jemand war hier. In unmittelbarer Nähe.
»Frau Wilms?«
Mein Herz pochte mir bis zum Hals. Vollkommen blind tastete ich die Wand nach einem weiteren Lichtschalter ab. »Wer ist da?«
Ein hölzernes Knacken. Ich fuhr herum. Ein kalter Luftzug erfasste mich. Ich schrak davor zurück. Die Türklinke bohrte sich schmerzhaft in mein Kreuz. Rücklings umklammerte ich sie, stemmte mich gegen das Holz. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich konnte nicht schreien.
Hektisches Scharren, ein knurrender Laut. Abermals drückte ich die Klinke, stieß dieses Mal fest mit der Schulter gegen das Holz. Die Tür sprang auf. Hastig stolperte ich hinein, wirbelte herum, knallte das Blatt in die Zarge. Hektisch fingerte ich nach dem Schlüssel. Das leise Knacken im Schloss klang wie eine Erlösung. Hier kam niemand mehr herein. Mit zitternden Fingern drückte ich den Schalter und tröstliche Helligkeit flutete mein Zimmer. Ich war allein.
Vollkommen aufgewühlt rutschte ich rücklings am Holz der Tür herunter, bis ich auf den nackten Dielen saß. Mein Atem ging stoßweise, mein ganzer Körper bebte.
Hinter meinem Rücken kratzten scharfe Krallen über das Holz. Mir stellten sich die Nackenhaare auf. Fluchtartig hechtete ich von der dünnen Tür fort. Was auch immer draußen lauerte, es wollte herein.
Kapitel 5
Ich saß mit angezogenen Knien auf dem Teppich vor meinem Bett. Auch wenn ich meinen Kopf gesenkt hatte, sodass mir die Locken ins Gesicht fielen, ließ ich die Türklinke keinen Moment aus den Augen aus Angst, sie könnte sich abwärts bewegen. Angestrengt lauschte ich auf jedes Geräusch. Ich wusste, dass ich abgeschlossen hatte, aber das Holz schien mir in meiner Erinnerung so unglaublich dünn zu sein.
Die kratzenden Laute waren verstummt. Stattdessen glaubte ich, ein Schnauben zu hören. Oder hielten mich meine Ohren zum Narren und es war nur mein eigener Atem, der sich stoßweise aus meiner Kehle wand?
Ich kreuzte die Arme und rieb mir die Schultern, wiegte mich kaum merklich vor und zurück wie ein verängstigtes Kind. Ich würde warten. So, wie ich es immer getan hatte. Einfach warten, bis es vorbei war …
»Hannah?«
Ich fuhr zusammen.
»Hannah? Ist alles in Ordnung?«, hörte ich Frau Wilms und ihre Stimme klang besorgt.
Ich wusste nicht, wie lange ich schon zusammengekauert auf dem Teppich gesessen hatte. Nichts war in Ordnung. Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt noch einen Ton herausbringen konnte, um ihr zu antworten. Ich räusperte mich vorsorglich und sagte dann laut und deutlich: »Nein.«
Frau Wilms drückte die Klinke, rüttelte an der Tür. »Warum hast du dich denn eingeschlossen? Hannah?«
Was sollte ich darauf schon antworten? Ich versuchte aufzustehen; meine Beine fühlten sich an, als wären sie aus Pudding.
In meinen Gedanken formten sich die Worte: Vielleicht, damit mich das Monster nicht fressen kann? Ich sagte keinen Ton. Ich hörte Frau Wilms hinter der Türe schimpfen. Allerdings galt ihr Fluchen nicht mir, sondern sie sagte etwas von kalt und verrückt.
Endlich schaffte ich es auf wackligen Beinen zur Tür. Zögernd hielt ich inne, dann schalt ich mich selbst. Frau Wilms wäre sicherlich angegriffen worden, wäre diese geisterhafte Kreatur noch draußen im Flur. Ich drehte den Schlüssel und zog an der Tür, doch das Holz schien verzogen, denn ich schaffte es erst im zweiten Versuch. In meiner Erinnerung formte sich das Bild, wie ich mich dagegen geworfen hatte. Endlich öffnete ich sie einen Spalt breit, gerade genug, um hinaus zu spähen.
Frau Wilms stand im Gang und drückte mit Gewalt gegen den Fensterflügel. Ein weiterer Ruck, und das Holz fügte sich in den Rahmen. Sie drehte den Knauf, dann wandte sie sich zu mir um. »Hast du das Fenster geöffnet?«
Ich trat zu ihr hinaus. Fröstelnd rieb ich mir die Arme, starrte auf den Rahmen und schüttelte irritiert den Kopf.
»Nun, vielleicht war es nicht recht verschlossen …«, sagte Frau Wilms, »… und der Wind hat es aufgedrückt.«
Während ich das Fenster musterte, hörte ich in meinen Gedanken Holz knacken. Danach hatte ich in kalter Zugluft gestanden.
Sie sah mich forschend an. »Du hast nach mir gerufen. Was ist denn geschehen?«
»Das Licht ging plötzlich aus und …« Ich wagte nicht, sie anzusehen. »Es war stockdunkel«, murmelte ich beschämt.
»Aber natürlich«, sagte sie. »Das große Flurlicht funktioniert per Schaltung. Es verlischt automatisch.«
Ihr Blick wanderte zur Decke. »Aber du hast Recht, ich hätte daran denken sollen. Die Leuchte hier im Gang ist schon seit Wochen defekt. Es ist wirklich höchste Zeit, sie instand zu setzen. Es bestand nur bisher keine Veranlassung, da dieser Flügel vor deiner Ankunft nicht genutzt wurde.«
»Wo haben denn die anderen Pflegerinnen gewohnt?«
Sie verzog die Lippen und es klang kleinlaut, als sie sagte: »Im Dachgeschoss.«
Sie wandte sich von mir ab und ging Richtung Flur. Unsicher, ob ich ihr folgen sollte, trat ich ihr wenige Schritte nach, bis sie am Durchgang stehen blieb und um die Ecke fasste. Man hätte das leise Klicken des Schalters überhören können, doch mir dämmerte in diesem Moment, was sie tat.
Zu meiner Bestätigung sah sie mir entschuldigend entgegen und kommentierte: »Sonst stehen wir gleich wieder im Dunkeln.«
»Selbsterfüllende Prophezeiung«, murmelte ich mehr zu mir selbst. Ich kam mir so unglaublich dumm vor.
»Bitte?«
Statt meine Worte zu wiederholen, sagte ich zerknirscht: »Es war vielleicht einfach zu viel für einen Tag. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie extra wegen mir noch einmal heraufkommen mussten.«
Sie winkte mit einer Geste ab, die man immer noch hätte elegant nennen können. »Da der Cognac zur Neige gegangen ist, wollte ich ohnehin zu Bett gehen«, sagte sie gnädig und lächelte mir aufmunternd zu.
»Danke«, sagte ich schlicht. Es war mir bewusst, dass es nun an der Zeit war, in mein Zimmer zurückzukehren. Trotz der rationalen Erklärungen zögerte ich einen Augenblick.
Sie schien es zu bemerken, denn sie wurde plötzlich ernst. »Ich kenne deine Not nicht, Hannah, aber ich hoffe inständig, dass du uns eine Chance gibst.« Sie zog die Stirn kraus, dann überlegte sie laut: »Vielleicht sollte ich dir noch einige Tage zur Seite stehen, bevor ich zu meiner Familie reise.«
Wir standen uns gegenüber, unsere Blicke trafen sich. In diesem Augenblick erkannte ich, dass wir beide auf unsere eigene Weise dem Schicksal ausgeliefert waren. Sie, gefangen im Haus ihrer Großmutter, die es galt, in Zukunft versorgt zu wissen. Es war mehr als deutlich, dass ihr nichts lieber war, als bei ihrer Familie zu sein.
Auf der anderen Seite ich, die nicht zurück wollte in ein Leben, das meinem Selbstvertrauen mehr als geschadet hatte.
Meine Furcht war es, die zwischen der Erfüllung unserer Wünsche stand. Ich nahm all meinen Mut zusammen, zwang meine Stimme in ein festes Gewand, als ich sagte: »Geben Sie mir die Chance, mich einzuleben und ich werde Sie nicht enttäuschen.«
Frau Wilms nickte stumm, und ich sah in ihren Augen die Hoffnung glimmen. »Gute Nacht, Hannah«, sagte sie und ging. Sie drückte noch einmal auf den Lichtschalter, wandte sich zu mir um und lächelte mir zu. Dann sah ich sie quer durch das Treppenhaus gehen, bis sie am gegenüberliegenden Ende in den Gang trat und die Tür hinter sich schloss.
Ich ging zurück zu meinem Zimmer. Die Tür stand immer noch offen, genau so, wie ich sie verlassen hatte. Von außen zog ich sie in die Zarge, um mich noch einmal zu vergewissern, wie schwergängig sie war. Ich stellte mir vor, das Licht würde verlöschen, hörte in Gedanken das Holz des Fensters knarren und drehte mich um. Ich hatte in der kalten Zugluft gestanden und dann versucht, die Tür zu öffnen. Ich drückte die Klinke, lehnte mich sanft gegen das Blatt, doch wie erwartet rührte es sich nicht. Diesmal trat ich gegen das Holz, um meine Schulter zu schonen; die Tür sprang auf.
Während ich dachte: Guten Abend, mein Name ist Hannah Feiglingund es gibt keine Geister, wanderte mein Blick ans untere Ende der Tür. Mein Atem geriet ins Stocken. Auf dem Holz waren eindeutig frische Kratzspuren zu erkennen.
Kapitel 6
Als ich am nächsten Morgen erwachte, waren die Schatten der vergangenen Nacht einem sonnigen Tag gewichen. Verwundert sah ich auf die Uhr und stellte fest, dass ich trotz der Ereignisse am letzten Abend irgendwann doch noch in den Schlaf gefunden hatte. Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, etwas geträumt zu haben. Vermutlich war es pure Erschöpfung gewesen, die mich hatte schlafen lassen. Und nicht nur das, es war bereits später Vormittag. Das würde mit Sicherheit keinen guten Eindruck hinterlassen, wenn ich so lange im Bett verbrachte. Ich sprang beinahe in meine Jeans. In Windeseile knöpfte ich meine Bluse zu, warf einen prüfenden Blick in den Spiegel und schnappte mir den Kulturbeutel vom Nachtschränkchen.
Ein Badezimmer; Frau Beck hatte mir gar nicht gezeigt, wo sich eines befand. Und nach den Ereignissen am Vorabend hatte ich mein Zimmer nicht noch einmal verlassen wollen. Es half nichts. Da ich die Haushälterin nicht bemühen wollte, beschloss ich, es auf eigene Faust zu suchen. Weit konnte es schließlich nicht sein.
Ich trat aus meinem Zimmer in den mit Licht durchfluteten Zwischenkorridor. Bei Tage betrachtet wirkte er überhaupt nicht beängstigend. Das Flurfenster war fest verschlossen, das Haus war angenehm warm. Ich drehte mich auf dem Absatz um und ging in die Hocke. Mit einer Hand fuhr ich die Kratzer an der Tür nach. Tiefe Riefen, aber waren sie wirklich frisch? Ich war mir nicht sicher. Es gab einen Farbunterschied, ja. Aber hätte ich wirklich Stein und Bein darauf beschwören können, dass sie nicht schon länger im Holz gewesen waren? Aber das Kratzen. Das konnte ich mir unmöglich eingebildet haben. Die schlimmste Nacht in meinem Leben; Zeit, die Koffer zu packen, dachte ich und schauderte bei der Vorstellung. Ich kann nicht zurück. In diesem Augenblick war meine Entscheidung gefallen. Ich würde nicht aufgeben. Es gab sicher eine Erklärung für die Geräusche, vielleicht hatte ich sie mir in meiner Panik auch nur eingebildet. Ich wollte nicht auf die selbsterfüllende Prophezeiung hereinfallen. Irgendwie musste ich mich mit der alten Helene arrangieren. Ich musste nur einen Weg finden, mich hier einigermaßen heimisch zu fühlen, dann würde auch meine Furcht verschwinden. Entschlossen richtete ich mich auf, straffte den Rücken und ging zum Fenster. Ich sah hinaus.
Die Sonne lugte über die verschneiten Baumwipfel, Vögel zwitscherten und ein Eichhörnchen sprang geschickt durch die Zweige. Unten stand Frau Beck in ihrer Küchenschürze und unterhielt sich mit einem Mann, der in einen dicken Parka gekleidet war. Seine Handschuhe umschlossen den Stiel einer Schneeschaufel. Ein Windstoß strich durch die Bäume und blies Schnee von den Zweigen, der sanft zu Boden segelte.
Der Mann wuschelte sich durch das schwarze Haar, schüttelte den Kopf und sah auf.
Unsere Blicke trafen sich, er wirkte verdutzt.
Frau Beck schaute ebenfalls herauf, ich setzte einen Fuß rückwärts und sah zu, dass ich vom Fenster verschwand. Irgendwie fühlte ich mich ertappt. Ich konnte noch ihre Stimmen hören, ein kurzer Wortwechsel nur, dann verstummten sie und wenige Augenblicke später wurde eine Tür geschlossen.
Ob Frau Beck zu mir heraufkommen würde? Mich womöglich fragen, ob ich sie belauscht hätte? Ich besann mich auf das Badezimmer, das ich hatte suchen wollen. So konnte ich mich aus dem Staub machen und hoffen, dass sie den Vorfall bei einer späteren Begegnung vielleicht vergessen haben würde. Gleich zu meiner Linken befand sich eine Tür, die etwas schmaler wirkte als die anderen. Ich ging darauf zu und drückte die Klinke.
Begleitet von einem knarrenden Geräusch, schwang die Tür nach innen und offenbarte mir ein betagtes, dennoch geräumiges Badezimmer. Es gab eine halbwegs moderne Dusche, einen Waschtisch mit kupferfarbener Armatur und eine Toilette mit hölzernem Sitz und rosa Plüschauflage.
Unwillkürlich kräuselte ich die Lippen. So hochwertig, geradezu einschüchternd prunkvoll die Villa im Grunde war, es gab die ein oder andere Ecke, die einer umfassenden Renovierung bedurfte. Beruhigend. Vielleicht gefiel mir dieses Bad genau aus diesem Grunde so gut. Konnte allerdings auch an dem rosa Plüsch liegen, der eigentlich so gar nicht meinem Geschmack entsprach und doch einen Hauch von Altbekanntem in mir weckte.
Ich warf einen Blick in den Spiegel über dem Waschbecken, ignorierte die dunklen Ringe unter meinen Augen und öffnete nacheinander die drei Türen. Es war offensichtlich, dass niemand dieses Bad benutzte, denn das Schränkchen war zur Gänze leer. Ich sortierte meine Waschutensilien auf die Plastikregale und entschloss, mich doch noch schnell unter die Dusche zu stellen.
Kaum zwanzig Minuten später verließ ich das kleine Bad und begab mich durch den Flur Richtung Treppenhaus. Auf dem oberen Treppenabsatz angelangt, wollte ich gerade die Stufen hinabgehen, als ich einen Einfall hatte.
Ich kehrte um und schlenderte durch den kleinen Flur, der zu Helenes Zimmer führte. Vor ihrer geschlossenen Zimmertür hielt ich inne. Sollte ich wirklich? Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ihr einen guten Morgen zu wünschen, zumal es schon beinahe Mittag war. Andererseits, wenn ich ihr zeigte, dass ich nicht vollkommen verängstigt die Koffer gepackt hatte … Dass dazu nicht gerade viel gefehlt hatte, konnte sie schließlich nicht wissen. Unentschlossen trat ich von einem Bein auf das andere. Bei dem Gedanken an ihren eisigen Blick krampfte sich mein Magen schmerzhaft zusammen. Ich würde mich in ihrer Gegenwart wieder fühlen wie eine verängstigte Maus.
Langsam hob ich eine Hand und legte sie federleicht auf den Türgriff. Er fühlte sich kühl an. Meine Finger schlossen sich um das Metall. Mit der anderen Hand klopfte ich zögerlich. Nichts regte sich. Ich klopfte beherzter, doch wiederum bekam ich keine Antwort.
Ich nahm all meinen Mut zusammen und drückte die Klinke. Zögernd schob ich die Tür auf, einen Spalt nur, dann etwas weiter, bis ich hineinspähen konnte.
Das Bett war leer. Zerwühlt zwar, doch die alte Helene Ockenfels war nicht zu sehen. Vorsichtig öffnete ich die Tür zur Gänze und trat schließlich über die Schwelle.
Im Gegensatz zum vorigen Abend wirkte der Raum freundlich. Die schweren Vorhänge waren weit geöffnet und die Sonne flutete herein. Gleich vor dem Fenster standen ein runder Kaffeetisch und zwei orangebraune Clubsessel aus den 60er Jahren. Der rechteckige Raum wurde jedoch beherrscht von dem schweren Bett aus dunkelrotem Mahagoni. Über dessen Kopfende hing ein Wandteppich, der ein üppig verziertes Jugendstilmotiv zeigte. Flankiert wurde es von zwei antiken Nachtschränkchen, die allerdings wesentlich edler wirkten als mein eigenes. In einer Erkernische zu meiner Linken stand ein Sekretär, dessen Abdeckung geschlossen war. Davor ein fein geschnitzter Stuhl mit altroséfarbenem Sitzbezug und einer Lehne aus glänzendem Samt. Die Wände waren halbhoch mit Holz vertäfelt, schlossen mit einem schmalen Sims und gingen dann über in eine fein gemusterte, helle Tapete. Das Zimmer wirkte gemütlich, wenn auch zu gediegen für meinen Geschmack. Ein schwerer Kleiderschrank und eine Schminkkommode mit dreiflügeligem Spiegelaufbau rundeten den Gesamteindruck ab. Als ich näher an das verwaiste Bett herantrat, wurden meine Schritte durch einen dicken, hellen Teppich gedämpft und ich fühlte mich, als ob ich etwas Verbotenes tat. In Gedanken hörte ich Dennis’ Stimme sagen: Was schleichst du hier herum? Habe ich dir deine Spioniererei immer noch nicht ausgetrieben?
Ein unangenehmes Kribbeln britzelte mir im Nacken, doch ich widerstand dem instinktiven Zwang, den Kopf einzuziehen und mich umzudrehen. Er war nicht hier. Ich stand in dem riesigen Schlafzimmer der Helene Ockenfels und war allein. Vollkommen allein.
Auf der antiken Kommode, wenige Schritte entfernt vom Bett, sah ich einen silbernen Bilderrahmen. Darin steckte ein Schwarzweißfoto. Meine Neugierde war geweckt. Da ich mich unbeobachtet glaubte, trat ich heran und nahm das Bild genauer in Augenschein. Es zeigte das Portrait einer jungen Frau im Halbprofil. Sie trug lediglich einen dunklen Pelz, der so drapiert war, dass wie zufällig eine Schulter entblößt wurde. Der lasziv wirkende Blick der hellen Augen war leicht nach oben gerichtet und doch dem Betrachter zugewandt. Ihr Scheitel wurde von einer mit Diamanten besetzten Libelle gehalten. Die Sinnlichkeit des Fotos wurde vom offenen, blonden Haar unterstrichen, das sich wie eine weiche Welle über den schwarzen Pelz ergoss. Die Frau wirkte wunderschön. Sie war perfekt geschminkt, und das ganze Arrangement der Aufnahme erinnerte an Portraits von Hollywoodstars der dreißiger Jahre.
Hatte Frau Ockenfels in jungen Jahren so ausgesehen? Unglaublich. In Gedanken hörte ich das Klicken einer Kamera, malte mir aus, wie Helene für den Fotografen posierte, Anweisungen erhielt aufzusehen, die Pose zu wechseln, das Haar zu schütteln. Ich wollte das Foto näher betrachten und streckte gerade meine Finger nach dem Rahmen aus, als ich von unten eine Stimme hörte.
»Frau Abel?«
Es war Frau Beck.
Eilig hastete ich aus Helenes Zimmer und schloss leise die Tür hinter mir, als sie auch schon erneut nach mir rief.
»Frau Abel!«
»Ja?«, antwortete ich und trat aus dem Zwischenflur heraus. Ich schlenderte unauffällig zum Treppenabsatz und blickte in die Halle hinunter.
Frau Beck stand schon auf halber Höhe und als sie mich sah, runzelte sie die Stirn. »Haben Sie mich denn nicht rufen hören?«, fragte sie und in ihrer Stimme lag ein leicht verärgerter Unterton.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte ich und gab dann zu: »Ich wollte zu Frau Ockenfels, um sie zu fragen, ob sie etwas braucht, aber sie ist nicht in ihrem Zimmer.«
Die Brauen der Haushälterin hoben sich und die Überraschung stand ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. »Oh«, sagte sie und ihre Stimme klang sanfter, als sie fortfuhr: »Nein, um diese Uhrzeit ist Frau Ockenfels im Wintergarten bei einer Tasse Tee.«
Langsam ging ich die Stufen zu ihr hinunter und als ich sie beinahe erreicht hatte, fragte ich: »Gibt es für Frau Ockenfels einen festen Tagesablauf?«
»Minutiös«, sagte die Haushälterin und verzog die Lippen. »Anderenfalls würde hier das bloße Chaos ausbrechen.« Frau Beck musterte mich geringschätzig. »Sie werden sich hier an einiges gewöhnen müssen.« Kopfschüttelnd fragte sie: »Warum tun Sie sich das an? Gab es keine andere Anstellung für Sie? Ich würde mir das gut überlegen, wenn ich Sie wäre.«
Verdutzt forschte ich in ihrem Gesicht. Sie war schließlich nicht die erste Person in Remagen, die mir nahelegte, von hier zu verschwinden. Ich hatte geglaubt, dass gerade sie froh wäre, jemanden zu haben, der ihr mit Frau Ockenfels half. Schließlich bestritt sie den Tag hier in der Villa bisher vollkommen allein, wenn Ilona Wilms in Hannover war. Wieder einmal fühlte ich mich abgelehnt, geradezu unwillkommen. Dass die alte Frau Ockenfels so reagierte, ja, das konnte ich halbwegs nachvollziehen. Aber Frau Beck? War ich in ihren Augen lediglich ein junges Küken? Traute sie mir schlicht den Umgang mit der alten Dame nicht zu?
Wortlos ging ich an ihr vorbei die letzten Stufen hinab und zog es vor, nicht auf ihre Bemerkung einzugehen. Ich sah darin keinen Sinn. Gedanklich versuchte ich mir vorzustellen, wie es wohl sein würde, mit Frau Beck gemeinsam unter diesem Dach zu leben. Die, gelinde gesagt, schwierige Helene Ockenfels, eine mir gegenüber ablehnend eingestellte Haushälterin und ich, die verängstigte kleine Maus aus dem Ruhrgebiet. Was für eine Kombination. Ich beruhigte mich schließlich mit dem Gedanken, dass niemand von mir verlangen konnte, Frau Beck zu mögen, sollte sie ihre Meinung über mich nicht ändern. Viel wichtiger war es für mich, die alte Helene zu überzeugen. Wenn ich vor ihr bestand, dann würde ich auch mit allem anderen fertig werden. Ich schnaubte bei diesem naiven Gedanken. Mit allem anderen … war das so? Ich hatte eine winzige Kleinigkeit verdrängt, die sich noch zu einem großen Problem auswachsen könnte. Entschlossen schüttelte ich den Kopf, um diesen Gedanken zu vertreiben. Alles zu seiner Zeit.
Kapitel 7
Berlin, 1933
Das Atelier der Fotografin lag im Dachgeschoss eines alten Ziegelbauwerks. Der Architekt hatte breite Fensterfronten in die Giebel eingelassen, wodurch der Raum optimal ausgeleuchtet wurde. Es herrschte eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Lediglich das unstete Klicken der Rolleiflex Kamera zeugte von emsiger Betriebsamkeit. Zwischendurch gab Frau Walther einige Anweisungen, die Christie augenblicklich umsetzte.
Christie – sie hatte sich schon beinahe an ihren Künstlernamen gewöhnt, doch noch nicht ganz. Manchmal hörte sie jemanden ihren neuen Namen rufen und bemerkte erst zu spät, dass man sie meinte. Dies hatte am Filmset zu mancherlei Missverständnissen geführt, doch Helene war fest entschlossen, diesen Makel für die Zukunft abzustellen. Folglich nannte sie sich selbst nur noch Christie und verbat ihrem Umfeld, je einen anderen Namen zu verwenden. Sie wollte perfekt in ihrer neuen Lebensrolle aufgehen. Schauspielerin, Künstlerin, sie könnte eine Berühmtheit werden. Der Weg war geebnet, ihr Debüt abgedreht, Der Traum vom Rhein wurde heute uraufgeführt. Der Grundstein ihrer Karriere war gelegt.
Wenngleich sie nicht die UFA für sich hatte einnehmen können. Die kleine R. N.-Filmproduktionsfirma hatte ihr diese Chance geboten. Robert Nappach war gleich bei ihrem ersten Kennenlernen auf sie zugekommen und hatte ihr die Rolle der Mary angeboten. Eine weibliche Hauptrolle. Das hätte sie zuvor nie zu träumen gewagt. Nicht so schnell zumindest. Wie aufregend es nun war, für die Illustrierten Pressefotos anfertigen zu lassen, noch unglaublicher würde es sein, den Film in vollständiger Länge zu genießen. Heute Abend würde sie für jedermann in Großformat auf der Leinwand zu sehen sein.
Und dann erst die Gala. Ein Festessen mit Musik und Tanz zur Feier des Tages. Unterhaltung der feinsten Art, die Comedian Harmonists würden auf Bitte ihres Freundes Nappach ein Gastspiel geben. Wie außergewöhnlich.
»Ich schlage vor …«, brach die Stimme der Fotografin in ihre Gedanken ein, »… dass wir den Hintergrund austauschen. Ich möchte gerne noch eine andere Kombination versuchen.«
»Woran denken Sie?«, fragte Christie.
»Sie werden doch heute Abend zur Gala den Schwarzfuchsschal um die Schultern tragen. Sie haben ihn mitgebracht, nicht wahr?«
»Natürlich, Sie haben darum gebeten.«
»Sehr gut.« Frau Walther gab einem Assistenten ein Zeichen. »Wir brauchen die silberne Wolke«, wies sie an.
Was immer das bedeuten soll, dachte Christie und beobachtete, wie der Assistent sich einem überdimensionierten Schrank zuwandte, die Türen öffnete und einige Papprollen inspizierte. Endlich schien er gefunden zu haben, was er gesucht hatte.
Unterdessen knüpfte die Fotografin die Schnürung des kleinen Päckchens auf und holte den Pelz hervor. »Wundervoll«, sagte sie, spitzte die Lippen und blies sanft über das schwarze Fuchshaar. »Ihr Kleid?«
»Silberne Seide mit schmalen Trägern«, antwortete Christie prompt.
»Exzellent, das wird hervorragend zu den vereinzelten Silberhaaren im Pelz passen.« Hoffnungsvoll fragte sie: »Das haben Sie nicht zufällig auch mitgebracht?«
»Nein, entschuldigen Sie. Ich wollte es mir nicht versehentlich verderben.«