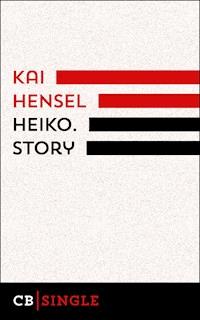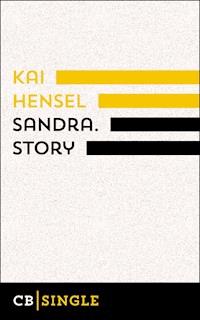Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Katze kann ohne den Menschen leben, aber der Mensch nicht ohne Katze.Der Kater Valentin wurde am Tag der Liebenden geboren, daher sein Name. Sein plötzliches Verschwinden stürzt die beschauliche Kleinstadt Aschersburg in einen Taumel. Die Biologielehrerin Katja sucht verzweifelt nach Valentin, ihre Schülerin Ricky nach der Wahrheit. Warum lügt Katja? Wird Ricky ihre Lehrerin überführen? Und wer wird Valentin zuerst finden?Ein hinreißender Abenteuerroman über die Sehnsucht auszubrechen und einen ganz besonderen Kater.»Wer immer schon wissen wollte, warum ein Leben ohne Katze möglich, aber sinnlos ist, lese diesen liebenswerten Roman!« Nele Neuhaus
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KAI HENSEL arbeitete als Werbetexter, Comedy-Autor und Drehbuchschreiber für TV und Kino. Er ist vielgespielter Bühnenautor. Sein Werk wurde in zwölf Sprachen übersetzt, für den Hörfunk adaptiert und mehrfach ausgezeichnet. Sein Roman Sonnentau war für den Glauser-Preis nominiert. Kai Hensel lebt in Berlin.
Die Biologielehrerin Katja ist verzweifelt. Ihr schöner, einfühlsamer Kater Valentin ist eines Tages spurlos verschwunden. Warum hat er sie verlassen? Wer wird ihr abends Gesellschaft leisten, wenn sie Klausuren korrigiert? Das Kollegium hat andere Sorgen, denn das Gymnasium steht vor dem Aus. Die Schülerin Ricky wittert derweil den großen journalistischen Coup. Warum lügt Katja in Bezug auf Valentins Herkunft? Der Praktikumsplatz bei der Lokalzeitung ist ihre große Chance. Wird sie Valentin finden und ihre Lehrerin überführen? Valentin hat es vorgemacht: Man muss ausbrechen, um am Leben zu bleiben. »Man kann im Leben auf vieles verzichten, aber nicht auf Katzen und Literatur«, sagt Elke Heidenreich.
FÜR MEINEN KATER
6.12.2013 – 31.10.2014
Inhalt
1. Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
2. Teil
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
1. Teil
»EIN HUND ZEIGT UNS DIE WELT, WIE SIE IST.
EINE KATZE ZEIGT UNS DIE WELT, WIE SIE SEIN KÖNNTE.«
Madame de Ronron, am Abend ihrer Verhaftung
1.
Der Frühling war endlich gekommen.
Katja stand am Küchenfenster und beobachtete das Rotkehlchen im Kirschbaum. Es putzte sein Gefieder, Morgentau glitzerte in den Zweigen. In der Früh hatte sie der Gesang von Amseln geweckt, dann Blaumeisen und Buchfinken. Das Leben reckte sich, rollte seine Blätter aus, überall Knospen, junge Triebe, Geflatter und Gesang. Sie hätte den ganzen Morgen hier stehen können, aber sie war spät dran. Die Sicherung des Durchlauferhitzers war wieder rausgeknallt, sie musste das alte Ding endlich reparieren lassen.
Sie schüttete Müsli in die Schale, goss siedendes Wasser über das Teesieb. Frühstück, darüber hatte sie letztens mit Frau Kirstein diskutiert. Selbstgeröstetes Müsli? Kretischer Bergtee? Dafür fehlte Frau Kirstein morgens die Zeit. Mehr als ein Kaffee, eine Zigarette und manchmal ein Apfel war nicht drin, in letzter Zeit kam sie morgens immer schwerer aus dem Bett. Katja mochte Frau Kirstein, eine erfahrene, allseits beliebte Kollegin, die ihr in den ersten Monaten an der Schule manch guten Tipp gegeben hatte. Aber ihre Haltung zum Frühstück, die hatte sie fragwürdig gefunden – und jetzt, während sie eine Banane schnitt, fiel ihr die passende Erwiderung ein: »Es geht nicht allein um uns, sondern um die Schüler. Wir erwarten von ihnen, dass sie vorbereitet zum Unterricht erscheinen, Hausaufgaben gemacht, genügend Schlaf – und, ja, ordentlich gefrühstückt haben. Wir können an die Schüler doch keine Ansprüche stellen, die wir selbst nicht erfüllen.«
»Lehrer sind Schauspieler«, hörte sie Frau Kirstein sagen. »Vier bis sieben Akte à 45 Minuten, gelangweiltes Publikum, manchmal Buhrufe, nie Applaus.«
»Trotzdem – wir können den Schülern in Wahrheit oder Lüge gegenübertreten. Wahrheit ist besser.«
Sie sah Frau Kirsteins wegwerfende Geste vor sich, in der Hand wie üblich ihre Zigarette, sie würde etwas sagen wie: »In meinem Alter ist die Wahrheit zu anstrengend, lügen schont den Kreislauf.«
Katja nahm die Mandelmilch aus dem Kühlschrank, hörte Tapsen auf den Fliesen. Sie sah in den Augenwinkeln einen silbergrauen Schatten, fühlte Fell an ihr Bein streichen … Valentin sprang auf den Stuhl, auf die Tischplatte und ließ eine Maus neben die Müslischale fallen.
Katja schloss die Augen: nicht schon wieder.
Die zweite Maus diesen Monat.
Davor ein Lurch.
Unvergessen der Nymphensittich.
Wenn Ihnen Ihre Katze Beute mitbringt, handelt es sich um ein wertvolles Geschenk. Schimpfen Sie nicht, denn es ist ein Liebesbeweis. »Bedanken« ist die oberste Pflicht des Katzenbesitzers; erst dann darf das Präsent diskret entsorgt werden.
So oder ähnlich stand es in allen Katzenratgebern, auf allen Webseiten, die Katja zu diesem Thema konsultiert hatte. Und wenn die Maus, wie jetzt, noch lebte? Wenn der winzige Brustkorb sich in Spasmen hob und senkte und sich eine Blutlache unter dem zerbissenen Körper ausbreitete?
Wenn die Beute Ihrer Katze noch lebt, versuchen Sie, sie zu retten und an einem sicheren Ort auszusetzen. Das gilt jedoch nur, wenn die Beute eine Überlebenschance hat.
Katja hatte während ihres Studiums in der Notaufnahme eines Krankenhauses gearbeitet; sie wusste, was ein Polytrauma ist. Keine Transfusion, keine Not-OP würde diese Maus retten.
Ist die Beute hingegen fast tot, sollte man besser nicht mehr eingreifen; sie würde nur noch länger leiden.
Unfug! Die Maus könnte noch zehn Minuten oder länger leben. Sollte man achselzuckend danebenstehen? Es gab eine Methode, das Leiden eines Kleintiers schnell, ohne Schmerz und weiteres Blutvergießen zu beenden; unverständlich, warum die Katzenratgeber sich darüber ausschwiegen. Sie holte einen Beutel Eiswürfel aus dem Gefrierfach, scheuchte Valentin von der Tischplatte und schüttete das Eis über die Maus. Kälteschock, Herzstillstand, Tod innerhalb von zwei Minuten. Nehmt das, Katzenratgeber!
Sie schaute auf die Uhr. Valentin saß zu ihren Füßen, rieb seinen Kopf an ihrem Bein, schaute aus seinen goldgrünen Augen zu ihr hoch und erwartete Dankbarkeit: Kraulen zwischen den Ohren, unter dem Kinn, am besten eine halbe Stunde kuscheln. Aber Katja hatte keine Zeit zum Kuscheln, vor allem keine Lust. Sie war ratlos und wütend. Katzen sollte man nicht bestrafen, da waren sich die Ratgeber einig: Nicht schimpfen, nicht schreien, Erziehung durch Liebe war der einzige Weg. Aber hatte Katja es nicht mehrere Mäuse, Lurche und einen Nymphensittich lang mit Liebe versucht? Die Wahrheit ist der Katze zumutbar. Und die Wahrheit war: Sie freute sich nicht über halbtote Kleintiere zum Frühstück!
Keine Zeit mehr fürs Müsli. In der Diele strich sie mit der Bürste durch ihre schulterlangen, blonden Haare, entschied sich für die Opalohrringe, die besser zu der türkisblauen Bluse passten, die sie letztes Jahr in Edinburgh gekauft hatte. Sie begriff manche Kollegen nicht, die Intellektualität mit Verwahrlosung verwechselten. Jeder Mensch konnte, im Rahmen seiner Möglichkeiten, gut aussehen. Und wer gut aussah, wurde ernst genommen und hatte mehr Spaß im Job.
Die zwei Minuten waren noch nicht um, da hörte sie ein Schaben aus der Küche: Valentin war wieder auf den Tisch gesprungen und wühlte nach der Maus. Eiswürfel rutschten über die Tischkante, zersprangen auf den Fliesen, jetzt hatte er die Maus im Maul. Katja packte ihn unter den Achseln: »Lässt du die Maus in Ruhe?!«
Er fauchte und strampelte, die Maus flog ins Spülbecken. Katja trug ihn zur Terrassentür, schob sie mit dem Fuß auf und warf ihn ins Gras. Einige Augenblicke standen sie beide reglos da, fixierten sich, Katja außer Atem, mit pochendem Herzen, Valentin geduckt, mit finsterem Blick und zuckendem Schwanz.
Sie schloss die Terrassentür und zog die Vorhänge zu. Er musste begreifen, dass sie es ernst meinte. Doch schon während sie sich die Schuhe anzog, meldeten sich in ihrem Kopf, wie ein mahnender Chor, die Katzenratgeber:
Die Maus ist ein Liebesbeweis! Bedanken ist Pflicht! Wer schreit, macht sich schuldig!
Sie ging zurück ins Wohnzimmer, zog die Vorhänge zurück und schob die Terrassentür auf: Valentin war nicht mehr da. Sein Blick funkelte auch nicht zwischen den Büschen.
»Valentin? Es tut mir leid.«
Schweigen im Garten, nicht einmal die Vögel zwitscherten. Sie seufzte. Was sie getan hatte, konnte sie nicht mehr ändern, nicht rückgängig machen. Vor allem musste sie los, in zwanzig Minuten begann ihr Unterricht. Valentin wurde schnell zornig, aber er war nicht nachtragend. Heute Abend würde die Sache vergessen sein.
Sie hatte gerade noch Zeit für einen letzten Blick ins Spülbecken: Die Maus lag im Ausguss und war eindeutig tot.
2.
»Guten Morgen«, sagte Katja und schloss die Tür.
»Guten Morgen …«, antworteten die Schüler. »Morgen, Frau Fontane …« »Echt jetzt?! Ich dachte, wir haben Französisch …«
Telefone wurden ausgeschaltet oder wenigstens stumm gestellt, Schulhefte mit den Hausaufgaben hektisch unter Tischen hindurchgereicht. Katja tat, als ob sie das nicht sah. Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern glich dem zwischen Mann und Frau in einer langen Ehe. Und so sehr sie Ehrlichkeit schätzte; zu viel davon hatte noch jede Beziehung ruiniert. Es gab Grauzonen und Grenzen, die von Lehrer zu Lehrer, von Klasse zu Klasse neu verortet wurden. Hausaufgaben abschreiben, zum Beispiel. Wenn Katja gleich Simon bitten würde, seine Hausaufgabe vorzulesen, würde er selbstbewusst, mit fester Stimme einen Text vorlesen, den er bis zur letzten Sekunde bei Friedrich abgeschrieben hatte und von dem er kaum etwas verstand. Sie konnte ihm natürlich ein Bein stellen und danach Friedrich drannehmen, damit er seinen eigenen identischen Text vorlas, den er, im Unterschied zu Simon, sogar erklären könnte. Aber wer hätte etwas davon? Erstens traute sie Friedrich zu, dass er in seinen Text spontan kleine Änderungen, sogar Fehler einbaute, um Simon zu schützen. Zweitens fehlte ihr bei dem schönen Wetter zu so viel Hinterlist die Lust. Und drittens:
»Ich habe Ihre Klausuren dabei.«
Die 10c war eine freundliche, unkomplizierte Klasse. Fast alle Schüler waren respektvoll und motiviert. Wenn irgendwo ein Handy klingelte, wie jetzt gerade, reichte ein Blick in die hinteren Reihen, schon griff Leon in seine Hosentasche, murmelte eine Entschuldigung und das Klingeln hörte auf. Nicht von allen Klassen konnte man das sagen.
»Die Klausur ist gut ausgefallen«, sagte Katja und holte die Hefte aus ihrem Rucksack. »Die Mendelschen Regeln haben fast alle verstanden, die Proteinbiosynthese auch. Bei Frage Fünf sind einige ins Schleudern gekommen.«
»Die hatten wir nicht durchgenommen«, sagte Regine.
»Frage Fünf war zum Selberdenken.«
Regine verzog das Gesicht, ihre Mitschüler grinsten. Regine war ein Fleißwunder, sie fraß sich durch die Bücher wie eine Raupe durchs Erdbeerfeld. Doch eigenständiges Denken war nicht ihre Stärke; wenn ihr Fleiß sie an Grenzen brachte, regte sie das furchtbar auf.
Katja ging durch die Reihen, verteilte die Klausuren. Miriam, Antonio, Janine …
»Prima, Friedrich.«
Seine Klausur war die beste, natürlich. Bis vor einem halben Jahr war Annette Klassenbeste gewesen, in allen Fächern außer Sport. Dann war Friedrich aus Baden-Württemberg hergezogen, sein Vater hatte als Chefarzt die Reha-Klinik von Aschersburg übernommen. Mühelos hatte er Annette verdrängt, auch diese Klausur nahm er höflich, ohne Überraschung entgegen. Die anderen waren ihm nicht einmal böse, Privatgymnasium in Tübingen, was wollte man da machen? Wenn Katja Pausenaufsicht führte, sah sie ihn meist abseits mit einem Buch sitzen, Novalis wahrscheinlich oder Wittgenstein, weniger traute sie ihm nicht zu. Wenn seine Mitschüler nach dem Unterricht ihre Fahrräder aufschlossen, startete er seinen metallblauen Elektroroller. Seine Manieren waren untadelig. Jeder durfte bei ihm abschreiben. Der Blick aus hellbraunen Augen unter kastanienbraunen Locken, die immer aussahen, als käme er frisch aus der Dusche und habe sie flüchtig trocken geföhnt, war freundlich, aber distanziert. Auf dem Schulhof wirkte er oft wie ein Bildungstourist, der sich an den Ballermann verirrt hatte.
Vanessa, Marvin, Saskia …
»Alles gut, Regine.«
Regine stürzte sich auf ihr Heft, blätterte … Katja hörte sie erleichtert über ihre zehn Punkte seufzen.
»Karsten, achten Sie auf Ihre Rechtschreibung.«
»Ihre Bluse ist schön.«
»Achten Sie trotzdem auf Ihre Rechtschreibung.«
Friedrich sah gut aus, doch der schönste Junge des Jahrgangs war unbestritten Karsten – abgesehen vielleicht von Lennart, aber Lennart war ein entsetzlicher Poser, und Karsten war es kein bisschen. Er trug Jeans und einfache T-Shirts, auf die seine goldblonden Locken fielen. Die Mädchen schmachteten ihm wegen dieser Locken hinterher, den schmalen Hüften, kornblumenblauen Augen unter geraden Brauen, seinen vollen Lippen mit neuschneeweißen Zähnen. Niemand lächelte so bezaubernd wie Karsten, vor allem wenn er im Unterricht die Antwort nicht wusste. Und die wusste er eigentlich nie. Doch an Barren und Reck, da war er ein Gott. Die Mädchen verliebten sich in ihn, weil sie ihn retten wollten – vor den Lehrern, der Grausamkeit der Welt, vor allem vor anderen Mädchen. Seit Katja an diesem Gymnasium unterrichtete, wurden um diesen Jungen erbitterte Kämpfe geführt. Sie wünschte ihm eine Freundin wie Annette oder Regine, die nachmittags mit ihm auf der Wiese liegen und Rechtschreibung üben würden. Doch Karsten lächelte für alle, band sich an keine, und seine Rechtschreibung blieb auf dem Niveau eines Viertklässlers.
»Ricky, Ihr Essay über den Erbsensamenkäfer hat mir gefallen. Leider hatte er wenig mit dem Thema zu tun.«
»Es ging um Evolution.«
»Richtig, aber –«
»Der Erbsensamenkäfer zeigt, wo wir alle enden werden.«
Und dann gab es Schüler, die sich in keine Ordnung fügten, nirgends ihren Platz fanden. Freie Radikale, sie prallten gegen Wände oder saßen, wie jetzt Ricky, nach hinten gekippt auf ihrem Stuhl, die Arme vor der Brust verschränkt, der Blick finster unter dunklen, verstrubbelten Haaren, das kleine Kinn mit dem markanten Spalt in den Rollkragen des viel zu großen schwarzen Pullovers gedrückt. Katja mochte Ricky, der Dostojewski-Habitus erinnerte sie an ihre eigene Jugend, als sie wie ein gefangenes Raubtier durch die Straßen ihrer Heimatstadt getigert war – wütend, ohne zu wissen auf was. Und alle paar Tage meldete sich Ricky und lieferte einen Beitrag ab, dessen Brillanz alle Bemühungen ihrer Mitschüler in den Schatten stellte. Aber es half nichts: Was sie für diese Klausur zu Papier gebracht hatte, war am Thema vorbei.
Katja verteilte die letzten Hefte und kehrte zurück zum Pult. Alle Klausuren waren ausgegeben – bis auf eine. »Caroline, bitte kommen Sie nach der Stunde zu mir.«
Caroline saß in der letzten Reihe, den Stuhl weit vom Tisch gerückt, hielt das Gesicht in die Frühlingssonne und feilte ihre Nägel.
»Legen Sie die Feile weg, Sie sind nicht im Gefängnis.«
»Really?«
»Feile weg.«
Sie seufzte, schnalzte mit der Zunge und ließ die Feile sinken. Caroline war nicht schön, aber ein Hingucker. Sie wusste ihre Stärken zu betonen – große Brüste in engen Tops, lange Beine in engen Jeans und Stiefeln – und ihre Schwächen zu kaschieren – die etwas große Nase, die vorstehenden Augen, die flache Stirn. Sie schminkte sich stark und sparte nicht mit auffälligen Ketten und Ohrringen. Katja hatte sie einmal an der Baustelle am Hopfenmarkt vorbeilaufen sehen, trotz feuchtkalten Märzwetters in nabelfreier Pailletten-Jacke. Die Männer hatten ihre Arbeit unterbrochen, ihr Sprüche nachgerufen, die nicht jugendfrei waren. Caroline hatte sich nicht umgedreht, nur den Mittelfinger gereckt; die Bauarbeiter hatten gejohlt. Auf Katja hatte das fast wie ein Ritual gewirkt, die Baustelle am Hopfenmarkt gab es jedenfalls schon lange. Caroline war älter als ihre Mitschülerinnen, als einzige schon über achtzehn. Zweimal war sie bereits sitzen geblieben. Ihre Eltern versuchten um jeden Preis, sie auf dem Gymnasium zu halten. Doch mit dieser Klausur hatte sie den Bogen überspannt. Wenn es nach Katja ging, würde sie auch dieses Schuljahr, ihre letzte Chance, nicht schaffen, ihre Eltern konnten flehen, wie sie wollten.
»Frage Fünf«, sagte Katja. »Wie verändern sich Ausleseprozesse unter den Bedingungen der Zivilisation? Annette, Friedrich, Sie haben beide hervorragende Antworten geliefert. Wer möchte vorlesen?«
Friedrich deutete mit einer knappen, coolen Geste zu Annette. Annette entschuldigte sich mit einer Frühjahrserkältung und deutete etwas linkisch auf Friedrich zurück. Also las Friedrich, eher gelangweilt, aber mit einer warmen, angenehmen Stimme: »Auch wenn der Mensch sich gern als Krone der Schöpfung sieht, ist seine evolutionäre Entwicklung nicht abgeschlossen. Australische Forscher haben herausgefunden …«
Caroline blickte aus dem Fenster, drehte die Feile zwischen ihren Fingern und tat, als ginge sie das alles nichts an.
3.
Wieder ein Vormittag verlorenes Leben.
Ricky ging zum Schultor, allein, sie wollte mit diesen Idioten nichts zu tun haben, ihrem Gelächter und Stumpfsinn. Die Frühlingssonne brannte auf den Asphalt, ihr Pullover war zu groß und zu warm, sie hielt das alles nicht aus.
»Ricky!«
Sie drehte sich langsam um und sah Friedrich kommen. Was wollte der von ihr? Provozierend gut sah er aus, mit seinen braunen Locken, dem karierten Oberhemd und der Hose, wie sie Jungen in englischen Internaten trugen. Ihre Laune sank noch tiefer.
»Willst du in die Stadt? Ich kann dich mitnehmen.«
»Stadt ist da vorn.«
»Sind schon ein paar hundert Meter.« Er zeigte auf seinen E-Roller, der in der Sonne tiefblau schimmerte wie ein tropischer Käfer.
»Ich gehe lieber«, sagte sie.
»Kann ich ein Stück mitkommen?«
»Warum?«
»Ich will wissen, was du über den Erbsensamenkäfer geschrieben hast.«
»Sechs Punkte hat mir die blöde Kuh gegeben.«
»Heißt ja nicht, dass es schlecht ist.«
»Wie kommst du darauf, dass es schlecht ist?«
»Ich meine –«
»Es heißt, dass sie’s nicht begriffen hat!«
Sie verließen das Schulgelände durch das schmiedeeiserne, über einhundertfünfzig Jahre alte Tor. Das Humboldt-Gymnasium galt als das schönste Gymnasium Sachsen-Anhalts. Schön, über diesen Betrug hatte Ricky vor zwei Jahren eine beißende Glosse in der Schülerzeitung geschrieben. »Die Säulen und Giebelchen, der Stuck in den Fluren, die alten Bäume auf dem Schulhof und – ganz besonders – die Aula mit den Glasfenstern und Deckenmalereien: Das alles wird bewundert. Darauf sollen wir stolz sein, unser schönes Gymnasium. Aber wie schön kann ein Gymnasium sein, in dem ständig die Toiletten verstopft sind? In dem neun von zehn Lehrern nicht wissen, wie man einen Beamer anschließt (der zehnte weiß nicht, was ein Beamer ist)?« Die Glosse hatte Aufsehen erregt und Diskussionen ausgelöst. Glorreiche, vergangene Zeiten …
»Und dein Roller?«, fragte sie.
»Hole ich später.«
Er ließ sich nicht abschütteln. Sie musste ihn aber abschütteln, denn für das, was sie gleich vorhatte, konnte sie keinen Zeugen gebrauchen.
Sie bogen in die Pappelallee, die in den historischen Stadtkern führte. Früher hatte hier das Herrenhaus eines askanischen Grafen gestanden. Von dem Herrenhaus war nichts übrig, aber die Pappelallee hatte sich in den Jahrhunderten kaum verändert. Vögel zwitscherten in den Zweigen, Fahrräder und Autos rumpelten über das Kopfsteinpflaster wie früher die Kutschen. Und bestimmt hatten damals schon Liebespaare Herzen in die Stämme geritzt. Diese Pappelallee war schön, das gestand Ricky ein. Weil die Allee nicht vorgab, etwas zu sein, was sie nicht war.
»Also?«, fragte Friedrich.
»Der Erbsensamenkäfer, Callosobruchus maculatus, lebt in Gegenden, wo es wenig Wasser gibt. Die Männchen haben Haken am Penis, mit denen sie die Weibchen bei der Befruchtung oft verletzen. Deshalb haben die Weibchen eher wenig Lust auf Sex. Aber sie brauchen Wasser. Was tut also das Männchen? Pumpt sich mit Wasser voll. Sein Sperma besteht fast nur aus Wasser, und darauf sind die Weibchen scharf. Jetzt stell dir unsere Zukunft vor: Erderwärmung, Flüsse trocknen aus, alle haben Durst. Was bedeutet das für Männer und Frauen?«
»Mehr Wasser im Sperma?«
»Fettes Bankkonto, teure Kleidung, schicker Elektro-Roller … Wenn der globalisierte Kapitalismus zusammenbricht, ist das alles nichts mehr wert. Entweder wir werden wie die Erbsensamenkäfer, oder wir sterben aus.«
Mit der Anspielung auf den Roller hatte sie Friedrich provozieren wollen. Zu ihrem Unmut ließ er sich nicht provozieren. Im Gegenteil, er ging still neben ihr und schien über ihre Worte nachzudenken.
»Lust auf ein Eis?«, fragte er.
»Ich habe kein Geld.«
»Ich zahle.«
Sich als Frau von einem Mann einladen zu lassen, war das Allerletzte. Andererseits –
»Pistazie und Himbeere«, sagte sie.
Er stellte sich in die Schlange vor dem Eiscafé Gilberto. Sie tat, als müsse sie telefonieren, in Wahrheit beobachtete sie ihn. Sie hatte eine Doku über englische Internate gesehen und die schlimmen Dinge, die dort nachts in den Schlafsälen geschahen. Sie versuchte, sich Friedrich in so einem Schlafsaal vorzustellen, aber es gelang ihr nicht. Alles an Friedrich war heil. Sie wollte aber keinen heilen Jungen in ihrer Nähe, schon gar nicht an so einem Tag. Sie brauchte was Kaputtes. Bloß gab es solche Typen nicht an ihrer Schule, bis auf Mirko aus der Zwölften – und der war nicht kaputt, sondern einfach fertig.
Friedrich kam zurück mit zwei Eistüten: »Mein erstes dieses Jahr«, sagte er.
»Meins auch.«
Rumms! Eine Sekunde nicht aufgepasst, schon hatten sie etwas gemeinsam. Sie hätte »Ich hatte meins letzte Woche« sagen müssen oder »In Italien schmeckt’s am besten«, irgendwas, was ihn auf Distanz hielt. Ein schlechtes Omen für das Gespräch, das sie gleich führen musste. Den ganzen Vormittag schon war sie angespannt. Sie hatte schlecht geschlafen. Am Morgen hatte sie vor ihrem Kleiderschrank gestanden und fast geweint: Nichts, absolut nichts hatte sie anzuziehen! Schließlich hatte sie sich für schwarze Leggings entschieden und den schwarzen Rollkragenpullover, wenigstens gab der eine intellektuelle Note. Aber da hatte sie noch nicht gewusst, wie warm es werden würde. Sie gingen schweigend, leckten an ihrem Eis und kauten die Waffeln.
»Jetzt sind wir in der Stadt«, sagte er.
Die Stadt, das war der Händelplatz mit dem Brunnen, das Hotel »Ascherkrone«, die Matthäuskirche und das Rathaus mit den Blumenrabatten. Die Stadt war das China-Restaurant »Goldener Lotus« und die Touristeninformation, dahinter die historischen Bürgerhäuser. »Juwel an der Saale«, schwärmten die Reiseführer und verloren kein Wort über Menschen wie Ricky, die sich in diesem Juwel gefangen fühlte wie ein Insekt im Bernstein. Gerade kam ein Brautpaar aus der Kirche. Kinder streuten Blumen, Gäste warfen Reis, Ricky dachte: Wenn ich bis drei zähle und die Braut knickt auf ihren Absätzen um, ist das ein gutes Zeichen. Sie zählte bis drei, die Braut knickte nicht um, sondern posierte unfallfrei für die Fotografen. Der Tag hatte sich gegen sie verschworen.
»Ich gehe dann«, sagte sie.
»Ich hole meinen Roller.«
»Danke fürs Eis.«
»Viel Glück.«
Ricky ging und musste sich zusammenreißen, um sich nicht nach ihm umzusehen. Hatte er ihr gerade wirklich »viel Glück« gewünscht? Konnte es sein, dass er wusste, was sie vorhatte? Sie hatte mit niemandem darüber gesprochen, die Gefahr des Scheiterns war zu groß. Und mit Friedrich hatte sie, seit er an die Schule gekommen war, kaum mehr als ein paar Sätze gewechselt. Möglich, er hatte ihre Nervosität bemerkt. Überhaupt hatte er so etwas Lässiges, wohlerzogen Undurchdringliches; bei ihm konnte man nie wissen.
Vom Händelplatz bog sie in die Augustabreite, ging vorbei am Drogeriemarkt, dem Schnäppchenmarkt, dem Thai-Imbiss, einem Geschäft mit regionalen Souvenirs und Spezialitäten (Kräuterbitter, Bierkrüge, Harzer Schneekugeln), den Thalia-Lichtspielen (Vampire Teil VIII, deutsche Komödie, immer der gleiche Müll). Sie überquerte den Hopfenmarkt, immer heißer wurde ihr, der Rucksack drückte gegen ihren Rücken. Sie bog in die Fleischergasse, die Mühlgasse. Sie ging vorbei an der Bäckerei Ebner …
Aschersburger Tageblatt – seit 1868
Sie stand vor dem Fachwerkhaus mit der Fensterfront im Erdgeschoss. Sie sollte umdrehen, sofort, sich etwas anderes zum Anziehen kaufen. You never get a second chance to make a first impresssion. Sie hatte sechs Euro im Portemonnaie, dafür bekam sie nicht mal was bei KiK. Sie stieß die Tür auf und trat in einen Vorraum, in dem für ihr überreiztes Hirn alles grau aussah: Die Möbel, die Wände, der Fußboden, die ältere Frau im Hintergrund, die gleichzeitig telefonierte und tippte, die jüngere Frau am Tresen, die sie anlächelte.
»Guten Tag.« Ricky bemühte sich, das graue Lächeln zu erwidern. »Ich habe einen Termin bei Herrn Kukulies.«
4.
Die Kollegen saßen an den Tischen im Lehrerzimmer, nippten an Kaffeetassen, stocherten in Tupperdosen. Frau Kirstein sog an ihrer elektrischen Zigarette, die ließ man ihr hier gerade noch durchgehen. Alle waren erschöpft und ratlos. Man musste etwas machen, das war klar. Sechzigster Geburtstag, fünfunddreißigstes Dienstjubiläum, das konnte man nicht übergehen, und schon gar nicht mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Wein abhandeln. Ausgerechnet Frau Herczeg. Lehrerin für Musik und Mathematik, kein Mann, keine Kinder, harte Nuss. Immerhin, von einem Hobby wussten sie – angeln. An den Wochenenden konnte man Frau Herczeg frühmorgens am Saaleufer sitzen sehen, natürlich allein. Und es hieß, sie liebte Schubert. Aber welche Musiklehrerin tat das nicht?
»Forellenquintett«, sagte Doktor Schellenberg. »Zwei Fliegen mit einer Klappe.«
Kopfschütteln. Wer Schubert liebte und auch noch Musik unterrichtete, hatte mehrere Aufnahmen des Forellenquintetts im Regal stehen. Und eine CD reichte eben nicht, nicht für einen so wichtigen Tag.
»Schubert hat über hundert Sinfonien komponiert«, sagte Hannah Gödicke.
»Das war Haydn«, sagte Frau Bauernfeind.
»Ach, wie ärgerlich.«
Kauen auf Unterlippen. Vom Nachdenken zerfurchte Gesichter. Katja fand es regelmäßig erschreckend zu sehen, wie schnell ihre Kollegen alterten. Nicht von Jahr zu Jahr oder Monat zu Monat – von Stunde zu Stunde! Als leidlich gut erhaltene Männer und Frauen kamen sie morgens durchs Tor. Schon in der ersten großen Pause zeigten sich Zeichen des Verfalls. In der zweiten großen Pause war der Zustand bei manchen bedenklich. Nach der sechsten Stunde hingen sie in ihren Stühlen wie Boxer nach der zwölften Runde – der Blick glasig, die Bewegungen fahrig, sie waren kaum fähig, ihre Kaffeetasse zum Mund zu führen. Und dies war ein traditionsreiches humanistisches Gymnasium in einer mitteldeutschen Kleinstadt – die Welt war hier so heil, wie sie sein konnte. Frühere Kommilitonen von Katja unterrichteten an Brennpunktschulen in Rostock und Dortmund – das war Krieg! Und die klagten weniger, vermutlich fanden sie in ihrer Arbeit mehr Sinn. Frau Herczegs Jubiläum kam nun wirklich nicht überraschend, trotzdem hatten sie es bis zum letzten Moment vor sich hergeschoben.
»Wir schenken ihr einen Gutschein für die Therme in Wilsaue«, sagte einer.
»Ein Abo für eine Angelzeitschrift«, sagte eine andere.
»Einen Sack Würmer, als Köder.«
»Oder Schnaps, die soll sich mal richtig die Kante geben.«
»Ich glaube, ich habe eine Idee«, sagte Katja. Köpfe drehten sich in ihre Richtung, in den Augen flackerte schwache Hoffnung.
»Bayreuther Festspiele. Zwei Karten, eine Nacht im Hotel.«
»Dafür kriegt man keine Karten mehr«, sagte Frau Kirstein.
»Auf Ebay werden welche versteigert.«
»Teuer«, sagte Doktor Schellenberg.
»Haben Sie eine bessere Idee?«
»Bayreuth ist Wagner. Johohohee, sonst nichts.«
»Es muss nicht immer Schubert sein.«
»Schubert war Wagners Antipode«, sagte jemand.
»Brahms war sein Antipode.«
»Brahms hat über hundert Opern komponiert«, sagte Hannah Gödicke.
Ihre Kollegen waren plötzlich wach, jeder warf sein Halb- und Viertelwissen in die Runde. Würde jemand dieses Geschnatter aufnehmen und auf YouTube stellen, die Reputation des Humboldt-Gymnasiums wäre ruiniert. Lehrer hielten sich für gebildet und wurden von ihrer Mitwelt dafür gehalten; leider waren sie meist bloß Fachidioten, und selbst das Fachwissen rostete ein. Die Welt drehte sich weiter, die Diskrepanz zwischen dem, was sie wussten, und dem, was sie wissen müssten, wurde immer größer. Deshalb kam ihnen ihr Job von Jahr zu Jahr anstrengender vor. Nicht chronische Überlastung war das Problem, sondern schleichende Verblödung. Mit Ende vierzig lagen sie wimmernd beim Therapeuten auf der Couch: »Ich schaff’s nicht mehr.«
»Ich wiederhole«, sagte Doktor Schellenberg, »Karten für Bayreuth sind teuer«.
»Und wieso zwei?«, fragte Kirstein. »Herczeg hat doch niemanden.«
»Eben. Nur eine Karte wäre genau diese Botschaft«, sagte Katja. »Das wollen wir nicht, oder?«
Enno Schrader erhob sich. Weil er Sportlehrer war und einen Meter sechsundachtzig groß, weil er Energie und Frühlingsfreude ausstrahlte und sein Leinenhemd wie üblich bis auf die Brust offen stand, blickten die Kollegen auf. »Wir wissen nicht, wie teuer es wird. Katja und ich finden das heute Nachmittag heraus. Aber viel Zeit bleibt nicht für ein Geschenk. Und wollen wir an solch einem Tag jeden Cent zweimal umdrehen? Frau Herczeg ist, auch wenn der eine oder die andere hin und wieder mit ihr Schwierigkeiten hat, eine besondere Frau. Lasst uns großzügig sein.«
Widerwillig zustimmendes Klopfen auf Tische; dieser Rede wollte niemand widersprechen. Der Gong ertönte, fünf Minuten bis zum Nachmittagsunterricht, ihre Kollegen leerten Tassen und packten ihre Sachen.
»Hast meine Idee gerettet«, flüsterte Katja.
»Dieser Geiz«, flüsterte Enno zurück. »Unsere lieben Kollegen sitzen auf der Kohle. Aber einmal im Leben ein bisschen was rausrücken …«
Es stimmte. Das Leben in einer Kleinstadt war günstig, Möglichkeiten, das Gehalt auszugeben, gab es kaum. Aber es war wohl ein Naturgesetz: Je größer die eigene finanzielle Sicherheit, umso größer der Geiz.
»Steht dein Angebot?«, fragte sie. »Gucken wir heute zusammen nach Karten?«
»Klar. Aber vorher gehen wir mal wieder joggen.«
»Ich bin überhaupt nicht in Form.«
»Die Zeit der Ausreden ist vorbei.« Er klopfte ihr auf die Schulter. »Frühling ist nichts für Feiglinge.«
5.
Ricky saß Herrn Kukulies, dem Chefredakteur, gegenüber. Er blätterte durch ihre Bewerbungsmappe, wiegte seinen Kopf mit den strähnigen grauen Haaren und kratzte sein unrasiertes Kinn. Er setzte seine Brille ab, putzte sie an seiner Weste mit vielen Taschen, in denen Kugelschreiber steckten, und sah Ricky aus trüben, abwasserbraunen Augen an – Augen, denen niemand etwas vormachte, die alles gesehen hatten, jedenfalls in Aschersburg und Umland.
»Sie wollen also bei uns ein Praktikum machen.«
»Das Schülerpraktikum, ja. Die letzten zwei Wochen im Mai.«
»Sind Sie nicht die Einzige.«
Er zeigte auf einen Stapel Bewerbungsmappen im Regal, und Ricky fühlte ihr Herz sinken. Praktikumsplätze beim Aschersburger Tageblatt waren begehrt, fast so sehr wie bei der Kreissparkasse oder im Wildgehege. Es gab ja sonst nichts in diesem Drecksnest!
Er setzte seine Brille wieder auf, blätterte durch die wenigen Seiten in ihrer Mappe. »Aschersburger Tageblatt – seit 1868«, das Schild über dem Redaktionsgebäude war Hochstapelei. Seit Ewigkeiten war das Tageblatt nicht mehr als die Lokalbeilage der Mitteldeutschen Zeitung, acht Seiten, vor allem Anzeigen, Veranstaltungshinweise, der Rest Banalitäten: Nachwuchs bei den Zwergziegen. Rollstuhlrampe im Bürgeramt zu steil. Rüstige Hundertjährige erinnern sich. Und Kukulies war nicht bloß der Chefredakteur, er war der einzige Redakteur. Sein Büro war eng, es roch nach Zigarettenrauch und kaltem Kaffee. Auf dem Schreibtisch lagen Zeitungen und Manuskripte, in den Regalen standen Ordner, wahrscheinlich voll spannender Storys, die überall passiert waren, nur nicht in Aschersburg.
»Wie heißen Sie? Ricky Röpcke? Klingt wie ein Ringelwurm. Dieser Ringelwurm aus –« Kukulies schnippte mit den Fingern, machte eine wegwerfende Bewegung. Ricky hatte keine Ahnung, wovon er redete. Plötzlich hielt er mit dem Blättern inne, fixierte sie über den Rand seiner Brille: »Sie sind das? Mit den Putzfrauen?«
Rickys Herz machte einen Hüpfer. Er erinnerte sich! Vielleicht hatte er den Artikel sogar gelesen! Die Putzfrauen-Reportage war Rickys claim to fame. Sie war neu in der Redaktion der Schülerzeitung gewesen, mit gerade mal dreizehn Jahren. Es war ihre Idee gewesen, ein Porträt über die Reinigungsfrauen am Humboldt-Gymnasium zu schreiben: Frauen aus Osteuropa, die jeden Nachmittag in die Schule kamen, Toiletten putzten, Glasscherben aufsammelten, Kaugummi von Tischen kratzten. Niemand dankte es ihnen, niemand nahm diese Frauen wahr. Die Schüler erwarteten einfach, dass ihr Klassenraum jeden Tag tipptopp geputzt war, damit sie ihn neu verdrecken konnten. Ricky wollte diesen Frauen ein Gesicht und eine Stimme geben. Also war sie in den folgenden Wochen länger in der Schule geblieben, hatte sich mit ihnen, von denen viele kaum Deutsch sprachen, angefreundet, ihr Vertrauen gewonnen – und war auf ein System illegaler Beschäftigung, gefälschter Papiere und unterschlagener Löhne gestoßen. Ihre Reportage hatte überregional Aufsehen erregt. Der Geschäftsführer der Zeitarbeitsfirma war verhaftet worden, außerdem der missratene Sohn des damaligen Hausmeisters, der die Frauen kontrolliert und sich an mindestens zwei von ihnen vergangen hatte (das letzte hatten die Frauen nur Ricky anvertraut, nicht der Polizei). Mehrere Wochen durfte Ricky sich im Ruhm sonnen, Interviews für den MDR und die Magdeburger Stimme geben. Jakob, der siebzehnjährige Redaktionsleiter der Schülerzeitung, in den sie verknallt gewesen war, hatte ihr auf die Schulter geklopft: »Bin stolz auf dich, Kleine.«
»In unserer Branche werden Lorbeeren schnell welk«, sagte Kukulies. »Gibt’s Ihre Zeitung noch?«
»Letztes Jahr mussten wir einstellen. Zu wenig Anzeigenkunden.«
»Kenne ich.«
»Unsere Leser hängen nur noch am Handy rum …«
»Kenne ich, kenne ich.«
Ricky fühlte ein Band zwischen ihnen wachsen. Krise des Journalismus, sie saßen im selben Boot, ruderten gegen denselben Strom.
»Die Leute glauben nicht mehr an Wahrheit«, sagte sie. »Harte Wahrheit, die weh tut und wachrüttelt. Haben Sie von dem Cholera-Ausbruch in Bukavu gehört?«
»Wo?«
»Ein riesiger Skandal. Hier« – sie breitete eine Süddeutsche Zeitung über den Tisch – »ist der Kivu-See, zwischen der Republik Kongo und Ruanda. Hier« – sie stellte Kukulies’ Kaffeetasse an den Papierrand – »Ist das UN-Camp. Die Soldaten kommen aus Pakistan und Nepal, die haben die Seuche eingeschleppt! Weil nämlich hier« – sie legte aus Bleistiften eine Linie – »das Abwasser mit den Bakterien vom Camp in die Rebellengebiete fließt. Die UN wollte das vertuschen!«
»Mädchen …«
»Das, Herr Kukulies, sind die Storys, die ich schreiben will. Aschersburg ist ein Kaff, schon klar. Aber draußen brennt die Welt! Den Rechtlosen eine Stimme geben! Dafür will ich auf die Journalistenschule, dafür brauche ich den Praktikumsplatz!«
»Wissen Sie, was wir hier machen? Lokaljournalismus.«
»Das globale Bewusstsein –«
»Tag der offenen Tür im Seniorenstift. Rätselecke für die Kleinen. Aber Sie wollen die Leser belehren! Über Vertuschung im Kongo?« Er stand auf, sein Gesicht lief rot an, er stemmte die Arme auf den Schreibtisch. »Als letztes Jahr das Flüchtlingsheim in Löbnau brannte – da sind die feinen Herrschaften eingeschwebt, von der Süddeutschen, von der Zeit! In meinem Büro saßen sie, auf Ihrem Platz! Sie haben in der Ascherkrone das teuerste Menü bestellt, ihre Edelfedern ausgepackt und irgendeinen Dreck über moralische Verantwortung zusammengekleistert! Den Rechtlosen eine Stimme geben! Dass ich nicht in den Papierkorb kotze! Und jetzt raus aus meinem Büro.«
»Ich wollte nur –«
»Geh zur Süddeutschen, Mädchen, schreib schicke Artikel über globales Bewusstsein.«
»Bitte, ich –«
»Raus!!«
Ricky wankte aus dem Redaktionsgebäude. Die Sonne blendete, Passanten rempelten sie an, Kinder tobten vor dem Drogeriemarkt. Alles drehte sich, sie hielt sich an der Mauer fest. Sie musste sich übergeben, nein, sie wurde ohnmächtig! Tränen schossen ihr in die Augen, ihre Haut juckte unter dem Pullover, ihr Körper brannte. Sie wollte sich alle Kleider vom Leib reißen und schreien.
6.
»Valentin?«
Katja stand auf der Schwelle, den Türgriff in der Hand. Kein Tapsen, kein Miauen. Kein Streichen von Fell um ihr Bein.
Sie schloss leise die Haustür, vielleicht schlief er auf seiner Wolldecke. Doch da lag er nicht, die Wolldecke lag verlassen in der Ecke des Sofas. Sie ging in die Küche. Der Napf stand neben dem Vorratsschrank, Valentin hatte die Futterkroketten nicht angerührt. Auch die Katzentoilette war unbenutzt.
Sie hatte nicht viel Zeit, musste sich fürs Joggen umziehen. Draußen wartete Enno. Sie öffnete die Terrassentür und rief: »Valentin!«
Keine Bewegung, kein Rascheln im Gebüsch. Im Nachbargarten lief der Rasenmäher. Sie machte sich zu viele Sorgen, was konnte ihm schon passiert sein? Der erste warme Frühlingstag, er war eben unterwegs. Wenn sie nachher zurückkam, würde er bestimmt zu Hause sein.
Die Märzstürme hatten Bäume entwurzelt und Äste auf die Pfade geweht. Immer wieder musste Katja Pfützen ausweichen. Doch das Laufen tat ihr gut, füllte ihre Lunge mit frischer Luft, die nach Erde und feuchtem Holz roch. Ihr Blick glitt über Galloway-Rinder auf den Weiden und Osterlämmer, die an den Eutern ihrer Mütter saugten. Sie übersah ein Schlammloch, der Schlamm spritzte ihr bis zur Hüfte.
»Wir hätten an der Saale laufen sollen«, rief sie zu Enno, der vor ihr lief.
»Bei dem Wetter? Zu viele Spaziergänger mit gestörten Hunden.«
Da hatte er recht. Hier, auf abgelegenen Pfaden durch den Wald, waren sie allein. Allerdings erforderte das Laufen Konzentration, und Enno war besser trainiert. Er war nicht der Typ, der gönnerhaft für eine Frau das Tempo reduzierte, was sie ihm anrechnete. Seitenstiche meldeten sich, sie presste die Luft mit Faustschlägen und Atemstößen aus der Bauchhöhle.
Die Lichtung vor ihnen war traditionell der Ort für ihre Gehpause. Enno reduzierte das Tempo, der Pfad wurde breiter, sie gingen jetzt nebeneinander, vorbei an zersägten Baumstämmen, die hier letztes Jahr noch nicht gelegen hatten.
»Herrliche Luft«, sagte er.
»Allerdings.«
»Man könnte vergessen, wie kaputt die Natur ist.«
»Das gesamte untere Saaletal ist Naturpark.«
»Und warum fällen sie die Bäume? Alles greenwashing, alles Kommerz.«
Sie hätte ihm schon erklären können, warum auch in einem Naturpark hin und wieder Bäume gefällt wurden. Aber Enno sah überall kapitalistische Verschwörungen, und der Nachmittag war zu schön für politische Diskussionen. Sie nahm ihre Trinkflasche aus dem Gürtel, Enno aß einen Müsliriegel.
»Hast du schon gehört?«, sagte er. »Krugmeyer hört auf.«
»Wann?«
»Sobald wie möglich. Sein letztes EKG war wohl nicht gut.«
»Wer sagt das?«
»Gerüchte. Aber musst ihn dir nur mal ansehen.«
Krugmeyer war der Direktor des Humboldt-Gymnasiums, seit fast drei Jahrzehnten. Die Schule war sein Geist und seine Seele, alle wussten um die Kämpfe, die er täglich führte – um mehr Stellen, mehr Mittel, die Sanierung der Sporthalle, in der es seit letztem Winter durchs Dach regnete (»Stellen Sie bis zur nächsten Haushaltssitzung einen Eimer drunter«, hatte man ihm beschieden). Diese Kämpfe zehrten an Krugmeyer, und seit einiger Zeit sah man es ihm an. Er wirkte unkonzentriert, ließ die Zügel schleifen, die Vertretungspläne wurden wirr.
»Gibt’s schon eine Nachfolge?«, fragte Katja.
»Wird gesucht.«
»Dann kann’s dauern.«
Schlimmer als der Mangel an Lehrkräften war der Mangel an Direktoren. Katja wusste von fünf Schulen allein im Landkreis, die kommissarisch geleitet wurden, in einem Fall von der Sekretärin. Wer tat sich diesen Job freiwillig an? Tägliche Verwaltung des Mangels, Klagen der Eltern über ausgefallenen Unterricht, veraltetes Lehrmaterial, kaputte Waschbecken. Und jedes Mal beschwichtigen, die Lage schönreden, auf nächste Woche, nächsten Monat, den nächsten Haushaltsplan vertrösten. Diese Lügerei musste selbst eine Frohnatur wie Krugmeyer auslaugen.
»Wir sind die Kapelle auf dem sinkenden Schiff«, sagte Enno. »Das letzte Gymnasium im Landkreis.«
»Das vorletzte.«
»Lise-Meitner wird in zwei Jahren fusioniert. Integrierte Gesamtschule, Beschluss aus Magdeburg. Für uns gibt’s auch bald nicht mehr genügend Schüler.«
»Es wird welche geben. Aschersburg verliert keine Einwohner mehr, im Gegenteil. Junge Familien ziehen her, sie merken, dass das Leben in einer Kleinstadt besser ist als in den Metropolen.«
»Aber reicht das für ein eigenes Gymnasium? Ich meine, wen unterrichten wir? Kinder von Eltern, die sich für was Besseres halten.«
»Oder Kinder, die auf dem Gymnasium besser aufgehoben sind.«
»Wir fördern keine Individualität, sondern Elitendenken. Und was hat Krugmeyer erreicht mit seinen Kämpfen? Übergewicht und ein krankes Herz.«
Katja und Enno waren bei den Schülern beliebt, aber auf unterschiedliche Art. Katja nahm ihre Arbeit ernst und erwartete, dass die Schüler den Unterricht ernst nahmen. Biologie und Chemie waren Schlüsselfächer, wer hier nichts begriff, begriff vom Leben wenig. Unbegreiflich war ihr die Ignoranz mancher Kollegen von den Geisteswissenschaften; sie wollten ihre Schüler zu umfassend gebildeten Menschen erziehen, aber hielten Eukaryoten für eine Inselgruppe. Enno war in vieler Hinsicht ihr Gegenteil: Die Schüler nannten ihn einfach »Schrader«, seit Jahren war er Vertrauenslehrer und einer der wenigen Kollegen, der die Schüler aller Jahrgänge duzte, obwohl das eigentlich ab der zehnten Klasse nicht mehr erlaubt war. Im Englisch-Unterricht lasen sie Texte aus Rocksongs oder sahen Antikriegsfilme aus den Siebzigern. Im Sportunterricht war er etwas fordernder, aber auch nur so, dass seine Schüler sich bei den Schulmeisterschaften nicht blamierten. So geschickt, wie mancher Schüler beim Abschreiben war, war Enno darin, gute Noten zu geben. Hier eine Andeutung, welcher Text in der nächsten Klausur Thema sein würde, dort ein Wink beim Verteilen der Fragen, ein freundschaftlicher Blick über die Schulter, Tippen auf einen Fehler … Am Ende schrieb kaum jemand weniger als zehn Punkte. Enno galt als engagierter Pädagoge, Eltern wie Schüler himmelten ihn an. Und kaum einer arbeitete so wenig. »Ich bin zu lange im Job«, hatte er Katja einmal beim Abendessen gestanden, dabei war er nur sechs Jahre älter. In wenigen Jahren, fürchtete sie, würde auch er beim Therapeuten auf der Couch liegen.
»Caroline hat die letzte Klausur komplett abgeschrieben«, sagte sie. »Von Wikipedia.«
»Wie hat sie das gemacht?«
»Das frage ich mich auch. Neue Smartwatch? Brille mit eingebautem Display? In ein paar Jahren kommen Kontaktlinsen mit augmented reality auf den Markt. Dann können wir einpacken.«
»Wie viele Punkte gibst du ihr?«
»Null, was sonst?«
»Sei ein bisschen großzügig.«
»Caroline gehört nicht aufs Gymnasium. Sie quält sich, wir quälen sie.«
»Sie ist in einer schwachen Phase, Probleme mit den Eltern, ich versuche da zu vermitteln. In einem halben Jahr kann das ganz anders aussehen.«
»Das hast du letztes Jahr auch gesagt. Sie interessiert sich für nichts außer Haaren und Fingernägeln. Sie will Stylistin werden, wunderbar. Dafür braucht sie kein Abitur.«
»Sei streng, aber nimm ihr nicht die Würde.«
Sie stiegen über einen herabgestürzten Ast, dahinter war der Pfad frei. Sinnlos, diese Diskussion fortzuführen, sie wussten es beide. Katja stand für Leistung und Ehrlichkeit, Enno für gute Stimmung und Ein-Auge-Zudrücken. Und Caroline war der Abgrund zwischen ihnen, über den keine Brücke führte. Also liefen sie weiter, auf die Abendsonne zu. Ein Reh sprang ins Dickicht, aus einem Teich flatterten Enten und Kormorane.
»Valentin!« Katja stand auf der Terrasse, in der Hand hielt sie den Futternapf. Sie raschelte mit den Kroketten, obwohl das sonst nicht nötig war. Wenn sie abends nach Hause kam, wartete er auf sie. Wollte gestreichelt und am Bauch gekrault werden, wollte sich auf ihrem Schoß zusammenrollen, während sie fernsah oder ein Buch las.
Die Tage wurden länger, sicher. Heute Abend war es besonders warm. Trotzdem, etwas stimmte nicht. War es möglich, dass er ihr wegen heute Morgen immer noch böse war?
Sie ging in die Küche, fischte die eingeschrumpelte Maus aus der Spüle und entsorgte sie endlich in der Bio-Tonne. Den Streit heute Morgen bereute sie nun doch. So viel Krach wegen dieses winzigen Tierchens. Sie kontrollierte die Katzenklappe neben der Haustür. Sie klemmte nicht. Liebling, wo ist dein Problem?
Sie musste duschen und ihre Haare waschen, das würde eine Weile dauern. Wenn sie danach im Bademantel aus dem Bad kam – bestimmt saß Valentin im Flur und wartete.
7.
»Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe geschätzte, verehrte, an diesem Tag besonders gefeierte Frau Herczeg.«
Direktor Krugmeyer stand in der Mitte des Lehrerzimmers. Seinen massigen Arm hatte er um Herczeg gelegt, die auch an diesem Tag nicht auf die Idee gekommen wäre, etwas anderes zu tragen als eines ihrer dunkelgrauen Strickkleider und alten, vermutlich seit Generationen vererbten Silberschmuck. Mager und starr stand sie neben Krugmeyer wie seine Armstütze – immerhin, der schmale Mund lächelte. Dies war ihr Tag, die Kollegen standen um sie herum, mit Sekt- oder Wassergläsern.
»Vor fünfundzwanzig Jahren sind Sie an dieses Institut gekommen …«
Krugmeyer hielt eine launige Rede, es wurde geschmunzelt und gelacht; er konnte das, obwohl er auch heute nicht ganz fit wirkte, sogar zweimal kurz unterbrechen und sich mit dem Taschentuch über die Stirn wischen musste. Er vermied Ausdrücke wie »Inventar« oder »Urgestein«, auch wenn sie gepasst hätten – das Humboldt-Gymnasium ohne Frau Herczeg konnte sich niemand vorstellen. Und doch gehörte sie nicht wirklich dazu. Sie war eine der wenigen Kollegen, die von allen gesiezt wurden – nicht aus Abneigung, eher aus Respekt. Als junge Frau war sie aus Rumänien gekommen, bis heute hatte sie sich ihren Banater Dialekt bewahrt, mit rollendem R. Immer noch umwehte sie, vor allem wenn sie sich mit renitenten Schülern herumärgern musste, ein Hauch von Ceaușescu-Regime. Sie war eine Lehrerin, die von schlechten Schülern verachtet, dem Mittelmaß verspottet und den guten verehrt wurde. Mehrere ihrer Privatschüler waren professionelle Musiker geworden. Eine hatte, als international erfolgreiche Pianistin, einen »Echo« gewonnen und Frau Herczeg in ihrer Dankesrede erwähnt. Aber sonst? Sie lebte allein, in einem Bungalow aus den sechziger Jahren im Poetenviertel, nur wenige Straßen von Katja entfernt. War sie verheiratet gewesen? Hatte sie Kinder? Niemand wusste es.
»… bleibt mir und uns allen an diesem Tag nur ein Wunsch: dass Sie uns und unserem Gymnasium noch lange erhalten bleiben. Liebe Frau Herczeg, leben Sie hoch!«
»Sie lebe hoch!«, riefen die Kollegen. »Hoch, hoch, hoch!«