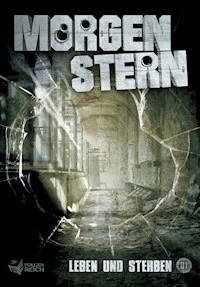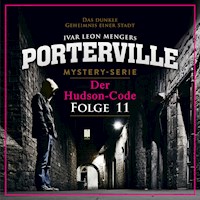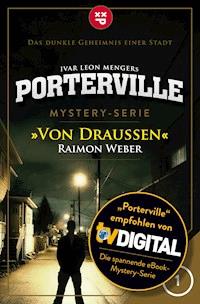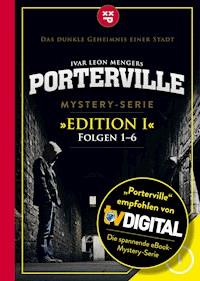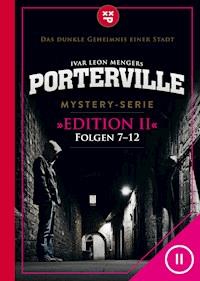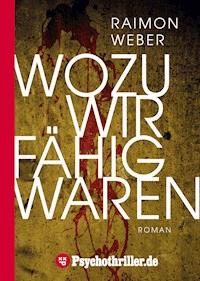
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Wir waren fünf. Vier Freunde und Udo. Er war älter und glaubte, clever zu sein." Eine westfälische Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets im Herbst 1978. Am Ufer der Ruhr brennt eine Leiche und ein Mann sieht seine Stadt aus einer ungeahnten Perspektive. Ein Roman über einflussreiche Lokalpolitiker, erste Drogen, einen Benzinkanister und das Ende einer Jugend. "Wir mussten erkennen, wozu wir fähig waren." "Schnörkellos und in klaren Bildern erzählt Raimon Weber eine spannende Geschichte über Abgründe, die man auch an Orten finden kann, die dem Leser bestens vertraut scheinen." - RUHRNACHRICHTEN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wozu wir fähig waren
Raimon Weber
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-942261-39-5
Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
1972
„Fehlfarben“, flüsterte ich und fuhr mit dem Zeigefinger über das raue Holz der Zigarrenschachtel. Sie war flach und quadratisch, besaß genau die richtige Größe, um sie in der Jackentasche zu verbergen. Angefüllt mit kostbaren Dingen, die man immerzu mit sich herumtragen wollte.
Die Schachtel gehörte Matthes. Er hob darin Sammelbilder von Fußballspielern auf. Viele der Spieler sahen schlecht gelaunt aus. Ich hätte auch gern so eine Schachtel besessen. Ich würde darin interessantere Dinge als Bildchen von Männern in Trikots aufbewahren: das winzige Taschenmesser mit dem Perlmuttgriff aus dem Kaugummiautomaten, die isländische Münze, die ich gefunden hatte, und natürlich die getrocknete Blindschleiche. Aber ich kannte niemanden, der Zigarren rauchte.
„Was bedeutet Fehlfarben?“, fragte ich.
Matthes zuckte mit den Schultern. „Vielleicht ... vielleicht fehlt den Zigarren die Farbe. Sie sind dann bleich statt braun.“
Ich versuchte mir „bleiche“ Zigarren vorzustellen. Wer sollte so etwas rauchen?
Ein Windstoß fuhr durch den Kirschbaum über unseren Köpfen. Das Rascheln der Blätter endete abrupt und hinterließ einen Moment der Stille. Auf der nahen Straße näherte sich jetzt ein Auto. Manchmal waren sie viel zu schnell. Die Fahrer unterschätzten die so harmlos aussehende Kurve und ihre Wagen landeten auf dem gegenüberliegenden Feld. Vor einiger Zeit war ein Motorradfahrer verbrannt. Seine Honda war gegen eine Laterne gerast und in Flammen aufgegangen. „Es war wie in einem Film“, hatten die Leute erzählt. Der verbogene und vom Feuer geschwärzte Laternenmast war nach einigen Tagen ausgewechselt worden. Nur ein dunkler Fleck auf dem Asphalt des Bürgersteigs erinnerte noch an den Unfall.
Matthes griff nach dem Seil, das um einen der unteren Äste des Kirschbaums geschlungen war. „Wer es am weitesten nach oben schafft!“
Pflaumen- und Apfelbäume wuchsen in dem verwilderten Garten. Aber der alte Kirschbaum überragte sie alle, und während die Äste der anderen Bäume unter unserem Gewicht knirschten und manchmal mit einem trockenen Knacken brachen, konnten wir dem Kirschbaum vertrauen. Sein Holz fühlte sich hart und unnachgiebig an. Selbst die nur fingerdicken Zweige in der Spitze der Krone brachen nicht. Sie gaben nur nach, und wenn wir sie wieder losließen, schnellten sie in ihre Ausgangsposition zurück, so als seien sie aus Gummi.
Matthes hatte den Baum fast zur Hälfte erklommen. Ich hangelte mich am Seil empor. Der alte Kirschbaum war ein perfektes Klettergerüst. Die ausladenden Äste, die Gabelungen boten unseren umhertastenden Händen und Füßen immer den richtigen Halt.
Noch lag das Grundstück unter mir brach. Die ehemals penibel gepflegten Beete waren von Unkraut überwuchert. Vergessene Kohlköpfe waren zu seltsamen, blumenartigen Gewächsen ausgetrieben. Ein Sturm hatte die vertrockneten Maisstauden geknickt. Jetzt bildeten sie ein Durcheinander, das mich an die Mikadostäbchen aus unserer Spielesammlung erinnerte.
Ich kletterte höher. Die unbewegte Luft um uns herum war so klar, dass ich den fauligen Gestank aus der Regentonne riechen konnte. Die Tonne stand im Schatten einer verfallenen Hütte. Der letzte Sturm hatte sie in eine bedenkliche Schieflage gebracht. Wenn man sich gegen die Wände stemmte, stieß die Holzhütte ein Ächzen aus und erzitterte. Alles in ihrem Inneren – Pappkartons, alte Möbel, Gartengeräte – verwandelte sich in ein glitschiges, rostiges Gemenge. Aber da war noch die zweite Hütte: Zwei kleine Zimmer hinter Fenstern mit gelblichen Gardinen und ein Dachboden, den man über eine Luke in der Decke erreichen konnte. So niedrig, dass wir uns nur gebückt bewegen konnten. Wir hatten es uns dort oben mit alten Kissen und Decken eingerichtet. Wenn man die Luke zuschlug, blieb nur ein feiner Lichtschein, der durch die Ritzen zwischen den Bodenbrettern drang.
In der Hütte hatte bis zu seinem Tod ein alter Mann gewohnt. Wir kannten seinen Namen nicht und hatten ihn nur ein paar Mal vom Zaun aus beobachtet. Niemals zuvor waren wir einem Mann mit so vielen Haaren begegnet. Grau und dicht standen sie wirr von seinem Schädel ab. Ein Bart bedeckte das ganze Gesicht. Keine Nase, kein Mund, noch nicht einmal Augen waren auszumachen. Er kroch in den Furchen zwischen Kohl und Karotten umher. Wir glaubten, dass er das Grundstück niemals verließ. Dass er sich nur von dem ernährte, was seine eingezäunte Welt hergab. Dann war es ganz schnell gegangen. Der Fremde starb und Matthes Eltern kauften das Grundstück. Der geheimnisvollste Ort inmitten der Stadt Unna, umgeben von einfachen Mehrfamilienhäusern, sollte uns für viele Monate als Ort für Abenteuer zur Verfügung stehen. Bis Matthes Eltern ein Haus bauen würden. Wenn es so weit war, wollten wir den Kirschbaum beschützen. Auf keinen Fall durfte der gefällt werden.
Je höher ich stieg, desto dünner wurden die Äste. Unter meinem Gewicht schwangen sie hin und her. Matthes hockte über mir in einer Astgabelung und ließ die Beine baumeln. Der Riemen einer Sandale war abgerissen. Er grinste mich an. Ein Schneidezahn fehlte. Matthes hatte ihn verloren, als er bei einem Fahrradrennen mit dem Vorderreifen in den Rillen eines Gullydeckels stecken blieb und über den Lenker flog.
„Die Liebe und der Suff, die reiben den Menschen uff!“
Sofort fielen mir die Fotos wieder ein. Sie hingen in den Schaukästen des Kinos. Gegenüber dem Kiosk, der das Eis im Hörnchen schon für zwanzig Pfennig verkaufte. Für zwei Groschen bekam man keine Kugel, das Eis wurde mit einem Spachtel auf die Waffel geschmiert. Die Portion fiel so viel größer aus, als wenn man die Kugel für dreißig Pfennig wählte. So was machten in unseren Augen nur Idioten, die vom Eiskaufen keine Ahnung hatten.
Mit dem Eis schlenderten wir dann immer zu den Kinobildern. Seit sechs Wochen lief dort Laß jucken Kumpel!. Die bunten Bilder zeigten Grimassen schneidende Männer in Unterhosen und mollige Frauen im Büstenhalter. Das ist also ein Sexfilm, fanden wir heraus. Seit sechs Wochen marschierten nun Unnas Erwachsene in einen Film, der mit dem Spruch Die Liebe und der Suff, die reiben den Menschen uff! lockte. Es hieß, dass er in unserer Gegend gedreht worden war. Vielleicht sogar mit Leuten, die wir kannten. Wir betrachteten deshalb die Schauspieler auf den Fotos ganz genau. Ohne Erfolg. Aber wir lernten, dass es beim Sex aufgrund der dargestellten Szenen lustig, aber auch ein wenig ekelig zugehen musste. Immer wieder versuchten wir, uns die Handlung des Films zusammenzureimen. Da waren Bergleute, Putzfrauen in karierten Kitteln, unter denen sie offenbar nackt waren, Krankenschwestern mit hochhackigen Schuhen ...
„Ich habe gehört, dass es auch im Fernsehen Sexfilme gibt“, sagte Matthes und ließ Spucke aus seinem Mund in die Tiefe fallen. „Eins, zwei, drei ...“, zählte er leise. Dann landete seine Spucke auf dem Boden. Drei Spucksekunden. Wir stellten uns vor, dass die Spucke pro Sekunde zwei Meter tief fiel. Also befanden wir uns jetzt in sechs Meter Höhe. Irgendwie konnte das aber nicht stimmen. Das waren mehr als sechs Meter. Über uns reckten sich nur noch ganz dünne Zweige dem Sonnenlicht entgegen. Matthes hatte zu langsam gezählt.
„Im Fernsehen?“, staunte ich. „Das glaube ich nicht.“
„Hat der Georg aber behauptet“, erwiderte Matthes und wischte sich eine grün schillernde Fliege vom Gesicht. Georg war Matthes´ Cousin. Er war drei Jahre älter als wir und als Vierzehnjähriger stellte er eine Autorität dar. Georg rauchte auch schon. Nicht Ernte 23 oder Milde Sorte wie unsere Väter, sondern Players Navy Cut. Ohne Filter und mit einem Matrosen auf der Packung.
„Die Filme kommen ein paar Mal in der Woche. Nachts nach zwei Uhr.“
„Dann ist doch längst Sendeschluss“, widersprach ich.
„Das ist ja der Trick.“ Matthes verengte die Augen zu schmalen Schlitzen und nickte mir wissend zu. „Ist eben nur für Eingeweihte. Außerdem musst du den Sender erst suchen.“
„Häh? Wie suchen?“
„Na, an dem Knopf zur Feineinstellung. Die Filme sollen sich rechts vom ZDF verstecken.“
Die Verlockung war groß. Ich überlegte, ob ich mir in einer der nächsten Nächte den Wecker stellen sollte, um mich vor den Grundig-Fernseher im Wohnzimmer zu hocken. Die Lautstärke auf ganz leise gestellt. Nein, am besten ganz ohne Ton. Bloß kein Risiko eingehen.
„Ob unsere Eltern davon wissen?“, fragte ich.
„Meine bestimmt nicht.“ Matthes winkte ab. „Die haben von Sex sowieso keine Ahnung.“
„Aha“, brummte ich und war in Gedanken wieder bei der Suche nach den geheimen Filmen. Was, wenn ich mich aus dem Bett schlich und meine Eltern vor dem Fernseher überraschen würde? Wie peinlich. Ich würde mich für sie schämen. Für den Rest meines Lebens.
Ich blickte zum Feld auf der anderen Straßenseite. Der Bauer hatte es längst gemäht. Die Luft flimmerte über den Getreidestoppeln. Man konnte weit sehen, es war wie im Ausguck eines Segelschiffs. An manchen Tagen war es gut, mit Matthes allein zu sein. Ohne die anderen Freunde. Nur zu zweit war es möglich zu schweigen. Wir konnten den eigenen Gedanken nachhängen, um dann, viele Minuten später, wenn einer von uns beiden wieder zu sprechen begann, festzustellen, dass wir über dieselben Dinge nachgedacht hatten. Ich war mir sicher, dass uns in diesen besonderen Momenten etwas Unsichtbares verband.
Matthes hielt die Augen geschlossen. Seine winzige Nase kräuselte sich, er lächelte. Er würde mich gleich an seinen guten Gedanken teilhaben lassen.
An der Kreuzung – dreihundert Meter von uns entfernt – jaulte Gummi auf Asphalt. Ein heiseres Röhren näherte sich. Ein Auto. Dem Geräusch zufolge mit viel PS. Ich schaute neugierig zur Straße. Viel zu schnell, dachte ich. Ein metallicblaues Monstrum rauschte in die Kurve hinein. So absurd lang, dass ich ein verblüfftes Grunzen ausstieß. Ein Opel Diplomat. Das einzige deutsche Auto, das ich mir in den amerikanischen Krimiserien vorstellen konnte, die ich manchmal sehen durfte. Die Karosserie wankte wie ein volltrunkener Seemann. Der Diplomat spuckte eine dichte Rauchfahne – verbranntes Öl – aus. Die Fliehkraft drückte den schweren Wagen nach rechts. Das Heck brach aus, der rechte Hinterreifen prallte gegen die hohe Bordsteinkante. Ein dumpfer Schlag, die Radkappe wirbelte durch die Luft, blitzte kurz im Sonnenlicht. Dann hob sich das Hinterteil des Wagens, der Motor heulte infernalisch auf, als beide Antriebsräder den Kontakt zur Fahrbahn verloren. Der Diplomat erinnerte jetzt an eine grobschlächtige, stark übergewichtige Ballerina, die wider besseren Wissens eine Pirouette riskierte. Einen Sekundenbruchteil lastete das tonnenschwere Gewicht des Fahrzeugs nur auf dem linken Vorderrad. Der Reifen sprang von der Felge, der Diplomat kippte vornüber, landete auf dem Dach und rutschte über die Straße. Die Frontscheibe zersprang in einem Sprühregen winziger Glassplitter. Ich starrte auf den schwarzen Unterboden des Monstrums, die Auspuffanlage löste sich aus ihrer Halterung und schleuderte davon. Metall kreischte über Asphalt. Der Kofferraum öffnete sich und spuckte seinen Inhalt aus: einen roten Benzinkanister, Werkzeug, einen Sack Zement, der als grauer Nebel verpuffte. Und zuletzt ein rundes Etwas, das ich zuerst für den Ersatzreifen hielt. Aber ein Ersatzreifen war nicht grün, hatte auf einer Felge zu sitzen und sah nicht so zerfleddert wie dieses runde Ding aus, das gegen den Zaun unseres Grundstücks prallte. Endlich kam der Wagen zum Stehen, erzitterte kurz, als würde er verenden, während heißer Dampf und rostiges Kühlwasser unter ihm hervorschoss. Der Opel Diplomat erinnerte mich an ein zertretenes Insekt, einen übergroßen Mistkäfer.
Ich bemerkte erst jetzt, dass ich während des ganzen Unfalls den Atem angehalten hatte. Prustend stieß ich die Luft aus meiner Lunge. Das runde Ding vor dem Zaun, zehn Meter von mir entfernt, war einer von diesen aus Tannenzweigen zusammengesteckten Kränzen, wie sie die Erwachsenen bei Beerdigungen auf das frische Grab legten. Ich konnte jetzt sogar eine weiße Schleife sehen.
Ein orangefarbener VW bremste so hart vor der Unfallstelle, dass ihn der nachfolgende Linienbus beinahe gerammt hätte. Im Diplomat regte sich nichts. Niemand versuchte, aus der auf dem Dach liegenden Karosserie zu klettern. Seltsamerweise glommen in diesem Moment die Rücklichter auf. Einmal kurz, dann noch einmal lang ... und noch mal kurz. So, als wollte der Diplomat um Hilfe morsen. Der Busfahrer und mehrere seiner Fahrgäste liefen herbei. Im VW saß eine Frau. Sie schlug die Hände vor ihr Gesicht und ich hörte bis in die Höhe des Baumes ihr „Ohgottohgottohgott!“. Der Opel quittierte ihr Geschrei mit einem Rülpser und erbrach dickflüssiges Öl.
Es war wie im Film gewesen. Ein Unfall ausgerechnet mit diesem riesigen Wagen, würdig eines Gangsterbosses. Spektakulär inszeniert mit umherfliegenden Kränzen und einer Gischt aus Dampf und Zementstaub. Mir war gar nicht bewusst, dass jemand dabei zu Schaden gekommen sein könnte. „Boah!“, machte ich und blickte zu Matthes empor.
„... Matthes?“
Mein Freund hockte nicht in der Astgabel. Ich sah mich nach allen Seiten um, spähte zu den höchsten Ästen, als wäre es möglich, dass ihn die Neugierde bis in jenen Bereich getrieben hätte, an dem selbst die Zweige des Kirschbaums zu dünn wurden, um uns zu tragen.
Lauter, verwundert: „Matthes?“
Ich sah zur Straße, wo jetzt immer mehr Menschen zusammenliefen. Der Busfahrer machte sich an der Fahrertür des Opels zu schaffen. Sie hatte sich verkeilt. Aus der Ferne drang das Geräusch von Polizeisirenen. Matthes war nicht dort. Er hatte sich nicht unbemerkt zum Unfallort aufgemacht. Mein Atem beschleunigte sich, ich spürte den Herzschlag in meiner Brust.
Und mit einem Anflug von Panik: „Matthes! Wo ...?“
Wie zufällig streifte mein Blick den Boden unter dem Kirschbaum. Dort lag ein kleiner Körper. Für einen Augenblick versagte mein Verstand. Ich atmete mechanisch. Wie im Leerlauf. Das karierte Hemd. Erst das karierte Hemd – braun-gelb-grün – machte mir bewusst, dass dort unten zwischen dem hohen Gras mein Freund lag. Nicht ausgestreckt wie zum Schlafen oder Träumen. Nein! Das Gesicht dem Erdboden zugewandt. Der linke Arm bildete einen unmöglichen Winkel zur Schulter. Der rechte Unterschenkel bot einen noch absurderen Anblick. Er musste sich im Kniegelenk komplett verdreht haben. Etwas Helles, Weißliches ragte aus dem Fleisch des Unterschenkels hervor. Zuerst dachte ich, ein herumliegender Ast hätte ihn durchstoßen, dann erkannte ich, dass es Matthes gesplittertes Schienbein war.
Matthes bewegte sich nicht.
Mir wurde ganz leicht. Meine Muskeln verloren alle Kraft, schienen nicht mehr zu mir zu gehören. Mein Griff löste sich. Und dann, von einer Sekunde zur anderen, krampfte mein Körper, zog sich zusammen wie eine panische Schnecke. Ich umklammerte die Äste, schloss die Augen, presste das Kinn gegen die Brust. Zitterte, erbrach mich kurz und bitter, wagte nicht, mir den Schaum von den Lippen zu wischen, zitterte stärker. Die Baumkrone schwankte plötzlich im Wind, die Zweige schlugen aneinander. Der Boden war so fern. Etwas in mir sagte, dass ich Hilfe holen musste. Hilfe für meinen besten Freund. Aber ... aber die Knochen stachen schon durch sein Fleisch. ... Ich war doch oben ... der Boden so weit weg. Ich vergaß, dass die Hilfe in Rufweite war. Trotz des Lärms auf der Straße – eine Motorsäge kam kreischend zum Einsatz – würde man mich sicher hören. Aber ich konnte nicht schreien, mich nicht bewegen, nur so hektisch atmen, dass mir schwindlig wurde.
Wumm! Wumm! Wumm! Wumm! hämmerte mein Herz und wollte sich dabei überschlagen.
Ich bohrte die Fingernägel in die Rinde des Kirschbaums. Ich erstarrte.
Ich gefror.
2006
Matthes ...
Die Bilder von damals verblassen nicht, sie brechen so abrupt ab, als hätte jemand einen Schalter in meinem Geist umgelegt.
Ich bin wach. Es ist dunkel. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Tupfen Grau taucht in der Schwärze auf. Er beginnt zu wachsen, pulsiert im Rhythmus meines hektisch schlagenden Herzen. Das Grau verdrängt das Dunkel. Gedanken zerfasern, treiben davon und ich gleite ab in eine schmerzhafte Müdigkeit. Mein Körper fühlt sich unerträglich schwer an. In meinen Ohren erklingt ein auf- und abschwellendes Rauschen. Ich muss krank sein.
Konzentrier dich!
Vielleicht hat mich ein plötzlicher Herzanfall niedergestreckt. Beim letzten Belastungs-EKG hatte mein Hausarzt stirnrunzelnd die Ergebnisse betrachtet, während ich hechelnd und schweißgebadet versuchte, beim Absteigen vom Fahrrad nicht in Ohnmacht zu fallen. Mehr Bewegung, vernünftigere Ernährung hatte der Arzt dringend angeraten.
Das Herz! Das ist es! Es hat mir endlich die Quittung serviert. Ich muss meinen Zustand überprüfen. Wie schlimm hat es mich erwischt? Ich weiß fast nichts über die Auswirkungen eines Infarkts. Man kann danach gelähmt sein, stumm, blind. So hilflos, dass einem die Spucke unkontrolliert aus den Mundwinkeln rinnt und das Atmen von einer Maschine erledigt werden muss.
Überhaupt: Ich kann nur durch die Nase atmen.
Panik erfasst mich, wühlt sich durch die Kopfschmerzen, vertreibt die Müdigkeit, aber nicht die Schmerzen, die jeden Quadratzentimeter meines Körpers ausfüllen und dem Verstand das Gefühl vermitteln, er sei gefangen unter einer undurchdringlichen Eisdecke. Wo bin ich?,brülle ich, doch der Schrei erklingt nur in meinem Kopf. Kein Wort kommt über meine Lippen. Nur ein ersticktes Grunzen. Meine Zungenspitze ertastet etwas Weiches und Feuchtes vor meinen Lippen.
Man hat mich geknebelt.
Ich versuche, meinen rechten Arm zu bewegen, um mich von dem Ding zu befreien. Der Arm rührt sich nicht, sendet nur einen stechenden Schmerz.
Ich bin gefesselt. Bin hilflos.
Ich atme stoßweiße durch die Nase ein. Der Knebel schränkt meine Luftzufuhr ein. Ich beginne unwillkürlich zu würgen, spüre den scharfen Geschmack von Magensäure, die durch die Speiseröhre nach oben drängt.
Nein! Ruhig!
Wenn ich mich übergebe, werde ich bestimmt ersticken. Der Inhalt meines Magens ... er kann nicht hinaus. Meine Muskeln zucken unkontrolliert, ich versuche die Luft gleichmäßig durch meine Nasenlöcher ein- und auszuatmen ... zu viel Sauerstoff! Langsamer! ... ich beginne zu hyperventilieren und fühle, wie mein Bewusstsein schwindet.
Laaangsam!!!
Es gelingt mir, den Brechreiz zu unterdrücken. Erfolglos versuche ich erneut, den rechten Arm zu bewegen. Dann den linken. Keine Reaktion. Ich stelle mir vor, dass sie fort sind. Ich bin gar nicht gefesselt. Meine Arme wurden bei einem schweren Unfall abgetrennt. Oder amputiert.
Sofort beginnt es erneut in meinem Magen zu rumoren. Kein Herzinfarkt!, brüllt die Angst mir zu. Ein Unfall! Ich bin eingequetscht in meinem Wagen. Bin Fleisch mit einem letzten, versiegenden Lebensfunken. Eingebettet in verbogenem Blech und geborstenem Kunststoff. Es ist Nacht. Deshalb sehe ich nichts.
Stopp!
Ich sehe doch etwas. Den grauen Schimmer, den ich wahrgenommen hatte, als ich erwachte. Das muss Licht sein, das durch meine geschlossenen Lider dringt.
Ich will die Augen öffnen und stelle fest, dass sie schon die ganze Zeit geöffnet waren.
Ich muss fast völlig blind sein. Vielleicht strahlt mir eine Lampe direkt ins Gesicht und alles was ich noch wahrnehmen kann, ist dieser schwache graue Schimmer.
Hinter dem Knebel – oder ist es etwas Anderes? Ein Verband? – dringt ein Wimmern hervor. Ich kann es nicht zurückhalten. Der Zustand wird unerträglich. Noch einmal versuche ich, Arme und Beine zu bewegen. Es gelingt mir, die Knie ein wenig anzuziehen. Die Finger ... ich kann sie bewegen. Ich liege auf dem Rücken, die Arme unter mir. Ich will mich auf die Seite wälzen. Es gelingt mir nicht. Etwas schneidet in die Haut über meinen Handgelenken. Meine Hände, meine Arme, sie sind nicht amputiert worden. Ein kurzes Glücksgefühl durchfährt mich, um sofort wieder der Angst zu weichen. Ich muss mir ein Bild von meiner Situation machen. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Der Verstand befindet sich auf einer Gratwanderung, jederzeit bereit, das Denken einzustellen. Ich versuche mühsam, eine Checkliste zusammenzustellen:
Beine und Arme sind gefesselt. Ich schaffe es nicht, mich aufzurichten oder auch nur zur Seite zu drehen. Ich versuche, mich rutschend fortzubewegen, krümme mich dabei zusammen wie eine Raupe. Nach wenigen Zentimetern werde ich gestoppt.
Zusätzlich bin ich irgendwo festgebunden. Meine Bewegungsfähigkeit ist extrem beschränkt.
Ich bin geknebelt und leide deshalb unter Atemnot. Meine Augen sind – hoffentlich! – von einer Binde oder etwas Ähnlichem verdeckt. Ich kann nicht sehen und mich nicht durch Rufe bemerkbar machen.
Vielleicht wäre das auch gar keine so gute Idee. Denn wer immer mich in diese Situation gebracht hat, könnte noch in der Nähe sein. Ich lausche. Es ist windig, ich spüre die kalte Luft in meinem Gesicht, also befinde ich mich im Freien. Von irgendwoher dringt ein dumpfes Brummen – ein Motor? – und verebbt.
Wo bin ich? Wer hat mich hierher gebracht? Und vor allem: Warum?
Ich bin nicht reich genug, um ein lohnendes Entführungsopfer abzugeben. Ich verdiene mein Geld, indem ich den Menschen – es sind überwiegend Männer – ein wenig Angst mache. In ihnen vielleicht durch die ausufernde Schilderung von Gewalt sogar eine gewisse Lust wecke. Damon Cooper, so heißt der Held, der alle vierzehn Tage auszieht, um Kinder, Greise und vor allem schöne Frauen vor irgendwelchen Ausgeburten der Hölle zu schützen. Groschenromane, die den schnellen Kick bieten. Damon Cooper, der Mann ohne Vergangenheit, dafür aber aufgrund eines „genetischen Defekts“ mit zwölf Fingern ausgestattet, die er in seinen ledernen Handschuhen verbirgt.
Was für ein Blödsinn! Ein Blödsinn, der mich ernährt, aber bei weitem nicht so viel Geld einbringt, wie manche Leute glauben.
Sollte es das sein? Glaubt ein Irrer, dass Damon Cooper mein Konto mit Millionenbeträgen flutet?
Ich habe nie jemandem ernsthaft etwas zu Leide getan, habe zwar einige meiner Mitmenschen beleidigt, Schmerzen zugefügt, aber doch nie über jenes Maß hinaus, das ... normal ... ja, normal ist. Jeder tut solche Dinge. Ein wenig lügen, die eine oder andere Partnerin betrügen ...
Ich spüre, wie sich meine gerade noch halbwegs klaren Überlegungen in ein winselndes Quengeln verwandeln.
Nichts von dem, was ich je getan habe, rechtfertigt diese Situation. Nichts! Hier liegt ein fataler Irrtum vor. Ich habe das hier nicht verdient!
... Oder vielleicht doch?
Zuerst waren es nur Stunden. Aus den Stunden wurden Tage, an denen ich überhaupt nicht mehr daran denken musste. In den Jahren darauf ist es mir manchmal gelungen, die Ereignisse von damals zu verdrängen. Und wenn ich mich dann erinnere, kommt mir alles vollkommen unwirklich vor, so als wäre es nie passiert.
Aber das ist natürlich nur Selbstbetrug. Ich weiß, wozu wir fähig waren.
1978
Der Song explodierte in einer infernalischen Rückkopplung. Ich ließ die Trommelstöcke fallen und hielt mir die Ohren zu. „Scheiße!“, fluchte Udo. Ich hatte das Wort von seinen Lippen ablesen müssen, denn ich war für den Moment so gut wie taub. Ich sprang auf und zog mit einem energischen Ruck das Gitarrenkabel aus Bucks Verstärker. Das Pfeifen brach abrupt ab.
„Du hast das Ding bis zum Anschlag aufgedreht!“
Buck kommentierte meine Feststellung mit einem Achselzucken. Udo schüttelte verständnislos den Kopf, schnallte sich die eigene Gitarre ab und lehnte sie mit übertriebener Vorsicht an die Wand. So weit wie möglich von seinen Mitmusikern entfernt. Einmal war Roger, unser Bassist, nach der zweiten Flasche Bier gegen Udos Gitarre gestoßen. Roger vertrug nicht allzu viel, Alkohol machte ihn schnell redselig und tapsig. Die Gibson hatte bei dem Malheur einen stecknadelgroßen Kratzer abbekommen. Udo hatte getobt, mit diesem hohen, unangenehmen Timbre, das seine Stimme immer annahm, wenn er sauer war. Wenn ihm bei den Proben unserer Band etwas nicht passte, weil wir seinen Vorstellungen von progressiver Musik nicht immer folgen konnten oder wollten, fuhr er seitdem mit den Fingern scheinbar gedankenverloren über die winzige Schramme. Vermutlich sah er sich als Boss oder zumindest musikalischer Kopf unserer Band. Er war mit seinen zwanzig Jahren auch der Älteste und besaß eine echte Gibson und die teuerste Verstärkeranlage. Zudem probten wir im Keller seiner Eltern. Es roch hier unten zwar muffig, angereichert mit dem Aroma des nebenan gelagerten Heizöls, aber der Raum war groß genug und mit einem alten Teppich ausgelegt. An den Wänden klebten Styroporplatten zur Geräuschdämmung, während wir in völliger Unkenntnis der Folgen die niedrige Decke mit Glaswolle gepolstert hatten. Buck hatte das Zeug bei einer Baustelle besorgt. Selbst wenn man nicht mit der Kellerdecke in Berührung kam, glaubte man sich trotzdem nach jedem Song kratzen zu müssen. Besonders unangenehm war es für Roger, der, obwohl er sich ansonsten eher zurückhaltend verhielt, die Angewohnheit hatte, beim Schlussakkord einen Luftsprung zu machen. Roger war in dieser Hinsicht nicht lernfähig, die Musik versetzte ihn jedes Mal in Ekstase. Er zupfte den Bass mit geschlossenen Augen und schüttelte wild seine schulterlangen Haare. Unabhängig vom Tempo des Songs. Die Band war seine letzte Flucht vor einer trostlosen Zukunft. Sein Vater, ein sehr einflussreiches Mitglied der Mehrheitsfraktion vor Ort, hatte die weitere Laufbahn seines Sohnes bereits detailliert geplant. Den Wunsch Rogers, Karriere als Rockmusiker zu machen, ignorierte er, Roger sollte in der Stadtverwaltung untergebracht werden. Das erschien Roger so reizvoll, als müsste er den Rest seines Lebens in Einzelhaft zu verbringen. Allerdings hatte er sich nach zaghaften Versuchen des Widerspruchs in sein Schicksal gefügt. Selbst ich konnte die Dominanz seines Vaters geradezu körperlich spüren, wenn ich mich mit dem Mann nur im selben Raum aufhielt. Man fühlte sich klein – mindestens zehn statt dem einem Jahr von der gesetzlichen Volljährigkeit entfernt – und es war so, als verfügte er über eine Art Röntgenblick, mit dem er jeden von der Norm abweichenden Gedanken erfassen konnte.
„Was soll´s“, meinte Buck lakonisch und nahm einen Schluck aus der Bierflasche. „Fangen wir eben noch mal von vorn an.“ Er schnallte sich seine Pfeilgitarre um. Sie sah fast so aus wie das Instrument seines großen Vorbilds Michael Schenker. Nur dass Buck Linkshänder war und die von ihm verkehrt herum aufgezogenen Saiten dementsprechend mit der Linken zupfte.
Udo stieß zischend die Luft zwischen den Zähnen hervor. „Ich brauche erst mal eine Pause.“