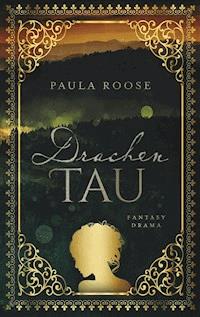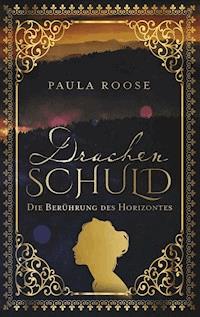Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wunder kommen leise
- Sprache: Deutsch
»Seine Worte stachen mir ins Herz. Ich spürte, dass er recht hatte. Ein Penner weniger machte für diese Welt keinen Unterschied. Aber für ihn machte es einen Unterschied, wie sich die Welt zu ihm verhielt. Und die Welt, das wurde mir unbequem klar, war in diesem Augenblick ich.« An einem nasskalten Abend in der Adventszeit nimmt der gescheiterte Geschäftsmann Johannes Bublitz den obdachlosen Rudi mit zu sich nach Hause und bewahrt ihn so vor dem Erfrieren. Dieser bedankt sich mit einem vergoldeten Schließfachschlüssel. Johannes macht sich auf, das Geheimnis des Schlüssels zu lüften. Was als kleines Abenteuer beginnt, wird zu einer Reise in seine Vergangenheit und öffnet ein Fenster in eine bessere Zukunft. Es ist eine Geschichte vom Scheitern und Neubeginnen. Und vom Glauben an Gott, in Kindertagen wie im Erwachsenenleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
Dichtes Schneegestöber trat mir entgegen. Die Dämmerung war der Dunkelheit gewichen. Nasse Kälte streckte sich mit langen Fingern nach mir aus und kroch durch jede Lücke in meiner Kleidung. Ich zog meinen abgewetzten Mantel enger um mich und beschleunigte den Schritt.
Der Schnee blieb nur kurz liegen, verwandelte sich rasch in dreckigen Matsch. Der Gehweg wurde glatt. Die Straße war an dieser Stelle eng. Gewöhnlich mied ich sie, denn viele Erinnerungen klebten hier fest. Schöne Erinnerungen schmecken bitter, wenn sich die verbundenen Hoffnungen nicht erfüllt haben.
Warum ich gerade an diesem Tag dort entlang ging? Wahrscheinlich das schlechte Wetter. Ich wollte ausnahmsweise keinen Umweg nehmen und schnell nach Hause.
Es war eine der zahlreichen Nebenstraßen des Stadtkerns, gesäumt von historischen Gebäuden. Ich lief zwischen den Fassaden und wild geparkten Autos am Bordstein, als die Häuserfront zurückwich. Ein Vorgarten wurde sichtbar. Ich wollte es nicht. Wollte nicht stehen bleiben. Wollte so tun, als bemerkte ich es nicht. Aber meine Füße verweigerten den Gehorsam. Sie hielten an und drehten mich zur Villa. Nun, es war dunkel, ich war allein, da konnte man einen Blick riskieren. Doch kaum sah ich auf das Haus mit der hölzernen Eingangstür und den bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss, da wurde mein Blick auch schon festgehalten.
In meinen Gedanken erwachte das Haus zum Leben. Licht ging an. Der Versammlungsraum war mit Stühlen gefüllt, hinter der Kanzel stand ein Holzkreuz. Ich saß, wie alle Kinder, in der ersten Reihe und lauschte dem Klavier. Der Raum war hell und angenehm warm. Eine Frau im mittleren Alter nahm mich an die Hand und brachte mich in einen Nebenraum mit gelben und roten Farben. Kinderstühle bildeten in der Mitte einen Kreis. Jesus liebt mich ganz gewiss, haben wir gesungen und geglaubt. Die Frau, sie hieß Martina, hatte es uns ins Herz gepflanzt.
Lange war das her. Der Glaube aus meinen Kindertagen war nicht mit mir erwachsen geworden. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe zu glauben. Irgendwann bin ich einfach nicht mehr hingegangen.
Ein eisiger Windstoß versuchte, meinen Mantel zu öffnen, und holte mich in die Gegenwart zurück. Mit einem Seufzen löste ich den Blick vom Gemeindehaus und setzte meinen Heimweg fort, als ich aus dem Augenwinkel eine Frau hinterm Haus hervorkommen sah. Ich stockte. Mir war, als hätte ich sie schon einmal gesehen. Zögerlich sah ich zu ihr hinüber.
Blonde Haare schauten unter ihrer Mütze hervor. Die Wangen in ihrem weichen Gesicht waren gerötet. Auch sie hatte mich gesehen und stutzte. Einen kurzen Augenblick sahen wir uns schweigend an. Dann erkannte ich sie.
Aber ja, es war Martina. Jene Martina, die mir Sonntag für Sonntag Gottes Liebe nahe gebracht hatte. Die so viel für mich geglaubt und gehofft hatte. Die ein Teil von Gottes Liebe für mich geworden war. Ich erinnerte mich an ihre warmen, weichen Arme, die immer für mich offen waren. Und was war aus mir geworden?
Rasch senkte ich meinen Blick und drehte mich weg. Auf keinen Fall sollte sie mich sehen. Nicht so. Nicht hier. Nicht jetzt.
Aber es war zu spät. Sie hatte mich erkannt. Sie würde mich überall erkennen. So war sie eben.
»Johannes!«, rief sie mir hinterher. »Warte doch!«
Ich spürte ihren enttäuschten Blick in meinem Rücken und beschleunigte den Schritt.
Durch die Innenstadt lief ich weiter. Meine kleine Zweizimmerwohnung lag auf der anderen Seite des Stadtkerns, dort, wo Wohnen weniger kostete.
2. Kapitel
Mein Heimweg führte mich über den Weihnachtsmarkt. Der Duft von gebrannten Mandeln und Waffelgebäck zog in meine Nase. An den Ständen drängten sich die Menschen. Sie wärmten ihre Hände an Glühweinbechern, schlürften ihn genussvoll und versuchten so, der Kälte ein wenig zu entkommen. Überall wurde gelacht und geschwatzt. Blasmusik drang an mein Ohr, Süßer die Glocken nie klingen, das war mein Lieblingslied gewesen. Aber wieso gewesen? Das war es noch immer.
Ich überdachte kurz meinen Geldbeutel, dann beschloss ich, mir auch einen Glühwein zu leisten. Der brummige Verkäufer füllte meinen Becher und ich stellte mich an einen runden Stehtisch.
Der Glühwein schmeckte köstlich, wärmte meinen Bauch und meine Hände. Früher hatte ich oft hier gestanden. Mit Freunden, Arbeitskollegen oder Kunden hatte ich Weihnachtsdüfte und -klänge genossen. Nie hätte ich geglaubt, dass es anders werden könnte. Mein Leben war perfekt gewesen. Die kleine Computerfirma lief gut, ich konnte mir allerhand leisten, hatte Anerkennung, wurde gebraucht. Ja, ich arbeitete viel, rund um die Uhr, kann man sagen. Das musste sein, ohne mich lief es nicht. Meine Freundin konnte an meiner Seite ein tolles Leben führen, shoppen gehen, Partys feiern – alles, was sie wollte.
Ich bemerkte nicht, dass ihr Geld nicht wichtig war, dass sie mich liebte, Zeit mit mir verbringen wollte. Noch schlimmer, ich bemerkte nicht, dass sie einsam war, mich vermisste. Und dann war es zu spät. Eines Nachts kam ich nach Hause und fand nur noch diesen Zettel von Claudia: Ich habe dich verlassen.
Seitdem ging es mit mir bergab. Erst langsam, kaum spürbar, dann immer schneller. Ich musste Insolvenz anmelden, Hartz IV beantragen. Freunde? Hatte ich plötzlich keine mehr. Anders als bei Claudia ging es ihnen nur ums Geld – um mein Geld. Zu Anfang kam noch hin und wieder ein Anruf, aber auch das hörte bald auf. Ich habe versucht, meine Freundin zu finden, noch einmal mit ihr zu reden. Sie hatte mich gründlich verlassen. Ich weiß bis heute nicht, wo sie ist. Die teuren Kleider ließ sie im Schrank. Die hat der Gerichtsvollzieher mitgenommen.
O du fröhliche, klang es aus den Lautsprechern. Ja, von wegen, o du traurige, müsste es heißen. Ich hatte wie auf einer Luxusjacht gelebt und war ohne Vorwarnung ins Meer gestoßen worden.
Nach dem letzten Schluck Glühwein setzte ich meinen Heimweg fort. Hier und dort erspähte ich ein bekanntes Gesicht. Rasch schauten sie weg. Mein Gesicht wollte niemand mehr sehen.
In der Mitte der Stadt stand die alte Marktkirche, deren einst prachtvoller Vorhof nun an zwei Wochentagen zum Marktplatz wurde. Die weit ausladenden Treppenstufen luden ein, hereinzukommen. Ich benutzte sie als Abkürzung auf meinem Heimweg. Die schweren, hölzernen Türen waren verschlossen. Rechts neben der Tür, in die Ecke gedrängt, saß ein Obdachloser.
Ich blieb stehen und betrachtete den Mann, der dort mit geschlossenen Augen saß, den Kopf an die Wand gelehnt. Ein zerfranster Schal war um seinen Hals gebunden, seine Handschuhe hatten Löcher. Die Nische, in der er saß, bot kaum Schutz vor dem dichter werdenden Schneetreiben und der nassen Kälte. Etwas berührte mich: die Erkenntnis, dass es mir in meiner Armut noch gut ging. Es gab Menschen, die waren schlechter dran als ich.
Der Mann schien vorzuhaben, die Nacht hier zu verbringen. Wenn er das tat, würde er den Morgen nicht erleben. Noch bevor die Sonne aufging, würde er erfroren sein.
3. Kapitel
Ich stieg die Treppen zu dem Mann hinauf und sprach ihn an.
»Hey, Sie!«
Er reagierte nicht. Ich beugte mich vor, befürchtend, dass er schon tot sei, und rüttelte an seiner Schulter. Uringeruch stieg mir in die Nase.
»Hey, Sie!«, sagte ich noch einmal lauter. Träge öffnete er die Augen und sah mich mit leerem Blick an. Erleichtert atmete ich auf. Er lebte noch.
»Wenn du vorhast, hier zu übernachten, könnte es ziemlich kalt werden.«
Langsam zog er die Augenbrauen hoch. »Na und? In einer Nacht wie dieser ist es für jemanden wie mich überall kalt«, antwortete er gedehnt.
»Wenn du hier bleibst, erfrierst du.« Ich wusste nicht, was ich eigentlich erwartete.
»Was macht das schon? Ein Penner weniger auf der Welt. Keiner wird es merken.« Er schloss die Augen und brummelte unverständlich vor sich hin.
Seine Worte stachen mir ins Herz. Ich spürte, dass er recht hatte. Ein Penner weniger machte für diese Welt keinen Unterschied. Aber für ihn machte es einen Unterschied, wie sich die Welt zu ihm verhielt. Und die Welt, das wurde mir unbequem klar, war in diesem Augenblick ich. Kurz überlegend fasste ich einen Entschluss. Erneut rüttelte ich an seiner Schulter.
»Komm, steh auf, du kannst bei mir pennen.«
Er öffnete die Augen. »Bist du bekloppt? Was willst du mit einem Penner bei dir zu Hause?«
Ich hätte gedacht, dass er sich freut, und zog die Augenbrauen zusammen. »Gar nichts will ich mit dir. Komm einfach mit und bleib am Leben.«
Er schloss die Augen. »So‘n Quatsch!«
»Sei nicht blöd, Mann. Hier kannst du nicht bleiben oder hast du dir den Verstand schon versoffen?«
Ohne mich anzusehen, rappelte er sich auf. »Gut, ich komm mit«, sagte er. »Aber wenn du mich beklaust, bist du tot.«
»Geht in Ordnung.«
Er packte sein weniges Hab und Gut und folgte mir. Zu meiner Wohnung waren es gut fünfzehn Minuten Fußmarsch. Schweigend gingen wir nebeneinander her, während die Weihnachtsmusik aus der Stadt immer mehr verblasste.
Die Straßen wurden leerer, der Wind rauer. Wir zogen unsere Mäntel enger und hielten zum Schutz vor dem Schnee die Köpfe gesenkt.
Ich wagte einen verstohlenen Blick auf meinen Begleiter. Er trug einen Bart, sein graues Haar war filzig. Er schien meinen Blick zu spüren und schaute mich an. Seine Augen waren ungewöhnlich tiefblau.