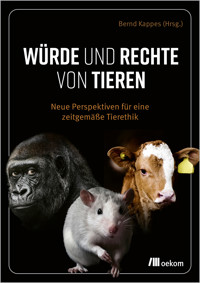
Würde und Rechte von Tieren E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stellen wir uns eine Welt vor, in der Tiere nicht als Ressourcen betrachtet werden, sondern als fühlende Wesen mit eigenen Rechten und eigener Würde. Acht Autor:innen widmen sich intensiv der Frage, welche Verantwortung wir als Menschen gegenüber Tieren tragen. Nach einer Einführung in die philosophischen und ethischen Grundlagen der Tierethik fragen Beiträge zu einzelnen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, was tierethische Grundsätze für landwirtschaftlich genutzte Tiere, Tierversuche, Heimtierhaltung und den Umgang mit Wildtieren bedeuten. Hier gerät die Tierethik mit menschlichen Nutzungs- und Wirtschaftsinteressen in Konflikt. Veränderungen in Politik, Gesellschaft und Kirchen sind dringend geboten, um tierethische Standards nachhaltig durchzusetzen. Der Band versammelt Beiträge einer Tagung der Evangelischen Akademie Hofgeismar und schließt mit einer von den Teilnehmenden beschlossenen Resolution.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Kappes
Würde und Rechte von Tieren
Neue Perspektiven für eine zeitgemäße Tierethik
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© Bernd Kappes (Hrsg.)
Erschienen 2025 im oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: le tex, xerif
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen). Diese Lizenz erlaubt das Vervielfältigen und Weiterverbreiten des Werkes, nicht jedoch seine Veränderung und seine kommerzielle Nutzung. Die Verwendung von Materialien Dritter (wie Grafiken, Abbildungen, Fotos, Auszügen etc.) in diesem Buch bedeutet nicht, dass diese ebenfalls der genannten Creative-Commons-Lizenz unterliegen. Stehen verwendete Materialien nicht unter der genannten Creative-Commons-Lizenz, ist die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers für die Weiterverwendung einzuholen.
In dem vorliegenden Werk verwendete Marken, Unternehmensnamen, allgemein beschreibende Bezeichnungen etc. dürfen nicht frei genutzt werden. Die Rechte des jeweiligen Rechteinhabers müssen beachtet werden, und die Nutzung unterliegt den Regeln des Markenrechts, auch ohne gesonderten Hinweis.
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987264139
DOI: https://doi.org/10.14512/9783987264139
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers
Teil 1:
Philosophisch‐theologische Grundlagen
Teil 2:
Praxisfelder
Teil 3:
Handlungsoptionen
Resolution :
der Tagung »Tierethik im Konflikt – Welche Verantwortung haben wir für Tiere?«
Der Herausgeber
Anmerkungen
Vorwort des Herausgebers
Haben Tiere Rechte? Haben Tiere eine Würde? Und was folgt daraus für unseren Umgang mit den Mitgeschöpfen? Der vorliegende Band führt ein in die philosophischen und theologischen Grundlagen der Tierethik, erörtert den moralischen Status von nichtmenschlichen Tieren und entwirft neue Perspektiven für eine zeitgemäße Tierethik.
Anhand konkreter gesellschaftlicher Handlungsfelder wird diskutiert, was tierethische Grundsätze in der Praxis bedeuten können – in der Landwirtschaft, bei Tierversuchen, bei der Haltung von Haustieren sowie in Bezug auf unseren Umgang mit Wildtieren. Nicht selten geraten die Erkenntnisse und Grundsätze der Tierethik hier in Konflikt mit menschlichen Nutzungs‐ und Wirtschaftsinteressen.
Was müsste sich ändern in Politik, Gesellschaft und Kirche, um tierethischen Standards zur Durchsetzung zu verhelfen? Besondere Aufmerksamkeit kommt hier der Arbeit von Tierschutzbeiräten und Tierschutzbeauftragten zu.
»Würde und Rechte von Tieren. Neue Perspektiven für eine zeitgemäße Tierethik«: Die Publikation dokumentiert die Vorträge, die bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Hofgeismar im Sommer 2024 gehalten wurden. Die Tagung fand in Kooperation mit dem Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V., den Tierärzten für verantwortbare Landwirtschaft e. V., der Landestierschutzbeauftragten Baden‐Württemberg, der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. sowie der Landestierschutzbeauftragten Hessen statt.
Den beteiligten Organisationen danke ich für das gemeinsame Engagement in Vorbereitung und Durchführung der Tagung. Den Referent*innen und Autor*innen danke ich für ihre Expertisen, mit denen sie zum Gelingen der Tagung und zur Erstellung dieses Bandes beigetragen haben. Dr. Barbara Felde (Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht) und Torsten Schmidt (Bund gegen Missbrauch der Tiere) danke ich für die Zusammenarbeit bei der Redaktion der Texte.
Würde und Rechte von Tieren: Den tierethischen Impulsen des Buches wünsche ich breite Resonanz in Politik, Gesellschaft und Kirchen.
Bernd Kappes
Oktober 2024
Teil 1Philosophisch‐theologische Grundlagen
Welche Verantwortung haben wir für Tiere? Grundlagen der Tierethik
Friederike Schmitz
Einleitung
Der Beitrag diskutiert die Frage, was die Tierethik als philosophische Disziplin zur individuellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung um unseren Umgang mit Tieren beitragen kann. Ein Blick in die Realität zeigt, dass ethische Positionen und Argumente in vielen aktuellen Debatten wenig praktische Durchsetzungskraft haben. Inwieweit können sie dennoch wichtige Funktionen erfüllen? Im Rahmen der Tierethik lassen sich vier verschiedene theoretische Herangehensweisen unterscheiden. Alle vier liefern relevante Einsichten in unser Verhältnis zu Tieren. Insgesamt zeigt sich: Das vorherrschende Verhältnis zu Tieren bedarf einer grundlegenden Neuausrichtung. Nun kommt es darauf an, diese ethischen Einsichten auch praktisch wirksam werden zu lassen.
Die Tierethik als philosophische Disziplin diskutiert die Frage, wie wir mit Tieren umgehen sollten. In Anbetracht dessen, wie viele empfindende Lebewesen von unserem Handeln betroffen sind, könnte diese Frage kaum wichtiger sein. In Deutschland wurden im Jahr 2023 allein für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern etwa neunmal so viele empfindende Tiere genutzt und getötet, wie Menschen in diesem Land leben, nämlich über 745 Millionen. Noch viel größer ist die Zahl der Fische und Meerestiere, die von uns meist unter Qualen aus dem Meer gezogen werden. Tierversuche, Schädlingsbekämpfung, Haustierhaltung, Zoos und Zirkusse – unser Umgang mit Tieren ist Teil unserer Gesellschaft, meist ein ziemlich brutaler Teil. Er hat zahlreiche Auswirkungen auf diverse Bereiche – Klimakatastrophe, Umweltprobleme, Gesundheit, globale Gerechtigkeit, um nur einige zu nennen. Aber hier soll es nicht um diese Auswirkungen, sondern um unseren Umgang mit Tieren selbst gehen. Die Frage ist: Was kann die Tierethik als philosophische Disziplin zur individuellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung um unseren Umgang mit Tieren beitragen? Meine Antwort lautet: Sie kann nicht so viel beitragen, wie von ihr teilweise erwartet und erhofft wird – aber auch nicht nichts. Sie liefert Gründe und Motivation, sich für einen ganz anderen Umgang mit Tieren einzusetzen, als er heute üblich ist – so anders, dass er nicht mit ein paar Reformen erreicht wird, sondern eine grundlegende Neuausrichtung erfordert. Im Folgenden stelle ich zunächst einige Überlegungen zur Aufgabe und Rolle der Ethik dar. Dann gehe ich näher auf einen bestimmten Bereich unseres Umgangs mit Tieren ein, um ihn einer ethischen Betrachtung zu unterziehen: die sogenannte Nutztierhaltung. Davon ausgehend, gebe ich einen Überblick über vier verschiedene theoretische Herangehensweisen an tierethische Fragen. Ich erkläre, wie sich aus diesen Perspektiven erstens die aktuell übliche Nutztierhaltung bewerten lässt, und zweitens, was aus den Perspektiven für die grundlegende Frage folgt, ob wir Tiere töten dürfen, um sie zu essen.
Wozu noch Ethik?
Wir alle haben viele moralische Überzeugungen. Manche davon sind so grundlegend, dass man sich kaum sinnvoll darüber streiten kann. Dazu gehört zum Beispiel. die Überzeugung, dass man keine Kinder töten und grillen sollte. Gemeint sind hier natürlich menschliche Kinder. Dass wir das nicht tun, gehört zum Kern unserer Gesellschaft und Kultur.
Bei der Frage, wie wir mit Tieren umgehen sollten, gibt es dagegen innerhalb unserer Gesellschaft durchaus verschiedene Positionen. Manche sagen, dass auch Tiere nicht getötet und gegrillt werden sollten, andere möchten diese Praxis beibehalten. Teilweise wird das so dargestellt, als ob es sich dabei um Unterschiede in bloßen Meinungen handelte, die völlig beliebig oder zufällig wären. Natürlich haben solche Positionen häufig gewisse nachvollziehbare Ursachen – wir wurden auf eine bestimmte Weise erzogen und haben bestimmte Erfahrungen gemacht, die zu bestimmten Meinungen geführt haben. Sobald wir uns aber über unsere Positionen unterhalten und diskutieren, reden wir typischerweise nicht über Ursachen, sondern über Gründe: Wir liefern Argumente für unsere Meinung, von denen wir denken, dass sie nicht nur für uns selbst überzeugend sind, sondern auch für andere einsehbar sein müssten. Und unsere Gesprächspartner*innen können unseren Gründen zustimmen oder ihnen widersprechen, indem sie Einwände und Gegengründe anführen.
Sobald wir auf diese Weise diskutieren, betreiben wir Ethik. Die Ethik ist die Reflexion und Diskussion über die moralischen Normen und Überzeugungen. Wir suchen dabei nicht nach einem äußeren Gesetz, einer Vorschrift aus dem Universum, sondern wir benutzen unsere eigenen Fähigkeiten wie unseren Verstand oder auch unser Einfühlungsvermögen, um zu Bewertungen zu kommen. Wir überlegen, für welche Handlungen oder Regeln wir welche Gründe haben und welche Verhaltensweisen wir rechtfertigen können. Dabei sind nicht alle Gründe gleich gut, sondern es gibt bessere und schlechtere Gründe. Ein schlechter Grund ist zum Beispiel einer, der schlicht auf eine Tatsache verweist, um eine Bewertung zu rechtfertigen. Das kommt in Alltagsdiskussionen zum Mensch‐Tier‐Verhältnis oft vor: Leute sagen beispielsweise, dass es in Ordnung sei, Fleisch zu essen, weil Menschen das schon seit Jahrtausenden getan hätten. Das Letztere ist zwar eine Tatsache, aber daraus folgt eben noch nicht, dass wir das auch heute weiter so handhaben sollten. Sofern wir die Möglichkeit haben, es anders zu machen, könnten wir uns auch dagegen entscheiden. Aus dem bloßen Sein folgt also kein Sollen.
Die Ethik hat genau die Aufgabe, die Realität immer wieder zu hinterfragen: Lässt sich das, was wir täglich tun, überhaupt rechtfertigen? Dabei kann sich herausstellen, dass die Gründe, die gegen eine Praxis sprechen, besser sind als die, mit denen sich diese Praxis verteidigen lässt.
Dieses Verständnis von Ethik erklärt auch den Allgemeinheitsanspruch, den ethische Urteile mit sich bringen – wofür sie gern kritisiert werden. Wenn ich z. B. behaupte, dass man Tiere nicht grillen sollte, weil sie ein Recht auf Leben haben – will ich damit für alle Menschen festlegen, was richtig und falsch ist? In gewisser Weise schon: Ich gebe einen Grund dafür, dass wir eine bestimmte Regel anerkennen und befolgen sollten. Es liegt in der Natur von Gründen, dass sie mit dem Anspruch vorgebracht werden, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen überzeugend zu sein. Selbstverständlich kann man sich darüber dann prächtig streiten – aber wenn die ursprüngliche Behauptung gar keinen Allgemeinheitsanspruch gehabt hätte, gäbe es letztlich gar keinen Anlass zur Diskussion.
Nun gibt es allerdings in Bezug auf unseren Umgang mit Tieren nicht nur Kontroversen, sondern auch viel Übereinstimmung innerhalb unserer Gesellschaft. Niemand behauptet mehr, dass es völlig beliebig wäre, wie wir Tiere behandeln. Es gibt auch hier einen moralischen Konsens, den man etwa so formulieren könnte: Es ist falsch, fühlenden Tieren ohne gewichtigen Grund große Leiden oder Schäden zuzufügen. Mit »Leiden« meine ich dabei starke unangenehme Empfindungen, die körperlicher, aber auch psychischer Art sein können. Unter »Schäden« verstehe ich insbesondere die Einschränkung von artgemäßen Verhaltensweisen. Aufgrund dieser Überzeugung verurteilen wir zum Beispiel schmerzvolle Tierversuche für einen neuen Badeschaum. Wir kritisieren auch eine Hundebesitzerin, die ihren Hund dauerhaft in einem kleinen Käfig einsperrt. Die Überzeugung kommt ebenfalls in der Art zum Ausdruck, wie die meisten Menschen auf Undercovervideos von engen, verdreckten Ställen mit verletzten Tieren reagieren: Tiere so zu behandeln, kann nicht richtig sein.
Gerade das Beispiel der Nutztierhaltung zeigt allerdings, dass ethische Überzeugungen keineswegs zwangsläufig die Realität bestimmen – weder auf individueller noch auf gesellschaftlicher Ebene. So gibt es die Kritik an der üblichen Nutztierhaltung seit Jahrzehnten. Praktisch alle Menschen erkennen an, dass es falsch ist, Tiere so zu züchten, dass sie zwangsläufig unter ihren Körpereigenschaften leiden, oder sie unter Bedingungen einzusperren, in denen sie Verhaltensstörungen und Krankheiten entwickeln. Nichtsdestotrotz passiert das weiterhin im großen Stil. Und die meisten Menschen, die diesen Überlegungen zustimmen, kaufen trotzdem Produkte, die aus solchen Nutzungssystemen stammen.
Eine wichtige Ursache liegt darin, dass einmal etablierte Praktiken sich schwer ändern lassen. Die Tierhaltung ist kulturell und wirtschaftlich fest verankert, sie wird in Studiengängen und Ausbildungsberufen unterrichtet und von mächtigen Interessengruppen verteidigt. Der Tierkonsum gehört zur Normalität in den allermeisten Familien, Geschäften, Restaurants und Kantinen. Fleisch, Milch und Eier sind allgegenwärtig, günstig zu haben, leicht zu bekommen, werden attraktiv beworben und schmackhaft zubereitet. Man nennt das »Ernährungsumgebungen«, und diese begünstigen aktuell meist Tierprodukte. Wer diese boykottieren will, muss oft zumindest am Anfang gegen eigene Geschmacksvorlieben, Gewohnheiten, Bequemlichkeiten und soziale Normen handeln. Die Motivation, ethisch korrekt zu handeln, reicht dafür bei vielen nicht aus. Die Folge ist ein dauerhafter Konflikt zwischen moralischen Überzeugungen und eigenem Verhalten, der in der Psychologie als kognitive Dissonanz beschrieben wird (Pfeiler 2019).
Es gibt eine Reihe von Mechanismen, wie Menschen mit der kognitiven Dissonanz umgehen – dazu gehören Verdrängung und Vermeidung des Themas. Man könnte auch sagen, dass unsere ganze Gesellschaft sich in einer kognitiven Dissonanz befindet. Kollektiv glauben wir, dass Tiere Schutz verdienen, aber praktisch dulden wir Tierquälerei im großen Stil. Dass tierethische Fragen im Privaten, in Medien und an Universitäten immer mehr diskutiert werden, ändert daran wenig, ist vielleicht sogar ein weiteres Symptom dieser Dissonanz.
Ist Ethik also sinnlos? Ich denke nicht. Zwar stimmt es, dass für Verhalten und gesellschaftliche Realität oft andere Faktoren ausschlaggebender sind als ethische Überlegungen. Das ist wichtig zu bedenken, wenn man die Realität verändern will – oft bewirkt man mehr, wenn man es schafft, diese Strukturen zu verändern, als wenn man versucht, Menschen mit guten Gründen zu überzeugen. Aber zugleich sind moralische Motive nicht immer unwirksam: Immer wieder gelingt es ja Menschen, ihre kognitive Dissonanz zu überwinden. Und wenn man betrachtet, wer eigentlich aus welchen Gründen Veränderungen der Realität vorantreibt, dann sind es typischerweise genau die Menschen, die aus moralischen Überzeugungen die aktuelle Praxis ablehnen. Das heißt: Ohne solche Motivation gäbe es keine Veränderung, keinen Fortschritt.
Nun könnte jemand entgegnen: Es mag sein, dass solche Motive wichtig sind, aber dabei handelt es sich oft einfach um Mitgefühl oder die Einsicht, dass die aktuelle Praxis dem moralischen Konsens widerspricht. Wozu braucht man dazu eine akademische Disziplin mit Theorien und Artikeln und Büchern? Dafür lässt sich zweierlei anführen: Zum einen kann auch eine theoretische Reflexion die Haltung und das Handeln von Einzelnen verändern – das habe ich schon oft in Tierethikseminaren erlebt. Sie bieten eine Art geschützten Denkraum, wo man sich mit den Gründen und Gegengründen für bestimmte Praktiken in Ruhe auseinandersetzen kann, und das stößt oft Veränderungen an. Zum anderen spielt eine aktive Tierethik eine wichtige Rolle in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung: Eine fundierte Argumentation kann in Debatten bestimmte Positionen stärken.
Aber zugleich sollte man bedenken: Gute Argumente sind nie genug. Man darf sich nicht einbilden, dass sich gesellschaftlich automatisch die Positionen durchsetzen würden, die am besten begründet sind, das sehen wir ja leider jeden Tag. Es geht immer auch um strukturelle Bedingungen und Machtverhältnisse. Zweitens möchte ich noch warnen: Ethische Diskussion kann auch eine Form der Ablenkung von der Realität sein. Anstatt das Grauen in den Ställen an sich heranzulassen, räsoniert man gepflegt darüber, ob Tiere eigentlich Rechte haben. So erlebe ich manche Diskussionen in Medien oder auch im privaten Kontext: Eigentlich müsste man erst einmal wirklich hinschauen, was mit Tieren passiert, man müsste den Gestank und das Blut und das Schreien der Tiere erst einmal wahrnehmen. Man wäre geschockt und sprachlos darüber, was Menschen anderen fühlenden Lebewesen antun. Aber stattdessen wird das Thema Tierhaltung zum Gegenstand für eine gepflegte Diskussion oder einen intellektuellen Wettstreit, in dem es darum geht, wer die klügeren Argumente hat. Also da muss man sich vorsehen. Und um nicht in diese Falle zu tappen, beleuchte ich im Folgenden schlaglichtartig die reale Situation der Tiere in der sogenannten Nutztierhaltung.
Realität der Tierausbeutung
In einer konventionellen Schweinemastanlage darf man laut Vorschriften auf einer Fläche, die so groß ist wie ein Standardautoparkplatz von zwölf Quadratmetern, 16 Schweine mit bis 110 Kilogramm einsperren. Schweine sind intelligente, neugierige Tiere mit feinem Geruchssinn und vielfältigen Bedürfnissen. Wenn sie könnten, würden sie in Wald‐ und Wiesenlandschaften weite Strecken zurücklegen, zur Nahrungssuche im Boden wühlen und komplexe Sozialbeziehungen pflegen. Stattdessen verbringen sie ihr ganzes Leben auf wenigen Quadratmetern hartem Beton über ihrem eigenen Kot.
Bei Hühnern ist es erlaubt und üblich, sie zu Zehntausenden in strukturlosen Hallen ohne jeden Kontakt zu Erde, Gras, Sonne oder Regen zu halten. Dabei stammen die Hühner von Waldvögeln ab, die in kleinen Gruppen leben, nach Nahrung scharren und picken, zur Körperpflege Sandbäder nehmen und in Bäumen schlafen.
Auch die meisten Rinder sind ihr ganzes Leben lang im Stall – 70 Prozent der sogenannten Milchkühe kommen nie auf eine Weide. Sie werden einmal pro Jahr künstlich befruchtet. Das Kalb, das sie unter Schmerzen zur Welt bringen, nimmt man ihnen direkt nach der Geburt weg, weil die Milch für den Verkauf vorgesehen ist.
Generell kann man sagen, dass die allermeisten Tiere in der industriellen Tierhaltung ihre artgemäßen Bedürfnisse und Fähigkeiten nicht ausleben können. Viele von ihnen werden darüber hinaus krank oder ziehen sich Verletzungen zu. Das liegt häufig schon an der Züchtung: Sogenannte Masthühner zum Beispiel erreichen bereits innerhalb von vier bis sechs Wochen ihr »Schlachtgewicht«, sie leiden häufig an Herz‐Kreislauf‐ oder Beinproblemen. »Legehennen« wiederum sind so einseitig auf die Eierproduktion gezüchtet, dass sich fast alle von ihnen mindestens einmal im Leben das Brustbein brechen. Auch bei Rindern und Schweinen zeigen Untersuchungen hohe Krankheitsraten. Hinzu kommen das Grauen bei Tiertransporten sowie die Gewalt in den Schlachtbetrieben.
Nun wird oft gesagt, dass die Probleme gelöst werden könnten, indem man das »Tierwohl« verbessert. Zum Beispiel durch höhere Haltungsstufen. Für Schweine gibt es dazu jetzt auch eine staatliche Haltungskennzeichnung. Aber die verschiedenen Haltungsformen unterscheiden sich eigentlich kaum voneinander. Während »Stall« den gesetzlichen Mindeststandard bezeichnet, haben Schweine bei »Stall+Platz« 12,5 Prozent mehr Platz. Das bedeutet, dass man auf der Fläche eines Standardparkplatzes statt 16 nur noch 14 Schweine bis 110 Kilogramm einsperren darf. Im »Frischluftstall« sind es neun Schweine pro Parkplatz, die zudem »Zugang zum Außenklima« haben müssen. Die Haltungsform »Auslauf/Weide« bedeutet, dass man im Stall auf einer Parkplatzfläche zwölf Schweine halten darf und für diese zwölf Schweine zusätzlich eine Außenbucht von einer halben Parkplatzfläche bereitstellen muss. Das ändert also an der schrecklichen Situation der Tiere sehr, sehr wenig.
Dann gibt es noch eine weitere Haltungsform, die Biohaltung. Auch diese wird oft als Lösung präsentiert. Viele Menschen stellen sich eine Idylle mit glücklichen Tieren auf grünen Wiesen vor. Aber bei der Schweinehaltung schreiben die Bioregeln auch bei den Anbauverbänden wie Bioland und Demeter vor, dass man im Stall bis zu neun Schweine pro Parkplatzfläche halten darf, die zusätzlich einen Auslauf von einer drei viertel Parkplatzfläche haben müssen – denn der Auslauf muss pro Schwein nur einen Quadratmeter groß sein. Man kann sich diese Ausläufe zudem auch vorstellen wie einen Parkplatz: Auf dem betonierten Boden können die Schweine nicht in der Erde wühlen oder sich suhlen, geschweige denn mehr als ein paar Schritte gehen oder eine interessante Umgebung erkunden.
Auf Biomilchbetrieben ist es wie sonst auch üblich, dass man den Kühen ihre Kälber direkt nach der Geburt wegnimmt. Krankheiten und Verletzungen treten in der Biohaltung praktisch genauso häufig auf wie in der konventionellen Haltung. Zum Beispiel gilt auch in Biobetrieben, dass die meisten »Legehennen« sich mindestens einmal im Leben das Brustbein brechen.
Die Fakten gelten sicher nicht für alle Biobetriebe, aber doch für die allermeisten – denn auch Biobetriebe müssen wirtschaftlich sein. Es ganz anders zu machen, funktioniert wirtschaftlich kaum oder nur in kleinen Nischen, die eben genau deshalb gar nicht skaliert werden könnten.
Die Unterschiede zwischen ökologischer und konventioneller Haltung sind also denkbar gering. Trotzdem sehen viele Menschen darin eine Lösung oder kaufen Biofleisch oder Biomilch, um Tieren etwas Gutes zu tun. Das könnte möglicherweise eine andere Form der Ablenkung von der Realität sein – eine Art, nicht hinzuschauen, eine Art, mit der kognitiven Dissonanz zwischen Überzeugungen und Realität umzugehen. Hinzu kommt, dass viele Menschen nur glauben, dass sie vor allem Bioprodukte konsumieren: Bei Umfragen sagen 64 Prozent der Menschen, dass sie bei Eiern ausschließlich oder häufig Bioeier kauften (BMEL 2023). Tatsächlich beträgt der Marktanteil aber nur 16 Prozent (BÖLW 2023). Bei Fleisch und Wurst sagen 39 Prozent der Leute, dass sie ausschließlich oder häufig Bio kauften, tatsächlich liegt der Marktanteil unter vier Prozent (BMEL 2023; BZL 2023).
Gehen wir nun zurück zu dem, was ich den moralischen Konsens genannt habe. Ich denke, es ist nach der Darstellung der Fakten klar, dass die aktuell übliche Tierhaltung diesem Konsens widerspricht – obwohl das den allermeisten Menschen nicht bewusst ist. Es handelt sich um große Schäden und Leiden, die Tieren zugefügt werden. Und gewichtige Gründe sehe ich dafür nicht – wir müssen ja als Gesellschaft keine Tierprodukte und schon gar nicht in dieser Menge herstellen.
Wenn man wirklich hinschaut, braucht man also eigentlich gar keine weiteren Argumente, um die Praxis abzulehnen. Die Philosophin und Autorin Hilal Sezgin hat das einmal so formuliert: »Seien wir ehrlich: Im Grunde braucht es keine komplexen Theorien, keine verschachtelten Argumente, kein Expertenwissen, um festzustellen: Die Tiere, die uns heute Fleisch, Eier, Milch, Wolle und Leder ›liefern‹, führen ein erbärmliches Leben. Wenn Privatpersonen ihre Hunde oder Katzen so hielten, würden wir von Tierquälerei sprechen. Und wer Tierquälerei nicht unterstützen und nicht von ihr profitieren will, sollte die entsprechenden Produkte nicht konsumieren. So einfach ist es eigentlich.« (Sezgin 2014, S. 160)
Das gilt für die konventionelle Tierhaltung und mindestens den allergrößten Teil der Biotierhaltung, womöglich mit Ausnahmen in winzigen Nischen, die man sehr gezielt suchen muss – und die man im normalen Leben weder im Supermarkt noch im Bioladen, noch im Hofladen um die Ecke zu kaufen bekommt.
Die nächste Frage ist: Wie lässt sich dieses Urteil im Rahmen ethischer Theorien begründen?
Vier theoretische Perspektiven auf die aktuelle Tierhaltung
Es gibt sehr unterschiedliche Theorien darüber, was moralische Richtigkeit ausmacht, wie sie begründet wird und was zur ethischen Reflexion dazugehört. Aus meiner Sicht können mehrere dieser Perspektiven gute Gründe für ihren jeweiligen Ansatz vorweisen. Ich gehe daher davon aus, dass wir uns für die Beurteilung lebenspraktischer Fragen nicht von vornherein für einen der Ansätze zulasten der anderen entscheiden sollten (vgl. auch Schmitz 2020).
Der Utilitarismus ist eine Version der konsequentialistischen Perspektive, aus der es für die moralische Beurteilung einer Handlung ausschließlich auf deren Folgen für alle Betroffenen ankommt. Dabei kann man zwei Varianten unterscheiden: Im hedonistischen Utilitarismus geht es darum, die beste Bilanz von Glück und Leid zu erzielen. Im Präferenzutilitarismus ist eine Handlung dann richtig, wenn sie im Hinblick auf Befriedigung und Frustration aller relevanten Interessen die beste Bilanz erzielt. Es ist sinnvoll, auch vielen Tieren Interessen zuzuschreiben – so würden wir zum Beispiel sagen, dass Schweine oder Hühner das Interesse haben, keine Schmerzen zu erleiden oder möglichst erfüllte Leben zu führen.
Die weitverbreitete Überzeugung, dass wir Tieren nicht ohne gewichtige Gründe Leiden und Schäden zufügen sollten, lässt sich aus utilitaristischer Perspektive so ausbuchstabieren: Tieren Leid zuzufügen bzw. ihre Interessen zu frustrieren, kann nur dann legitim sein, wenn damit zugleich ein Nutzen entsteht, der das Leid bzw. die Interessenfrustration überwiegt, sodass die Bilanz insgesamt positiv ist. Zusätzlich müssten wir annehmen, dass der betreffende Nutzen nicht anderweitig und zu geringeren Kosten erreicht werden kann.
Wenn wir auf die aktuelle Tierhaltung schauen und eine Abwägung anstellen, ist das Ergebnis klar: Die Schäden sind immens, der Nutzen ist vergleichsweise klein, oder er könnte auch anders erreicht werden oder beides.
Diesem Urteil kann man auch dann zustimmen, wenn man davon ausgeht, dass Tiere generell moralisch weniger zählen als Menschen – wenn man also zum Beispiel der Ansicht ist, dass wir in echten Konfliktfällen (wenn zum Beispiel das Leid von Menschen gegen das von Tieren steht) Menschen bevorzugen sollten. Diese Ansicht ist völlig verträglich mit der Überzeugung: Günstige Schnitzel sind es nicht wert, Schweine ihr ganzes Leben lang auf wenigen Quadratmetern einzusperren oder sie unter Schmerzen zu töten. Denn auch wenn Tiere weniger zählen, so zählen sie ja nicht beliebig wenig. Die übliche Tierhaltung verursacht so große Leiden für so viele Tiere, dass eine Nutzen‐Schaden‐Abwägung klar gegen diese Praxis spricht.
Deontologische Ethiken gehen davon aus, dass die Richtigkeit einer Handlung nicht oder nicht ausschließlich in ihren Konsequenzen liegt, sondern anhand anderer moralischer Erwägungen oder Prinzipien beurteilt wird. Auf dieser Basis kann man für grundlegende Tierrechte argumentieren. Aber man braucht gar keine Tierrechte, um die aktuelle Tierhaltung zu kritisieren. Auch diejenigen, die heute Tieren Grundrechte absprechen, denken üblicherweise nicht, dass wir beliebig mit ihnen umspringen dürften. Einige Prinzipien zum Umgang mit Tieren sind entsprechend weithin akzeptiert. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir Tieren nicht achtlos oder grausam, sondern mit Respekt und Rücksicht begegnen sollten.
Sogar im deutschen Tierschutzgesetz stehen einige Sätze, die als moralische Prinzipien bzw. Formulierungen von Pflichten weite Akzeptanz finden dürften: »Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen« (§ 2). Dieses Prinzip wird offensichtlich in der Realität nicht umgesetzt. Auch auf diese Weise ließe sich also im Rahmen einer deontologischen Perspektive die übliche Tierhaltung kritisieren.
Unter dem Titel »Ethik der Sensibilität« fasse ich mehrere Ansätze zusammen, die in der Tierethik in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden. Sie sollen eine Alternative zu den »klassischen« Herangehensweisen von Utilitarismus und Deontologie liefern, weil diese unseren Gefühlen und Einstellungen zu wenig Beachtung schenken (siehe zum Beispiel Donovan/Adams 2007; Diamond 2012; Gruen 2011; Crary 2018).
Viele utilitaristische und deontologische Ethiken gehen davon aus, dass das moralische Handeln primär darin besteht, allgemeinen Regeln zu folgen. Diesem Bild zufolge schauen wir als moralische Akteure gleichsam von außen auf eine gegebene Situation. Unsere Aufgabe besteht darin, die Fakten zu prüfen und dann mithilfe des Verstandes unsere Regeln auf die jeweilige Situation anzuwenden. Demnach bemessen wir zum Beispiel zuerst möglichst objektiv das Leid der Tiere in der Tierhaltung, vergleichen es mit dem Genuss der Menschen beim Fleischessen und können daraufhin die Tierhaltung verurteilen, weil sie für eine schlechte Gesamtbilanz von Wohlbefinden sorgt.
Solche Überlegungen liefern uns zwar »externe Orientierung« beim Handeln, so die Kritik, bleiben dabei aber ein Stück weit abstrakt und distanziert (Gruen 2011, S. 42). Sie vernachlässigen, dass wir als Menschen immer schon in konkrete Situationen eingebunden sind und die Welt auf eine bestimmte Weise wahrnehmen, die von Einstellungen und Gefühlen geprägt ist – und dass dies auch für das moralische Handeln eine wichtige Rolle spielt. Um zum Beispiel die Tierhaltung überhaupt als Thema für eine moralische Reflexion zu erkennen, müssen wir zuallererst bereit sein, der Situation der Tiere unsere Aufmerksamkeit zu geben und ihre Realität wirklich an uns heranzulassen.
Wenn wir das allerdings tun, dann erkennen wir oft unmittelbar, dass der übliche Umgang mit den Tieren falsch ist – dazu brauchen wir keine Regel anzuwenden und keine Abwägung anzustellen. Entscheidend scheint dabei vielmehr unsere Fähigkeit zu sein, mit den Schweinen, Rindern und Hühnern in den Mastanlagen und Schlachthöfen mitzufühlen. Gefühle wie Mitleid oder Empörung sind zudem wichtig, um uns zum Handeln zu motivieren – die bloße Einsicht, dass ein bestimmtes Verhalten moralisch richtig ist, reicht dafür oft nicht. Die Ethik der Sensibilität bezieht diese Gefühle nun explizit und als relevante Handlungsgründe in die ethische Reflexion mit ein.
Das heißt nicht, dass es nur noch um Gefühle geht. Ziel ist es, zu einer Position zu gelangen, die nicht nur im Hinblick auf unsere Überzeugungen konsistent und gut begründet ist, sondern die mit unseren emotionalen Einstellungen und der ›Weise, wie wir die Welt sehen‹ im Einklang ist. Wer sich offen und ehrlich mit der aktuellen Situation beschäftigt und sich auf die Lage der Tiere einlässt, wird kaum umhinkommen, Mitleid zu verspüren und festzustellen, dass es nicht zu den eigenen Einstellungen gegenüber Tieren und den eigenen moralischen Überzeugungen passt, wie mit ihnen in der üblichen Nutztierhaltung umgegangen wird.
Ich möchte die geschilderten drei ethischen Perspektiven noch um eine politische Perspektive ergänzen, weil nur diese die gesellschaftliche und politische Dimension des Problems angemessen in den Blick bekommt. In der Ethik beurteilen wir typischerweise Handlungen einzelner Menschen. Nun lässt sich der aktuell übliche Umgang mit Tieren aber offensichtlich nicht als bloß individuelles Fehlverhalten betrachten, das zum Beispiel einzelne Landwirt*innen oder Konsument*innen zu verantworten hätten. Es handelt sich vielmehr um eine soziale Praxis, die von zahlreichen institutionellen Bedingungen abhängt: Dazu gehören die verschiedenen Gesetze, die einen Großteil der geschilderten Zustände erlauben und damit schützen. Aber auch wirtschaftliche Verhältnisse, Förderungspolitik oder die behördliche Kontroll‐ und Sanktionierungspraxis (bzw. das Fehlen derselben) tragen dazu bei, dass Tiere so viel Leid erfahren.
In der politischen Perspektive wird die übliche Tierhaltung in diesem Sinne explizit als gesellschaftliches Phänomen und als Ergebnis einer institutionellen Ordnung verstanden. Daraus ergeben sich neue Fragen, die die vorhergehende ethische Kritik der Praxis bereits voraussetzen: Wie kann diese innerhalb einer Demokratie überhaupt weiter bestehen, obwohl sie doch von so vielen Menschen abgelehnt wird, mindestens sobald sie sich näher mit der Situation beschäftigen?





























