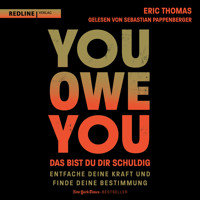18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Motivationsguru Eric Thomas zeigt, wie man seine Kräfte bündelt, sein Leben selbst in die Hand nimmt und seine eigene Erfolgsstory schreibt. Vom obdachlosen Schulabbrecher zum weltbekannten Motivationsguru für Spitzensportler Führungskräfte, Schauspielgrößen und Musiker – Eric Thomas weiß, wovon er spricht. Sein Credo: Jeder kann sich seiner Stärken bewusst werden, anfangen seiner Bestimmung zu folgen und dauerhaft erfolgreich sein. Wichtig ist dabei jedoch, nicht auf Inspiration zu warten, sondern endlich selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen – weil man es sich schuldig ist. Mit seinem inspirierenden Buch liefert Thomas eine Schritt-für-Schritt-Anleitung raus aus der Untätigkeit hinein in ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Er zeigt anhand von vielen Anekdoten aus seinem Leben, wie ein Neuanfang gelingt und erklärt, warum man manchmal etwas Gutes aufgeben muss, um Großes zu erreichen. Dabei lautet sein wichtigstes Erfolgsgeheimnis: Du bist der Einzige, der dein Leben ändern kann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eric Thomas
You Owe You – das bist du dir schuldig
ERIC THOMAS
YOU OWE YOU DAS BIST DU DIR SCHULDIG
ENTFACHE DEINE KRAFT UND FINDE DEINE BESTIMMUNG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2023
© 2023 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2023 by Eric Thomas
Die englische Originalausgabe erschien 2022 bei Rodale Books unter dem Titel You owe You.
Diese Ausgabe wurde in Absprache mit Rodale Books veröffentlicht, einem Imprint von Random House, einer Abteilung von Penguin Random House LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Martin Bayer
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-86881-939-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-524-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-523-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Ich möchte dieses Buch meiner Frau Dede widmen und mit ihr allen, denen das Leben, so wie ihr, übel mitgespielt hat, die aber, anstatt aufzugeben, den Kampf aufgenommen und das Hindernis überwunden haben.
Wenn du nicht fliegen kannst, dann laufe, wenn du nicht laufen kannst, dann gehe, wenn du nicht gehen kannst, dann krieche, aber was immer du tust, bleibe in Bewegung. MARTIN LUTHER KING, JR.
INHALT
Vorwort
EinleitungDer Einzige, der Ihr Leben verändern kann, sind Sie selbst
Kapitel 1Sie gegen sich selbst Wenn Sie Ihr Leben in Besitz nehmen, werden Sie zum Chef.
Kapitel 2Sie sind nie der Einzige Man ist nur dann alleine, wenn man es sich einredet.
Kapitel 3Entdecken Sie Ihre Superkraft Wenn Sie Ihre Superkraft finden und für sich einsetzen, finden Sie auch den Weg zum Ziel.
Kapitel 4Was ist Ihr Beweggrund? Wenn Sie ihn finden, können Sie Ihre Superkraft und Ihr Leben auf eine höhere Ebene heben.
Kapitel 5Bewegen Sie sich auf Ihr Ziel zu Wenn Sie sich Ihrer Begabungen bewusst werden, bewegen Sie sich auf Ihr Ziel zu.
Kapitel 6Auf ins Land der Wunder Sie können sich Ihre eigenen Wunder herbeiwünschen.
Kapitel 7Werden Sie zur dreifachen Bedrohung Wissen ist das neue Geld.
Kapitel 8Opfern Sie das Gute für das Großartige Gut ist gut, aber gut ist nicht großartig.
Kapitel 9Sie sind ein Unternehmen Jeder Mensch kann ein Geschäft aufmachen, wenn er mit dem anfängt, was er hat.
Kapitel 10Das schulden Sie sich Niemand schuldet Ihnen etwas, aber Sie sich selbst alles.
Danksagung
Über den Autor
VORWORT
Als ich E.T.s Stimme zum ersten Mal hörte, war ich sofort begeistert. Sie hat einfach was: Leidenschaft, Nachdruck, Beharrlichkeit. Sie packt mich jedes Mal. Seit Jahren spricht E. mir Nachrichten aufs Telefon, immer vor einem Spiel oder wenn er weiß, dass ich Probleme habe, und jedes Mal, wenn seine Stimme einsetzt, bewirkt sie etwas. E.s Arbeit ist zeitlos. Sie können sich auf YouTube einen Vortrag von ihm anhören und merken nur am Hochladedatum, wie alt das Video ist. Er spricht wie ein Prediger. Wenn Sie je in der Kirche waren und bei der Predigt gedacht haben: Mann, der Pfarrer meint bestimmt mich, dann wissen Sie, wie es sich anhört, E.T. reden zu hören. Man glaubt immer, er spreche einen persönlich an.
Erics Arbeit und Erbe erinnern mich an meinen Großvater, der als erster Schwarzer in North Carolina eine Tankstelle aufmachte, und an meinen Vater, der mich und meinen Bruder beim Sport und im Leben coachte. Sie erinnern mich an meine eigenen Kinder, die stolz auf mich sein können und dasselbe Erfolgserlebnis wie ich im Leben haben sollen. E. spricht davon, dass man einen Beweggrund haben muss. Für mich bestand er immer darin, dass ich es viel schlimmer fand, zu verlieren, als dass ich mich über Siege gefreut hätte. Das hat sich im Lauf der Jahre geändert. Als ich als Basketballprofi in der NBA anfing, glaubte ich noch, mich beweisen zu müssen, in der Liga und gegenüber meiner Familie und meinen Jugendfreunden. Jetzt habe ich die Chance, meinen Kindern zu zeigen, wie schwere Arbeit aussieht. Ich darf ihnen zeigen, was es heißt, gut vorbereitet zu sein. Ich darf ihnen zeigen, wie Entschlossenheit aussieht. Ich glaube, E. tut das für uns alle. Er zeigt uns, wie schwere Arbeit und Entschlossenheit aussehen.
Bei meiner eigenen Arbeit als Profibasketballer tue ich mich mit denen zusammen, die dieselbe Einstellung haben. Ich spiele jetzt meine 17. Saison und denke immer noch genauso wie am Anfang: Niemand arbeitet schwerer als ich. Mit Menschen, die diese Arbeitseinstellung teilen, komme ich immer gut aus. Manchmal reicht es schon, jemandem in die Augen zu schauen, um zu sehen, dass er Durchhaltevermögen hat. So jemanden nehme ich jederzeit für meine Mannschaft. Bei E.T. ist das genauso, Man sieht ihm an, wie leidenschaftlich und entschlossen er ist. Er fliegt quer durch die USA, um mich spielen zu sehen. Er kommt zu meinen Youth Leadership Camps überall im Land und hält Vorträge. Er taucht wirklich jedes Mal auf und will nie etwas dafür haben. Und so ist er nicht nur bei mir, sondern immer. Ich habe selbst gesehen, wie er Jugendlichen spontan seine Telefonnummer gegeben hat, weil er sah, dass sie jemanden zum Reden brauchten. Er macht das, weil es seine Berufung ist. Es ist seine Berufung, uns zu coachen, egal, warum wir jemanden brauchen, der uns weiterhilft. Es ist seine Berufung, in unserer Mannschaft zu spielen.
Das ist etwas, was Sie mit mir gemeinsam haben. E. ist ja auch in Ihrer Mannschaft.
Chris Paul
All-Star-Spieler der NBA, Philanthrop und Unternehmer
EINLEITUNG Der Einzige, der Ihr Leben verändern kann, sind Sie selbst
Wenn Sie dieses Buch in der Hand halten, dann ist es das richtige Buch für Sie. Ich habe es für Sie geschrieben. Das klingt vielleicht verrückt, denken Sie; schließlich halten ja jetzt gerade auch Tausende anderer Menschen das gleiche Buch in der Hand und lesen diese Zeile, aber es stimmt trotzdem. Ich wende mich direkt an Sie.
You Owe You - das bist du dir schuldig ist ein Handbuch, das Ihnen Ihre Kraft und Ihr Ziel zeigt. Es ist ein Ratgeber, in dem ich anhand meiner eigenen Kämpfe und Triumphe versuche, Sie zur Erkenntnis Ihres Beweggrunds zu führen und der Verwirklichung Ihres Potenzials näherzubringen. Dieses Buch ist für Sie, wo auch immer Sie auf Ihrem Weg zur Großartigkeit gerade sind. Es ist ein Buch mit der dringenden Aufforderung, nicht länger auf die große Inspiration zu warten, sondern vielmehr aufzuwachen und Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Heute noch. Sie schulden es sich selbst, vollständig und authentisch Sie selbst zu werden und Ihr Leben so zu führen, wie nur Sie selbst es können.
Ich wünschte, ich hätte eine solche Anleitung auf meinem eigenen Weg zur Großartigkeit gehabt. Ich habe so viele Jahre vergeudet. Ich habe so lange planlos dahingelebt. Ich habe viel zu lange damit gewartet, mein Ziel zu verfolgen. Wenn ich dieses Buch gehabt hätte, wären mir meine Talente und meine Kraft womöglich viel früher im Leben bewusst geworden. Mit diesem Buch hätte ich mich womöglich nicht so viele Jahre lang als Opfer gefühlt, von Einsamkeit zerfressen und besessen von dem, was andere Leute von mir hielten.
Ich bin oft gestolpert und fehlgetreten, bis ich schließlich meinen eigenen Weg zu einem zielstrebigen Leben gefunden hatte. Und heute habe ich das Glück, eine Zuhörerschaft anzusprechen, die ebenso groß wie vielfältig ist. Und ich habe das Glück, mit Reichen zu arbeiten, mit Armen, mit Schwarzen und Weißen, mit Menschen im mittleren Alter und sogar mit welchen, die über 80 sind. Ich rede mit Prominenten und mit Menschen auf der Straße, die mich ansprechen, weil sie mich erkennen.
Aber meine ersten Schüler waren Kinder. Das liegt daran, dass ich damals, vor langer Zeit inzwischen, zuerst mit ihnen arbeitete. Als Schüler am Oakwood College in Huntsville, Alabama, sprach ich zu meinen Schulkameraden. Und dann fing ich an, Highschool-Abbrechern zu helfen, ihren Abschluss nachzuholen, so wie mir damals auch jemand geholfen hatte. Ich arbeitete in Grundschulen und an der Mittelstufe. Ich besuchte Jugendstrafanstalten und Kinderheime. In Huntsville unterrichtete ich Englisch, Theaterwissenschaft und Rhetorik und betreute als Tutor Jugendliche, die in der Schule Probleme hatten, so wie ich seinerzeit. Durch diese Arbeit wurde ich als E.T. bekannt, der Hip-Hop-Prediger.
Nachdem YouTube online gegangen war, gehörten Jugendliche zu den ersten, die sich meine Videos anschauten. Und einige dieser Jugendlichen hatten Erfolg im Leben. Sie wurden Collegespitzensportler oder sogar Profis. Sie wurden Unternehmer und Lehrer. Sie wurden Comedians, Schauspieler oder Musiker. Diese Kinder wurden erwachsen und nahmen mich mit sich. Ich verdanke dieses Buch den Jugendlichen. Besonders solchen, die ohne Vater aufwuchsen, die an Lernbehinderung oder einem Trauma litten, Problemfälle wie ich selbst.
Ob ich an Schulen spreche, in Gefängnissen, in einem NBA-Umkleideraum oder einem NFL-Trainingslager, ob ich in Australien oder Los Angeles oder Detroit oder London oder Alabama oder Frankreich auftrete - die Reaktion ist überall dieselbe. Die Menschen hören mich und wissen, dass ich zu ihnen persönlich spreche. Dass ich ihnen sage: Jetzt ist der entscheidende Augenblick. Jetzt geht es um Leben und Tod. Jetzt ist es Zeit, aufzustehen und das eigene Leben zu ändern. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Ruhm, es geht nicht um den Schulabschluss oder den Touchdown oder den Gehaltsscheck als Lohn für die Schufterei. Es geht darum, jeden Tag aufzustehen, seine eigene Kraft zu kennen, dem Weg zu seinem Ziel zu folgen, zu wissen, was man will, und den Rest des Lebens jede Minute damit zu verbringen, diesem Ziel näherzukommen.
Dieses Buch stützt sich auf viele andere Bücher, die ich gelesen habe: Think and Grow Rich: A Black Choice von Dennis Kimbro; Visions for Black Men von Dr. Na’im Akbar und Der wunderbare Weg von M. Scott Peck, sowie auf meine eigenen Erfahrungen, als ich Bücher wie The Secret to Success und The Grind im Selbstverlag herausbrachte, aber ich hoffe dennoch, das vorliegende Buch vermittelt mein Anliegen auf neuartige Weise. Viele Bücher, die ich gelesen habe, sind schwierig, gelehrt und kompliziert. Meine Botschaft ist tiefgründig, aber auch einfach. Ich möchte, dass Sie dieses Buch lesen und seine Botschaft verstehen können, ob Sie nun 12 oder 40 Jahre alt sind. Ich möchte, dass Sie es verstehen, woher auch immer Sie kommen oder wie lange Sie die Schule besucht haben. Ich möchte, dass meine Botschaft wirklich jedem klar ist.
Und diese Botschaft lautet, dass Sie selbst der einzige Mensch sind, der Ihr Leben verändern kann. Sie sind der einzige Mensch, der bestimmt, wie viel Sie wert sind. Sie sind die einzige Person, die Ihnen Ihr Ziel vorgeben und den Weg zur Großartigkeit zeigen kann. Sie sind die einzige Person, die weiß, was Sie Besonderes an sich haben und wie Sie daraus Nutzen ziehen. Sie sind der einzige Mensch, der Ihnen helfen kann.
Ich weiß, wie es Ihnen geht. Ich spreche zu jedem, der sich als Außenseiter fühlt, zu jedem, der glaubt, die Welt sei einfach nicht für ihn gemacht. Auch ich habe erlebt, wie es ist, eine fremde Sprache verstehen zu müssen, von der man nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Uns verbindet die gemeinsame Erfahrung einer Situation, die so wichtig ist, als gehe es um Leben und Tod - ob Sie nun Ihre Kinder erziehen, die Miete aufbringen müssen, einen kranken Ehepartner pflegen, zum wichtigsten Spiel Ihres Lebens antreten oder eine Prüfung vor sich haben, die darüber entscheidet, ob Sie an der Schule bleiben können. Wir sind alle Menschen. Wir alle haben diese Gefühle, wenn wir sie zulassen. Wenn ich also zu meinen Leuten spreche, dann spreche ich auch zu Ihnen.
Weil meine Arbeit sich von meiner Person nicht trennen lässt, geht es mir immer auch darum, was es heißt, als Schwarzer in den USA zu leben und dem amerikanischen Traum nachzustreben. Das heißt aber nicht, dass ich mich wegen meiner Lebensumstände (Hautfarbe, Geschlecht, Alter, wirtschaftlicher Status) als Opfer darstellen wollte, sondern es heißt, die eigene Geschichte zu schreiben und den eigenen Platz in der Welt zu beanspruchen, gleichgültig, wie die Umwelt einen sieht. Ich weiß, was es heißt, sich als Opfer zu fühlen. Das ist mir auch schon passiert. Ich dachte, die Welt sei etwas, das mir zustößt. Ich wurde obdachlos. Ich wandte mich von meiner Familie ab und weigerte mich, die Verantwortung für meine Handlungen zu tragen. Ich suchte mein Essen in Mülltonnen. Ich schlief in leer stehenden Häusern. Das war die Folge meiner eigenen Entscheidungen, und ich weigerte mich, meine Mitschuld daran zu erkennen. Ich machte mir eine Opfermentalität zu eigen, bis ich schließlich einen Ausweg fand und zum Sieger wurde.
In der wirklichen Welt gibt es viele Wege zum Erfolg. Einer davon ist, den Erfolg so sehr zu brauchen wie die Luft zum Atmen. Aber das ist nur der Anfang. Wer Erfolg haben will, muss sich klarmachen, dass der Einzige, der ihn daran hindert, er selbst ist. Man muss seine Kraft erkennen und dann sein Ziel finden und unverwandt darauf hinsteuern. Man muss sich selbst kennenlernen und so klar sehen, wer man selbst ist, dass man auf die Welt um sich herum reagieren und seine Chancen entdecken kann. Man muss seinen Beweggrund, seine Motivation finden, den Grund, warum man morgens aufsteht und sich in die Arbeit stürzt. Man muss wissen, wann es Zeit ist, etwas Gutes für etwas Großartiges aufzugeben. Man muss sein Potenzial kennen und sich bemühen, es zu erreichen. Man muss erkennen, dass man es sich irgendwann einfach schuldet, großartig zu sein.
Auch wenn Sie vielleicht gerade erst von mir gehört haben - mich gibt es schon lange. Diese Vorträge halte ich jetzt schon seit über 30 Jahren. Aber ich bin auch Pastor, Lehrer und Berater. Ich arbeite als persönlicher Coach für Profisportler. Ich engagiere mich als Ehe- und Familienberater für die Mitglieder meiner Gemeinde. Ich bete jede Woche mit Tausenden Menschen weltweit. Ich unterrichte an Universitäten und in Gefängnissen. Ich arbeite mit Vorstandsvorsitzenden von Fortune-500-Unternehmen an ihren Teambuilding-Fähigkeiten und persönlichem Wachstum. Sämtliche Aspekte meiner Arbeit sind nur möglich, weil ich meine persönlichen Hausaufgaben gemacht habe. Ich habe meine Probleme bewältigt, habe mich weitergebildet und mich abgemüht, um ausgezeichnete Leistungen bringen zu können. Ich habe mein Leben damit verbracht, zu erkennen, wer ich bin und was mein Ziel ist. Jeden Tag versuche ich, mein Potenzial zu verwirklichen, wache auf, um meinem Beweggrund nachzustreben, und gebe Gutes auf, um Großartiges zu erreichen. Es war wirklich ein langer Weg bis hierher. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass er es wert war. Der Weg ist alles. Der Weg ist der Sinn des Ganzen. Ich bin nicht bis hierher gekommen, indem ich es mir gewünscht habe. Ich bin bis hierher gekommen, weil ich mich selbst auf einen Ausflug mitgenommen habe. Und ich bin immer noch dabei. Und Sie jetzt auch.
KAPITEL 1 Sie gegen sich selbst
WENN SIE IHR LEBEN IN BESITZ NEHMEN, WERDEN SIE ZUM CHEF.
Heute gehe ich an Orten ein und aus, die unvorstellbar Privilegierten vorbehalten sind, von den Umkleidekabinen der NBA bis zu den Sitzungsräumen der Vorstände von Fortune-500-Unternehmen. Als ich noch klein war, hätte ich mir nie vorgestellt, dass der Junge, der vor dem Wohnblock in Detroit auf der Straße spielte, ein solches Leben führen könnte.
Als Jugendlicher stellte ich keine großen Erwartungen ans Leben. Ich bin in Chicago geboren und in den 1970er-Jahren in Detroit aufgewachsen. Wer damals aus einer Detroiter Arbeiterfamilie kam, wusste genau, wie sein Leben verlaufen würde: Er schloss die Highschool ab, fing bei Ford, General Motors oder Chrysler an, heiratete und arbeitete die nächsten 40 Jahre am Fließband. Danach kam die Rente. So hätte auch mein Leben aussehen sollen. Und es wäre nicht mal so schlecht gewesen. Meine Eltern haben so gelebt, viele lebten damals so, und es ging ihnen gut dabei.
Man muss nämlich eines bedenken: Niemand stellte große Erwartungen ans Leben, weil es schon ein Fortschritt war, überhaupt am Leben zu sein. Meine Urgroßeltern waren Pachtbauern bei einem Großgrundbesitzer, ihre Eltern waren noch Sklaven. Dass meine Eltern ein Haus und zwei Autos hatten, dass meine Mutter einen eigenen Garten und einen Arbeitsplatz bei der Ford Motor Company hatte, zu dem sie jeden Tag fuhr, war jenseits von allem, was sich ihre Vorfahren je erträumt hätten. Wenn man ums Überleben kämpft, wie soll man da noch an höhere Ziele denken?
Damit Sie sich vorstellen können, wie ich aufgewachsen bin, muss ich Ihnen erzählen, wie meine Mutter, Vernessa Craig, aufgewachsen ist. Fragen Sie Vernessa, was von ihr erwartet wurde, und sie wird Ihnen sagen: nichts. Sie wird Ihnen erzählen, wie sie in den 1960er-Jahren in Chicago auf dem Höhepunkt der Rassentrennung überlebt hat, als eines von 14 Kindern in einer 75-Quadratmeter-Wohnung auf der South Side. Niemand erwartete etwas von ihr, weil es wenig Hoffnung für sie gab.
Ihre Großeltern wurden in der Zeit der sogenannten Jim-Crow-Gesetze geboren, als Schwarze in den USA in allen Bereichen des öffentlichen Lebens von den Weißen getrennt bleiben mussten. Eisenbahnwaggons, Trinkwasserspender, Toiletten, Hotels - meiner Familie wurde die Würde vorenthalten, dieselben öffentlichen Räumlichkeiten wie die Weißen zu benutzen. Der Vater meiner Mutter stammte aus der Gegend von Selma, Alabama. Ihre Mutter war aus Sardis, Alabama. Das waren verarmte ländliche Gemeinden, in denen die Sklaverei nur dem Namen nach aufgehoben war. Die Familien meiner Großeltern verdingten sich als Pächter und gaben einen Teil ihrer Ernte an den Landbesitzer ab, um zu überleben. Aber wie sechs Millionen anderer Schwarzer in den USA im Lauf von ungefähr 65 Jahren nahmen sie schließlich ihr Schicksal in die eigene Hand und suchten eine bessere Zukunft für sich in den Industriegebieten der Nordstaaten.
Meine Großeltern Jessie McWilliams und Mary Craig kamen mit ihren Eltern um 1940 nach Detroit. Sie waren als Kind mit dem Zug aus Alabama gekommen und landeten in einem Viertel namens Black Bottom, das für seine solidarische Schwarzengemeinde bekannt war. Hier arbeiteten alle zusammen, gaben einander Lebensmittel ab und kümmerten sich umeinander.
Jessie McWilliams, eines von acht Kindern - er war Eva und Aaron McWilliams’ Sohn -, kam während der großen irischen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Eltern aus Irland in die USA. Jessie hatte weiße und schwarze Vorfahren, seine Haut war hell genug, um ihn als Kubaner oder Italiener durchgehen zu lassen, sodass er sich in der Öffentlichkeit ungehinderter als andere Schwarze bewegen konnte.
Meine Ururgroßmutter mütterlicherseits, Kate Gardner, starb bei der Geburt ihrer Tochter Mary Kate Craig, meiner Großmutter. Meine Mutter erzählt davon, was für eine große Lücke das in Marys Geist hinterließ und wie zurückgezogen und abwesend sie den größten Teil ihres Lebens über war. Sie sprach nie über ihre Vergangenheit. Mary war das einzige Kind ihrer Eltern und wurde von einer Stiefmutter aufgezogen, die hauptsächlich ihre Amme war und mit Marys Vater Fred noch zehn weitere Kinder hatte. Ich erinnere mich, dass ich als Kind meine Großmutter ernsthaft und humorlos erlebte, eine echte Versorgerin, die darauf konzentriert war, ihrer Familie das zu beschaffen, was sie brauchte, um bis zum nächsten Tag zu überleben. Natürlich verstand ich als Kind nicht, warum meine Großmutter so in sich zurückgezogen war. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie diese Frauen aufwuchsen und Kinder großzogen und sich selbst ohne die Hilfe irgendeines anderen Menschen versorgten, sehe ich, wie sie das davon abgehalten haben mag, die volle Bandbreite ihrer Gefühle auszudrücken.
Meine Großeltern Mary Craig und Jessie McWilliams trafen sich in Detroit und hatten drei gemeinsame Kinder, heirateten aber nie. Jesse setzte sich schließlich ab und verschwand. Mary traf Mr Braxton, den Stiefvater meiner Mutter, und sie zogen nach Chicago und bekamen elf weitere Kinder. Meine Mutter wuchs in dem Glauben auf, ihr Vater sei tot, bis er eines Tages auftauchte, als sie zehn oder elf war, und sie ihn überhaupt nicht wiedererkannte. Sie erinnert sich daran, wie weiß ihr Vater aussah und wie weiß die Frau war, die er dabeihatte, ihre Stiefmutter Bernice. Sie brauchte lange, um zu akzeptieren, wer sie war, aber schließlich fanden sie ein enges Verhältnis zueinander, und Bernice kämpfte darum, ihre Beziehung zu normalisieren. Die Familie ihres Stiefvaters mochte seine Kinder, die eine dunklere Hautfarbe hatten, lieber, mehr als sie und ihre beiden Schwestern, aber trotz der komplizierten Abstammungsverhältnisse behandelten die Kinder einander wie richtige Geschwister und ignorierten die Implikationen ihrer unterschiedlich schwarzen Haut.
Ich erkläre Ihnen die verwickelten Zusammenhänge meines Stammbaums, um Ihnen zu zeigen, wie meine eigene persönliche Geschichte auf einer instabilen Grundlage gebaut war. Für meine Familie gab es in der Gesellschaft keine Beständigkeit, ebenso wenig wie es im Privatleben keine Beständigkeit für sie gab. Es gab ständigen Tumult, ständige Sorge um die Beschaffung der Grundlagen des Überlebens. Regelmäßig flüchteten die Männer aus der Beziehung und ließen die Frauen alleine mit den Kindern zurück. Dadurch führte eine Dysfunktionalität zur nächsten, und ein Kreislauf der Unberechenbarkeit entstand. Wie kann man daran denken, sich ein erfülltes Leben aufzubauen, wenn man in bitterer Armut lebt?
Vernessa Craig wurde mit 17 Jahren schwanger. Als ich geboren wurde, war sie 18. Sie gehörte zu den zehn besten Schülern an der Dunbar High School, einer Fachoberschule mit besonders schwieriger Aufnahmeprüfung, aber damals wurden Schülerinnen, die schwanger wurden, noch der Schule verwiesen. Ein Studienberater erzählte ihr dann von einer gesetzlichen Möglichkeit, die die Schule den Betroffenen gerne verschwieg: Man konnte sich zu den Prüfungen anmelden, auch ohne den Unterricht besucht zu haben, und so trotz Schwangerschaft den Highschool-Abschluss bekommen, und das gelang ihr auch. Sie versuchte eine dauerhafte Beziehung zu meinem biologischen Vater aufzubauen, einem Mitschüler von der Dunbar High School namens Gerald Munday. Sie erinnert sich, dass er anders als die anderen jungen Männer in ihrem Viertel war. Er war kein Gangmitglied und geriet nicht in Schwierigkeiten. Letztlich war er aber auch nicht daran interessiert, mich, Eric Munday, als seinen Sohn aufzuziehen.
Als Mom dann Jesse Thomas kennenlernte, einen Zweimetermann, der Collegebasketball am Texas Southern gespielt hatte, waren sie zuerst nur Freunde. Das war 1972. Sie war 20 und hatte einen zweijährigen Sohn. Jesse wollte eigentlich eine Frau, die größenmäßig mit ihm mithalten konnte, vielleicht eine Volleyballerin. Und eine gute Hausfrau sollte sie sein. Mom ist 1,60 Meter groß und definitiv nicht der Hausfrauentyp. Aber sie kamen ins Reden, und er verstand sie und fühlte sich von ihrer Willenskraft und Intelligenz angezogen. Er sagte, er wolle Kinder, also war auch ich kein Hindernis. Er wollte mich sogar adoptieren. Sie heirateten, Mom hieß jetzt Vernessa Thomas, und nachdem Jesse sie überredet hatte, mit ihm nach Detroit zu ziehen - wenn sie hart arbeiteten, konnten sie sich dort ein eigenes Haus mit Garten leisten, und es gab gute Jobs -, beantragte Jesse beim zuständigen Gericht meine Adoption. So wurde 1974 Eric Thomas aus mir und Jesse mein gesetzlicher Vater. Dass er nicht auch mein biologischer Vater war, erzählten sie mir nicht. Damals war das so, und ich hielt ihn als Kind ganz selbstverständlich für meinen richtigen Vater.
In Detroit wohnten sie zuerst noch zur Miete, aber bald kauften sie sich ein eigenes Ziegelhäuschen mit drei Schlafzimmern, Ecke 8 Mile Street und Braile Street. Mom hatte sich nie vorstellen können, einmal ein eigenes Haus zu besitzen und so gut leben zu können, aber sie hatte auch schwer dafür gearbeitet und genoss es. Damals gab es noch streng getrennte Schwarzen- und Weißenviertel in Detroit, wie in den meisten Städten der USA. Weiter als zwei Querstraßen nördlich der 8 Mile Street durften wir uns nicht vorwagen. Manchmal stießen wir bis zur 7 Mile Street vor, aber keinesfalls bis zur 6 Mile Street oder der 9 Mile Street. Es gab eine unausgesprochene 1-Meilen-Regel für die Bewegungsfreiheit.
Detroit war eine schöne Stadt, als ich noch ein Kind war. Hier tat sich eine Menge, und wir waren sehr stolz auf unsere Stadt. Detroit war das Ideal der amerikanischen Mittelschicht. Die ganze Welt hörte unsere Musik und fuhr unsere Autos. Damals war Coleman Young der erste schwarze Bürgermeister und Motown stand ganz oben in der Hitparade mit den Temptations, den Supremes, den Isley Brothers und den Clark Sisters. Wenn meine Freunde und ich hörten, dass Diana Ross in der Stadt war oder Michael Jackson erwartet wurde, hingen wir an der Ecke herum, spähten in die Ferne und bildeten uns ein, wir könnten einen Blick auf eine Luxuslimousine auf dem Weg zu Berry Gordys Aufnahmestudio mit der blauen Stuckfassade erhaschen. Meine Großmutter wohnte in der Gegend, und es genügte schon, in der Nähe zu sein, um die Aufregung zu spüren. Auch der Kampf um die Gleichberechtigung der Schwarzen war ein wichtiges Thema in der Stadt. Es hieß zum Beispiel, Rosa Parks werde in der Innenstadt sprechen, und die Erwachsenen erzählten manchmal davon, wie Martin Luther King seine Walk-to-Freedom-Rede gehalten hatte. Der Mord an Malcolm X, der eine Zeit lang in Lansing gewohnt hatte, war damals erst zehn Jahre her und die Erinnerung an ihn noch sehr lebendig.
Ich stand schon damals immer vor allen anderen auf. Das mache ich heute noch so. Noch vor Sonnenaufgang war ich schon draußen auf der Straße und wartete auf meine Freunde und darauf, dass die Erwachsenen endlich aufstanden. Den ganzen Sommer über waren wir jeden Tag von früh bis spät unterwegs, fuhren mit dem Fahrrad durch die Gegend oder spielten Straßenfußball. Ich hielt mich damals für den kommenden Carl Lewis und träumte vom 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Spielen. Oder, wenn das nicht klappte, wollte ich es mindestens in die NFL schaffen.
Fast jedes Wochenende nahm meine Mutter meine Schwestern und mich nach Chicago mit, um ihre Familie zu besuchen. Ihre Geschwister lebten alle noch dort, und sie standen einander nahe. Die Sommer in Chicago waren lebhaft. Am Abend brachten die Leute ihre Stereoanlagen hinaus an die Ecke, und alle versammelten sich, Technomusik dröhnte, und sie tanzten auf der Straße. Chicago war ein bisschen härter als Detroit, aber mein ältester Vetter Randy kam mit allen gut klar, also wussten wir, dass wir sicher waren. Wir gingen immer an die Docks zum Angeln, und zu Dominic’s, um Süßigkeiten zu kaufen, stahlen Cornflakesschachteln von den Güterzügen und schauten den Mädchen beim Seilspringen zu. Das Leben war angenehm, und ich kannte kein anderes.
Aber etwa mit elf oder zwölf Jahren fing ich an, Fragen zu stellen. Ich hatte gehört, wie die Nachbarn tratschten und worüber meine Tanten redeten. Die Nachbarskinder auf der Straße machten sich über mich lustig und behaupteten, mein Daddy sei gar nicht mein Vater. Wenn wir beim Kartenspielen oder Basketball in Streit gerieten, kam es schnell zu Wortwechseln, bei denen wir gegenseitig unsere Eltern beleidigten und böse Witze machten, die mit »Deine Mutter ist ...« anfingen. Bei mir hieß es immer: »Dein Daddy ist nicht dein richtiger Daddy.« Wenn man das immer wieder zu hören kriegt, fragt man sich irgendwann, ob was dran ist.
Eines Tages nach der Schule durchsuchte ich das ganze Haus. Ich durchstöberte Regale und Schachteln und Wandschränke, bis ich fand, was ich suchte. In einer Schublade ganz oben im Schlafzimmer meiner Mutter lag meine Geburtsurkunde. In der Rubrik Vater stand nicht Jesse Thomas. Ich war entsetzt, aber ich hatte es mir schon gedacht. Ich hatte es nur nicht wahrhaben wollen, und so recht glaubte ich es immer noch nicht. Ich war empört, dass meine ganze Familie mich systematisch belogen hatte. Am schlimmsten fand ich, dass meine Mutter, die allerwichtigste Vertrauensperson, die Frau, die mich geboren hatte, mich mein ganzes Leben lang belogen hatte.
Ich wollte hören, wie sie es zugab. Also rief ich sie auf der Arbeit an. Wenn ich sie heute nach diesem Tag frage, sagt sie, dass meine Stimme anders als sonst klang, als sie ans Telefon ging. Sie sagt, sie habe sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. Ich sagte ihr, ich müsse ihr eine Frage stellen. Ich sagte ihr, dass ich ihr glauben würde, was auch immer sie mir sagte. Also fragte ich sie geradeheraus: Ist der, den ich für meinen Vater halte, wirklich mein Vater? Und sie sagte mir, was ich bereits wusste.
Im Rückblick war es wohl ziemlich offensichtlich. Ich wuchs mit drei Großmüttern auf. Mein Vater war zwei Meter groß und ich immer der kleinste Junge im Viertel. Seine Hautfarbe ist dunkler als meine, und wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Es gab Gerede und Andeutungen. Aber wenn man noch so jung ist, glaubt man, was einem gesagt wird, bis es einfach nicht mehr geht.
Die Wahrheit kann einen stark machen oder zerbrechen. An jenem Tag zerbrach etwas in mir. Danach war nichts mehr so wie vorher. Eine Tatsache wurde klar und verdrängte alles, was mir in der Welt gut und richtig vorkam. Dieses Gefühl ist mir geblieben und wurde in das Gewebe meines Seins eingebettet. Selbst heute noch fällt es mir schwer, mich davon nicht zerstören zu lassen. Was ich fühlte, war, dass ich auf die grundlegendste Art betrogen worden war, dass sich alle gegen mich verschworen hatten, und anstatt dass ich mich dem stellte und es verarbeitete, stieß ich alle, die mir helfen konnten, von mir und wandte mich nach innen. Da fing mein Leben an schiefzugehen.
Als ich herausfand, dass der Vater, der mich aufzog, nicht mein biologischer Vater war, fühlte ich mich, als sei mir etwas weggenommen worden, und ich wurde mir eines Teils meiner selbst bewusst, der immer gefehlt hatte. Plötzlich war das Leben etwas, das mir zustieß, und ich konnte nichts mehr kontrollieren oder verhindern. Ich war in einer Krise und dabei, darin zu ertrinken.
Auf dem Weg zum Erfolg kann man sich keine Ausreden leisten.
Ich ging damit um, indem ich wütend wurde. Ich bin ein gefühlsbetonter Mensch, also gehe ich in meine Gefühle hinein, anstatt mich umzuschauen und die empirischen Beweise zu sammeln, wenn ich in eine schwierige Lage gerate. Ich wollte nichts mit meinem Vater zu tun haben. Ich sah ihn als Gegner. Ich glaube, mir muss klar geworden sein, dass ich nie ein emotionales Verhältnis zu ihm aufgebaut hatte, und ich sah ihn immer mehr als Ehemann meiner Mutter statt als meinen Vater. Ich sah ihn außerdem als Erzieher und lehnte ihn deshalb ab. Ich wollte wohl meine Mutter dazu bringen, sich zwischen mir und meinem Adoptivvater zu entscheiden. Und letztlich lief das darauf hinaus, dass ich mir einredete, meine Mutter habe sich für ihn und gegen mich entschieden, obwohl er mich als sein eigenes Kind aufgezogen hatte und obwohl meine Mutter in ihm einen zuverlässigen Mann gefunden hatte, der die Familie versorgte.
Ich ging zur Studienberatung meiner Schule. Ich ging zu Psychotherapeuten. Familienmitglieder sprachen mit mir. Nachbarn sprachen mit mir. Meine Mom versuchte alles, was sie konnte, um uns zu versöhnen, aber das half alles nichts, weil ich es gar nicht wollte. Ich kam mir wie in einem schlechten Film vor, wenn ich mich bei irgendeinem Seelenklempner, einem völlig Fremden, in die Praxis setzte und mit ihm über Belangloses plauderte, bis er die Sitzung startete und ich plötzlich mit ihm über etwas so Intimes und Tiefliegendes reden sollte, dass ich selbst keine Worte dafür hatte. Ich fühlte mich wie eine Laborratte. Ich sah nicht ein, warum ich derjenige war, der zur Therapie gehen musste, wenn es doch meine Mutter und mein Stiefvater waren, die mich angelogen hatten. Ich war so wütend, dass ich überhaupt nicht mehr auf sie hörte. Ich kam kaum noch nach Hause, schwänzte die Schule und übernachtete bei Freunden. Mit zwölf Jahren fing ich an, aus dem Nest zu fliehen, mit 16 hatte ich mein Zuhause endgültig verlassen.
Zum Streit, der das Fass zum Überlaufen brachte, kam es an einem Wochenende im März meines vorletzten Highschool-Jahrs. Meine Eltern waren mit meinen beiden kleinen Schwestern Jeneco (damals elf) und Malori (damals zwei Jahre alt) nach Chicago gefahren. Als sie weg waren, schmiss ich im Haus eine Party für die Jungs. Wir aßen alles auf, was da war, auch ein paar Steaks, die Mom für meinen Adoptivvater gekauft hatte. Wir grillten, die Jungs tranken Bier, und wir saßen alle herum und taten so, als seien wir Männer. Als meine Eltern wieder nach Hause kamen, suchte mein Adoptivvater die Steaks und entdeckte den benutzten Grill und die vollen Mülltonnen. Mom sagte mir, ich solle mich hinsetzen und ihr zuhören, aber ich weigerte mich. Mein Adoptivvater ermahnte mich, meine Mutter nicht so zu missachten, und ich drehte mich um und wollte gehen. Er packte mich am Arm, und da verlor ich die Nerven. Bis dahin hatte ich kein Wort gesagt. Ich hatte meine Gefühle so lange hinuntergeschluckt und schweigend gelitten, dass ich unter Druck stand wie eine Dampflok. Ich hatte meine Mutter vorher noch nie beschimpft, wirklich nie, aber jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Die Dämme brachen, und ich sagte ein paar hässliche Sachen zu ihr. Für mich waren meine Eltern Heuchler. Sie redeten immer von Respekt und Integrität, aber als es um die entscheidenden Einzelheiten meines Lebens ging, hatten sie mich nicht respektiert und mich im Dunkeln gelassen. Meine Wut und meine Bitterkeit hatten sich angestaut und waren jetzt nicht mehr zurückzuhalten. Ich stürmte aus dem Haus. Es war Sonntagnachmittag, alle Nachbarn waren draußen und sahen es.
An jenem Tag zerbrach noch etwas in mir. Ich kam mir vor, als sei ich am Ende einer sehr langen Straße angekommen, und jetzt blieb mir noch, von ihr abzubiegen und meinen eigenen Weg zu gehen. Niemand sollte mir mehr sagen, was ich zu tun habe, besonders nicht jemand, der dazu doch gar nicht die Befugnis habe, fand ich. Ich verließ das Haus für immer. Außer den Klamotten, die ich trug, hatte ich nichts dabei. In der ersten Nacht schlief ich im Garten zwischen den Sträuchern und der Hauswand. Im März herrscht in Detroit nasses, graues Tauwetter mit Schneematsch. Am Morgen war ich steif vor Kälte, aber alles kam mir besser vor als zurückzugehen. Als der Schulbus kam, freute ich mich auf die Schule wie noch nie. Ich lief zwei oder drei Tage lang in denselben Sachen herum und übernachtete noch ein paarmal im Garten, aber dann driftete ich langsam immer weiter von meinem Elternhaus weg.
Damals fing es in Detroit gerade an, etwas härter zuzugehen. Es war 1986, und die Y.B.I, die Young Boys Incorporated, eine Bande von Drogenhändlern, hatte ihre große Zeit. Die Weißen zogen immer weiter von der Innenstadt weg. Manchmal konnte ich bei einem Freund übernachten, aber in anderen Nächten musste ich frierend und hungrig in leer stehenden Häusern unterkriechen. Ich hörte die Ratten neben meinem Kopf herumlaufen und Schüsse von draußen. Ich konnte nie länger als zwei oder drei Nächte am selben Platz bleiben, damit niemand meine Gewohnheiten auskundschaften und mich ausrauben oder noch Schlimmeres mit mir anstellen konnte. Ich hatte solchen Hunger, dass ich anfing, die großen Müllcontainer hinter den Supermärkten zu durchwühlen, um abgelaufene und aussortierte Lebensmittel zu finden, und die Mülleimer in der Nähe von Fast-Food-Restaurants, in die damals alles wanderte, was nach einer Schicht übrig blieb.
Man kann seine Umgebung verändern, aber nichts wird sich je ändern, solange man nicht sich selbst verändert.
Als ich aus meinem Elternhaus weglief, hatte ich nichts. Ich hatte keine Ahnung, wie ich an eine Unterkunft und Essen kommen oder mich warm halten würde. Ich hatte weder Papiere noch Geld. Ich hatte nicht mal saubere Klamotten. Damals gab es auch noch keine Mobiltelefone. Wenn ich mit jemandem reden wollte, musste ich in eine Telefonzelle gehen oder gleich zu ihm selbst. Das alles wurde mir aber erst ungefähr eine Woche, nachdem ich ausgerissen war, richtig klar. Ich ging gerade die 12 Mile Road entlang, wo sie sich mit der Evergreen Street kreuzt, und es fing an zu schütten. Ich hatte nichts als einen »Starter«-Blouson und eine Baseballmütze, um mich vor dem Regen zu schützen. Ich flüchtete in einen Getränkehandel, kaufte eine Flasche rote Faygo-Limonade und eine Tüte Chips und drückte mich so lange wie möglich im Laden herum. Als schwarzer Jugendlicher in einem arabischen Schnapsladen in Detroit kann man allerdings nicht sehr oft die Gänge auf- und abwandern, ohne verdächtig zu wirken.
Kurz nach diesem Erlebnis rief ich kleinlaut meine Mutter an. Sie fand es zwar nicht gut, dass ich nicht mehr zurückkommen wollte, aber sie sagte, sie werde mich weiterhin lieben und unterstützen, wenn ich sie ließe. Sie half mir sogar, meinen Führerschein zu bekommen, und segnete mich mit einem Auto, damit ich mobil war. Manchmal schlief ich auch im Auto, wenn ich nicht bei einem Freund unterkommen konnte und es zu kalt war, um in einem Abbruchhaus zu übernachten. Aber auf Dauer war es nicht durchzuhalten, dass ich auf der Straße schlief. Außerdem war das gefährlich. Ich heuerte deswegen bei McDonald’s in der Nachtschicht an, von 17 Uhr bis fünf Uhr früh, um nachts ein Dach über dem Kopf zu haben. Es war ein 24-Stunden-McDonald’s an der Ecke Finkle und Wyoming Street. Ich fing zur Abendessenszeit an und machte durch bis zum Frühstück. Und die ganze Zeit über ging ich weiter zur Schule und versuchte zu verheimlichen, dass ich obdachlos war. Nach der Nachtschicht bei McD’s hatte ich immer noch ein paar Stunden, bevor die Schule anfing, und die nutzte ich, um bei einem Kumpel, dessen Mutter um sechs Uhr zur Arbeit fuhr, ein bisschen Schlaf nachzuholen.
Ich hielt mich selbst gar nicht für obdachlos. Ich wohnte bloß nicht mehr zu Hause. Ich verbrachte so viel Zeit alleine im Dunkeln, dass es in mir auch dunkel wurde. Ich fühlte mich völlig machtlos. Ich verbitterte. Ich war immer noch voller Wut. Ich gab meiner Mutter und meinem Adoptivvater die Schuld an allem, was in meinem Leben schieflief. Manchmal dachte ich daran, mir etwas anzutun. Ich hatte keine konkreten Selbstmordpläne, aber ich ließ mich in eine Depression abrutschen, die sich wie ein undurchdringlicher Nebel um mich legte. Wenn ich Ihnen das alles heute erzähle, muss ich dazusagen, dass dieser Zustand für mich unnatürlich war. Ich neige nicht zu Depressionen oder Geisteskrankheit; hätte ich dieses Problem gehabt, wäre alles noch viel komplizierter geworden, ich weiß. Aber ich bin von Natur aus Optimist, fröhlich und gesellig. Im Normalzustand bin ich gesprächig und energiegeladen. Wenn Leute um mich sind, fühle ich mich wohl. Aber als ich aus meinem Elternhaus weglief, machte ich mich selbst zum Opfer der Umstände. Ich fügte mir bewusst selbst Schaden zu.
Solange man noch ein Kind ist, sagen einem die Eltern, was man tun soll, und geben einem, was man zum Leben braucht. Sie geben vor, was man anzieht, was man isst, bringen einem Laufen und Sprechen bei. Sie holen einen von der Schule ab und zahlen die Rechnungen für das Haus, in dem man wohnt. Selbst wenn sie einem nichts beibringen, lehren sie doch durch ihr Vorbild. Als Kind lebt man noch in sorgloser Unwissenheit darüber, dass man eines Tages für sich selbst verantwortlich ist. Eines schönen Tages ist man dann auf sich alleine gestellt, und von da an schuldet einem niemand mehr irgendetwas.
Dass ich obdachlos war, hatte ich mir selbst eingebrockt. Ich hatte mich dafür entschieden. Ich hatte mich zu einem Opfer gemacht, weil ich glaubte, die Welt habe mich misshandelt. Ich glaubte, meine Mutter sei schuld. Ich glaubte, ihr sei ihr Mann wichtiger als ich gewesen. Ich erkannte damals noch nicht, dass es ihr gelungen war, einen zuverlässigen Ehemann zu finden, der sie und ihre Familie ernährte, einen Mann, der die Verantwortung übernahm, mich als seinen Sohn aufzuziehen. So wie ich die Geschichte sah, war mir Unrecht geschehen. Ich war ein Opfer. In Wirklichkeit schadete ich mir nur selbst.
Ich brach die Highschool ab. Später holte ich den Abschluss nach und ging aufs College, aber selbst danach noch, sogar nachdem ich schon meine Frau Dede kennengelernt und sie geheiratet hatte, spielte ich noch das Opfer. Ich verbrachte meine Zeit mit Videospielen und schwänzte die Examensarbeiten. Ich gab keine Hausarbeiten ab, ging nicht zum Unterricht. Und wissen Sie, was? Genauso, wie ich aus der Highschool geflogen war, flog ich jetzt vom College. Ich glaubte immer noch, jemand anders sei verantwortlich für mich. Ich glaubte die ganze Zeit, dass jemand kommen und sich um mich kümmern werde.
Sie haben die Wahl: Opfer oder Sieger
Die Opferhaltung ist eine Denkweise. Sie ist eine Einstellung, die einen zu bestimmten Entscheidungen und Verhaltensweisen treibt. Opferhaltung heißt, dass die Welt etwas ist, das einem zustößt, und dass man davon abhängig ist, sich von ihr das Leben vorschreiben zu lassen. Opferhaltung heißt, man wartet darauf, dass die Welt einem die Mittel bereitstellt, voranzukommen. Damit gibt man die Kontrolle an jemand anderen oder an etwas anderes ab. Bedenken Sie: Wenn Sie der Welt diese Macht geben, spielen Sie russisches Roulette mit Ihrem Leben. Sie wissen nicht, wo Sie landen werden, weil Sie nicht am Steuer sitzen. Aber wenn Sie selbst die Kontrolle übernehmen, werden Sie sehen, dass Sie die Macht haben, Ihre Einstellung zu ändern und ein Sieger auf Ihrem Weg zu werden.
Die Wirklichkeit sah so aus: Als die Krise kam, entschied ich mich, ein Opfer zu sein. Dadurch verletzte ich mich nur selbst. Ich hielt dieses Gefühl des Verletztseins fest, ließ es in mein Inneres und ließ es zum bestimmenden Faktor werden. Ich wollte unbedingt glauben, dass andere Menschen mein Leben ruiniert hatten. Dabei hatte mich niemand aus dem Haus geworfen, niemand hatte mir gesagt, ich solle gehen, ich schadete mir mit meinem Entschluss selbst am meisten. Ich entschloss mich, in Abbruchhäusern zu übernachten. Ich entschloss mich, aus Mülltonnen zu essen. Ich entschloss mich, diese Sache weiter zu treiben, als nötig gewesen wäre.
In Ihrem Leben wird es genug Punkte geben, an denen alles schiefläuft. Sie werden sich oft verletzt fühlen. Es ist auch in Ordnung, wenn Sie das fühlen. Sie dürfen durchaus wütend und verärgert sein. Aber Gefühle sind keine Tatsachen, sie sind eben bloß Gefühle. Mit Fakten kann man seine Gefühle verarbeiten und überwinden. Ich wünsche mir, ich könnte dem 16-jährigen Eric von damals sagen: Du darfst wütend sein, aber sei zu Hause wütend. Sei in deinem Kinderzimmer wütend. Du kannst verärgert sein, aber ärgere dich mit Klimaanlage und einem Dach über dem Kopf. Du darfst traurig sein, aber sei traurig, während du Essen auf dem Tisch hast und saubere Sachen zum Anziehen. Du musst nicht dein ganzes Leben sabotieren, um deine Gefühle zu spüren. Du darfst diese Gefühle haben, aber du musst deswegen nicht zum Opfer werden.
Das Gute ist nämlich: Wenn Sie die Opferhaltung hinter sich lassen und Ihr Leben in die Hand nehmen, wenn Sie die Verantwortung dafür und die Kontrolle darüber übernehmen, sind Sie der Chef. Sie sind der CEO Ihres Lebens. Es gibt nichts Erfolgloses in Ihrem Leben, wenn Sie es in die Hand nehmen. Der Einzige, gegen den Sie ankämpfen, sind Sie selbst. Es ist ein Kampf von Ihnen gegen sich selbst. Wenn Sie sich einmal klargemacht haben, dass Sie der Einzige sind, der Ihrem Vorankommen im Weg steht, können Sie das Muster verändern.
Wirklicher Erfolg fängt an, wenn man die Kontrolle über und die Verantwortung für den eigenen Anteil am Misserfolg im Leben übernimmt.
Wenn ich mir jemanden vorstellen will, der die Opferhaltung besiegt hat, fällt mir Vernessa Craig ein. Niemand hatte etwas Besonderes von meiner Mutter erwartet; sie war schon als Jugendliche auf Sozialhilfe angewiesen und hatte weniger Mittel als ich in meinen schlechtesten Zeiten zur Verfügung, aber sie führte sich nie als das Opfer ihrer Lebensumstände auf. Sie war zäh und nicht unterzukriegen, und sie wusste, dass ihr niemand etwas schenken würde.
Mit neun oder zehn Jahren wurde sie missbraucht und verstummte aufgrund des erlittenen Traumas. Die anderen Kinder hänselten sie deshalb, sodass sie sich zurückzog und ihre Zeit mit Lesen verbrachte. In allen Büchern, die sie las, gab es einen Weg zum Glück: Es gab eine andere Welt jenseits der ihren, und sie war entschlossen, dort einen Platz für sich zu finden. Als sie mit mir schwanger wurde, hätte sie das aus der Bahn werfen können, aber sie nahm sich nur noch fester vor, von der Sozialhilfe unabhängig zu werden und mit ihrem eigenen Einkommen für mich zu sorgen. Damals konnte eine Frau, die Kinder, aber keinen Mann im Haus hatte, problemlos Sozialhilfe bekommen. Auf sie traf beides zu. Aber Vernessa arbeitete fleißig, seit sie 14 war, und brachte es schließlich bis zu einem Posten im Staatsdienst, beim Argonne National Laboratory bei Chicago.
1973 ging sie ein letztes Mal zum Sozialamt und sagte ihrem Sachbearbeiter, dass sie keine Stütze mehr brauche. Einen letzten Einkaufsgutschein wollte sie aber noch, für eine Waschmaschine und eine Schlafzimmereinrichtung. Der Beamte sah sie verblüfft an, als frage er sich, woher sie die Chuzpe für eine solche Forderung nahm, aber offenbar gefiel ihm ihr Mut, und er schrieb den Gutschein aus. Schwarze Frauen wurden damals zur Unterwürfigkeit erzogen, aber unterwürfig war sie nie. Vernessa war immer selbstbewusst und sagte stets, was sie wollte. Sie fühlte sich wie nach einem Sieg in der Schlacht und ging hinüber zum Polk-Brothers-Möbelladen in der Cicero Avenue. Das lag auf der falschen Seite der Halstead Street, aber es gab dort schönere Möbel als bei uns im Viertel. Nachdem sie die Schlafzimmereinrichtung bestellt hatte, machte sie sich auf den Rückweg zur Bushaltestelle. In dieser Gegend musste man als Schwarzer damals Angst haben. Es gab Viertel in Chicago, wo einen die Weißen feindselig anstarrten, sodass man sich als Schwarzer fehl am Platz vorkam. In der Cicero Avenue beschimpften sie einen und scheuten auch vor Gewalt nicht zurück. Tatsächlich fingen ein paar Männer an, Mom zu belästigen, nannten sie »Nigger«, folgten ihr und suchten offenbar Streit. Da hielt zum Glück ein Bus neben ihr, in den sie sich flüchten konnte. Der Fahrer war ein Schwarzer; sie erinnert sich, wie er mit ihr schimpfte und sie ihm versprechen musste, nie wieder auf der Cicero Avenue herumzulaufen. Sie sagt, er habe sie vielleicht vor einem schlimmen Erlebnis bewahrt, aber dass sie sich damals auch geschworen habe, nicht den Rest ihres Lebens so zu verbringen.