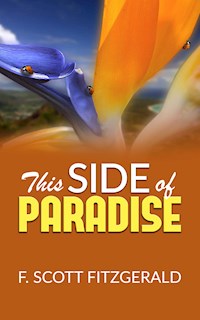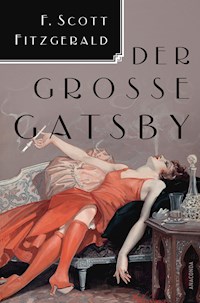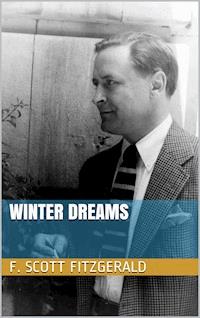3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In der Villa der Exil-Amerikaner Dick und Nicole Diver an der Südküste Frankreichs gehen Künstler, Snobs und andere Landsleute ein und aus. Die jugendlich-unverdorbene Schauspielerin Rosemary aber sucht mehr als exquisite Geselligkeit, sie verführt den Hausherrn und gewinnt tatsächlich die Liebe des erfolgreichen Psychiaters. Damit beginnt eine Dreiecksgeschichte, die spannungsreicher kaum verlaufen könnte, denn Dick und Nicole bindet weit mehr aneinander als ein Eheversprechen. Dieser autobiografisch grundierte Roman voll psychologischer Finesse ist der letzte große Wurf von F. Scott Fitzgerald, dem Schöpfer des »Großen Gatsby«.
- »Engel sind die eleganteren Menschen. Aber wer hoch steigt, wird tief fallen. Niemand zeigte beides so schön wie F. Scott Fitzgerald.« Frankfurter Rundschau
- »F. Scott Fitzgerald ist ein Schriftsteller, wie er uns heute fehlt. Man kann ihn wieder und wieder lesen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Zärtlich ist die Nacht
Aus dem Englischen von Grete Rambach
Anaconda
Tender is the Night erschien erstmals 1934 bei Charles Scribner’s & Sons in New York. Die Übersetzung von Grete Rambach erschien erstmals 1952 bei Blanvalet in Berlin. Sie beruhte auf der posthum von Malcolm Cowley nach Notizen Fitzgeralds überarbeiteten zweiten Fassung von Tender is the Night.
Für die hier vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung vollständig überarbeitet, der Erstausgabe, die vor allen Dingen eine andere Chronologie der Ereignisse aufweist, angepasst, und an wenigen Stellen um fehlende Absätze ergänzt.
Hinweis:
Der Roman enthält stereotype Figurenkonstellationen und rassistische Begriffe. Die im Deutschen verwendeten Begriffe entsprechen jenen des Originals. Die Begriffe und dahinterstehende Vorstellungen sollten mit historisch kritischer Distanz rezipiert werden.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Alberto Fabio Lorenzi (1880 – 1969), Illustration aus ›La Vie Parisienne‹ © The Advertising Archives / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
ISBN 0391-978-3-64131-8529V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Erstes Buch
Buch zwei
Buch drei
Für Gerald und Sara
viele Feste
Already with thee! tender is the night…
…But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verdurous glooms and winding mossy ways.
– Ode to a Nightingale (John Keats)
Schon bin ich bei dir! Zärtlich ist die Nacht,
… Doch hierher reicht kein Licht,
nur was ein Windhauch aus den Himmeln trägt,
durch grünen Dämmer und verschlung’ne moosbewachs’ne Pfade.
Ode an eine Nachtigall (John Keats)
Erstes Buch
I
An der Küste der französischen Riviera, auf halbem Weg etwa zwischen Marseille und der italienischen Grenze, stand ein großes, stolzes, rosafarbenes Hotel. Ehrerbietige Palmen milderten die Glut seiner Fassade, und vor ihm erstreckte sich ein kurzer, blendender Badestrand. Neuerdings dient er angesehenen und eleganten Leuten als Sommerfrische; 1925 lag er, wenn seine englischen Gäste im April nach Norden abgereist waren, nahezu verlassen da. Nur die Dächer von einem Dutzend alter Villen schimmerten wie Wasserrosen aus den dichten Pinien zwischen Gausses Hôtel des Étrangers und dem fünf Meilen entfernten Cannes hervor.
Das Hotel und sein leuchtender gelbbrauner Gebetsteppich von Badestrand bildeten ein Ganzes. Früh am Morgen spiegelten sich im Wasser das ferne Bild von Cannes, die Rosa- und Elfenbeintöne alter Befestigungen und die purpurnen Alpen an der italienischen Grenze zitterten auf den sich kräuselnden Wellen und den Ringen, die an klaren, seichten Stellen von Wasserpflanzen an die Oberfläche geschickt wurden. Vor acht kam ein Mann in blauem Badeanzug zum Strand herunter, und nachdem er nach umständlichen Vorbereitungen seinen Körper mit dem kalten Wasser in Berührung gebracht hatte, planschte er mit viel Gebrumm und Schnaufen eine Minute im Meer herum. Als er sich entfernt hatte, lagen Strand und Bucht eine Stunde lang ruhig da. Handelsschiffe zogen am Horizont langsam westwärts; Hotelpagen lärmten im Hof; der Tau auf den Pinien verdunstete. Eine Stunde später tönten die Autohupen von der gewundenen Straße an der Hügelkette des Maurenmassivs herab, das das Küstengebiet vom richtigen provenzalischen Frankreich trennt.
Eine Meile vom Meer entfernt, wo die Pinien durch staubige Pappeln abgelöst werden, befindet sich eine abgelegene Bahnstation; von dorther brachte eine leichte Kutsche an einem Junimorgen 1925 eine Dame und ihre Tochter zu Gausses Hotel. Das Gesicht der Mutter trug Spuren einer verblassenden Schönheit, die bald von roten Äderchen durchzogen sein würde; ihr Ausdruck war in angenehmer Weise ruhig und aufgeweckt zugleich. Man ließ jedoch seine Augen alsbald zu ihrer Tochter wandern, die einen Zauber in ihren rosigen Händen barg und deren Wangen lieblich glühten, wie die Haut von Kindern, die nach dem kalten abendlichen Bad von plötzlicher Röte überzogen wird. Ihre schöne, hohe Stirn stieg sanft zu ihrem Haar hinan, das sie wie eine Helmzier umgab und aus der Schmachtlocken und Wellen und Schnörkel aus Aschblond und Gold hervorquollen. Ihre Augen waren lebhaft, groß, klar, feucht und glänzend, die Farbe ihrer Wangen war echt; sie wurde von ihrem jungen, starken Herzen unmittelbar zur Oberfläche gepumpt. Ihr Körper verweilte noch eben im letzten Stadium der Kindheit – sie war fast achtzehn, doch der Tau lag noch auf ihr.
Als Meer und Himmel in Form einer dünnen, glänzenden Linie unter ihnen erschienen, meinte die Mutter:
»Ich habe das Gefühl, dass uns dieser Ort nicht zusagen wird.«
»Ich will sowieso nach Hause«, antwortete das Mädchen.
Beide sprachen in heiterem Ton, hatten jedoch offenbar keinen festen Plan; außerdem ärgerten sie sich über die Tatsache, dass ihnen kein Vorhaben, einerlei welcher Art, zugesagt hätte. Sie trugen Verlangen nach besonders aufregenden Dingen, nicht weil ihren erschöpften Nerven ein Anreiz nötig hatten, sondern aus der Begierde von Schulkindern heraus, die einen Preis gewonnen und sich ihre Ferien verdient haben.
»Wir bleiben drei Tage und fahren dann nach Hause. Ich werde sofort telegrafisch Plätze auf dem Dampfer belegen.«
Im Hotel gab das Mädchen die Bestellung in fließendem, aber ziemlich monotonem Französisch auf, wie etwas Auswendiggelerntes. Als sie sich im Erdgeschoss eingerichtet hatten, trat sie in die Helle der französischen Fenster und ein paar Stufen hinaus auf die Steinterrasse, die am Hotel entlanglief. Beim Gehen hielt sie sich wie eine Balletttänzerin, ließ ihr Gewicht nicht in den Hüften, sondern im Kreuz ruhen. In dem heißen Licht draußen hob sich ihr Schatten scharf ab, und sie zog sich zurück – es blendete zu sehr. Fünfzig Meter weiter unten bot das Mittelmeer den sengenden Sonnenstrahlen seine Farbe dar; unter dem Geländer schmorte ein ausgeblichener Buick in der Hotelauffahrt.
Tatsächlich herrschte nur am Strand lebhaftes Treiben. Drei englische Kinderwärterinnen saßen und strickten Pullover und Strümpfe mit den langweiligen viktorianischen Mustern der Vierziger-, Sechziger- und Achtzigerjahre und begleiteten ihr Tun mit einem Geplapper, das im Tonfall einer Beschwörung glich. Näher am Wasser hatte sich ein Dutzend Leute unter einem gestreiften Sonnenschirm häuslich eingerichtet, während die dazugehörigen Kinder an seichten Stellen nach wenig beeindruckten Fischen jagten oder nackt und glänzend vom Kokosöl in der Sonne lagen.
Als Rosemary zum Strand kam, lief ein zwölfjähriger Junge an ihr vorbei und warf sich mit jauchzenden Schreien ins Meer. Da die forschenden Blicke aus den fremden Gesichtern sie bedrückten, legte sie ihren Badeumhang ab und folgte dem Jungen. Sie ließ sich ein paar Meter mit dem Gesicht nach unten treiben, aber als sie merkte, dass das Wasser flach war, kam sie mit Anstrengung auf die Füße und stakste vorwärts, indem sie ihre schlanken Beine wie Gewichte gegen den Widerstand des Wassers schob. Als es ihr bis zur Brust ging, blickte sie zum Strand zurück: ein kahlköpfiger Mann mit einem Monokel und im Badetrikot, mit herausgedrückter Brust und eingezogenem Bauch, betrachtete sie aufmerksam. Als Rosemary den Blick zurückgab, ließ der Mann das Monokel fallen, das sogleich in seinem vorwitzigen Brusthaar verschwand, und goss sich aus einer Flasche, die er in der Hand hielt, ein Glas ein.
Rosemary legte ihr Gesicht aufs Wasser und kraulte mit kurzen, heftigen Schlägen zum Floß. Das Wasser umspülte sie, zog sie sanft hinab, von der Hitze fort, sickerte in ihre Haare und floss in die Winkel ihres Körpers. Sie drehte sich um und um darin, umarmte es, schwelgte darin. Als sie das Floß erreichte, war sie außer Atem, aber eine sonnengebräunte Frau mit sehr weißen Zähnen blickte zu ihr herunter, und Rosemary, die sich plötzlich der kalkigen Weiße ihres eigenen Körpers bewusst wurde, drehte sich auf den Rücken und ließ sich dem Strand zutreiben. Der behaarte Mann mit der Flasche sprach sie an, als sie herauskam.
»Hören Sie – draußen, hinter dem Floß, gibt’s Haie.« Er war von unbestimmbarer Nationalität, sprach aber ein langsames Oxford-Englisch. »Gestern haben sie zwei britische Matrosen von der Flotte in Golfe-Juan verschlungen.«
»Um Himmels willen!«, rief Rosemary.
»Die Abfälle von den Schiffen locken sie herein.«
Seine Augen wurden ausdruckslos, als wenn er andeuten wollte, dass er nur gesprochen hatte, um sie zu warnen; er tat zwei Schritte rückwärts und goss sich ein weiteres Glas ein.
Etwas verlegen, doch angenehm berührt von dieser Unterhaltung, in der sich ein gewisses Interesse ihr gegenüber gezeigt hatte, suchte sich Rosemary einen Platz zum Sitzen. Augenscheinlich hatte jede Familie den Streifen Sand im Besitz, der vor ihren Sonnenschirmen lag; überdies herrschte ein lebhaftes Hin und Her – man besuchte sich, man plauderte miteinander – eine Atmosphäre von Gemeinsamkeit, in die man nicht eindringen konnte, ohne anmaßend zu erscheinen. Weiter oben, wo der Sand mit Steinen und trockenem Seetang gemischt war, befand sich eine Gruppe von Menschen, deren Haut ebenso weiß war wie ihre. Sie lagen unter kleinen Handsonnenschirmen statt unter Strandschirmen und fühlten sich offenbar weniger zu Hause. Rosemary fand Platz zwischen den dunklen und den hellen Leuten und breitete ihren Badeumhang auf dem Sand aus.
Als sie so dalag, hörte sie zunächst nur die Stimmen der Menschen, fühlte deren Füße um ihren Körper herumlaufen und ihre Gestalten zwischen ihr und der Sonne vorbeigehen. Der warme und nervöse Atem eines neugierigen Hundes berührte ihren Nacken; sie spürte, wie ihre Haut zu schmoren begann, und lauschte dem matten Glucksen der heranspülenden Wellen. Dann unterschied ihr Ohr einzelne Stimmen, und sie vernahm, wie jemand spöttisch berichtete, »dieser Kerl, der North«, habe am Abend vorher einen Kellner aus einem Café in Cannes gewaltsam entführt, um ihn mitten durchzusägen. Erzählt wurde die Geschichte von einer weißhaarigen Dame in voller Abendgarderobe, die offensichtlich noch vom Abend vorher stammte, denn ein Diadem haftete in ihrem Haar, und eine kraftlose Orchidee hauchte an ihrer Schulter ihr Leben aus. Rosemary wurde von einer vagen Antipathie gegen sie und ihre Gesellschaft erfasst und wandte sich ab.
Am nächsten bei ihr, auf der anderen Seite, lag eine junge Frau unter einem Dach von Schirmen und schrieb aus einem auf dem Sand liegenden Buch eine Liste von Dingen ab. Sie hatte ihren Badeanzug von den Schultern gestreift, und ihr rötlich-orangebrauner Rücken, den eine Reihe mattweißer Perlen zierte, glänzte in der Sonne. Ihr Gesicht war herb und schön und traurig. Sie begegnete Rosemarys Blicken, aber sah sie nicht. Weiter weg befanden sich ein gut aussehender Mann mit Jockeymütze und rot gestreiftem Badetrikot; dann die Frau, die Rosemary auf dem Floß gesehen hatte und die sie nun gleichfalls anblickte, die sie sah; dann ein Mann mit schmalem Gesicht, goldgelben, löwenhaften Locken, in blauem Badetrikot und ohne Hut, der sich ernsthaft mit einem unverkennbar südländischen jungen Mann in schwarzem Badetrikot unterhielt, während beide an kleinen Stücken Seetang im Sand herumzupften. Sie hielt die Mehrzahl von ihnen für Amerikaner, etwas jedoch ließ sie anders erscheinen als die Amerikaner, die sie in der letzten Zeit kennengelernt hatte.
Nach einer Weile bemerkte sie, dass der Mann mit der Jockeymütze dieser Gruppe von Menschen eine richtige kleine Vorstellung gab; er ging feierlich mit einem Rechen umher und tat so, als ob er Kies wegharkte, dabei führte er eine nur für Eingeweihte bestimmte Burleske auf, deren Spannung durch seine ernste Miene aufrechterhalten wurde. Die geringste Veränderung seines Gesichtes wirkte lustig, bis schließlich alles, was er sagte, einen Sturm von Heiterkeit auslöste. Selbst wer wie sie zu weit entfernt war, um die Worte zu verstehen, verfolgte das Spiel mit Aufmerksamkeit, bis zuletzt die einzige Person am Strand, die nicht davon berührt wurde, die junge Frau mit der Perlenkette war. Vielleicht aus einer gewissen Bescheidenheit, wie sie Besitzenden eigen ist, quittierte sie jede Lachsalve damit, dass sie ihren Kopf tiefer über ihre Liste beugte.
Der Mann mit dem Monokel und der Flasche sprach plötzlich aus dem Himmel über ihr zu Rosemary herab:
»Sie sind eine famose Schwimmerin.«
Sie widersprach.
»Doch, ausgezeichnet. Mein Name ist Campion. Hier ist eine Dame, die Sie vorige Woche in Sorrent gesehen hat und weiß, wer Sie sind; sie möchte gern Ihre Bekanntschaft machen.«
Als Rosemary sich mit unterdrücktem Ärger umblickte, sah sie, dass die Leute mit der weißen Haut sie erwarteten.
Zögernd erhob sie sich und ging zu ihnen hinüber. »Mrs Abrams – Mrs McKisco – Mr McKisco – Mr Dumphry –«
»Wir wissen, wer Sie sind«, sagte die Dame im Abendkleid. »Sie sind Rosemary Hoyt; ich habe Sie in Sorrent erkannt und erkundigte mich beim Geschäftsführer des Hotels; wir alle finden Sie einfach wunderbar und möchten wissen, warum Sie nicht in Amerika sind und einen weiteren wunderbaren Film machen.«
Sie forderten sie durch überflüssige Gesten auf, näher zu kommen. Die Dame, die sie erkannt hatte, war keine Jüdin, trotz ihres Namens. Sie war eine jener alten Junggebliebenen, die dank einer guten Verdauung und einem Schutz vor Erfahrungen Teil einer anderen Generation zu sein scheinen.
»Wir wollten Sie davor warnen, sich am ersten Tag einen Sonnenbrand zu holen«, fuhr sie munter fort, »denn Ihre Haut ist wichtig; aber hier am Strand scheint es so verdammt formell zuzugehen, dass wir nicht wussten, ob Sie etwas dagegen hätten.«
II
»Wir dachten, Sie seien vielleicht mit im Komplott«, sagte Mrs McKisco. Sie war eine hübsche junge Frau mit nichtssagenden Augen und entwaffnender Lebhaftigkeit. »Wir wissen nicht, wer im Komplott ist und wer nicht. Ein Herr, zu dem mein Mann besonders nett gewesen war, entpuppte sich als Hauptperson – praktisch als rechte Hand des Helden.«
»Ein Komplott?«, fragte Rosemary, die nur halb begriff. »Gibt es ein Komplott?«
»Das wissen wir nicht, meine Liebe«, sagte Mrs Abrams unter stoßweisem, behäbigem Lachen. »Wir sind nicht Teil davon. Wir sind die Galerie.«
Mr Dumphry, ein flachsköpfiger, verweichlichter junger Mann, bemerkte: »Mama Abrams ist ein Komplott für sich.« Campion jedoch drohte ihm mit seinem Monokel und sagte: »Royal, sei nicht so schrecklich ungezogen.« Rosemary blickte unbehaglich von einem zum andern und wünschte, ihre Mutter wäre mit ihr heruntergekommen. Ihr gefielen diese Leute nicht, ganz besonders in unmittelbarem Vergleich mit denen, die am andern Ende des Strandes ihr Interesse erregt hatten. Das zurückhaltende, aber ausgeprägte gesellschaftliche Talent ihrer Mutter wurde mit unerwünschten Situationen schnell und sicher fertig. Aber Rosemary war erst seit einem halben Jahr eine Berühmtheit, und mitunter führten die französischen Sitten und Gebräuche ihrer frühesten Jugend, zu denen sich später die demokratischen Gepflogenheiten Amerikas gesellt hatten, zu einer gewissen Verwirrung, durch die sie unfehlbar in solche Lagen geriet.
Mr McKisco, ein knochiger Mann um die dreißig mit rotem, sommersprossigem Gesicht, fand das »Komplott« als Gesprächsstoff nicht erheiternd. Er hatte auf das Meer hinausgestarrt – nun, nach einem schnellen Blick auf seine Frau, wandte er sich zu Rosemary und fragte herausfordernd:
»Schon lange hier?«
»Erst einen Tag.«
»Ach so.«
Offenbar merkte er, dass das Gespräch eine völlig andere Wendung genommen hatte, und blickte die anderen der Reihe nach an.
»Werden Sie den ganzen Sommer bleiben?«, fragte Mrs McKisco unschuldig. »Wenn ja, dann können Sie beobachten, wie sich das Komplott entwickelt.«
»Um Gottes willen, Violet, hör endlich auf damit!«, explodierte ihr Mann. »Denk dir einen neuen Scherz aus, ich flehe dich an!«
Mrs McKisco beugte sich zu Mrs Abrams und schnaubte hörbar:
»Er ist nervös.«
»Ich bin nicht nervös«, widersprach McKisco. »Zufällig bin ich überhaupt nicht nervös.«
Er war sichtlich wütend – eine graue Röte hatte sich über sein Gesicht gebreitet, und jeglicher Ausdruck darin war einer nichtssagenden Mattigkeit gewichen. Plötzlich wurde er sich seines Zustandes irgendwie bewusst; er erhob sich, um ins Wasser zu gehen, seine Frau folgte ihm, und Rosemary ergriff die Gelegenheit, und folgte ebenfalls.
Mr McKisco holte tief Atem, warf sich in das seichte Wasser und begann, mit steifen Armen auf das Mittelmeer einzuschlagen, augenscheinlich in der Absicht, ein Kraulen anzudeuten. Als ihm die Luft ausging, stellte er sich auf, blickte um sich und machte ein erstauntes Gesicht, weil das Ufer noch in Sicht war.
»Ich habe noch nicht gelernt, richtig zu atmen. Ich habe nie recht begriffen, wie man atmen muss.« Er blickte Rosemary fragend an.
»Ich glaube, Sie müssen unter Wasser ausatmen«, erklärte sie. »Und nach jedem vierten Stoß drehen Sie den Kopf nach oben, um Luft zu holen.«
»Das richtige Atmen fällt mir am allerschwersten. Wollen wir aufs Floß?«
Der Mann mit der Löwenmähne lag ausgestreckt auf dem Floß, das mit der Bewegung des Wassers auf und nieder schaukelte. Als Mrs McKisco danach griff, neigte sich das Floß plötzlich nach der anderen Seite und riss ihren Arm hart nach oben, worauf der Mann aufstand und sie an Bord zog.
»Ich dachte schon, Sie hätten sich wehgetan.« Er sprach langsam und schüchtern. Sein Gesicht war eins der traurigsten, die Rosemary je gesehen hatte, mit hohen Wangenknochen wie ein Indianer, einer langen Oberlippe und großen, tief liegenden, dunkel goldbraunen Augen. Er sprach aus dem Mundwinkel heraus, als hoffe er, seine Worte würden auf Umwegen unaufdringlich zu Mrs McKisco gelangen. Einen Augenblick später stieß er sich vom Floß ab, und sein langer Körper strebte ohne eine weitere Bewegung dem Strand zu.
Rosemary und Mrs McKisco beobachteten ihn. Als sein Schwung nachließ, drehte er sich mit einem Mal um sich selbst; seine dünnen Oberschenkel ragten aus dem Wasser, dann verschwand er ganz und gar und ließ höchstens etwas Schaum zurück.
»Er ist ein guter Schwimmer«, sagte Rosemary.
Mrs McKiscos Antwort kam mit erstaunlicher Heftigkeit.
»Das schon, aber ein erbärmlicher Musiker.« Sie wandte sich an ihren Mann, dem es nach zwei erfolglosen Versuchen gelungen war, auf das Floß zu klettern, und der, nachdem er das Gleichgewicht wiedererlangt hatte, zum Ausgleich eine besondere Bewegung machen wollte und dabei nur neuerlich ins Straucheln geriet. »Ich sagte gerade, dass Abe North zwar ein guter Schwimmer, aber ein schlechter Musiker sei.«
»Ja«, pflichtete McKisco widerwillig bei. Offenbar hatte er die Welt seiner Frau geschaffen und gestattete ihr wenig Freiheit darin.
»Antheil ist ein Mann nach meinem Geschmack.« Mrs McKisco kehrte sich herausfordernd Rosemary zu. »Antheil und Joyce. Ich nehme an, Sie werden in Hollywood nicht viel von solchen Leuten hören; aber mein Mann hat über den ›Ulysses‹ die erste Kritik geschrieben, die in Amerika erschienen ist.«
»Ich wünschte, ich hätte eine Zigarette«, sagte McKisco ruhig. »Das ist mir im Moment wichtiger.«
»Er hat etwas – das findest du doch auch, Albert?«
Ihre Stimme erstarb plötzlich. Die Dame mit den Perlen hatte sich zu ihren Kindern im Wasser gesellt, und nun tauchte Abe North unter einem von ihnen auf wie eine vulkanische Insel und hob es auf seine Schultern. Das Kind kreischte vor Schreck und Begeisterung, und die Dame sah mit lieblicher Seelenruhe zu, ohne zu lächeln.
»Ist das seine Frau?«, fragte Rosemary.
»Nein, das ist Mrs Diver. Sie wohnen nicht im Hotel.« Ihre Augen blieben unlösbar an dem Gesicht der Dame haften. Nach einer Weile wandte sie sich ungestüm an Rosemary.
»Waren Sie schon früher im Ausland?«
»Ja – ich bin in Paris zur Schule gegangen.«
»Also – dann werden Sie wahrscheinlich auch wissen, dass man unbedingt ein paar waschechte französische Familien kennenlernen muss, um sich hier zu amüsieren. Was haben die Leute davon?« Sie wies mit der linken Schulter nach dem Strand. »Sie bilden kleine Cliquen miteinander. Wir hatten natürlich Empfehlungsschreiben und haben die bedeutendsten französischen Künstler und Schriftsteller kennengelernt. Dadurch hatten wir es sehr hübsch.«
»Das glaube ich.«
»Mein Mann beendet nämlich gerade seinen ersten Roman.«
Rosemary meinte: »Ach, wirklich?« Sie dachte an nichts Besonderes, außer dass sie gern gewusst hätte, ob ihre Mutter bei der Hitze wohl schlafen könne.
»Er geht vom selben Gedanken aus wie ›Ulysses‹«, fuhr Mrs McKisco fort. »Nur statt vierundzwanzig Stunden nimmt mein Mann hundert Jahre. Er schildert einen alten, dekadenten französischen Aristokraten und bringt ihn in Gegensatz zum mechanisierten Zeitalter –«
»Um Himmels willen, Violet, erzähl doch nicht jedem Menschen die Idee«, protestierte McKisco. »Ich will nicht, dass sie überall bekannt ist, bevor das Buch erscheint.«
Rosemary schwamm zum Strand zurück, wo sie sich den Badeumhang über ihre bereits schmerzenden Schultern zog, und legte sich wieder in die Sonne. Der Mann mit der Jockeymütze ging jetzt von Schirm zu Schirm; er trug eine Flasche und kleine Gläser in den Händen, und sofort wurden er und seine Freunde lebhafter, rückten näher zusammen, und im Nu befanden sie sich unter einem Dach von aneinandergestellten Schirmen – sie schloss daraus, dass jemand wegfahren würde und dass dies ein Abschiedsdrink am Strand sei. Selbst die Kinder merkten, dass unter dem Schirmdach lebhaftes Treiben herrschte, und näherten sich ihm – und Rosemary schien es, als ginge alles von dem Mann mit der Jockeymütze aus.
Die Mittagsstunde beherrschte Meer und Himmel – sogar der fünf Meilen entfernte weiße Strich von Cannes wurde zu einer Luftspiegelung dessen, was vorher frisch und kühl gewesen war; ein hereinkommendes rotbauchiges Segelboot hinterließ eine Kiellinie, hinter der die offene dunklere See lag. An der Küste, in ihrer ganzen Ausdehnung, schien kein Leben vorhanden, ausgenommen in dem gedämpften Sonnenlicht unter den Schirmen, wo es, inmitten der Farben und des Stimmengewirrs, hoch herging.
Campion kam auf sie zu, blieb ein paar Schritte von ihr entfernt stehen, und Rosemary schloss die Augen und tat, als ob sie schliefe; dann öffnete sie sie halb und beobachtete zwei dunkle, verschwommene Säulen, die Beine waren. Der Mann versuchte, sich einen Weg durch eine sandfarbene Wolke zu bahnen, aber die Wolke schwebte davon, in den weiten, heißen Himmel hinein. Rosemary schlief wirklich ein.
Sie erwachte in Schweiß gebadet und fand den Strand öde und verlassen bis auf den Mann mit der Jockeymütze, der den letzten Strandschirm zusammenklappte. Als er Rosemary blinzeln sah, kam er näher und sagte:
»Ich hätte Sie geweckt, bevor ich weggegangen wäre. Es tut nicht gut, sich gleich zu sehr verbrennen zu lassen.«
»Danke.« Rosemary sah an ihren roten Beinen herunter. »Du lieber Himmel!«
Sie lachte fröhlich, als Aufforderung zu einem Gespräch; aber Dick Diver schleppte bereits ein Zelt und einen Strandschirm zu dem wartenden Wagen hinauf, und so ging sie ins Wasser, um den Schweiß abzuspülen. Er kam zurück, suchte einen Rechen, eine Schaufel und ein Sieb zusammen und verstaute sie in einer Felsspalte. Er blickte den Strand entlang, um zu sehen, ob er etwas vergessen hätte.
»Wissen Sie, wie viel Uhr es ist?«, fragte Rosemary.
»Ungefähr halb zwei.«
Gemeinsam betrachteten sie die Landschaft.
»Es ist keine schlechte Zeit«, sagte Dick Diver. »Es ist nicht die schlechteste Zeit des Tages.«
Er blickte sie an, und eine Sekunde lebte sie in der strahlend blauen Welt seiner Augen, verlangend und zuversichtlich. Dann nahm er das letzte Stück der liegengebliebenen Sachen auf die Schulter und ging zu seinem Wagen, und Rosemary kam aus dem Wasser, schüttelte ihren Badeumhang aus und ging zum Hotel hinauf.
III
Es war fast zwei, als sie in den Speisesaal gingen. Über die verlassenen Tische huschte ein scharf geprägtes Muster von Licht und Schatten hin und her, der Bewegung der Pinien draußen folgend. Zwei Kellner, die Teller aufeinanderstapelten und laut italienisch miteinander redeten, verstummten, als sie hineinkamen, und brachten ihnen die dürftigen Überreste des Table-d’hôte-Lunchs.
»Ich habe mich am Strand verliebt«, sagte Rosemary.
»In wen?«
»Zuerst in eine ganze Menge Leute, die nett aussahen. Dann in einen Mann.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«
»Nur ein paar Worte. Sieht sehr gut aus. Hat rötliches Haar.« Sie aß mit Heißhunger. »Aber er ist verheiratet – immer dieselbe Geschichte.«
Ihre Mutter war ihre beste Freundin und hatte alles bis zum Letzten in ihre Ausbildung gesteckt – nichts Seltenes im Schauspielerberuf, in diesem Fall aber etwas Besonderes, weil Mrs Elsie Speers dadurch kein eigenes Scheitern aufzuwiegen versuchte. Dem Leben gegenüber kannte sie weder Bitterkeit noch Groll; zweimal zufrieden verheiratet und zweimal verwitwet hatte sich ihr heiterer Gleichmut mit jedem Mal verstärkt. Ihr erster Mann, Rosemarys Vater, war Militärarzt gewesen, der zweite Kavallerieoffizier; beide hatten ihr etwas vererbt, und sie war bestrebt, es Rosemary unangetastet zugutekommen zu lassen. Dadurch, dass sie Rosemary nicht geschont hatte, war diese hart geworden – dadurch, dass sie selbst keine Arbeit und keine Mühe gescheut hatte, war in Rosemary eine Schwärmerei großgezogen worden, die sich gegenwärtig ganz auf ihre Mutter konzentrierte, sodass sie die Welt mit deren Augen betrachtete. Wenngleich also Rosemary noch ganz kindlich war, hatte sie doch einen doppelten Schutz: die Rüstung ihrer Mutter und ihre eigene – sie hatte ein durchaus erwachsenes Misstrauen gegen alles Triviale, Oberflächliche und Gewöhnliche. Mrs Speers jedoch fühlte nach Rosemarys plötzlichem Filmerfolg, dass es Zeit sei, sie seelisch zu entwöhnen; ja, es hätte sie weniger geschmerzt als gefreut, wenn diese etwas übertriebene, atemraubende und aggressive Schwärmerei sich außer auf sie noch auf ein anderes Objekt gerichtet hätte.
»Demnach gefällt es dir hier?«, fragte sie.
»Es könnte lustig sein, wenn wir die Leute kennen würden. Es waren auch noch andere da, aber sie waren nicht sympathisch. Sie haben mich erkannt – wir können hinfahren, wohin wir wollen, jeder hat ›Daddy’s Girl‹ gesehen.«
Mrs Speers wartete, bis sich die Woge der Selbstgefälligkeit gelegt hatte, dann sagte sie in sachlichem Ton: »Übrigens – wann wirst du Earl Brady besuchen?«
»Ich dachte, wir könnten heute Nachmittag hin, wenn du ausgeruht bist.«
»Geh du allein – ich komme nicht mit.«
»Dann warten wir eben bis morgen.«
»Ich möchte, dass du allein hingehst. Es ist doch nicht so weit – und schließlich sprichst du ja französisch.«
»Mutter – gibt’s nicht irgendetwas, was ich nicht tun muss?«
»Nun gut, dann geh ein andermal, aber noch bevor wir fortfahren.«
»Gut, Mutter.«
Nach dem Lunch wurden sie beide von der plötzlichen Langeweile gepackt, wie sie amerikanische Reisende an stillen ausländischen Orten überfällt. Keine Anregung war vorhanden, keine Stimmen riefen von draußen nach ihnen, keine Bruchstücke ihrer eigenen Gedanken sprangen ihnen plötzlich aus den Köpfen anderer entgegen, und da sie den Trubel des Weltreichs vermissten, kam es ihnen vor, als stünde das Leben hier still.
»Wir wollen nur drei Tage hierbleiben, Mutter«, sagte Rosemary, als sie wieder in ihren Zimmern waren. Draußen wirbelte ein leichter Wind die Hitze umher, drängte sie zwischen die Bäume und sandte kleine heiße Böen durch die Jalousien.
»Und was ist mit dem Mann, in den du dich am Strand verliebt hast?«
»Ich liebe nur dich allein, Mutter.«
Rosemary begab sich in die Halle und sprach mit Gausse Père über Züge. Der Portier, der in hellbrauner Khakiuniform hinter seinem Tisch faulenzte, starrte sie unbeweglich an, dann plötzlich besann er sich darauf, was seinem Beruf zukam. Begleitet von zwei unterwürfigen Kellnern fuhr sie mit dem Bus zum Bahnhof. Ihr ehrerbietiges Schweigen irritierte sie, und sie hätte ihnen am liebsten gesagt: »Reden Sie doch, amüsieren Sie sich. Es stört mich nicht.«
In dem Erster-Klasse-Abteil war es erstickend heiß; die lebhaften Reklamebilder der Eisenbahngesellschaften – der Pont du Gard in Arles, das Amphitheater in Orange, Wintersport in Chamonix – wirkten frischer als das weite, unbewegte Meer draußen. Im Gegensatz zu amerikanischen Zügen, die von ihrer eigenen unbedingten Notwendigkeit durchdrungen sind und Leute aus einer anderen, weniger schnellen und atemlosen Welt verachten, war dieser Zug ein Bestandteil des Landes, durch das er fuhr. Sein Luftzug wehte den Staub von den Palmblättern, die Kohlenasche vereinigte sich mit dem getrockneten Mist in den Gärten. Rosemary hatte den Eindruck, sie könne sich aus dem Fenster lehnen und Blumen pflücken.
Vor dem Bahnhof in Cannes schliefen ein Dutzend Droschkenkutscher in ihren Wagen. Gegenüber auf der Promenade kehrten das Kasino, die eleganten Läden und die großen Hotels dem sommerlichen Meer blinde, eiserne Masken zu. Es war unvorstellbar, dass hier jemals eine Saison gewesen sein sollte, und Rosemary, die etwas auf Mode hielt, war plötzlich verunsichert, ob darin, dass sie sich außerhalb der Saison hier aufhielt, etwas Unzeitgemäßes lag. Als würden sich die Leute darüber Gedanken machen, warum sie in der Ruhepause zwischen der Fröhlichkeit des vorigen und des nächsten Winters hier war, während oben im Norden das Leben dahinbrauste.
Als sie mit einem Fläschchen Kokosnussöl aus einer Drogerie kam, kreuzte eine Frau ihren Weg, in der sie Mrs Diver wiedererkannte; sie hatte die Arme voller Sofakissen und ging zu einem Wagen, der am Ende der Straße parkte. Ein langer, kurzbeiniger schwarzer Hund bellte sie an, ein Chauffeur, der eingenickt war, fuhr hoch. Sie saß im Wagen, ihr liebliches Gesicht unbeweglich und beherrscht, ihre schönen Augen blickten aufmerksam geradeaus ohne festes Ziel. Ihr Kleid war leuchtend rot, und ihre braunen Beine waren ohne Strümpfe. Sie hatte dichtes, dunkles, goldenes Haar wie ein Chow-Chow.
Da Rosemary eine halbe Stunde auf ihren Zug warten musste, setzte sie sich ins Café des Alliés auf der Croisette, wo die Bäume ein grünes Zwielicht auf die Tische zauberten und eine Kapelle ein imaginäres Publikum von Kosmopoliten mit dem Nizza-Karnevalslied und den amerikanischen Songs des Vorjahrs umwarb. Sie hatte Le Temps und The Saturday Evening Post für ihre Mutter gekauft, und während sie ihre Citronnade trank, öffnete sie das amerikanische Blatt bei den Memoiren einer russischen Prinzessin und fand die unklaren gesellschaftlichen Konventionen der Neunzigerjahre wirklicher und lebensnaher als die Schlagzeilen des französischen Blattes. Es war das gleiche Gefühl, das sie im Hotel bedrückt hatte. Gewohnt, die ausgefallensten Wunderlichkeiten eines Erdteils, aufbereitet als Komödie oder Tragödie zu betrachten, und ungeübt in der Kunst, das Wesentliche für sich herauszuschälen, begann sie jetzt, das französische Leben schal und leer zu finden. Dieses Gefühl verstärkte sich noch, als sie den traurigen Melodien der Kapelle lauschte, die an die melancholische Musik bei akrobatischen Darbietungen in Vaudevilles erinnerte. Sie war froh, als sie wieder in Gausses Hotel war.
Ihre Schultern waren zu verbrannt, als dass sie am nächsten Tag hätte schwimmen können. So mieteten sie und ihre Mutter einen Wagen – nach vielem Feilschen, denn Rosemary hatte die Bewertung des Geldes in Frankreich gelernt – und fuhren an der Riviera, dem Mündungsgebiet vieler Flüsse, entlang. Der Chauffeur, ein russischer Zar aus der Zeit Iwans des Schrecklichen, hatte eigenmächtig die Führung übernommen, und die schillernden Namen – Cannes, Nizza, Monte Carlo – begannen aus ihrer trägen Verschleierung hervorzuleuchten und erzählten flüsternd von alten Königen, die hergekommen waren, um zu schmausen oder zu sterben, von Maharadschas, die englischen Tänzerinnen Edelsteine aus Buddhastatuen zuwarfen, und von russischen Großfürsten, die in den entschwundenen Zeiten des Kaviars ihren Aufenthalt im Süden in nordisch helle Nächte verwandelten. Am offensichtlichsten war an der Küste die Spur der Russen zurückgeblieben: ihre geschlossenen Buchläden und Lebensmittelgeschäfte. Zehn Jahre zuvor, als im April die Saison zu Ende ging, wurden die Türen ihrer orthodoxen Kirche abgeschlossen, und der süße Champagner, den sie liebten, wurde für ihre Rückkehr aufbewahrt. »Wir kommen nächste Saison wieder«, sagten sie voreilig, denn sie kamen nie mehr zurück.
Es war hübsch, am späten Nachmittag zum Hotel zurückzufahren, hoch über einem Meer, das geheimnisvoll getönt war wie die Achate und Karneole der Kindheit: milchig grün-weiß, bläulich wie Waschwasser, dunkel wie Wein. Es war hübsch, an den Menschen, die vor ihren Häusern speisten, vorbeizufahren und den wilden Klängen der mechanischen Klaviere hinter den Weinstöcken der ländlichen Gasthäuser zu lauschen. Als sie von der Corniche d’Or abbogen und auf Gausses Hotel zufuhren, durch dämmrige Gruppen von Bäumen, deren Grün sich in vielen Schattierungen voneinander abhob, schwebte der Mond bereits über dem Gemäuer des Aquädukts.
Irgendwo in den Bergen hinter dem Hotel fand ein Tanz statt, und Rosemary lauschte der Musik in dem gespenstischen Mondlicht unter ihrem Moskitonetz, sie erkannte, dass irgendwo hier auch Fröhlichkeit herrschte, und dachte an die netten Leute am Strand. Vielleicht würde sie sie am Vormittag treffen; aber anscheinend bildeten sie eine kleine Gesellschaft für sich, und wenn sie erst einmal ihre Bambusmatten, Hunde und Kinder platziert hatten, war dieser Teil des Strandes buchstäblich eingezäunt. Rosemary fasste auf alle Fälle den Entschluss, ihre letzten beiden Vormittage nicht mit der anderen Gruppe zu verbringen.
IV
Die Angelegenheit wurde ohne ihr Zutun entschieden. Das Ehepaar McKisco war noch nicht da, und kaum hatte sie ihren Badeumhang ausgebreitet, als zwei Männer, der mit der Jockeymütze und der große Blonde – der Vergnügen darin fand, Kellner in zwei Hälften zu zersägen –, die Gruppe verließen und auf sie zukamen.
»Guten Morgen«, sagte Dick Diver. Er ließ sich nieder. »Hören Sie – Sonnenbrand hin, Sonnenbrand her, warum sind Sie gestern weggeblieben? Wir haben uns Sorgen um Sie gemacht.«
Sie setzte sich auf, und ihr glückliches kleines Lachen hieß die Eindringlinge willkommen.
»Wir möchten gern«, sagte Dick Diver, »dass Sie heute Vormittag zu uns kommen. Wir gehen hinüber und essen und trinken etwas, es ist also eine gehaltvolle Einladung.«
Er schien freundlich und bezaubernd zu sein – seine Stimme klang, als wenn er sich für sie interessierte, als wenn er ihr künftig ganz neue Welten eröffnen und eine endlose Reihe von Möglichkeiten vor ihr aufrollen würde. Bei der Vorstellung vermied er es geschickt, ihren Namen zu erwähnen, und gab ihr dann beiläufig zu erkennen, dass alle wussten, wer sie war, jedoch die Unantastbarkeit ihres Privatlebens respektierten – eine Rücksicht, der sie seit ihrem Erfolg lediglich bei Berufskollegen begegnet war.
Nicole Diver, deren Perlen über ihren braunen Rücken hingen, suchte in einem Kochbuch nach Hühnchen auf Maryland-Art. Sie war etwa vierundzwanzig Jahre alt, schätzte Rosemary; ihr Gesicht hätte landläufig als hübsch bezeichnet werden können, aber es erweckte den Eindruck, als wäre es zunächst in heroischer Manier – stark in Struktur und Zeichnung – angelegt worden, als wären die Züge und die Lebendigkeit des Ausdrucks und der Tönung, alles was sich für uns mit Temperament und Charakter verbindet, in Anlehnung an Rodin geformt und dann mit dem Meißel auf Hübschheit hin bearbeitet worden, bis zu einem Punkt, wo ein einziges Abgleiten des Stahles die Kraft und den Wert des Ausdrucks unwiederbringlich verkleinert hätte. Mit dem Mund war der Bildhauer etwas gewagt verfahren: es war der Amorbogen vom Titelblatt eines Magazins, und dennoch hatte der Mund teil an der Würde des Ganzen.
»Bleiben Sie lange hier?«, fragte Nicole. Ihre Stimme war tief, beinahe harsch.
Plötzlich spielte Rosemary mit dem Gedanken, dass sie eine Woche länger bleiben könnten.
»Nicht sehr lange«, entgegnete sie unbestimmt. »Wir sind schon ewig im Ausland – im März sind wir auf Sizilien gelandet und langsam nach Norden gereist. Ich hatte mir im Januar beim Filmen eine Lungenentzündung zugezogen und musste mich erholen.«
»Meine Güte! Wie ist das geschehen?«
»Ach, beim Schwimmen.« Rosemary ließ sich nur widerstrebend auf persönliche Enthüllungen ein. »Eines Tages hatte ich Grippe, ohne es zu wissen, und es wurde eine Szene gedreht, in der ich in einen Kanal in Venedig springen musste. Es war eine sehr kostspielige Aufnahme, darum musste ich den ganzen Vormittag tauchen, tauchen und wieder tauchen. Mutter hatte einen Arzt dabei, aber es half nichts – ich bekam eine Lungenentzündung.« Entschlossen wechselte sie das Thema, bevor die anderen etwas sagen konnten. »Gefällt es Ihnen hier – ich meine, an diesem Ort?«
»Es muss ihnen gefallen«, sagte Abe North gemächlich. »Sie haben ihn erfunden.« Langsam drehte er seinen vornehmen Kopf, sodass seine Augen voll Zärtlichkeit und Liebe auf den Divers ruhten.
»Ach, wirklich?«
»Es ist erst das zweite Mal, dass das Hotel im Sommer geöffnet ist«, erklärte Nicole. »Wir haben Gausse überredet, einen Koch, einen Kellner und einen Bediensteten zu behalten – es hat sich bezahlt gemacht, und in diesem Jahr geht es noch besser.«
»Aber Sie wohnen nicht im Hotel?«
»Wir haben ein Haus gebaut, oben in Tarmes.«
»Die Sache liegt so«, sagte Dick, indem er einen Schirm anders stellte, um einen Sonnenfleck von Rosemarys Schulter zu beseitigen, »dass sich die Russen und Engländer, alle, denen die Kälte nichts ausmacht, Badeorte im Norden, wie zum Beispiel Deauville, ausgesucht haben, wogegen die Hälfte aller Amerikaner aus tropischen Gegenden stammt – darum haben wir angefangen hierherzukommen.«
Der junge Mann von südländischem Typ hatte im New York Herald geblättert.
»Was für Landsleute sind das wohl?«, fragte er unvermittelt und las in leicht französischem Tonfall vor: »›Im Palast-Hotel in Vevey trugen sich ein: Mr Pandely Vlasco, Mme Bonneasse‹ – ich übertreibe nicht – ›Corinna Medonca, Mme Pasche, Seraphim Tullio, Maria Amalia Roto Mais, Moises Teubel, Mme Paragoris, Apostle Alexandre, Yolanda Yosfuglu und Genoveva de Momus!‹ Die reizt mich am meisten – Genoveva de Momus. Es würde sich fast lohnen, nach Vevey zu fahren, um Genoveva de Momus in Augenschein zu nehmen.«
In plötzlicher Ruhelosigkeit stand er auf und streckte sich mit einer einzigen ruckartigen Bewegung. Er war einige Jahre jünger als Diver oder North. Er war groß, sein Körper sehnig und übermäßig mager bis auf die geballte Kraft in seinen Schultern und Oberarmen. Auf den ersten Blick schien er in landläufigem Sinn schön – aber sein Gesicht zeigte dauernd einen Anflug von Ekel, der den vollen feurigen Glanz seiner braunen Augen beeinträchtigte. Und doch erinnerte man sich ihrer später, wenn man die Unfähigkeit des Mundes, Langeweile zu ertragen, und die junge Stirn mit ihren gereizten, nutzlosen Sorgenfalten vergessen hatte.
»Wir haben vorige Woche ein paar feine Namen von Amerikanern in der Zeitung gefunden«, sagte Nicole. »Mrs Evelyn Oyster und – wie hießen die anderen noch?«
»Da war Mr S. Flesh«, sagte Diver und erhob sich ebenfalls. Er nahm den Rechen zur Hand und ging mit ernstem Gesicht daran, kleine Steine aus dem Sand zu entfernen.
»Richtig – S. Flesh – da kriegt man doch direkt eine Gänsehaut!«
Mit Nicole allein war es geruhsam – Rosemary fand es sogar geruhsamer als mit ihrer Mutter. Abe North und Barban, der Franzose, unterhielten sich über Marokko, und Nicole nahm, nachdem sie das Rezept abgeschrieben hatte, eine Näharbeit zur Hand. Rosemary betrachtete prüfend ihre »Einrichtung« – vier große Sonnenschirme, die ein schattiges Dach bildeten, ein transportables Badehaus zum Umziehen, ein mit Luft gefülltes Gummipferd, neuartige Dinge, wie Rosemary sie noch nie gesehen hatte, die ersten Auswüchse der Luxusindustrie nach dem Krieg und wahrscheinlich im Besitz der ersten Käufer. Sie hatte den Eindruck gewonnen, es mit mondänen Leuten zu tun zu haben, aber obwohl ihre Mutter ihr beigebracht hatte, solche Menschen als Drohnen zu betrachten, hatte sie hier dieses Gefühl nicht. Selbst in ihrer völligen Bewegungslosigkeit, die der Morgenstille glich, spürte sie einen Zweck, ein Beschäftigtsein, eine innere Einstellung, eine schöpferische Tat, anders als alles, was sie bisher kennengelernt hatte. Ihr noch kindliches Gemüt stellte keine Mutmaßungen über die Natur ihrer gegenseitigen Beziehungen an, sie interessierte sich nur für ihr Verhalten ihr selbst gegenüber – aber sie spürte die Fäden einer angenehmen Verflechtung und fasste das in dem Gedanken zusammen, dass sie sich sehr gut zu amüsieren schienen.
Sie sah sich die drei Männer der Reihe nach an und ergriff sozusagen Besitz von ihnen. Alle drei waren, jeder in seiner Art, von angenehmem Äußeren; alle waren von besonderer Liebenswürdigkeit, die ein Teil ihres Lebens, des vergangenen und zukünftigen, war und durchaus nicht durch irgendwelche äußeren Umstände hervorgerufen wurde, so gar nicht wie die Umgangsformen der Schauspieler, und außerdem stellte sie ein weitgehendes Taktgefühl fest, das sich von der ungehobelten Kameradschaftlichkeit der Regisseure unterschied, die in ihrem Leben die Intellektuellen darstellten. Schauspieler und Regisseure – das waren die einzigen Männer, die sie kennengelernt hatte, außer der heterogenen, zusammengewürfelten Masse der Studenten, die sich nur für Liebe auf den ersten Blick interessierten und denen sie im vorigen Herbst auf dem Ball in Yale begegnet war.
Diese drei waren anders. Barban war weniger kultiviert, skeptischer und spöttisch, seine Manieren waren förmlich, fast schablonenhaft. Abe North besaß neben seiner Schüchternheit einen trockenen Humor, der sie belustigte, aber auch verwirrte. Wegen ihrer ernsthaften Natur glaubte sie, keinen starken Eindruck auf ihn machen zu können.
Dick Diver jedoch – war einfach vollkommen. Im Stillen bewunderte sie ihn. Seine Hautfarbe war rötlich, vom Wetter gegerbt, und rötlich war auch das Haar, das in einem feinen Flaum auf seinen Armen und Händen wuchs. Seine Augen waren von einem strahlenden, harten Blau, seine Nase war ziemlich spitz, und man war niemals im Zweifel darüber, wen er ansah oder mit wem er sprach – und das ist eine sehr angenehme Eigenschaft, denn wer sieht uns schon richtig an? Blicke, neugierige oder gleichgültige, streifen uns, nichts weiter. Seine Stimme, in der ein schwacher irischer Akzent mitklang, war einschmeichelnd, und dennoch spürte Rosemary Züge von Härte in ihm, von Beherrschtheit und Selbstdisziplin, die auch ihre Tugenden waren. Ja, sie wählte ihn, und Nicole, die ihren Kopf hob, sah, dass sie ihn wählte, und hörte den kleinen Seufzer darüber, dass er bereits vergeben war.
Gegen Mittag kamen die beiden McKiscos, Mrs Abrams, Mr Dumphry und Signor Campion an den Strand. Sie hatten einen neuen Schirm mitgebracht, den sie mit Seitenblicken auf die Divers aufstellten und unter dem sie sich mit zufriedenen Mienen niederließen – außer Mr McKisco, der mit spöttischem Gesicht draußen blieb. Beim Harken war Dick nahe bei ihnen vorbeigekommen und kehrte nun zu seinen Schirmen zurück.
»Die beiden jungen Männer lesen zusammen im ›Buch des guten Tones‹«, sagte er leise.
»Beabsichtigen wohl, mit der vornehmen Welt zu verkehren«, sagte Abe.
Mary North, die braun gebrannte junge Frau, der Rosemary am ersten Tag auf dem Floß begegnet war, kam vom Schwimmen zurück und sagte mit einem Lächeln, das wie ein verwegener Lichtstrahl war:
»Also sind Mr und Mrs Unverzagt angekommen?«
»Es sind die Freunde dieses Mannes«, ermahnte Nicole sie, auf Abe zeigend. »Warum geht er nicht hin und spricht mit ihnen? Sie sind doch anziehend, findest du nicht?«
»Ich finde, sie sind sehr anziehend«, stimmte Abe zu. »Ich finde nur eben nicht, dass sie anziehend sind, das ist alles.«
»Na, ich bin schon lange der Ansicht, dass diesen Sommer zu viele Leute am Strand sind«, gestand Nicole. »An unserem Strand, den Dick aus einem Kieselhaufen erschaffen hat.« Sie blickte sich um, dann dämpfte sie die Stimme, sodass das Kinderwärterinnen-Trio, das hinter ihnen unter einem anderen Schirm saß, sie nicht hören konnte. »Und doch sind sie erträglicher als die Engländer vom vorigen Sommer, die andauernd riefen: ›Ach, wie blau ist das Meer! Wie weiß ist der Himmel! Wie rot ist Klein-Nellies Nase!‹«
Rosemary dachte, dass sie Nicole nicht zur Feindin hätte haben mögen.
»Sie haben die Balgerei nicht gesehen«, fuhr Nicole fort. »Am Tag, bevor Sie ankamen, hat der verheiratete Mann, der so heißt wie ein Benzin- oder Butterersatz –«
»McKisco?«
»Ja – also sie zankten sich, und sie warf ihm Sand ins Gesicht. Natürlich saß er sofort auf ihr und drückte ihr Gesicht in den Sand. Wir waren wie elektrisiert. Ich wollte, dass Dick sich einmischte.«
»Ich denke«, sagte Dick Diver und starrte geistesabwesend auf die Strohmatte, »ich gehe hinüber und lade sie zum Dinner ein.«
»Nein, das wirst du nicht tun«, sagte Nicole schnell.
»Ich glaube, es wäre eine feine Sache. Sie sind nun einmal hier – wir wollen mit den Wölfen heulen.«
»Wir heulen doch ganz hübsch«, beharrte sie lachend. »Ich werde mich nicht mit der Nase in den Sand drücken lassen. Ich bin eine unangenehme, schwierige Frau«, erklärte sie Rosemary, dann erhob sie die Stimme: »Kinder, zieht die Badeanzüge an!«
Rosemary ahnte, dass dieses Schwimmen etwas Typisches in ihrem Leben bedeuten, dass es immer in ihrer Erinnerung auftauchen würde, wenn man vom Schwimmen spräche. Die ganze Gesellschaft begab sich gleichzeitig ins Wasser, übereifrig, nach der langen, erzwungenen Untätigkeit aus der Hitze in die Kühle hinüberzuwechseln, und mit der Genüsslichkeit, mit der man zu einem scharfen Currygericht kalten Weißwein trinkt. Die Tage der Divers verliefen so wie die früherer Zivilisationen, indem man aus dem Gegebenen so viel wie möglich herausholte und alle Übergänge richtig auskostete, und Rosemary wusste nicht, dass sogleich ein neuer Übergang stattfinden würde, nämlich von der völligen Hingabe an das Schwimmen zu der Geschwätzigkeit des provenzalischen Mittagessens. Aber wieder hatte sie das Gefühl, als ob Dick sich für sie interessierte, und voller Entzücken ging sie auf die zufällige Regung ein, als wäre sie ein Befehl gewesen.
Nicole reichte ihrem Mann das merkwürdige Kleidungsstück, an dem sie gearbeitet hatte. Er ging in das Umkleidezelt und erregte Aufsehen, als er kurz darauf in durchbrochenen schwarzen Spitzenbadehosen erschien. Bei näherer Betrachtung stellte es sich allerdings heraus, dass sie mit fleischfarbenem Stoff unterlegt waren.
»Was ist denn das für ’ne Tuntenmode!«, stieß McKisco verächtlich hervor – dann drehte er sich hastig zu Mr Dumphry und Mr Campion um und fügte hinzu: »Bitte um Entschuldigung!«
Rosemary gluckste vor Vergnügen über die Badehose. In ihrer Naivität stimmte sie der kostspieligen Einfachheit der Divers aus vollem Herzen zu, ohne deren Kompliziertheit und den Mangel an Unschuld zu bemerken, ohne zu wissen, dass es sich für diese Leute beim Ansturm auf das Warenhaus Welt lediglich um Qualität, nicht um Quantität handelte; und ebenso, dass die Einfachheit des Benehmens, der kindliche Friede und das Wohlwollen sowie die Betonung der schlichten Tugenden nur Teil eines verzweifelten Abkommens mit den Göttern darstellten und nur mithilfe von Kämpfen erreicht worden waren, von denen sie nichts ahnen konnte. Zu dieser Zeit repräsentierten die Divers äußerlich die höchste Entwicklungsstufe einer Klasse, sodass die meisten anderen Menschen gegen sie abfielen – in Wahrheit hatte bereits eine innere Wandlung eingesetzt, die für Rosemary völlig unsichtbar blieb.
Sie stand bei ihnen, während sie Sherry tranken und Kekse aßen. Dick Diver sah sie mit seinen kalten blauen Augen prüfend an; sein freundlicher, starker Mund sprach nachdenklich und bedächtig:
»Sie sind seit langer Zeit das erste Mädchen, das wirklich etwas von einer Blüte an sich hat.«
Später verbarg Rosemary das Gesicht im Schoß ihrer Mutter und weinte.
»Ich liebe ihn, Mutter. Ich bin irrsinnig in ihn verliebt – ich habe gar nicht gewusst, dass ich so für jemand empfinden könnte. Und er ist verheiratet, und sie liebe ich auch – es ist einfach hoffnungslos. Oh, wie ich ihn liebe!«
»Ich bin gespannt darauf, ihn kennenzulernen.«
»Sie hat uns zum Dinner am Freitag eingeladen.«
»Wenn du verliebt bist, müsste dich das glücklich machen. Du müsstest lachen.«
Rosemary blickte auf, ein winziges, schönes Zittern lief über ihr Gesicht, und sie lachte. Ihre Mutter hatte von jeher großen Einfluss auf sie gehabt.
V
Rosemary machte sich auf den Weg nach Monte Carlo, so schmollend, wie sie es überhaupt zuwege brachte. Sie fuhr den holprigen Berg nach La Turbie hinauf zu einem alten Gaumont-Studio, das sich im Stadium des Wiederaufbaus befand, und als sie vor dem Gittertor stand und den Bescheid auf ihre hineingeschickte Visitenkarte erwartete, war es, als sähe sie Hollywood. Sie erblickte die bizarren Überreste eines kürzlich gedrehten Filmes, eine verfallene Straßenszene in Indien, einen großen Walfisch aus Pappe, einen ungeheuren Baum mit Kirschen, groß wie Basketbälle, der, der exotischen Ordnung folgend, dort wuchs und ebenso heimisch war wie der blasse Amarant, die Mimosen, die Korkeiche oder die Zwergpinie. Eine Schnellimbissbude und zwei scheunenähnliche Bühnen befanden sich da und, auf dem ganzen Gelände verstreut, Gruppen von wartenden, hoffnungsvollen, geschminkten Gesichtern.
Nach zehn Minuten kam ein junger Mann, dessen Haarfarbe dem Gefieder eines Kanarienvogels glich, eilig zum Tor gelaufen.
»Treten Sie näher, Miss Hoyt. Mr Brady ist gerade bei der Aufnahme, doch will er Sie unbedingt sehen. Es tut mir leid, dass Sie haben warten müssen, aber Sie wissen ja, wie manche französischen Dämchen es verstehen, sich hereinzuschmuggeln –«
Der Studioleiter öffnete eine kleine Tür in der glatten Wand des Aufnahmegebäudes, und Rosemary folgte ihm mit plötzlicher glücklicher Vertrautheit in das Halbdunkel. Hier und da hoben sich Gestalten aus dem Dämmerlicht ab, richteten sich aschgraue Gesichter zu ihr empor, wie arme Seelen im Fegefeuer, die einen Sterblichen vorübergehen sehen. Geflüster und leise Stimmen waren zu vernehmen und, anscheinend aus weiter Ferne, das sanfte Tremolo einer kleinen Orgel. Als sie die von einigen Häuserkulissen gebildete Ecke umschritten, gelangten sie in die weiße, knisternde Glut einer Bühne, auf der sich ein französischer Schauspieler – mit leuchtend rosafarbener Hemdbrust, Kragen und Manschetten – und eine amerikanische Schauspielerin bewegungslos gegenüberstanden. Sie starrten sich unentwegt in die Augen, als wenn sie schon seit Stunden die gleiche Position innehätten, und doch geschah lange Zeit gar nichts, und keiner bewegte sich. Eine Lichterwand erlosch mit einem wütenden Zischen und flammte wieder auf; das traurige Klopfen eines Hammers bat irgendwo in der Ferne um Einlass; ein blaues Gesicht erschien oben zwischen den blendenden Lichtern und rief etwas Unverständliches in die darüberliegende Finsternis. Dann wurde, unmittelbar vor Rosemary, das Schweigen durch eine Stimme unterbrochen:
»Baby, zieh die Strümpfe nicht aus, du kannst ruhig noch zehn Paar ruinieren. Das Kostüm kostet fünfzehn Pfund.«
Als der Sprecher einen Schritt zurücktrat, stieß er mit Rosemary zusammen, woraufhin der Studioleiter sagte: »Hey, Earl – Miss Hoyt.«
Sie sahen sich zum ersten Mal. Brady war lebhaft und betriebsam. Als er ihre Hand ergriff, merkte sie, wie er sie prüfend von Kopf bis Fuß betrachtete, eine Abschätzung, die ihr vertraut war und unter der sie sich heimisch fühlte, wenn sie ihr auch jedes Mal ein Gefühl der Überlegenheit vermittelte über den, der sie vornahm. Wenn ihre Person schon ein Vermögen darstellte, so konnte sie jeden Vorteil wahrnehmen, der sich aus diesem Besitz ergab.
»Ich dachte mir schon, Sie würden dieser Tage einmal kommen«, sagte Brady in einem Tonfall, der für den Privatgebrauch etwas zu unwiderstehlich klang und dem ein leicht herausfordernder Cockney-Akzent anhaftete. »Gute Reise gehabt?«
»Ja, aber wir sind froh, dass es wieder nach Hause geht.«
»Ach was!«, protestierte er. »Bleiben Sie noch etwas – ich muss Sie sprechen. Ich muss Ihnen sagen, Ihr ›Daddy’s Girl‹, das war ein Film. Ich habe ihn in Paris gesehen. Ich habe damals sofort zur Küste telegrafiert, um zu erfahren, ob Sie sich schon wieder verpflichtet hätten.«
»Das hatte ich gerade – es tut mir leid.«
»Mein Gott, was für ein Film!«
Da Rosemary keine Lust hatte, einfältig zustimmend zu lächeln, runzelte sie die Stirn.
»Man möchte ja nicht nur um eines einzigen Films willen im Gedächtnis der Leute bleiben«, sagte sie.
»Selbstverständlich – das ist richtig. Was haben Sie für Pläne?«
»Mutter war der Meinung, ich hätte eine Erholung nötig. Wenn ich zurück bin, werden wir wahrscheinlich entweder mit der First National abschließen oder bei der Famous bleiben.«
»Wer ist wir?«
»Meine Mutter. Sie gibt den Ausschlag in geschäftlichen Dingen. Ich könnte ohne sie nicht auskommen.«
Wieder musterte er sie eingehend, und als er es tat, fühlte sich etwas in ihr zu ihm hingezogen. Es war keine Zuneigung, nichts von der spontanen Bewunderung, die sie am Morgen für den Mann am Strand empfunden hatte. Es hatte geklickt. Er begehrte sie, und was ihre mädchenhaften Gefühle anbetraf, so sah sie einer Hingabe mit Gleichmut entgegen. Doch wusste sie, dass sie ihn eine halbe Stunde nach dem Abschied vergessen würde – wie einen Schauspieler, den man beim Filmen küsst.
»Wo sind Sie abgestiegen?«, fragte Brady. »Ach, richtig, bei Gausse. Also, meine Pläne für dieses Jahr stehen ebenfalls fest, aber was ich Ihnen in meinem Brief schrieb, hat weiter Gültigkeit. Möchte lieber einen Film mit Ihnen machen als mit irgendeinem anderen Mädchen, seit Connie Talmadge klein war.«
»Mir wäre es recht. Warum kommen Sie nicht nach Hollywood zurück?«
»Ich kann das verdammte Nest nicht ausstehen. Hier fühle ich mich tadellos. Warten Sie diese Aufnahme ab, dann führe ich Sie herum.«
Er ging zur Bühne und fing an, mit leiser, ruhiger Stimme auf den französischen Schauspieler einzureden.
Fünf Minuten vergingen – Brady sprach immer noch, während der Franzose von Zeit zu Zeit seine Fußstellung veränderte und mit dem Kopf nickte. Unvermittelt brach Brady ab und rief etwas in Richtung der Lampen, die unversehens in summendem, blendendem Licht aufflammten. Lärmend erstand jetzt Los Angeles vor Rosemary. Es war ihr, als bewege sie sich wiederum gleichmütig durch die Stadt aus dünnen Bretterverschlägen, und sie wünschte, wirklich dort zu sein. Aber sie hatte keine Lust, Brady in der Gemütsverfassung wiederzusehen, in der er, wie sie es sich ausmalte, nach Beendigung der Aufnahme sein würde, und verließ, noch verzaubert, das Filmgelände. Die mediterrane Welt war jetzt weniger still, seit sie wusste, dass das Studio dort war. Die Menschen auf der Straße gefielen ihr, und sie kaufte sich auf dem Weg zum Bahnhof ein Paar weiße Espadrilles.
Ihre Mutter war zufrieden, dass sie sich so verhalten hatte, wie es ihr gesagt worden war, aber sie wollte gern noch etwas allein bleiben. Mrs Speers war zwar dem Aussehen nach frisch, aber sie war müde; Totenbetten machen die Menschen fürwahr müde, und sie hatte an zweien gewacht.
VI
Nicole Diver fühlte sich gut nach dem Rosé zum Lunch; sie streckte ihre Arme so weit, dass die künstliche Kamelienblüte auf ihrer Schulter ihre Wange berührte, und ging hinaus in ihren hübschen, graslosen Garten. Auf einer Seite wurde er vom Haus begrenzt, von dem er ausging und in das er hineinwucherte, an zwei Seiten von dem alten Dorf und an der letzten von der Klippe, die stufenweise zur See abfiel.
An den Mauern der Dorfseite war alles staubig, der rankende Wein, die Zitronen- und Eukalyptusbäume und der Schubkarren, den man eben erst zufällig hatte stehenlassen und der bereits in den Weg eingesunken war, verkümmert und halb verrottet. Nicole war immer wieder einigermaßen überrascht, dass sie, wenn sie sich an dem Pfingstrosenbeet vorbei nach der anderen Richtung hin bewegte, in einen grünen und kühlen Bereich gelangte, wo sich die Blätter und Blüten in weicher Feuchtigkeit kräuselten.
Um ihren Hals hatte sie ein lila Tuch gebunden, das selbst in dem alle Farben schluckenden Sonnenlicht lila Schatten auf ihr Gesicht und um ihre sich bewegenden Füße warf. Ihr Gesicht war herb, fast hart, bis auf den sanften Schimmer rührenden Zweifels, der aus ihren grünen Augen sprach. Ihr einstmals blondes Haar war nachgedunkelt, aber sie war jetzt, mit vierundzwanzig Jahren, hübscher, als sie mit achtzehn gewesen war und ihr Haar heller geglänzt hatte als sie selbst.
Längs der weißen Grenzsteine zog sich ein Weg hin, gekennzeichnet durch einen hauchdünnen Blütenschleier, dem sie folgte, bis sie zu einer Stelle gelangte, von wo aus man auf das Meer blicken konnte, wo Laternen in den Feigenbäumen schlummerten und sich ein großer Tisch mit Korbsesseln und ein großer Markt-Sonnenschirm aus Siena befanden, alles unter einer riesenhaften Pinie, dem größten Baum des Gartens. Dort verweilte sie ein wenig, blickte geistesabwesend auf das Gewirr von Kapuzinerkresse und Schwertlilien, das zu Füßen des Baumes wucherte, als sei es einer achtlos hingestreuten Handvoll Samen entsprossen, und vernahm die Klagen und Vorwürfe eines Streits im Kinderzimmer des Hauses. Als diese Laute in der Sommerluft erstarben, ging sie weiter, zwischen rosa Wolkenmassen von kaleidoskopischen Pfingstrosen, schwarzen und braunen Tulpen und zarten Rosen mit gelblich-violetten Stielen, durchsichtig wie Blumen aus Zuckerwerk im Schaufenster eines Konditors – bis die Farben-Symphonie, als sei sie einer weiteren Steigerung nicht fähig, plötzlich mitten in der Luft abbrach und feuchte Stufen zu einer zwei Meter tiefer liegenden Fläche hinabführten.
Dort befand sich ein Brunnen, dessen Verkleidung ringsherum, selbst an heißesten Tagen, feucht und rutschig war. An der anderen Seite stieg sie die Treppe zum Gemüsegarten hinauf; sie ging ziemlich schnell; sie war gern aktiv, obwohl sie bisweilen einen Eindruck von einer Ruhe hervorrief, die bewegungslos und zugleich ausdrucksvoll war. Das kam daher, dass sie über wenig Worte verfügte und nichts von ihnen hielt. Unter Menschen war sie ziemlich schweigsam und steuerte ihren Anteil an verfeinertem Humor in so knapper Form bei, dass es an Dürftigkeit grenzte. Aber im selben Moment, da es den Fremden angesichts dieser Zurückhaltung anfing unbehaglich zu werden, konnte sie sich der Unterhaltung bemächtigen und sich von ihr fortreißen lassen, fieberhaft erstaunt über sich selbst – um sie dann zurückzuführen und plötzlich fallen zu lassen, beinahe ängstlich wie ein gehorsamer Apportierhund, der etwas übers Ziel hinausgeschossen ist.
Als sie in dem gedämpften grünen Licht des Gemüsegartens stand, ging Dick auf dem über ihr liegenden Weg zu seinem Arbeitshaus. Nicole wartete ruhig, bis er vorüber war, dann ging sie durch Reihen von zukünftigem Salat hindurch zu einer kleinen Menagerie, wo Tauben, Kaninchen und ein Papagei sie mit aufdringlichem Lärmen begrüßten. Als sie einen weiteren Absatz hinunterstieg, gelangte sie zu einer niedrigen runden Mauer und blickte zweihundert Meter tief zum Mittelmeer hinab.
Sie stand im uralten Bergdorf Tarmes. Die Villa und ihr Grundstück waren aus einer Reihe von Bauernhäusern entstanden, die an die Klippe grenzten – fünf kleine Häuser waren zur Villa zusammengefasst worden; vier waren für den Garten abgerissen worden. Die Außenmauern waren unangetastet geblieben, sodass sich das Haus, von der tief unten liegenden Straße aus gesehen, von der grauvioletten Masse der Gebäude des Dorfes überhaupt nicht abhob.
Eine Minute lang stand Nicole und schaute auf das Mittelmeer hinab, aber es war nichts damit anzufangen, auch mit ihren rastlosen Händen nicht. Gleich darauf trat Dick vor sein Einzimmerhaus; er hielt ein Fernglas in der Hand und blickte nach Osten in Richtung Cannes. Unversehens geriet Nicole in sein Blickfeld, woraufhin er in seinem Haus verschwand und mit einem Megafon wieder herauskam. Er hatte allerlei einfache mechanische Geräte.
»Nicole«, rief er, »ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich, als abschließende apostolische Geste, Mrs Abrams eingeladen habe, die Dame mit dem weißen Haar.«
»Ich dachte es mir. Das ist ein Skandal.«
Die Leichtigkeit, mit der ihre Antwort ihn erreichte, schien der Bedeutung seines Megafons Abbruch zu tun, darum erhob sie die Stimme und schrie: »Kannst du mich hören?«
»Ja.« Er senkte das Megafon und hob es eigensinnig wieder. »Ich werde auch noch andere Leute einladen. Ich werde die beiden jungen Männer bitten.«
»Schön«, stimmte sie gelassen zu.
»Ich will eine richtig anstößige Party geben, ich meine es ernst. Eine Party, bei der es Streitigkeiten und Verführungen gibt, die Leute beleidigt nach Hause gehen und die Frauen in der Garderobe Ohnmachtsanfälle haben. Du sollst schon sehen.«
Er kehrte in sein Haus zurück, und Nicole merkte, dass er in einer seiner charakteristischen Gemütsverfassungen war – einer Erregung, in die er jeden mitriss und der unweigerlich eine ihm eigene Art der Melancholie folgte, der er niemals Ausdruck verlieh, die Nicole jedoch erriet. Diese Erregung über Dinge erreichte eine Heftigkeit, die in keinem Verhältnis zu deren Wichtigkeit stand, und brachte eine wirklich außerordentliche Wirkung auf Menschen hervor. Außer bei wenigen sturen und ständig misstrauischen Menschen besaß er die Kraft, eine an Verzauberung grenzende und kritiklose Liebe zu erwecken. Die Reaktion trat ein, sobald er sich der Kraftvergeudung und Zügellosigkeit bewusst wurde, die dabei im Spiel waren. Manchmal blickte er mit Entsetzen auf die Wogen von Zuneigung, die er verursacht hatte, so wie ein General auf ein Gemetzel blicken mag, das er zur Befriedigung einer unpersönlichen Blutgier befohlen hatte.
Eine Zeit lang ein Teil von Dick Divers Welt zu sein, war jedenfalls ein beachtliches Erlebnis: die Leute glaubten, er räume ihnen eine besondere Stellung ein, weil er die stolze Einzigartigkeit ihres unter den Kompromissen endloser Jahre begrabenen, einzigartigen Schicksals erkannte. Er gewann alle Menschen augenblicklich durch ausgesuchte Rücksicht und Höflichkeit, die so schnell und intuitiv arbeiteten, dass man sie nur in ihren Wirkungen beobachten konnte. Dann öffnete er ihnen ohne Bedenken, aus Angst, das erste Grün der Beziehung könne welken, die Pforte zu seiner vergnüglichen Welt. Solange die Betreffenden ihr uneingeschränkt beipflichteten, war er nur auf ihr Glück bedacht, flackerte aber der erste Zweifel an der Ausschließlichkeit dieser Welt auf, so schwand er vor ihren Augen dahin und hinterließ nur wenige in Worte zu fassende Erinnerungen an das, was er gesagt und getan hatte.
Am Abend um halb neun kam er heraus, um die ersten Gäste zu begrüßen; seinen Rock trug er irgendwie zeremoniell und vielversprechend wie einen Toreroumhang in der Hand. Es war bezeichnend für ihn, dass er, nachdem er Rosemary und ihre Mutter begrüßt hatte, darauf wartete, dass sie zuerst sprachen, als wollte er ihnen Gelegenheit geben, sich durch den Klang ihre eigenen Stimmen Sicherheit zu geben in der neuen Umgebung.
Rosemary, die bezaubert von dem Aufstieg nach Tarmes und von der frischeren Luft war, blickte ebenso wie ihre Mutter anerkennend umher. So wie individuelle Eigenschaften außergewöhnlicher Menschen oft erst durch eine ungewohnte Veränderung im Ausdruck sichtbar werden können, so wurde die raffinierte Vollkommenheit der Villa Diana ganz plötzlich durch geringfügige Mängel spürbar, zum Beispiel durch das zufällige Auftauchen eines Dienstmädchens im Hintergrund oder einen allzu hartnäckigen Korken. Während die ersten Gäste eintrafen und die Spannung der Nacht mit sich brachten, trat die häusliche Geschäftigkeit des Tages nur allmählich zurück, symbolisiert durch die Diverschen Kinder, die mit ihrer Erzieherin immer noch beim Abendessen auf der Terrasse saßen.
»Was für ein wundervoller Garten!«, rief Mrs Speers.
»Nicoles Garten«, sagte Dick. »Sie kann ihm keine Ruhe lassen – immer hat sie etwas an ihm auszusetzen, macht sich Gedanken über seine Krankheiten. Ich erwarte jeden Tag, dass sie selbst krank wird, von Mehltau, Schildlaus oder Krautfäule befallen.« Er wies entschlossen mit dem Zeigefinger auf Rosemary und sagte mit einer Beiläufigkeit, hinter der sich ein väterliches Interesse zu verbergen schien: »Ich werde Ihren Verstand retten – ich werde Ihnen einen Hut schenken, den Sie am Strand tragen können.«
Er führte sie aus dem Garten zur Terrasse, wo er einen Cocktail einschenkte. Earl Brady erschien und war erstaunt, Rosemary anzutreffen. Sein Verhalten war liebenswürdiger als im Studio, so, als ob er an der Tür ein anderes Wesen angelegt hätte, und Rosemary, die ihn sofort mit Dick Diver verglich, schwenkte scharf zu letzterem über. Im Vergleich zu ihm schien Earl Brady nahezu unfein, fast ungebildet, und dennoch fühlte sie sich wiederum wie elektrisiert von seiner Person.
Er sprach ungezwungen mit den Kindern, die von ihrem Abendessen im Freien aufgestanden waren.
»Hallo, Lanier, wie wär’s mit einem Lied? Willst du mir mit Topsy ein Lied vorsingen?«