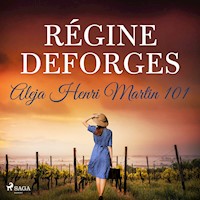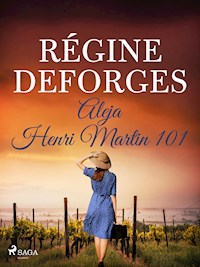4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Léone ist fünfzehn, sie ist ein hübsches Mädchen, lebhaft, frech und mutig, und sie ist verliebt. Zärtlich und leidenschaftlich verliebt – in Mélie, ihre Mitschülerin, die fünfzehn ist wie sie. Die Jungen verschmäht sie. Einer von ihnen stiehlt aus Wut und Eifersucht ihr Tagebuch, dem sie ihre geheimsten Sehnsüchte und Phantasien anvertraut hat, und entfesselt damit in einer französischen Kleinstadt in den 50er Jahren einen ungeheuerlichen Skandal ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Régine Deforges
Zärtliches Tagebuch
Aus dem Französischen von Ulrike Wiesenmeyer
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Léone ist fünfzehn, sie ist ein hübsches Mädchen, lebhaft, frech und mutig, und sie ist verliebt. Zärtlich und leidenschaftlich verliebt – in Mélie, ihre Mitschülerin, die fünfzehn ist wie sie. Die Jungen verschmäht sie. Einer von ihnen stiehlt aus Wut und Eifersucht ihr Tagebuch, dem sie ihre geheimsten Sehnsüchte und Phantasien anvertraut hat, und entfesselt damit in der französischen Kleinstadt einen ungeheuerlichen Skandal ...
Über Régine Deforges
Von Régine Deforges erschienen außerdem: «Der schwarze Milan» und «Lola».
Inhaltsübersicht
Ich widme dieses Buch
meinen Eltern,
M.
und der Zeit, die vergeht …
Doch weh dem Menschen,
durch welchen Ärgernis kommt …
Matthäus 18,7
«Du wirst sehen, dieser Sommer wird anders als die anderen.»
Wer hat das vorhin, in der Pause, gesagt? Die dicke Marie-Josèphe oder die kleine Marie-Thé, die beiden Unzertrennlichen? Ich habe nur müde gelächelt, denn in diesem Winkel des Poitou ist ein Sommer wie der andere, wenn man fünfzehn ist: Badeausflüge, Picknicks, Vereinsfeste, ein paar Tanzereien unter den Blicken der Eltern oder der älteren Schwestern, Feldarbeit für die, die auf dem Land wohnen, einmal in der Woche Kino, wo die neuesten Filme fünf oder sechs Jahre alt sind – das gleiche gilt nebenbei gesagt für die Wochenschauen, was unfehlbar Gelächter im Saal auslöst: das Publikum entdeckt auf diese Weise, was es von den Beteuerungen und Versprechen unserer Politiker zu halten hat und wie vergänglich alles im Leben ist! –, zwei oder drei Fahrten in die nächstgelegene Stadt, Poitiers oder Limoges. Und für die Glückspilze unter uns ein Aufenthalt am Meer oder im Gebirge.
Schwester Saint-André redet endlos über christliche Moral und gerät dabei auf seltsame Abwege: schamlos wirft sie alles in einen Topf, den heiligen Augustinus und die «kleine Therese von Lisieux», den Quietismus und den Jansenismus. Und weiter geht’s mit hohen Betrachtungen über die Liebe zu Gott, die Nächstenliebe, über die Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Die Arme, sie kann einem leid tun! Ich würde ihr gern etwas über die Gottesidee und deren Wirken erzählen. Aber wozu? Ich würde ja doch wieder wegen Frechheit aus dem Klassenzimmer gewiesen. Lieber träume ich weiter vor mich hin, eingehüllt in einen Sonnenstrahl, der mich schläfrig macht.
Der Staub in meinem Sonnenstrahl tanzt und glitzert, er scheint einer für menschliche Ohren unhörbaren Musik zu gehorchen. Jetzt flattert auch noch eine Fliege in dem Strahl herum; sie scheint verrückt geworden zu sein: wie von einem höllischen Rhythmus erfaßt, fliegt sie in dem Lichtstrahl auf und ab. Eine zweite gesellt sich zu ihr. Sie tanzen ein Ballett aus kunstvollen Figuren.
«Mademoiselle Léone, wenn Sie das nicht interessiert, kann ich auch zu einem anderen Thema übergehen!»
Die frostige Stimme unserer Lehrerin läßt mich zusammenfahren. Ich muß furchtbar geistesabwesend aussehen, denn die ganze Klasse fängt an zu lachen.
«Ruhe, meine Damen. Wenn Mademoiselle Léone wach ist und wenn sie gestattet, fahre ich fort.
Gott ist Liebe, die Prüfungen, die er uns schickt, sind Beweis seiner Fürsorge … hinnehmen … sich unterwerfen … göttliche Vorsehung … Lasset uns beten, Kinder.»
Uff! Das wäre geschafft! Ich hebe den Deckel meiner Schulbank hoch, um Bücher und Hefte wegzuräumen.
«Jean-Claude ist draußen und sucht dich», tuschelt Joëlle, meine Nachbarin, den Kopf unter ihrem Pult, zu mir herüber.
Ich erröte halb verschämt, halb erfreut. Seit mehreren Tagen gehe ich ihm aus dem Weg. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich Angst, daß Mélie davon erfährt, wenn ich mich mit ihm treffe; ich habe Angst, daß sie mir eine Szene macht und weint. Ich habe einen Horror davor, sie unglücklich zu machen, und Szenen bringen mich in Wut. Der andere Grund, vielleicht der eigentliche, wenn ich mir auch lieber die Zunge herausreißen ließe, als ihn zuzugeben: wenn Jean-Claude mich küßt, habe ich Lust, nackt zu sein, am ganzen Körper gestreichelt und geküßt zu werden. Er ist so zärtlich und ungeschickt, so sanft und brutal, so schüchtern und draufgängerisch. Er weiß, daß ich nie mit einem anderen Jungen geschlafen habe, das erregt ihn und macht ihm Angst. Außerdem habe ich ihm gesagt, daß ich in Mélie verliebt bin und nicht in ihn. Aber darüber hat er nur gelacht; er hat gesagt, daß Liebesgeschichten zwischen Mädchen nichts Ernstes seien, ich könnte Mélie so sehr lieben, wie ich wollte, solange er nur weiter mit mir flirten könnte.
«Trottel, verstehst du denn nicht? Ich LIEBE sie.»
Für sein schallendes Gelächter habe ich ihn gehaßt. Seither habe ich ihn nicht wiedergesehen.
Wir rennen mit kindischem Getöse in den Hof. Die herannahenden Ferien stimmen die Schwestern nachsichtig. Sie klatschen in die Hände, wir stellen uns in Reih und Glied auf und verlassen die Schule beinahe würdevoll.
Die Straßen der kleinen Stadt beleben sich mit einem Schlag und sind für kurze Zeit das Reich der Kinder und Jugendlichen. Die Erwachsenen sind verschwunden, als hätten sie sich angesichts von so viel Jugend in ihre Löcher verkrochen.
Joëlle hängt sich an mich und versucht, Näheres über meine Liebesgeschichten zu erfahren, etwas, worüber sie mit Maguy, ihrer besten Freundin, herziehen kann. Sie reizt mich, ich mag mich nicht ausfragen lassen, schon gar nicht über ein solches Thema. Sie bohrt immer weiter, und ich will sie gerade brutal zurückstoßen, als sie mich am Arm faßt:
«Da, sieh mal, da ist er, auf dem Bürgersteig gegenüber. Findest du nicht, daß er ein hübscher Junge ist?»
Stimmt, er ist nicht übel, aber das ist noch lange kein Grund, daß ich, unter den spöttischen Blicken meiner Klassenkameradinnen, auf sein Winken hin zu ihm hinübergehe.
«Los, geh doch, geh doch», drängt Joëlle.
Ich gebe ihr einen heftigen Fußtritt, worauf sie schweigt, sich das Schienbein reibt und auf der Stelle hüpft.
«Du bist völlig verrückt! Ich pfeife auf eure Geschichten, ich wollte dir einen Gefallen tun.»
Mir einen Gefallen tun … Die hält mich wirklich für blöd. Seit ich in der Anstalt Saint M. bin, seit vier Jahren, habe ich keine Freundin, zumindest keine, die ich so nennen würde; ich habe Kameradinnen, mit denen ich kichere und Dummheiten anstelle, mit denen ich Aufgaben mache oder Bilder tausche, aber zu Vertraulichkeiten kommt es nie. Das hat mir manchmal gefehlt, aber da ich keine fand, habe ich meine Geheimnisse lieber meinen Puppen, den Bäumen, dem rauschenden Wasser, dem wehenden Wind und sogar Gott anvertraut als jemand, dem ich nicht vertraue.
Sicher, da ist Mélie. Ihr könnte ich alles sagen, bestimmt, und da sie mich liebt, würde sie mich verstehen, sie würde mich in meinem Kummer trösten und sich mit mir über mein Glück freuen. Aber ich bringe es einfach nicht fertig, ihr zu sagen, was ich empfinde, was ich wirklich denke. Ich bin mißtrauisch, als fürchtete ich Verrat. Und trotzdem liebe ich sie, dessen bin ich gewiß, das ist sogar die einzige Gewißheit, die ich habe. Sie liebt mich auch, wir sollten uns eine der anderen vorbehaltlos hingeben. Doch es gelingt mir nicht.
Jean-Claude geht auf dem anderen Bürgersteig und sieht traurig und nachdenklich zu mir herüber. Es fehlt nicht viel, und er würde mich erweichen.
Am Zeitungskiosk trennen sich Joëlle und die anderen von mir. Ich gehe weiter zu Mélie. Als er sieht, daß ich allein bin, kommt Jean-Claude über die Straße. Ich gehe schneller, aber er holt mich ein.
«Warum rennst du weg? Ich sehne mich nach dir. Sonnabend ist in La Trimouille ein Ball mit einem guten Orchester. Kommst du mit mir?»
«Ich kann nicht. Ich gehe ins Casino von La Roche-Posay tanzen.»
Das ist nur halb gelogen. Mélie und ich fahren am Sonntagnachmittag mit ihren Eltern dorthin. Während sie Baccara spielen, tanzen wir, essen Törtchen oder toben im Park herum wie Gören, die wir sind. Erhitzt, atemlos, zerzaust, mit grünen Flecken an den Kleidern vom Gras, auf dem wir uns gerollt und manchmal geliebt haben – so finden uns Mélies Eltern nicht selten wieder, nachdem sie uns im ganzen Casino gesucht haben, das wir wie unsere Westentasche kennen, oder in den abgelegensten Winkeln des Parks.
Wir lassen uns geduldig ausschimpfen. Auf der Rückfahrt schlafen wir oft eng umschlungen in dem großen, sanft schaukelnden Auto ein.
«Laß mich jetzt gehen – wir treffen uns heute abend nach dem Abendessen, hol mich zu Hause ab.»
Sein Gesicht hellt sich auf, trällernd geht er davon.
Ich komme laufend vor Mélies Haus an, sie plaudert mit einer Lehrerin, Madame B., die sie gern hat. Ich wage sie nicht vor der Lehrerin zu küssen. Madame B. streicht mir mit der Hand über die Haare und zerzaust sie, wie man es bei einem dicken, wolligen Hund macht, dem man zeigen will, daß man ihn gern hat. Ich habe schon immer gewußt, daß Madame B. mich gern mag, aber meine Schüchternheit und vielleicht die ihre haben uns davon abgehalten, unsere gegenseitige Zuneigung auszusprechen.
«Was für schöne Haare du hast, Léone! Und wie ist für dich das Schuljahr gelaufen?»
Beim Anblick meiner Schnute bricht sie in jugendliches, heiteres Gelächter aus.
«Das habe ich mir schon gedacht. Mélie ist auch nicht gerade glänzend. Wenn ihr weniger häufig zusammen wärt, würdet ihr wahrscheinlich besser lernen.»
Wir senken errötend den Kopf und sind verlegen, wie vor einer x-beliebigen Lehrerin. Sie hat unsere Verlegenheit und ihre Ungeschicklichkeit bemerkt:
«Das war ein Scherz. In eurem Alter ist es wichtig, eine gute Freundin zu haben, die einen liebt. Nächstes Jahr werdet ihr es besser machen.»
Sie winkt uns zum Abschied zu und geht.
Ich fasse Mélie um die Schultern. Sie stößt die rot-weiße Schranke zum Garten auf, legt ihre Schultasche auf die Küchenstufen und zieht mich in ihr Zimmer. Dort umarmen wir uns so fest wir können, bis es weh tut. Es geht darum, wer die andere am festesten drücken kann. Mélie gibt nach.
«Hör auf, du tust mir weh.»
Ich lasse sie los, wir rollen auf dem Bett herum und lachen schallend. Ein paar Augenblicke bleiben wir regungslos liegen. Mélie stützt sich auf ihren Ellbogen und sieht mich an; ihre schmalen blauen Augen werden immer glänzender, fast hart. Ich kenne diesen Blick. Unter diesem Blick atme ich schneller, meine Arme und Beine schmerzen beinah, mein Mund wird trocken, mein Bauch spannt sich. Ich ziehe ihr Gesicht an mich und lecke es mit flinker Zunge ab, zuerst die Augen, die Nase, den Mund, dann knabbere ich an ihren Ohren, an ihrer zarten Kehle. Sie knöpft meine Bluse auf, schiebt meinen Büstenhalter nach oben und saugt an meinen Brüsten, saugt erst an der einen, dann an der anderen, mit einer Geschicklichkeit, die mir einen Seufzer entlockt.
Aber wir müssen uns jetzt trennen, denn die Glocke von Notre-Dame schlägt halb eins. Ich werde wieder einmal zu spät zum Mittagessen kommen und mir von Mama oder Großmutter Vorwürfe einhandeln – übertriebene Vorwürfe, wie ich finde.
Mit einem letzten, feuchten Kuß trennen wir uns.
Ich bin so schnell gelaufen, daß ich gerade zu Hause ankomme, als die Familie sich zum Essen hinsetzt.
Jean Claude erscheint pünktlich zum Rendezvous. Der Abend ist so mild, daß ich gegen Mamas Rat keine Weste mitnehme.
«Komm nicht zu spät nach Hause», sagt sie mit einem Blick, den ich komplizenhaft und deshalb völlig unpassend finde.
«Wollen wir an den Teich gehen?»
Ich zucke die Achseln, es ist mir egal. Alles, was ich von ihm verlange, ist, daß er nicht zuviel spricht, daß er die Stille der sinkenden Nacht nicht stört. Ich möchte die Gerüche einatmen, die aus der Erde aufsteigen, den pfeilschnellen Flug der Schwalben beobachten und das aufreizende Gleiten der ersten Fledermäuse. Es ist noch ziemlich hell, aber um uns herum macht sich alles zum Schlafen bereit. Und einige, die Nachtgeschöpfe, die Nachtschwärmer, die Schattenliebhaber, bereiten sich auf einen Sabbat vor, zu dem wir eingeladen sind, zu dem aber wenige von uns gehen – aus Mangel an Phantasie.
Die ländliche Nacht verlangt vom Menschen, sich vollständig ihrer Bewegung anzupassen, die sacht und tief ist, im Rhythmus der Erde zu atmen, im Rauschen der Pappelblätter das wechselvolle Murmeln des Windes wahrzunehmen, den Schrei des Ziegenmelkers und des Uhus zu kennen und den Angst- und Todesschrei der Waldmaus, die die Eule davonträgt. Diese Nacht ist erfüllt von Seufzern, Gemurmel, Kreischen, Rauschen, kurzen Angst- oder Lustschreien, von den schweren Flügelschlägen der Nachtvögel und dem gelegentlichen fernen Gebell eines aus dem Schlaf geschreckten Hundes. Ein Leben, das seine Geräusche dämpft, als wollte es nicht aufgespürt, nicht gestört werden, ergreift nachts auf dem Land Besitz von der Natur, bis zum frühen Morgen, wo es einem anderen Leben weicht, einem lärmenderen, stärkeren, vulgäreren Leben, das der Hahn mit seinem einfältigen, triumphierenden Schrei begrüßt.
Der betörende Duft des Geißblatts verursacht mir einen leichten Kopfschmerz. Wir gehen langsam, Hand in Hand. Jean-Claude redet wenig, ich spüre, daß er erregt ist, als stünde etwas Ernstes oder Wichtiges bevor. Seine Schüchternheit steckt mich an, denn ich weiß, an was er denkt. Er zieht mich vom Weg in die Büsche. Der Geruch nach Schlamm und Pfefferminze sagt mir, daß wir in der Nähe des Teiches sind. Er setzt sich auf das Moos und zieht mich an sich. Ich strecke mich aus und genieße das weiche Polster unseres Lagers. Die Bäume bilden einen wankenden und munkelnden Himmelbetthimmel. Wie schön ist es hier! Man möchte regungslos auf das Ende der Zeit warten, sich vom Gemurmel des Wassers und des aufkommenden Windes davontragen lassen.
Ich fühle Jean-Claudes heißen Atem auf meinem Gesicht, seine Lippen suchen meine, seine Zunge schlüpft zwischen meine Zähne. Ich versuche ihn zurückzustoßen, aber ein Schauer der Lust wirft mich gegen ihn, ich erwidere seine Küsse heftig und ungeschickt, ich habe Lust, ihn zu beißen. Lachend macht er sich los.
«Du tust mir weh, kleine Wildkatze. Du verdienst deinen Spitznamen wirklich.»
Ich reibe mich an ihm wie ein kleines, brünstiges Tier. Ich fühle sein hartes Glied an meinem Bauch. Ich habe wahnsinnige Lust, es anzufassen, es in meine Hände zu nehmen, aber ich wage es nicht. Seine Hand schiebt sich unter mein Kleid, unter das Gummiband meines weißen Baumwollhöschens. Als seine Finger die feuchte Spalte erreichen, stoße ich einen leisen Schrei aus. Er fürchtet, mir weh getan zu haben, und hält inne. Ich schüttele den Kopf und strecke ihm meinen Leib entgegen. Seine Finger werden immer geschickter und entlocken mir selige Seufzer. Er knabbert an meinen Brüsten, immer heftiger, er tut mir weh, aber ich liebe diesen Schmerz, der eine Welle der Wollust durch meinen Unterleib jagt. Sehr schnell bringt er mich zum Orgasmus.
Zuckend bleibe ich an ihn gepreßt liegen. Sein Glied ist jetzt nicht mehr hart, und er sieht mich mit irgendwie verschleiertem Blick an.
«Das ist raffiniert», sagt er und schiebt ein Taschentuch in seine Hose.
Wir bleiben eine Weile liegen und genießen die Nacht und unsere entspannten und glücklichen Körper. Aber allmählich dringt die Kühle des Bodens in uns ein, und wir stehen fröstelnd auf. Jetzt bereue ich, daß ich nicht auf Mamas Rat gehört habe, eine Weste mitzunehmen. Um uns aufzuwärmen, kehren wir im Laufschritt nach Haus zurück.
«Ich liebe dich», sagt er vor der Haustür zu mir. Ich puste ihm einen Handkuß zu.
Ich gehe gleich in mein Zimmer hinauf. Taumelnd vor Müdigkeit mache ich Katzenwäsche. Kaum liege ich im Bett, bin ich auch schon eingeschlafen.
Schluß mit der Angst im Bauch wegen nicht gelernter oder hingesauter Hausaufgaben. Schluß mit den scharfen Stimmen der frommen Schwestern, mit dem Nachsitzen, den Strafarbeiten, den Klassenkameradinnen, die nach Schule und ungewaschenen kleinen Mädchen riechen! Schluß mit der morgendlichen Kälte, mit den schläfrigen frühen Nachmittagen, den Rückenschmerzen von der Langeweile, den tintenverschmierten Fingern, den abgekauten Bleistiften, den verlorenen Radiergummis: jetzt sind Ferien, die großen Ferien.
Heute abend wird gefeiert. Es gibt einen Fackelzug durch die ganze Stadt und anschließend einen Ball auf dem Rathausplatz. Mélie, Jean-Pierre, Michel, Francis und mir macht es Spaß, bei dieser revolutionären, durchwachten Nacht dabei zu sein, und morgen geht das Fest weiter: Feuerwerk und Ball auf dem Marktplatz. Man muß die Gelegenheiten, sich zu vergnügen, ausnutzen, sie sind bei uns nicht gerade häufig.
Sobald es dunkel geworden ist, laufen wir hinter der Blasmusik durch die Straßen der Oberstadt hinunter in die Unterstadt. Viele Leute sind unterwegs, die Kinder tragen bunte Lampions, die ohne Lampions springen um die Musikkapelle herum und klatschen in die Hände. Mélie und ich halten uns an der Taille umfaßt. Jean-Claude hat sich uns, zusammen mit einem Jungen, angeschlossen, den ich nicht kenne und den ich auf Anhieb richtig unsympathisch finde. Er ist schon älter, er ist mindestens neunzehn. Jean-Claude hat uns bekannt gemacht: «Ich möchte euch Alain vorstellen, er verbringt hier seine Ferien.»
Der Blick, mit dem Alain uns ansieht, Mélie und mich, hat eine solche Härte, daß ich automatisch von ihr abrücke.
Wir gehen am Café du Commerce vorbei, ich ziehe Mélie aus dem Zug heraus:
«Ich bin müde, wollen wir nicht eine Limonade trinken?»
Die anderen sind uns gefolgt.
«Ich lade euch ein», sagt Jean-Claude. «Was wollt ihr trinken?»
Nachdem jeder über seine Pläne für die Ferien gesprochen hat, gerät die Unterhaltung ins Stocken und schläft schließlich ein. In Alains Gegenwart fühlen wir uns unbehaglich.
In der Ferne hört man Musik. Es muß ein Akkordeon sein.
«Wir wär’s, wollen wir tanzen gehen?» rufen Jean-Claude und Francis gleichzeitig.
Dieser Vorschlag macht mich wieder munter, und hüpfend und springend laufe ich los.
Es sind noch nicht viele Leute da. Francis fordert Mélie zum Tanzen auf, während Jean-Claude mich in etwas verwickelt, was er anscheinend für einen schmachtenden Tango hält. Er tritt mir auf die Füße, und ich, ich mag den Tango nicht, mir kommt dabei immer eins von meinen eigenen Beinen in die Quere. Wir einigen uns auf einen Kompromiß und tanzen sachte auf der Stelle. Er versucht mich auf den Hals zu küssen. Ich fange Mélies gequälten Blick auf. Ich stoße Jean-Claude zurück.
«Neulich abends warst du aber nicht so, weißt du nicht mehr? Wenn ich gewollt hätte …»
Ich würde ihn rasend gern ohrfeigen.
«Neulich abends war neulich abends, laß mich in Ruhe, oder ich gehe.»
Er begnügt sich damit, mich mit einem selbstgefälligen Lächeln noch fester an sich zu drücken. Der Tanz ist zu Ende, die Paare trennen sich, ich setze mich wieder neben Mélie, die mich finster und durchdringend ansieht. Ich küsse sie, und das scheint sie ein bißchen zu beruhigen.
«Schluß jetzt, Mädchen, genug geflirtet! Macht Platz für die Männer!» sagt Alain und umfaßt mich für einen Walzer. Wütend über diese «unglaubliche Dreistigkeit», diese «unbeschreibliche Flegelei» versuche ich mich zu befreien. Aber er lacht nur und drückt mich, daß es mir weh tut. Ich liebe Walzer, und er tanzt sehr gut. Gegen meinen Willen gebe ich den Widerstand auf und lasse mich immer mehr von der Freude am Tanzen hinreißen. Die anderen Paare sind stehengeblieben, um uns zuzuschauen, ein Kreis hat sich um uns gebildet. Wir wirbeln schneller und schneller herum. Ich habe den Eindruck, daß meine Füße kaum noch den Boden berühren. Ich blicke zu ihm auf, ein schmales, böses Lächeln entblößt seine Zähne. Er erinnert mich an bestimmte Hunde, die einen so tückisch ansehen und die Lefzen hochziehen, als ob sie einen beißen wollen. Ich spüre, wie mein Körper wieder steif wird. Er hat es auch gespürt, denn seine Hand wandert zu meinem Nacken, packt ihn und zwingt mich, den Kopf zu heben. Oh, diese Bewegung! Ich kann sie nur von Leuten, die ich liebe und die mich lieben ertragen, von Leuten, von denen ich nichts zu fürchten habe, aber nicht von diesem Jungen, den ich nicht kenne und vor dem ich Angst habe. Er versucht mich zu unterwerfen. Ich leiste Widerstand.
«Du wehrst dich vergeblich. Du liebst die Hand der Männer und nicht die der Mädchen. Alles in dir schreit nach dem Mann, und du weißt es. Jean-Claude und deine kleinen Freunde sind zu dumm und zu jung, um das zu verstehen. Du bist für das Vögeln geschaffen, so wie andere dafür geschaffen sind, Akrobaten, Fallschirmspringer, Mütter, Nonnen oder Priester zu werden, du bist für das Vögeln geschaffen, du süße kleine Nutte. Fühlst du, wie er mir steht, du Flittchen?»
Ich merke, wie ich rot werde, noch nie hat jemand so mit mir gesprochen. Mein Herz fängt an wie wild zu schlagen, in meinem Kopf dreht sich alles, ich habe Angst, ich schäme mich, ich bin wütend, und trotzdem reibt sich mein Körper an der harten Ausbeulung. Sein Grinsen bringt mich in die Wirklichkeit zurück.
«Siehst du, du Hürchen, ich habe mich nicht getäuscht!»
Ich reiße mich los in dem Moment, als der Tanz zu Ende ist, und renne rot und mit Tränen in den Augen zu meiner kleinen Clique. Jean-Claude und Mélie sehen nicht gerade begeistert aus, aber sie sagen nichts.
«Ich hab die Nase voll, ich will nach Hause.»
Sie versuchen mich zu überreden, daß ich noch bleibe. Aber ich weigere mich, und so begleiten sie mich nach Hause. Mélie macht ein unglückliches Gesicht, als ich die Haustür schließe. Mama wundert sich, daß ich so früh heimkomme.
«Was hast du denn bloß? Du siehst so müde aus. Du hast Ringe unter den Augen! Das Gebirge wird dir guttun.»
Ach ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Übermorgen fahren wir in die Pyrenäen, zu Papa, der dort eine Kur macht. Zu blöd! Ich langweile mich zu Tode in diesen Badeorten! Ich habe alles versucht, dieses Jahr darum herumzukommen, aber es ist nichts zu machen, sie behaupten, es täte meiner Gesundheit gut.