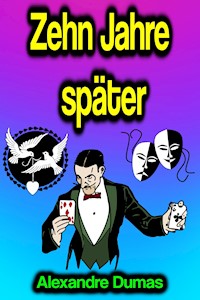
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre später Alexandre Dumas - Im dritten und letzten Band der Musketier-Trilogie hat Ludwig XIV. bereits den Thron bestiegen. D Artagnan als sein Hauptmann langweilt sich in Versailles, wo sein Gebieter ein Fest nach dem anderen feiert. Aramis spinnt inzwischen im Hintergrund eine Intrige: In seiner neuen Funktion als Jesuitengeneral will er den verantwortungslosen König durch seinen Zwillingsbruder austauschen. Hierzu sichert er sich die Mithilfe Porthos und des Finanzministers Nicolas Fouquet, der jedoch im entscheidenden Moment versagt und den Plan zunichte macht. Letztlich kostet ihn dies sein Amt und seine Freiheit; sein Nachfolger wird der intrigante Colbert (Jean-Baptiste Colbert). Ein weiterer Handlungsfaden umfasst Athos Sohn Raoul, der eine Hofdame, Louise de la Vallière, liebt. Leider macht der König sie jedoch zu seiner Mätresse und bringt Vater und Sohn, gleichermaßen treu und voller Respekt vor seiner Person, in einen Gewissenskonflikt. Nachdem der König Aramis Plan aufgedeckt hat, befiehlt er d Artagnan, die Verantwortlichen aufzuspüren; diesem gelingt es jedoch zuletzt, seine Freunde zu rehabilitieren. Drei der vier Helden der Geschichte sterben am Ende des dritten Bandes. Porthos wird durch den Einsturz einer Höhle getötet, in die er sich mit Aramis vor den feindlich gesinnten Männern des Königs geflüchtet hat, kann aber Aramis zuvor noch das Leben retten. Athos stirbt vor Kummer, als sein Sohn in Afrika getötet wird. D Artagnan (der im letzten Drittel des ersten Romans zum Musketier ernannt wird und später Leutnant und zuletzt Hauptmann der Kompanie wird) kommt in Holland bei der Belagerung von Maastricht durch einen Querschläger ums Leben, kurz nachdem ihn der König zum Marschall von Frankreich ernannt hat. Am Ende der Geschichte ist nur noch Aramis, der zwischendurch Abbé und General des Jesuitenordens war und nun spanischer Botschafter ist, am Leben. 1847 erschien dieser dritte Teil, Le Vicomte de Bragelonne ou Dix Ans Plus Tard (Der Vicomte von Bragelonne).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1043
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PUBLISHER NOTES:
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
LyFreedom.com
Zehn Jahre später oder Der Graf von Bragelonne
Roman aus der Regierungszeit Ludwig XIV., des Sonnenkönigs
Die Fortsetzung von "20 Jahre danach" (Der Fortsetzung von "Die 3 Musketiere")
Einleitung
Ein imposantes Kulturgemälde! Das ist der Eindruck, mit dem man von diesem lesenswerten Roman scheidet. Und ein glänzender Zeitabschnitt ist es, den Dumas darin wieder aufleben läßt. Die Jugendjahre Ludwigs XIV., des Sonnenkönigs, jenes großen Monarchen, der das Wort: »Der Staat bin ich!« nicht nur aussprach, sondern auch zu verkörpern, zu rechtfertigen wußte. Die Jugendjahre, die Lehrjahre des großen Fürsten, das ist der Inhalt des Buches. Ludwig XIV. ist der eigentliche Held der Erzählung, er steht im Mittelpunkt der Handlung, um seine Gestalt gruppiert sich die ganze farbenprächtige Welt, in die wir hineingeführt werden. Seine Wünsche und Befehle bewirken alles, was geschieht, bestimmen Denken und Handeln aller Personen, die auftreten. Daß Dumas dem werdenden König als Lehrmeister der Staatskunst, der Energie und des Seelenadels seine Lieblingshelden an die Seite stellt – seine drei Musketiere: d'Artagnan, Athos und Aramis – das wollen wir ihm nicht verübeln, sondern vielmehr danken; denn es gibt ihm Anlaß zu einigen prachtvollen Szenen, von denen der Literarhistoriker Scherr mit Recht sagt, daß nur ein echter Dichter sie geschrieben haben könne. Das sind die Szenen, wo Athos vor dem König seinen Degen zerbricht und das Band zwischen seinem Geschlecht und dem Königshause zerreißt, wo d'Artagnan sich gegen den Willen Ludwigs auflehnt und zuletzt doch in dem jungen Autokraten seinen Meister findet. Die Worte, die Dumas in diesen Auseinandersetzungen seinen Lieblingen in den Mund legt, verdienen mehr als einmal gelesen zu werden.
Mit großer Meisterschaft trifft Dumas den Ton, der am Hofe herrschte; wenn man die Herren und Damen reden hört, glaubt man einen Zeitgenossen zu hören, so getreu fühlt Dumas ihr Denken und Dichten nach, so lebendig und handgreiflich wird ihm diese sonderbare Welt, der das Lächeln oder der Unmut eines Jünglings die Signatur gab; wie denn überhaupt die Schilderung von Königshöfen, von glänzenden Gesellschaften, von höfischen Intrigen diesem Schriftsteller ganz besonders gut lag.
»Zehn Jahre später« ist der Schluß der Romanserie, die mit den »Drei Musketieren« beginnt und mit »Zwanzig Jahre nachher« fortgesetzt wird. (Beide Bände sind in gleicher Ausstattung im gleichen Verlag erschienen.) Der Grund zu derartigen Fortsetzungen eines Romans liegt oftmals weniger in einem innern Drange des Verfassers, das Schicksal seiner Personen weiterzuspinnen, als vielmehr in dem Wunsche des Publikums, von Helden, die es liebgewonnen, noch mehr zu hören, und in dem Wunsche eines Verlegers, einen Bucherfolg auszunützen. Oftmals fallen denn auch solche Fortsetzungen schwach und gezwungen aus. Das ist bei den zwei Bänden, die Alexander Dumas seinen »Drei Musketieren« folgen ließ, nicht der Fall. War schon »Zwanzig Jahre nachher« durch das interessante Milieu der »Fronde« mit der Gestalt des Staatsmannes Mazarin ein sehr glücklicher zweiter Band, so möchte man »Zehn Jahre später«, den dritten Band, fast als den glücklichsten der ganzen Serie bezeichnen. Denn Dumas zeigt sich darin nicht nur als geübter Gestalter ergreifender Szenen und spannend verketteter Ereignisse, sondern auch als Charakterzeichner, als Psycholog. Hier wird die Natur der Personen nie um aufregender Abenteuer willen vergewaltigt; sie handeln von Anfang bis zu Ende ihrem Charakter gemäß. Und Personen wie Lady Henriette von Stuart, Graf von Bragelonne, Luise von Lavallière und namentlich Ludwig XIV. und Marchiali, jener unglückliche Gefangene der Bastille, sind prachtvoll gesehene Persönlichkeiten, die leibhaftig vor unsern Augen stehen, Kabinettstücke dichterischer Charakteristik. Die Figur d'Artagnans aber erhebt sich in diesem Roman zu einer Höhe, auf der nur wenige glücklich entworfene Gestalten der Phantasie stehen, wie etwa der Fallstaff Shakespeares, der Kottwitz Kleists, der Zagloba Sienkiewiczs.
Ist die Zeichnung der Personen vortrefflich, so ist es nicht minder die Wahl der Geschehnisse, in denen sie auftreten. Die Handlung ist dreiteilig: das Liebesverhältnis zwischen Ludwig XIV. und der Lavallière, seiner ersten Mätresse, die um des Königs willen ihren Bräutigam, den Grafen von Bragelonne, verläßt, die politische Intrige, die dem Sturz des Finanzministers Fouquet vorhergeht, und der Staatsstreich der »Eisernen Maske«, den Aramis in Szene setzt – das sind die drei Bestandteile, die mit wunderbarem Geschick ineinander verwoben werden. Abgesondert, wie eine Einleitung gewissermaßen, erscheint die Episode aus dem Leben des Britenkönigs Karls II., mit der der Roman beginnt; aber sie dient doch auch als wichtiges Moment für die Entwicklung Ludwigs XIV., obwohl sie mit dem ganzen weiteren Verlauf nur sehr lose verknüpft ist.
Der geschlossene Eindruck, den der Roman in der vorliegenden Ausgabe macht, ist ihm jedoch in der Originalfassung nicht zu eigen. So lobenswert im allgemeinen die Konzeption dieses Dumas-Werkes ist, darf doch nicht verschwiegen werden, daß der Autor auch darin ganz nach dem alten guten Schema des Sensationsschriftstellers arbeitet. Auf jedes interessante Kapitel läßt er mindestens drei uninteressante folgen. Ich möchte hier ein Bild gebrauchen. Ich möchte die Lektüre eines solchen Romans mit einem Ritt vergleichen. Das Pferd ist der Leser, der Autor der Reiter. Er jagt ihn durch eine Menge von Fährnissen und Klippen, läßt ihn nicht zu Atem kommen, drückt ihm den Sporn von tausend Spannungen in die Flanke, und wenn er ihn ermattet glaubt, dann führt er ihn in ganz langsamem Schritt über eine völlig ebene Fläche, auf der es gar keine Aufregungen, aber auch herzlich wenig Futter gibt. Sand, trockener Sand, darin das Rößlein sich verschnaufen kann, sich aber auch von neuem nach einem flotten Galopp sehnt. Da macht kein moderner Leser mehr mit. Er würde diese überflüssigen Kapitel entweder überschlagen oder aber den Roman ungeduldig beiseitelegen. »Zehn Jahre später« im Original zu lesen, ist wirklich eine Geduldsprobe, bei der wir versagen. Was nützen uns auch hinreißende Kapitel, wenn wir jedes einzelne durch eine immer wiederkehrende Folge von Langweiligkeiten entgelten müssen? Der »Graf von Bragelonne« wäre für die Lesewelt unserer Zeit verloren, und das wäre denn doch sehr schade, denn er ist ein Roman, an dem man seine Freude haben kann. Aber nur in einer Bearbeitung, wie sie hier dem Publikum geboten wird. Nach dem Unterschied der Seitenzahlen des Originals und dieser Ausgabe, erscheint auf den ersten Blick die Kürzung beträchtlich; sie ist es jedoch nicht. Es fehlt keine für die Handlung wichtige Szene – nur lästiger Ballast ist entfernt worden, wofür der Leser, wenn er die letzte Seite des Buches umgeschlagen hat, dem Bearbeiter Dank wissen wird. Es sei hier nebenbei erwähnt, daß die Einteilung des Werkes in Bücher und Kapitel neu und Eigentum des Bearbeiters ist.
Noch ein paar Worte über diejenigen Personen des Romans, die historisch sind! Es wird den Leser interessieren, die Dichtung mit der Wahrheit zu vergleichen.
Ludwig XIV., der Große, Sohn Ludwigs XIII. und Annas von Oesterreich, 1643-1715. Während seiner Jugend riß seine Mutter die Regentschaft an sich, sie wurde später ganz machtlos in den Händen ihres ersten Ministers Mazarin, zu dem sie übrigens in intimem Verhältnis gestanden haben soll. Der junge König, 1660 mit Maria-Theresia, Infantin von Spanien, vermählt, erregte zuerst keine großen Erwartungen. Aber sofort nach Mazarins Tode übernahm er die selbständige Leitung des Staates, duldete keinen ersten Minister mehr, verdrängte seine Mutter völlig aus den Regierungsgeschäften und erhob die Lehre von der königlichen Allmacht zum halbreligiösen Dogma, wobei er allerdings aufs ehrlichste bestrebt war, durch strengste Erfüllung der königlichen Pflichten diese Vergötterung auch zu verdienen. Seine erste bedeutsame Tat war die Reorganisation der Finanzen, welche völlig in den Händen des Oberintendanten Fouquet lagen, und indem er diesen Minister stürzte und den weit bedeutenderen Staatsmann Colbert mit viel geringeren Privilegien und Befugnissen an seine Stelle setzte, vollbrachte er eine Tat, die zunächst von höchst vorteilhafter Wirkung für das Land war. Die späteren Kriege freilich verschlangen das Geld, das durch Colberts weise Verwaltung an den Tag gefördert wurde, sehr rasch wieder, und es riß von neuem eine furchtbare Finanznot ein, die zu den drückendsten Steuerlasten für Stadt und Land führte. Seine Kriege führte Ludwig XIV. im allgemeinen mit Glück durch, nur der letzte, der Spanische Erbfolgekrieg, endete unheilvoll und brachte Frankreich fast an den Rand des Zusammenbruchs. Die ungeheure Kriegssteuer, die nötig geworden war, stürzte das Volk in Armut, und bei allem hatte das Reich sich auch noch eine kolossale Schuldenlast aufgebürdet, welche dann sehr viel zur Förderung der Revolution beitrug. Dennoch nennt man noch heute die Zeit Ludwigs XIV. das »große Jahrhundert«, das auch in Literatur und Kunst einen Höhepunkt bezeichnet.
Anna von Oesterreich, älteste Tochter Philipps III. von Spanien, 1601-1666. Sie war noch nicht 15 Jahre alt, als man sie mit Ludwig XIII. von Frankreich vermählte. Sehr schön, sehr leidenschaftlich, lebte sie mit ihrem schwachen, mürrischen Gatten in unglücklicher Ehe. Die politischen Mißhelligkeiten, die ihre Opposition gegen Richelieu, Ludwigs XIII. Premierminister, und ihre geheime Verbindung mit dem spanischen Hofe mit sich brachte, führten zum völligen Bruch zwischen beiden, und erst in den letzten Jahren des Königs kam es wieder zu einer Annäherung. Nach dem Tode ihres Mannes wußte sie im Widerspruch gegen das königliche Testament, das einen Regentschaftsrat bestellte, das Parlament zu veranlassen, daß ihr allein die Regierung übertragen wurde. Sie empfand dann später die Ohnmacht, zu der ihr Sohn sie verurteilte, bis an ihr Ende um so drückender.
Maria Theresia, Infantin von Spanien, Tochter Philipps IV. von Spanien und Elisabeths von Frankreichs (Schwester Ludwigs XIII.), 1638-1683, war 22 Jahre alt, als man sie mit Ludwig XIV. zur Bürgschaft des Pyrenäischen Friedens verehelichte. Sie war also fünf Jahre älter als ihr Gemahl, woraus sich die in ihrem Eheleben sehr bald entstehende Entfremdung erklärt. Von ohnmächtiger Eifersucht verzehrt, überließ sie sich religiöser Schwärmerei. Von ihren sechs Kindern blieb nur der Dauphin, der Erstgeborene, am Leben.
Philipp von Orléans, Ludwigs XIV. jüngerer Bruder, vordem Herzog von Anjou, 1640-1701. Seine Nachkommen bilden das heutige Haus Orléans. Seine Erziehung wurde sehr vernachlässigt, und er entartete bald zum Schwächling und Lüstling. Nach Henriette von England heiratete er Elisabeth Charlotte von der Pfalz. An der Regierung nahm er nie teil.
Henriette Anna, Herzogin von Orléans, Tochter Karls I. von England und der Henriette Marie von Frankreich, 1644-1670. Als sie Philipps Gemahlin wurde, zählte sie 17 Jahre. Schön und geistreich, anmutig und kokett, wurde sie der Mittelpunkt des Hofs. Ludwig bediente sich ihrer als Geschäftsträgerin zwischen Paris und London. 1670 reiste sie nach England, angeblich einer Einladung ihres Bruders Karls II. folgend, in Wahrheit aber, um diesen zum Bundesgenossen Ludwigs XIV. im Kriege gegen die Niederlande zu werben, was ihr auch gelang. Kurz nach ihrer Rückkehr starb sie ganz plötzlich.
Gaston von Orléans, dritter Sohn Heinrichs IV. und Bruder Ludwigs XIII., 1608-1660, war das Haupt einer großen Reihe von Verschwörungen, erst gegen Richelieu, dann gegen Mazarin. An einer derselben war auch die Herzogin von Chevreuse beteiligt. Nach Ludwigs XIII. Tode hatte er eine Zeitlang Anteil an der Regierung. Während der »Fronde« trat er gegen Mazarin auf. 1652 verwies Ludwig XIV. den ewigen Störenfried für immer vom Hofe, und er hat dann sein Schloß zu Blois nicht mehr verlassen.
Mazarin, eigentlich Mazarini, 1602-1661, Sohn eines sizilianischen Edelmannes, begann seine Laufbahn nach kurzem Studium der Rechte als Offizier im päpstlichen Militärdienst. Als Gesandter des Vatikans kam er mit Richelieu in Berührung, der ihn alsbald für seine Zwecke gewann und ihm, nachdem er in Rom viel für Frankreich getan, den Kardinalshut verschaffte. Sterbend empfahl Richelieu ihn dem König zu seinem Nachfolger. Er wurde Staatsrat, Mitglied des Regentschaftsrats und nach dem Tode des Königs, indem er in ein Liebesverhältnis zur Königin-Witwe trat, alleiniger Leiter des Reichs. Das blieb er, trotz aller Gegenströmung, bis zu seinem Tode. Selbst Ludwig XIV. vermochte sich, solange M. lebte, nicht seiner Herrschaft zu entziehen. Die Jahre der »Fronde« waren seine schwerste Zeit, doch nach dem mühsam errungenen Siege saß er um so fester im Sattel. Er war unstreitig der größte Diplomat seiner Zeit. Seine stärksten Erfolge waren das Bündnis mit England und die Demütigung Spaniens. Weniger genial als Richelieu, wußte er doch geschickt zu vollenden, was die »rote Eminenz« begonnen hatte. Sein unermeßliches Vermögen erbte der Marquis von Lameilleraie, der M.'s Nichte, Hortensia von Mancini, heiratete.
Fouquet, 1615-1680, Staatsmann, leistete in den Kämpfen der »Fronde« Mazarin sehr wertvolle Dienste, wurde dafür 1653 von diesem zum Finanzminister erhoben und erhielt sich lange Zeit die Gunst des Hofs dadurch, daß er die Geldbedürfnisse des Königs und seiner Familie stets aufs ausgiebigste zu befriedigen wußte. Später schoß er selbst dem Staate Geld vor und ließ sich gegen solche Vorschüsse ganze Staatseinnahmen verpfänden, so daß in der Tat seine Macht auf Grund des Geldes in manchen Gebieten der Verwaltung größer war als die des Königs selbst. Das waren Zustände, die einem Ludwig XIV., der keinen neben sich dulden mochte, unerträglich waren. Fouquet hat auch alle Anstrengungen gemacht, sich zum ersten Minister aufzuschwingen und energisch gegen Ludwig XIV. intrigiert, indem er sogar Anna von Oesterreich umwarb. Von Colbert gewarnt, beschloß der König, ihn unschädlich zu machen. 1661 ward Fouquet verhaftet. Der lange und mit übertriebener Härte gegen ihn geführte Prozeß führte zur Verurteilung Fouquets. Ludwig hatte ein Todesurteil gewünscht, das Gericht erkannte nur auf ewige Verbannung; der König aber verschärfte die Strafe zu lebenslänglichem Gefängnis.
Colbert, Sohn eines vermögenden Kaufmanns, 1619 bis 1683, wurde an Mazarin empfohlen und hielt in der Sturmzeit der »Fronde« treu zu ihm, wofür Mazarin ihm noch im Tode durch Empfehlung an Ludwig XIV. dankte. Colbert trug sehr viel zur Beseitigung der liederlichen Finanzwirtschaft Fouquets bei, trat dann selbst an die Spitze der Verwaltung und leitete alsbald eine Periode der größten Reformen und der höchsten innern Leistungen des französischen Königtums ein. Ihm verdankt, obwohl Colbert stets ein energischer Förderer der Monarchie geblieben ist, der dritte Stand unendlich viel, indem C. eine gleichmäßige Besteuerung einführte, die Unzahl der Beamten und Pensionäre verminderte und zum erstenmal eine gewissenhafte Balanzierung der Staatseinnahmen und -ausgaben anstrebte. Die fortwährenden Kriege Ludwigs XIV. vereitelten allerdings manche seiner Pläne und zerstörten immer wieder einen großen Teil des Segens, den sonst seine Verwaltung hätte stiften müssen. Er organisierte das Zollwesen, schuf Handelsgesetze, regelte Handel und Verkehr nach gesunden weitblickenden Grundsätzen und sorgte dafür, daß im Lande selbst Fabriken für unentbehrliche Bedarfsartikel gegründet wurden. Ebenso Großes schuf er auf dem Gebiete des Seewesens und der Kolonien. Bei seinem Tode war Frankreich die größte Kolonialmacht der Welt. Mit gleichem Glück hob er Kunst und Wissenschaft, schuf Akademien, Schulen, Bibliotheken und Sternwarten. Er war ein arbeitskräftiger, ideenreicher Kopf, fast noch schöpferischer als Richelieu. Dennoch erreichte er nicht, was er wollte, weil er sich auf die Dauer nicht gegen den Absolutismus Ludwigs XIV. zu behaupten wußte, dessen Kriegslust ihn um die Früchte seiner Arbeit brachte. Zuletzt war das Volk über neue Steuern so sehr erbittert, daß es den Leichenzug C.'s angriff, um an dem Toten, der sein Leben dem Wohl des Staates gewidmet, Rache zu nehmen. Jedenfalls war C. nie der kleinliche Intrigant, als den Dumas ihn zuerst erscheinen läßt.
Karl II., König von Großbritannien und Irland, 1630 bis 1685, mußte 1646 nach Frankreich fliehen, nahm aber 1649 nach der Hinrichtung seines Vaters Karls I. sogleich den Königstitel an, ging 1650 nach Schottland, fiel 1651 in England ein und mußte, bei Worcester völlig geschlagen, abermals nach Frankreich flüchten. Er unterhielt mit der Royalisten-Partei und namentlich mit General Monk stets eine geheime Verbindung und wurde 1660 nach dem Sturz der Republik vom Parlament zurückgerufen. Er war ein fröhlicher, aber nichts weniger als sittenstrenger König, der es, was die Zahl der Mätressen anbetrifft, dem König von Frankreich fast noch zuvortat. Auch nach außenhin war seine Regierung wenig würdevoll.
Monk, englischer Feldherr, 1608-1670, blieb im Anfang der englischen Revolution Karl I. treu, ging dann aber zur Parlamentspartei über. Nach Cromwells Tode trat er dem General Lambert entgegen, der die bürgerliche Gewalt niederzuwerfen trachtete, besiegte ihn und erlangte dann die Bildung eines neuen Parlaments, das den König wieder auf den Thron setzte. Seine langjährige geheime Verbindung mit Karl II. während des Protektorats ist nachgewiesen.
Maria Mancini, Nichte Mazarins und Jugendgeliebte Ludwigs XIV., 1639-1715. Eine berühmte Schönheit, gewann sie das Interesse und die Zuneigung des Königs, doch billigte Mazarin das Verhältnis nicht, entfernte sie vom Hofe und vermählte sie 1661 mit dem Fürsten Colonna von Neapel. Sie entfloh 1672 ihrem Gatten und kehrte an den Pariser Hof zurück, doch gelang es ihr nicht mehr, den König zu fesseln. Bis 1634 lebte sie dann in einem spanischen Kloster. – Ihre Schwester Olympia hatte längere Zeit eine Stellung als Surintendantin bei Hofe, da sie aber gegen mehrere Mätressen des Königs komplottierte, verwies Ludwig sie. Später stand sie in Beziehungen zu der berüchtigten Giftmischerin Voysin. Doch ist nicht bewiesen worden, ob sie wirklich ihren Gemahl, den Grafen von Soissons, und die Königin von Spanien vergiftet habe.
Luise von Labaume-Leblanc und von Lavallière, 1644-1710, wurde Ehrendame der Herzogin von Orléans, und obwohl sie nicht schön war, ja sogar ein wenig hinkte, bezauberte sie durch liebenswürdiges Wesen und große Anmut Ludwig XIV. Von 1661-1667 etwa war sie seine Geliebte, sie gebar ihm vier Kinder. Es ist Tatsache, daß allerlei Kriegslisten und Verführungskünste angewendet werden mußten, um ihre Keuschheit zu besiegen, obwohl es der König war, der um sie warb. Von 1667, wo der König sich der Montespan zuwandte, bis 1674 führte sie bei Hofe das traurige Dasein einer gestürzten Mätresse; dann trat sie in das Kloster der Karmeliterinnen zu Paris, wo sie als Luise von der Barmherzigkeit bis zu ihrem Tode blieb. Sie war die charaktervollste von allen Mätressen Ludwigs.
Athenais von Montespan (bei Dumas eine geborene Tonnay-Charente), die Tochter Gabriels von Rochechouart, Herzogs von Mortemart, kam erst durch ihren Mann, den Marquis von Montespan, als Ehrendame an den Hof, wo sie weniger durch Schönheit als durch Witz und Schlagfertigkeit die Aufmerksamkeit des Königs auf sich zog. Ihr Regime liegt in den siebziger Jahren, dann wurde sie dem König zu arrogant, zumal sie auch durch den Giftmischerprozeß gegen die Voysin, in welchem sie mitbelastet war, sich stark kompromittiert hatte. Sie gebar Ludwig XIV. fünf Kinder, als deren Erzieherin man Frau von Maintenon bestellte, welche nach ihr die bevorzugte Mätresse des Königs wurde. 1691 mußte sie den Hof verlassen.
Herzogin von Chevreuse, geborene Marie von Rohan, 1600-1679, eine berüchtigte Intrigantin, deren Haupttätigkeit in den Jahren der »Fronde« lag. In diesem Schlußbande der Romantrilogie sehen wir sie nur noch als erloschenen Stern.
Der Mann mit der eisernen Maske: ein geheimnisvoller Staatsgefangener aus der Zeit Ludwigs XIV. Ueber diese mysteriöse Persönlichkeit gibt es eine große Zahl von Legenden. Tatsache ist, daß er in den Büchern der Bastille unter dem Namen Marchioli geführt wurde (Dumas schreibt Marchiali). Alle Deutungen wurden als falsch nachgewiesen. Heute gilt als feststehend, daß es ein gewisser Mattioli war, Minister des Herzogs Karl Ferdinand von Mantua, den Ludwig XIV. verhaften und nach Pignerol schaffen ließ. Von dort kam er, als der Gouverneur des Pigneroler Gefängnisses versetzt wurde, mit ihm nach der Insel Marguerite und dann erst in die Bastille.
Dr. Hermann Eiler.
1. Kapitel. Eine Botschaft
Mitte Mai 1660 ritten im Schloßgarten zu Blois drei Männer, begleitet von zwei Pagen, über die Stadtbrücke, dem alten Schlosse zu. Die Leute, die am Quai spazieren gingen oder herumstanden, kümmerten sich nicht viel um die vornehme Gesellschaft. Kaum daß einer mal den Hut lüftete oder mit den Worten: »Da kommt Monsieur von der Jagd«, den Nachbar darauf aufmerksam machte. Gaston von Orléans führte, als ältester Bruder des verstorbenen Königs, noch immer den Titel Monsieur. Die guten Bürger von Blois hätten sich eigentlich etwas darauf einbilden können, daß Monsieur ihr heiteres Städtchen zu seinem Wohnort erkoren hatte, allein sie fanden an dem etwas schlafmützigen Herrn mit den trüben Augen und der matten Haltung kein Gefallen.
Monsieur ritt einen kleinen Apfelschimmel und saß auf einem Sattel aus flandrischem Sammet. Dazu trug er ein karmoisinrotes Wams, das ihn schön aus seiner Begleitung heraushob. Der Kavalier an seiner Seite, der Oberstallmeister, war violett gekleidet, der Oberjägermeister zu seiner linken grün. Einer der Pagen trug auf einer Stange zwei Falken, der andere ein Jagdhorn, in das er zwanzig Schritte vor dem Schlosse einmal hineinblies. Darauf traten acht Hellebardiere in Reih und Glied, und Monsieur ritt feierlich ins Schloß. Im Hofe stieg er vom Pferde und begab sich in seine Gemächer, wo der Kammerdiener ihm beim Umkleiden half. Dann streckte er sich in den Armstuhl und schlief ein. Die Hellebardiere wußten, daß sie von nun ab keinen Dienst mehr haben würden, und legten sich der Länge nach auf die Bänke, die eben von der Sonne warm beschienen wurden. Wenn nicht ein paar Vögel in den Hecken gezirpt hätten, hätte man glauben können, das ganze Schloß läge im Schlafe, als wäre es elf Uhr abends.
Diese Stille wurde plötzlich von einem lauten Lachen unterbrochen, das aus jener Ecke des Schlosses herüberschallte, in welche eben die Morgensonne hineinschien. Dort sah man einen kleinen, mit Blumen geschmückten Balkon, und auch in dem Zimmer stand auf einem viereckigen Tische eine langhalsige Vase mit einem Strauß Maiblumen. An diesem Tische saßen zwei Mädchen, die man nach ihrer Kleidung für entlaufene Klosterzöglinge hätte halten können. Die eine schrieb einen Brief, die andere sah ihr dabei zu. Die letztere, aus deren Munde das laute Lachen erklungen war, mochte neunzehn Jahre alt sein. Sie war brünett und hatte lebhafte Augen, die unter kühn geschwungenen Brauen unternehmend blitzten. Zwischen frischen roten Lippen glänzten perlenartige Zähne. Ihre Bewegungen hatten etwas Explosives. – Die andere, welche den Brief schrieb, hatte blaue träumerische Augen, klar und rein wie der Himmel an diesem Tage. Sie war blond und trug das Haar in weichen Locken. Ihre Wangen waren rosig. Ihre zarte, weiße Hand und ihre weichen Schultern waren zwar schön geformt, erschienen aber doch ein klein wenig zu mager.
»Montalais!« rief diese Dame in sanftem Tone, »du lachst wie ein Mann. Nicht doch so laut. Die Gardisten hören es ja – und wir selbst können nicht hören, wenn Madame klingelt.«
»Die Gardisten schlafen, Luise,« antwortete die Montalais. »Du könntest eine Kanone abschießen, sie würden jetzt nicht aufwachen. Und wenn Madame schellt, na, du weißt ja, das hört man bis über die Brücke. Du ärgerst dich nur, daß ich gerade jetzt lache, während du schreibst, weil du Angst hast, deine Mutter, die gute Frau von Saint-Rémy, könnte heraufkommen und uns überraschen. Dann würde sie natürlich das Blatt Papier da sehen, auf das du seit einer vollen Viertelstunde noch nichts weiter geschrieben hast als die Worte: ›Werter Herr Rudolf!‹ – Und wenn deine Mutter dich ertappte, so würde sie Zetermordio schreien.«
Darauf lachte sie wieder. Die junge Blondine wurde nun ernstlich böse und zerriß das Papier. – »Ei, ei,« rief die Montalais, »unser Lämmchen wird zornig? Sei doch vernünftig, deine Mutter kommt ja gar nicht. Und warum sollst du nicht einmal an einen alten Freund schreiben?« – »Nun schreibe ich eben nicht an ihn!« antwortete die Blondine. – »Wohl zur Strafe für mich?« rief die Montalais lachend. »Doch horch, da klingelt es. Jenun, Madame muß eben warten oder heute morgen auf die Gesellschaft ihres ersten Ehrenfräuleins verzichten.«
In der Tat hatte es geklingelt – das Zeichen, daß Madame das Frühstück erwarte. Alsbald setzte sich denn auch die Dienerschaft in Bewegung und trug die Speisen ins Schloß, und wo der feierliche Zug vorbeikam, da präsentierten die Hellebardiere, die das Glockenzeichen dem süßen Schlummer entrissen hatte.
»Madame muß ohne mich frühstücken,« sagte die Montalais. »Sie wird mich dafür bestrafen, indem sie mich nicht auf die Spazierfahrt mitnimmt, aber das ist es eben, was ich wünsche. Es ist immer dasselbe – immer die gleichen ausgefahrenen Gleise! Und zum Schluß geht's immer wieder an den Fenstern jenes Schloßflügels vorbei, wo sich Maria von Medici befunden, und immer wieder sagt Madame: ›Wie ist es möglich, daß sich die Königin Maria aus diesem Fenster retten konnte? Siebenundvierzig Fuß hoch! Die Mutter von zwei Prinzen und drei Prinzessinnen!‹ Ist das vielleicht eine Unterhaltung? Ich danke schön. Du hast gut reden, Luise. Du bist hier keinem Zwange unterworfen. Denn obwohl du ein Ehrenfräulein bist wie ich, hat doch Madame die Zuneigung, die sie für deinen Stiefvater hegte, auf dich übertragen. Du hast hier im Grunde weiter keine Pflichten als hin und wieder an deinen schönen Rudolf zu schreiben. Na, und das tu nur jetzt. Fang also getrost einen neuen Bogen an.«
»Wie kannst du so reden?« entgegnete Luise. »Du hast eine glänzende Zukunft. Du bist bei Hofe zugelassen. Wenn der König sich vermählt, wird Monsieur zu ihm gerufen werden; du wirst die Festlichkeiten mitansehen –«
»Und auch Rudolf sehen, der bei dem Prinzen ist,« warf die Montalais ein. »Doch genug! Du sollst an ihn schreiben.« – Und sie reichte Luise Feder und Papier.
»Und fang diesmal nicht an: Werter Herr Rudolf!« fuhr die Montalais fort, »sondern so, wie dir ums Herz ist. Schreibe also: Mein lieber Rudolf! – O, erröte doch nicht – ich lese es ja in deinen Augen – Und weiter schreibe: Du mußt dich gewiß sehr am Hofe zu Paris langweilen, daß du noch Zeit hast, an ein Mädchen aus der Provinz zu denken.«
Luise stand plötzlich auf. »Nein, Montalais,« versetzte sie, »so ist mir nicht ums Herz. Vielmehr so – und nun lies das!« Und sie schrieb mit raschem Entschluß ein paar Zeilen. – Die Montalais las: »Ich wäre unglücklich gewesen, wenn Sie mich weniger inständig um ein Andenken an mich gebeten hätten. Hier erinnert mich ja doch alles wieder an die schönen ersten Jahre, die wir zusammen verlebt haben und die mir unvergeßlich sind.« – »Bravo!« rief die Montalais, »so ist's richtig. Und was schreibst du zum Schlusse? ›Ich danke Ihnen, Rudolf, daß Sie meiner gedenken. Wundern kann mich's nicht; haben doch unsere Herzen oft füreinander geschlagen‹ ...«
In diesem Augenblick erklangen Hufschläge auf dem Schloßhof. Luise sprang ans Fenster und rief: »Rudolf ist's.« Dann sank sie vor dem noch unvollendeten Briefe nieder. – »Er kommt wie gerufen,« sagte die Montalais und sah neugierig hinaus. – »Zurück vom Fenster!« rief Luise und zog sie fort. – »Ach was!« rief die Mutwillige, »er kennt mich ja gar nicht, laß mich nur sehen!«
Es war ein großer schlanker Mann von etwa 25 Jahren, der in den Hof ritt. Das malerische Kostüm seiner Zeit stand ihm sehr gut. Er rief einen der Gardisten heran. »Melde mich,« sprach er, »ich bringe eine Botschaft für Seine Königliche Hoheit.« – »So will ich gleich den Hofmeister, Herrn von Saint-Rémy rufen,« antwortete der Bote, »das heißt, nur wenn es dringlich ist.« – »Das ist es,« versicherte der Reiter. »Ich muß so rasch wie möglich vor Seine Hoheit geführt werden.«
»Welchen Namen darf ich dem Hofmeister nennen?«
»Graf von Bragelonne aus dem Gefolge des Prinzen Condé.« – Der Soldat grüßte militärisch und eilte davon. Nach wenigen Minuten kam er zurück.
Ihm folgte die wohlbeleibte Gestalt des Herrn von Saint-Rémy, durch den raschen Lauf ganz außer Atem gebracht. – »Sie in Blois, Herr Graf von Bragelonne?« rief er, sich den Schmerbauch haltend. »Guten Tag! Wie wird sich Fräulein von Lavall ... hm, und meine Frau freuen, Sie zu sehen! Was bringen Sie denn? Hoheit frühstücken eben? Sind es gute Nachrichten?« – »Sehr gute und sehr wichtige.« – »Hoheit lassen sich nicht gern stören, doch in diesem Falle will ich es wagen, Sie sogleich zu melden. Hoheit sind zum Glück auch gerade in sehr guter Laune.« – Nach diesen Worten führte er den jungen Mann ins Schloß.
Monsieur und Madame saßen an ihrer reich gedeckten Tafel. Die Becher klirrten, die Schüsseln dampften, und Gaston von Orléans ließ sich's schmecken, als Saint-Remy mit der Meldung hereintrat, ein Bote vom Prinzen von Condé bitte um Einlaß. – Monsieur erschrak ein wenig. Es schien, als wenn der Name des großen Prinzen einen gespenstischen Schatten über die Tafel werfe. – »Wie heißt der Bote?« fragte er, um seine Bewegung vor seinem Haushofmeister zu verbergen. – »Graf von Bragelonne, ein Edelmann aus dieser Gegend,« antwortete Saint-Rémy. – Monsieur richtete einen fragenden Blick auf Madame. Sie nickte leicht mit dem Kopfe, und Gaston befahl, den Boten vorzulassen.
Rudolf von Bragelonne trat ein, verneigte sich tief vor dem erlauchten Paare und erwartete schweigend die Ansprache des Prinzen. Dieser wartete, bis der letzte der Dienerschaft das Zimmer verlassen hatte und die Türen geschlossen worden waren. – »Sie kommen von Paris?« fragte er dann, die Augen auf den Abgesandten heftend. »Was macht der König?« – »Es geht ihm gut, Königliche Hoheit.« – »Und meine Schwägerin?« – »Ihre Majestät die Königin-Mutter sind noch immer brustleidend, doch befinden sie sich besser.« – »Und Sie kommen im Auftrage des Prinzen von Condé?« – »Sehr wohl, und soll diesen Brief überreichen und auf Antwort warten.«
Gaston von Orléans nahm mit zitternder Hand das Schreiben in Empfang, betrachtete es mit verstörtem Blick, öffnete es dann, las es und rief in freudigem Tone: »Das ist ja eine sehr angenehme Ueberraschung! Madame lesen Sie nur! oder lesen Sie es bitte meiner Frau vor, Herr Graf!« – Rudolf sprang herzu, nahm Monsieur das Schreiben aus der Hand und las: »Königliche Hoheit! Majestät reisen an die Grenze. Binnen kurzem wird die Vermählung Seiner Majestät stattfinden. Nun würden Majestät gern einen Tag in Blois verleben, und ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob Sie damit einverstanden sind, daß ich Ihr Schloß in die Marschroute einsetze. Sollte Ihnen diese unvermutete Bitte Verlegenheit verursachen, so lassen Sie es mich durch den Ueberbringer dieses Schreibens alsbald wissen. Majestät würden dann eben nicht über Blois, sondern über Vendôme oder Romorantin reisen. In der Hoffnung jedoch, Eurer königlichen Hoheit damit einen Gefallen zu erweisen, bin ich Ihr Prinz von Condé.«
»Nichts könnte uns angenehmer sein,« rief Madame »Sagen Sie Herrn von Condé, wir danken für seine Aufmerksamkeit.« – »Wann wird Majestät kommen?« fragte der Prinz. – »Heute abend.« – »So schnell? Dann sind Majestät wohl schon in Orléans?« – »Noch näher, Hoheit. Wahrscheinlich schon in Meung.« – »Mit dem Hofe?« – »Jawohl.« – »Ich vergaß, zu fragen – wie geht es dem Kardinal?« – »Eminenz scheinen sich wohl zu befinden.« – »Seine Nichten sind jedenfalls bei ihm?«
»Nein, die Fräulein von Mancini sind auf Geheiß Seiner Eminenz nach Brouage gegangen und reisen am linken Loireufer, während der Hof am rechten reist.« – »Wie? Fräulein von Mancini verläßt den Hof?« rief Monsieur, und ein Funke seiner früheren Freude an Intrigen blitzte in seinen trübseligen Augen aus. Darauf entließ er den Grafen, klingelte und rief den hereintretenden Schranzen und Dienern die magischen Worte zu: »Seine Majestät der König werden heute abend hier eintreffen.«
»Es lebe der König!« riefen die Hofleute wie aus einem Munde, und Gaston von Orléans, der ein ganzes Menschenleben lang den Ruf: »Es lebe der König!« hatte mitanhören müssen, neigte betrübt das Haupt; denn er hatte diesen Ruf eine lange Zeit nicht mehr vernommen. Das erlauchte Paar verließ die Tafel, und Madame rief im Hinausgehen Herrn von Saint-Rémy zu, man solle dafür sorgen, daß Graf von Bragelonne aufmerksam verpflegt würde.
Der Haushofmeister nahm sich sogleich des jungen Mannes an, erhielt aber auf seine Einladung, im Schlosse zu bleiben, die Antwort: »Ich danke, Herr von Saint-Rémy aber ich habe Sehnsucht, den Grafen, meinen Vater, wiederzusehen.« – »Das ist begreiflich,« sagte der Haushofmeister. »Bitte, mich aufs beste zu empfehlen.« – Nach diesen Worten wollte Graf von Bragelonne in den Hof hinabsteigen, um sich sein Pferd vorführen zu lassen, doch plötzlich vertrat im dunklen Korridor die Gestalt eines Mädchens ihm den Weg. Es legte den Finger auf die Lippen und reichte ihm die Hand. – »Wollen Sie mir folgen, Herr Ritter?« fragte die junge Dame leise. – Der Graf zauderte nicht, sondern ließ sich von der zarten Hand, die die seine festhielt, fast willenlos fortführen. Der Weg war indessen zu kurz, als daß unterwegs der Graf Zeit gehabt hätte, sich wegen des Ziels, zu dem er geleitet würde, Gedanken zu machen. Die unbekannte Dame stieß eine Tür auf und zog ihn in ein Zimmer. Kaum trat er ein, so hörte er einen lauten Schrei und sah eine schöne Blondine mit blauen Augen und schneeweißen Schultern, die, seinen Namen nennend, mit gefalteten Händen in einen Stuhl sank. Rudolf erkannte sie, warf sich vor ihr auf ein Knie und vermochte nur das eine Wort hervorzubringen: »Luise!«
»O, Montalais,« flüsterte Luise, »wie konntest du mich so hintergehen?« – »Wieso denn hintergehen?« – »Du hast doch gesagt, du wolltest dich nur im Hofe erkundigen. Nun bringst du den Grafen zu mir!« – »Er muß sich doch den Brief abholen.« – Rudolf sah das Schreiben auf dem Tische liegen und streckte die Hand aus; da auch Luise eben danach griff, begegneten sich ihre Hände, und Rudolf zog die des jungen Mädchens ehrfurchtsvoll an die Lippen. Inzwischen nahm die Montalais den Brief an sich, faltete ihn zusammen und steckte ihn in den Busen. – »Hier ist er wohlgeborgen, Luise,« sagte sie. »Der Graf wird nicht so kühn sein, ihn aus diesem Versteck zu rauben. Nun, ich sehe, Luise, du hast mir verziehen, daß ich den Grafen herführte, und der Graf selbst wird mir deshalb gewiß auch nicht böse sein. So wollen wir denn wie alte Freunde miteinander reden. Luise, stelle mich zuerst dem Herrn Grafen vor.«
»Herr Vicomte,« sagte Luise mit holdem Lächeln, »gestatten Sie mir, Sie mit meiner besten Freundin, Aure von Montalais, Ehrendame an Madames Hofe, bekannt zu machen. Sie sind ihr bereits bekannt. Meine Freundin weiß alles.« – Die Montalais nickte lachend. – »Schluß nun mit den Höflichkeiten!« rief sie. »Nehmen Sie Platz, Graf, und erzählen Sie, was für eine Botschaft Sie zu bestellen hatten.« – »Es ist kein Geheimnis mehr, Fräulein,« antwortete Rudolf. »Der König kommt nach Blois.« – Die Montalais war sogleich wie aus dem Häuschen. »Den König und den Hof sollen wir sehen?« rief sie, in die Hände klatschend. »Aber wann denn, Vicomte?« – Als sie jedoch erfuhr, daß Majestät schon am Abend dieses Tages kommen werde, zog sie ein saures Gesicht. – »Da hat man ja nicht mal Zeit, sich zu putzen,« schmollte sie. – »Trösten Sie sich,« antwortete Rudolf galant, »Sie sind ja immer schön.« – »Sehr gütig, Herr Graf! Also heute abend – mit dem ganzen Hofe? Sind die Fräulein Mancini auch dabei?« – »Nein, die sind nicht im Gefolge.« – »Aber man sagt doch, der König könne ohne Fräulein Marie von Mancini nicht leben.« – »Er wird wohl ohne sie leben müssen, denn der Kardinal hat sie aus seiner Nähe verbannt.« – »O, dieser Heuchler!« rief die Montalais und ließ sich durch eine warnende Gebärde Luisens nicht abschrecken hinzuzusetzen: »Ach was, es hört uns hier niemand. Mazarino Mazarini ist ein Heuchler, ich wiederhole es. Es wäre ihm nichts lieber, als wenn er seine Nichte Maria zur Königin von Frankreich machen könnte!«
»Nicht doch,« versetzte der Graf. »Hat doch Mazarin selbst Seiner Majestät die Infantin Maria-Theresia zur Gemahlin bestimmt. Zwischen Don Louis de Hara und Seiner Eminenz ist der Ehekontrakt schon abgeschlossen worden.« – »Also liebt der König Fräulein von Mancini nicht?« – »Im Gegenteil, er betet sie an.« – »Na, dann wird er sie auch heiraten. Und wenn's darüber zum Kriege mit Spanien käme.« – »Rede doch nicht so närrisches Zeug, Montalais,« rief Luise dazwischen. »Die Königin-Mutter wünscht, daß ihr Sohn die Infantin heirate, und er wird seiner Mutter nicht ungehorsam sein. Vor kindlichem Gehorsam muß die Liebe zurückstehen.« – Mit einem Seufzer schlug Luise die Augen nieder, während die Montalais mit übermütigem Lachen rief: »Ei nun, ich habe keine Eltern mehr.«
Doch mitten in ihrem Lachen unterbrach sie sich und horchte mir ernster Miene nach der Tür hin. »Mein Gott, es kommt jemand,« sagte sie. – »Wer kann das sein?« rief Luise ängstlich. – »Nach dem schwerfälligen Schritt zu urteilen, ist es Herr Malicorne,« sagte die Montalais. »Nun, der ist nicht eifersüchtig.« – »Nein,« rief Luise erschrocken, »er ist es nicht! Es ist meine Mutter – ich kenne ihren Schritt.« – Frau von Saint-Rémy!« sagte Rudolf betroffen. »Wo soll ich mich verbergen?« – »Ja, wahrhaftig,« sprach die Montalais, »nun erkenne ich auch die klappernden Stelzschuhe der Frau Mama. Nur ruhig Blut, Herr Graf! Das Fenster hier ist leider fünfzig Fuß hoch und geht auf einen gepflasterten Hof hinaus. Aber Sie können hier in diesen Schrank eintreten, der ist wie gemacht dafür.«
Frau von Saint-Rémy stieg rascher als gewöhnlich die Treppe hinauf und trat eben ein, als die Montalais den Schrank schloß und sich an die Tür lehnte. – »So finde ich dich doch hier, Luise?« rief Frau von Saint-Rémy in ungehaltenem Tone. – »Ja, Mutter,« antwortete Luise kleinlaut, als wäre sie über einem schweren Vergehen ertappt worden. – »Bitte, nehmen Sie doch Platz, gnädige Frau,« sagte die Montalais, ohne vom Schranke wegzutreten, doch Frau von Saint-Rémy lehnte in etwas spitzem Tone ab. »Ich danke, Fräulein Aure,« sagte sie. »Komm rasch mit mir, Kind, du mußt anfangen, Toilette zu machen,« wendete sie sich an Luise. »Wissen Sie denn etwa die große Neuigkeit noch nicht?« fragte sie mit einem Blick auf die Montalais. »Sollte wirklich noch niemand bei Ihnen gewesen sein?«
Dabei sah sie nach dem Tische hin, und Luise, ihrem Auge folgend, sah nun zu ihrem Entsetzen, daß Rudolf dort seinen Hut hatte liegen lassen. Die Montalais stellte sich rasch vor den Tisch, und Frau von Saint-Rémy fuhr fort, als wenn sie wirklich nichts gesehen hätte: »Es ist eben ein Eilbote mit der Nachricht angekommen, daß heute abend der König eintreffen wird. Da müssen sich alle jungen Damen schön machen. Also komm, Luise!«
Das junge Mädchen folgte der Mutter, die auf dem Wege zur Tür noch leise die Worte sprach: »Ich habe dir doch verboten, zur Montalais zu gehen! Und wem gehört der Hut auf dem Tische? Sicher diesem Tagedieb, dem Malicorne. Ein Ehrenfräulein darf mit solchem Taugenichts auf keinen Fall –«
Die andern Worte verloren sich auf dem Korridor, so daß die Montalais sie nicht mehr hörte. Sie zuckte leichthin die Achseln und ließ Rudolf aus seinem Versteck heraus. – »Verlassen Sie das Schloß so rasch wie möglich,« sagte sie, »damit uns durch irgendwelche Indiskretion der guten Dame nicht etwa Unannehmlichkeiten entstehen. Leben Sie wohl!« – »Werde ich von Luise hören?« fragte Rudolf. – »Gewiß, gewiß. Nur Mut! Hier in Blois kümmern wir uns nicht allzusehr um Papas und Mamas Einwilligung. Fragen Sie nur Malicorne.«
Rudolf schlich in den Hof, holte sein Pferd, schwang sich in den Sattel und ritt spornstreichs davon.
Er folgte der wohlbekannten Straße, an die sich viele ihm teure Erinnerungen knüpften, und bemerkte bald das spitze Dach, die beiden Türmchen und die Schwärme von Tauben, die sie umflogen. Ein Jahr war es nun her, daß er seinen Vater nicht wiedergesehen hatte, und diese ganze Zeit über war er beim Prinzen Condé gewesen. Nach den stürmischen Zeiten der Fronde hatte Condé sich feierlich mit dem König ausgesöhnt. Solange Feindschaft zwischen ihnen bestand, war Graf von Bragelonne dem Prinzen ferngeblieben und hatte, statt an dessen revolutionären Unternehmungen teilzunehmen, unter Turenne für den König gekämpft. Condé war Bragelonne sehr zugetan und verübelte ihm diese Königstreue nicht; vielmehr nahm er ihn nach der Aussöhnung mit dem Hofe mit Freuden bei sich auf. So jung Rudolf auch noch war, so hatte er doch unter Turenne und unter Condé bereits in zehn siegreichen Schlachten mitgefochten und durfte sich einen Soldaten nennen, dessen Schild durch keine Niederlage befleckt war.
Rudolf fand die Gartentür offen und ritt ohne weiteres hinein, ungeachtet der zornigen Gebärden eines alten Mannes, der am Wegesrande stand und offenbar erst um Erlaubnis zum Eintritt gefragt sein wollte. Der Alte arbeitete an einem Blumenbeete und trat entrüstet auf den Reiter zu; doch kaum hatte er dessen Gesicht gesehen, so warf er sein Arbeitszeug weg und rannte mit Zeichen höchster Freude auf das Haus zu. Der Graf ritt ruhig weiter, gelangte in den Hof, gab sein Pferd einem Knecht, ging ins Haus und trat in das Zimmer des Grafen de la Fère.
Der Graf war noch immer eine schöne stattliche Erscheinung, obwohl nun sein Haar fast weiß geworden war und der Schnurrbart stark ins Graue spielte. Trotz des Alters hatte der Mann, dem so mancher erlauchte Mund unter dem Namen Athos Lob und Dank gesprochen, noch nichts von seinem imposanten Aeußern eingebüßt. – Rudolf umarmte ihn so zärtlich und so stürmisch, daß der Graf sich nicht loszumachen vermochte. – »Rudolf!« rief er endlich, einen Schritt zurücktretend. »Du hier? Hast du Urlaub oder ist etwas passiert?« – »Ich war als Abgesandter des Königs in Blois. Majestät will seinem Oheim einen Besuch abstatten.« – »So hast du Monsieur gesehen? Ich wünsche dir Glück dazu.« – Rudolf verneigte sich. Athos sah ihm prüfend ins Auge. – »Wen hast du sonst noch in Blois gesehen?« – »Ich habe auch Madame gesehen, Vater,« antwortete der junge Mann. – »Ja doch, aber an die dachte ich dabei nicht,« versetzte Athos mit einem strengeren Blick. »Oder verstehst du mich nicht, Rudolf?«
»Ich verstehe Sie sehr wohl, Vater,« erwiderte Rudolf errötend. »Auch sinne ich nicht auf Ausflüchte, wenngleich ich nicht sofort eine Antwort bereit habe.« – »Also hast du Fräulein von Lavallière gesehen?« fragte der Vater. – »Ja. Ich wußte nicht, daß sie im Schlosse zu Blois sei, der Zufall führte mich zu ihr.« – »Der Zufall?« entgegnete der Graf de la Fère. »Und in welcher Gestalt erschien dir dieser Zufall?« – »In der Gestalt eines Fräuleins von Montalais.« – »Was ist das für eine Dame?« – »Ich habe sie nie zuvor gesehen und weiß nur, daß sie Ehrendame der Herzogin von Orléans ist.« – »Genug, ich habe dir geraten, Fräulein von Lavallière aus dem Wege zu gehen. Wenn nun der Zufall seine Hand im Spiele hatte, so kann ich dir ja wohl keinen Vorwurf machen. Mein Wunsch ist es und bleibt es, daß du sie nicht besuchst. Merke dir das ein für alle Mal, Rudolf. Und nun von etwas anderm! Kehrst du gleich in deinen Dienst zurück?« – »Nein, lieber Vater, ich kann den ganzen Tag bei Ihnen weilen. Der Prinz hat mir weiter keinen Auftrag gegeben, als den, den ich nun erledigt habe.« – »Er und der König sind wohlauf?« – »Wie immer. Vater.« – Nach Mazarin erkundigte sich der alte Herr nicht – er hatte schon früher nie nach ihm gefragt.
»Es freut mich, daß ich dich einen ganzen Tag bei mir habe – so will ich mich auch durch nichts abhalten lassen,« rief er. »Doch da ist ja unser alter Grimaud. Komm her, Mann, laß dich von dem Burschen hier umarmen.« – Das ließ sich Grimaud nicht zweimal sagen, eilte herbei und drückte den Jüngling an die Brust. Als dann Vater und Sohn in den Garten gingen, sah er ihm mit Tränen im Auge nach. »Wie groß er geworden ist!« murmelte er und strich seinen weißen Knebelbart. Und er hatte recht. Rudolf reichte mit dem Kopfe fast an den Querbalken der Tür heran.
2. Kapitel. Der Unbekannte
In Blois herrschte große Aufregung, wurde doch der König mit dem gesamten Hofstaat erwartet, und wo sollten alle diese Menschen, 100 Reiter, 10 Kutscher, 200 Pferde und ebensoviele Diener und Hofleute untergebracht werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich alsbald die ganze Stadt. Im Schlosse gar ging alles Hals über Kopf, denn die Zeit für die Vorbereitungen war knapp bemessen, und es galt, Wildbret zu holen, Fische zu beschaffen und Blumen zur Verzierung der Tafel zu besorgen. Eine ganze Schar von armen Leuten wurde aufgeboten, die die Höfe und Gärten ausfegen mußten.
Im untern Teile der Stadt, kaum hundert Schritte vom Schlosse entfernt, stand in der schönen Altgasse ein ehrwürdiges Haus mit spitzem Giebel, das im ersten Stock drei, im zweiten zwei, im dritten nur ein Fenster hatte. Der Sage nach hatte zur Zeit Heinrichs III. ein Stadtrat darin gewohnt, der auf Betreiben der Königin Katharina erdrosselt worden war. Nachher hauste darin ein Italiener namens Cropoli, ein ehemaliger Koch des Marschalls von Ancre. Der Mann hatte aus dem Hause eine kleine Restauration gemacht und war besonders wegen seiner schmackhaften Maccaroni weit und breit bekannt geworden, namentlich seit die Königin Maria von Medici, die im Schlosse gefangen gewesen, sich einmal eine Schüssel voll von dieser Spezialität hatte holen lassen. Als er starb, übernahm sein Sohn das Restaurant, änderte seinen italienischen Namen in einen französischen um, indem er aus Cropoli Cropolé machte, und ließ einen berühmten Maler kommen, der ein Schild mit den Bildnissen zweier Königinnen und mit der Inschrift »Zu den Medicis« malen mußte.
Das Gasthaus Cropolés erfreute sich eines großen Zuspruchs, und der Besitzer, der sich inzwischen auch mit einer jungen Französin verheiratet hatte, welche sogar eine hübsche Summe Geldes mit einbrachte, war auf dem besten Wege, ein reicher Mann zu werden. Daß dies so rasch wie möglich geschähe, war natürlich sein innigstes Verlangen. Anläßlich des Königsbesuchs hoffte er nun ein schönes Stück Geld auf einmal zu verdienen.
Im Gasthaus logierte zur Zeit nur ein Fremder, ein großer, stattlicher Mann von etwa dreißig Jahren und ernstem, fast trübsinnigem Wesen. Er trug ein Wams aus schwarzem Sammet mit weißem Kragen von puritanischem Schnitt. Ueber seiner etwas sarkastischen Oberlippe kräuselte sich ein blonder Schnurrbart. Seine blauen Augen hatten einen durchdringenden Blick, dem man schwer standhalten konnte.
Zu der damaligen Zeit gab es eigentlich nur zwei Klassen Menschen, den Kavalier und den gemeinen Mann, und diese beiden Klassen waren damals ebenso scharf voneinander geschieden wie heutzutage die weiße und die schwarze Rasse. Cropolés Gast nun mußte selbst auf einen flüchtigen Blick hin der ersteren Klasse zugezählt werden: man erkannte in ihm sofort einen Edelmann von reinstem Wasser. Trotzdem aber behagte es nun dem Wirt nicht, daß dieser alleinstehende Fremde die besten Zimmer seines Gasthauses innehatte, zumal er nach einer kurzen Mitteilung, daß er einen Herrn namens Parry erwarte, welcher sofort nach der Ankunft zu ihm zu führen sei, den Mund viele Stunden hintereinander nicht wieder geöffnet hatte. Erst als draußen lauter Lärm erscholl, und ungewöhnlich lebhaftes Treiben die sonst so stille Stadt erfüllte, erwachte er aus seiner gleichgültigen Ruhe und fragte nach der Ursache dieser Aufregung.
Cropolé nahm die Gelegenheit beim Schopfe und erzählte, daß der König erwartet würde, und daß er selbst nun in die größte Verlegenheit käme, da er für die zu erwartenden Gäste keine Zimmer mehr zur Verfügung hätte. – »Wie?« rief der Unbekannte entrüstet, »soll das etwa heißen, daß ich die Wohnung räumen soll? Sind Sie argwöhnisch? Halten Sie mich für arm? Fürchten Sie, nicht zu Ihrem Gelde zu kommen?« – »Durchaus nicht,« versetzte Cropolé geschmeidig, »allein Monsieur werden begreifen, es ist dies eine günstige Gelegenheit, ein Geschäftchen zu machen, die Zimmer teurer zu vermieten als sonst –« – »Herr Wirt,« versetzte der Fremde, »wenn der König nach Blois kommt, so ist dies für mich ein triftiger Grund, hier zu bleiben. Wieviel wollen Sie unter diesen veränderten Umständen für Ihre Zimmer haben?« – »Wenn Monsieur die ganze Wohnung haben wollen – oder wäre Monsieur damit einverstanden, ein paar Zimmer abzutreten, damit ich sie an das königliche Gefolge weitervermieten kann –?«
»Die ganze Wohnung behalte ich,« versetzte der Fremde, der eine etwas lispelnde Aussprache hatte, wie man sie bei Engländern findet. »Die ganze Wohnung, machen Sie Ihren Preis.«
»Jenun,« antwortete Cropolé, »der König kommt, viele Menschen werden Unterkunft suchen, da steigt der Tarif natürlich. Ich kann da spielend zwei Louisdors für das Zimmer herausschlagen.« – »Und ich habe drei Zimmer inne,« unterbrach ihn der Unbekannte. »Das wären also sechs Louisdors, und einen bewillige ich außerdem noch für Fütterung des Pferdes. Sind Sie zufrieden, Herr Wirt?« Mit diesen Worten zog er eine gestickte Börse, allein sie sah ziemlich schlaff aus, was dem scharfen Blick des Wirtes nicht entging. Sie enthielt denn auch nur noch sechs Louisdors, und um die erforderliche Summe vollzumachen, mußte der Gast seine Taschen umdrehen. Mit knapper Not fand sich soviel Geld zusammen, wie die Rechnung betrug.
»Ich danke bestens,« sprach der Wirt, das Geld einstreichend. »Dies wäre der Preis für heute. Gedenken Monsieur nun die Wohnung auch für morgen noch zu behalten? Oder könnte ich –?« – »Auch für morgen noch!« rief der Fremde. »Doch Sie haben es ja gesehen, Cropolé – ich habe kein Geld mehr. Nehmen Sie also diesen Diamantring – er ist unter Brüdern 300 Pistolen wert. Verkaufen Sie ihn so vorteilhaft wie möglich. So viel, wie die Wohnung kostet, schlagen Sie allemal heraus.«
»Aber ich bin kein Kenner von Schmucksachen,« wandte der Wirt bedenklich ein. – »So werden Sie hier einen Goldarbeiter finden, der Kenner ist,« erwiderte der Fremde. »Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Unsere Rechnung ist beglichen.« – Cropolé verneigte sich. »Wenn ich Monsieur beleidigt haben sollte, so bitte ich die Umstände zu berücksichtigen und es mir nicht übelzunehmen,« sprach er noch, aber der Fremde machte eine so abweisende, energische Handbewegung, daß der Wirt es vorzog, sich zu empfehlen.
Als er gegangen war, senkte der Fremde den bisher so majestätischen Blick zu Boden, und ein bitteres Lächeln der Hoffnungslosigkeit spielte um seine zusammengepreßten Lippen. Stumm und unbeweglich saß er am Fenster und blickte hinaus, bis die Nacht einbrach und in allen Fenstern Licht aufflammte. Während er saß und schaute, erklang unten plötzlich der Ruf: »Der König kommt! Der König kommt!« – Gleich darauf näherte sich, begleitet von vielen lodernden Fackeln, der Zug des Hofes. Eine Kompagnie Musketiere und eine Schar berittener Edelleute bildeten den Vortrab. Dann folgte, von vier Rappen gezogen, die Equipage des Kardinals Mazarin, hinter der seine Pagen und Diener einherschritten. Dann kam die Kalesche der Königin-Mutter mit einer Escorte von Ehrendamen und Kavalieren. Dann – auf einem schönen Pferde mit langer Mähne – der König – zwei Schritte hinter ihm Prinz von Condé, Dangeau und zwanzig andere Hofherren, begleitet von einem zahllosen Gefolge an Dienern und Gepäckträgern. Der ganze Zug wies eine fast strenge militärische Ordnung auf, auch trugen fast alle Höflinge und Diener Soldatentracht, nämlich das Wams von Büffelleder mit dem Ringkragen à la Henriquatre.
Der Fremde lehnte sich zum Fenster hinaus. Das Schmettern der Trompeten, der Jubel des Volks brauste ihm in den Ohren und schien ihm auf einen Augenblick die ruhige Ueberlegung zu rauben. »Der König ist es!« flüsterte er mit einem Ausdruck der Seelenangst und Verzweiflung. Der Zug war vorüber, die Wirtsleute drängten sich noch in der Tür, als ein alter Mann, der ein irländisches Pferd am Zügel führte, herantrat und Einlaß forderte. Er überließ seinen Gaul dem Stallknecht und eilte die Treppe hinauf, wo der Fremde, der ihn hatte eintreten sehen, ihn schon erwartete.
Sie fielen sich in die Arme. – »O, Parry!« rief der junge Mann, »Sie kommen von England – eine so weite Reise in diesem Alter! Setzen Sie sich, Sie haben in meinem Dienste gar schwere Mühsal zu ertragen. Gönnen Sie sich Ruhe!« – »Vor allem,« antwortete der Alte, »habe ich Ihnen die Antwort zu überbringen.« – »Und sie lautet ungünstig, Parry,« unterbrach ihn der Fremde, »sonst würdest du nicht so anfangen. O wehe mir, du hast mir nichts Gutes zu melden.« – »Nicht verzweifeln, Mylord!« antwortete der Greis, »noch ist nicht alles verloren. Fester Wille, Beharrlichkeit und vor allem Ergebung – das tut uns not.«
»Parry,« antwortete der junge Mann, »durch tausend Gefahren habe ich mich bis hierher durchgekämpft. Zehn Jahre lang habe ich an dem Gedanken, diese Reise auszuführen, hartnäckig festgehalten. Heute habe ich den letzten Diamanten meines Vaters verkauft, um den Wirt hier zufriedenzustellen. Zweifelst du an meinem festen Willen?« – Der Greis hob seine zitternden Hände gen Himmel. – »Sei getrost,« fuhr der Fremde fort, »der Wirt hat den Edelstein verkauft, und nach Abzug seiner Forderung bleiben mir noch 274 Pistolen. Damit halte ich mich für reich. Doch nun erzähle mir alles! Was hat der General gesagt?«
»Zuerst wollte er mich gar nicht vorlassen, und nachdem ich in einem Briefe Ihre Lage und Ihre Absichten eingehend erläutert hatte, ließ er mir sogar mit Verhaftung drohen.« – »Aber du hattest doch mit ›Parry‹ unterzeichnet?« – »Gewiß, und dem Adjutanten des Generals war ich auch von St. James her wohlbekannt.«
»So drohte dir der General vor den Leuten,« sprach der junge Mann, »aber was tat er, als du mit ihm unter vier Augen warst? Was sagte er da?« – »Er schickte mir vier Reiter, Mylord, die mich zum Hafen Terby brachten – ohne Aufenthalt, ohne Rast. Vom Hafen schafften sie mich in ein kleines Fischerboot, das eben nach der Bretagne in Segel ging. Und nun bin ich hier.«
»Und das ist alles, Parry?« rief der junge Mann, den Kopf in beide Hände pressend. – »Das ist alles, Mylord.« – Dieser kurzen Antwort Parrys folgte ein langes Schweigen, der junge Mann schritt in heftiger Erregung auf und ab. Der Alte wollte dem Gespräch eine Wendung geben und fragte daher, was der Lärm auf den Straßen zu bedeuten hätte. – »Das weißt du nicht?« antwortete der junge Mann. »Der König von Frankreich ist zum Besuch nach Blois gekommen. Sein Minister, der ihm Millionen zusammenscharrt, führt ihn einer reichen Braut zu. Das Volk begrüßt ihn mit Jubelgeschrei. Und während dieser Ludwig in Saus und Braus lebt, haben meine Schwester und meine Mutter nicht satt zu essen. Und wenn Europa erfährt, was du eben erzählt hast, so werde ich in allen Landen verspottet werden. Doch freilich, Parry,« rief er mit ungestümer Gebärde und gürtete das Schwert um, »wenn ich wie eine feige Memme nichts für mich selbst tue, was soll mein Gott für mich tun. Noch habe ich zwei Arme, noch ein Schwert – –!«
»Mylord,« rief der Greis, »was wollen Sie tun?« – »Was meine ganze Familie tut, was meine Mutter und meine Schwester tun und meine Brüder! Betteln um ein Almosen.« Er lachte wild auf, nahm den Hut zur Hand, warf den schwarzen Mantel um und stürmte hinaus. Parry sprang ans Fenster und sah ihn bald verschwinden.
Inzwischen war der König von Gaston von Orléans empfangen worden und weilte nun in demselben Schlosse, in welchem vor 72 Jahren Heinrich III. zu Mord und Verrat gegriffen hatte, um seinem Haupte und seiner Familie eine Krone zu erhalten, die schon von seiner Stirn zu gleiten begann. Ludwig, der junge Herrscher, war ein vollendeter Kavalier. Von ganz besonderer Schönheit waren seine tiefblauen, zugleich feurigen und sanften Augen, die mit dem Blau der unendlichen Himmelsräume, aber auch mit dem schrecklicheren Blau der Meerestiefe wetteifern konnten. Er war nicht groß, kaum fünf Fuß zwei Zoll; aber in all seinen Bewegungen lag dennoch Adel und körperliche Gewandtheit.
Viele freilich mochten die jugendliche Erscheinung für nicht königlich genug halten, weil man an ihrer Seite immer die hohe Gestalt der Königin-Mutter und die stattliche Figur des Kardinals Mazarin erblickte, und namentlich dem letzteren galt das allgemeine Augenmerk, denn es war ja ein öffentliches Geheimnis, daß er der eigentliche König von Frankreich war.
Während Gaston von Orléans mit dem König und dem Kardinal sprach und sich angelegentlich nach dem Befinden der drei Nichten Mazarins erkundigte, die dieser vor kurzem aus Italien hatte herbeigerufen, machte die Herzogin die Königin mit ihren Hofdamen bekannt und stellte ihr der Reihe nach Mademoiselle Arnoulx, Mademoiselle von Montalais und Luise von Lavallière vor. Ludwig XIV. verließ die beiden Herren und trat zu Mutter und Tante hinüber, um die jungen Damen zu mustern, die sich vor den Hoheiten tief verneigten.
»Gnädigste Frau Tante,« sagte der junge König lachend, »ist denn Blois gar so weit von Paris entfernt, daß die Moden mehrere Jahre brauchen, um hier herüberzugelangen. Diese Damen erscheinen noch alle in der Tracht, die man längst in die Rumpelkammer verbannt hat. Das hat man vor zehn Jahren getragen. Sehen Sie nur das weiße, veraltete Kleid dort mit dem lächerlichen Spitzenbesatz! Lassen Sie die Dame nähertreten. Sie weiß sich selbst in diesem Aufputz noch graziös und ungezwungen zu bewegen. Die andern erscheinen mir gegen sie wie Holzpuppen, mit Stoff behangen. Wie heißt dieses Mädchen?« – »Treten Sie näher, Luise,« befahl Madame, und die schöne Blondine, die wir schon kennen, kam schüchtern heran. – »Fräulein Luise Franziska von Labaume-Leblanc, die Tochter des Marquis von Lavallière und Stieftochter meines Haushofmeisters, des Herrn von Saint-Rémy,« sagte Madame in feierlichem Tone zum König. – Luise sah und hörte nichts, es summte ihr in den Ohren, vor ihren Augen verschwamm alles, und der König streifte das Mädchen nur noch mit einem flüchtigen Blick und trat dann zu den Herren zurück.
»Meine Nichten müssen vor allem erst ihre Erziehung beenden, gnädigster Herr Herzog,« sprach Mazarin zu Gaston von Orléans. »Ist dieses geschehen, so hoffe ich anständige Partien für sie zu finden, was mir nicht schwer fallen wird, denn Gott hat ihnen Anmut, Schönheit und Geist verliehen. Namentlich der jüngsten, der Maria. Sie sind unterwegs nach Brouage und müssen zur Zeit schon weit weg von Blois sein.« – Diese Worte sprach der Kardinal absichtlich laut, daß Ludwig, der eben von den Damen wegtrat, sie hören mußte. Sie trafen sein Herz wie ein vergifteter Pfeil, und obwohl der junge König sich schon soweit beherrschen gelernt hatte, daß er jetzt nur durch ein leichtes Erröten seine Erregung verriet, so war es doch für einen Mann, der seit zwanzig Jahren alle Diplomaten Europas an der Nase herumführte, ein leichtes, die tiefe Wirkung seiner Worte zu erkennen. Von diesem Augenblick an hatte nichts mehr Interesse für den König. Seit er erfahren, daß Maria von Mancini nicht nach Blois kommen würde, fühlte er sich unerträglich gelangweilt und benutzte die erste Gelegenheit, sich zurückzuziehen. Monsieur selbst geleitete die Majestät in ihre Schlafgemächer. Es waren dieselben, die einst König Heinrich III. bewohnt hatte. Auf dem Wege in diesen Teil des Schlosses machte Gaston von Orléans plötzlich halt, öffnete die Tür eines düstern Vorzimmers und sprach: »Dies ist der Ort, wo der Herzog von Guise ermordet wurde. Genau an dieser Stelle sank er nieder und riß im Fall die Vorhänge des Bettes dort mit sich. Er stand fast ebenso da, wie jetzt Eure Majestät und neben ihm – so wie jetzt Euer Musketier-Leutnant neben Euch steht – stand Herr von Loignes. Das andere Gefolge befand sich ein paar Schritte hinter ihm.«
Der König, der von der Geschichte seines Landes nur beschränkte Kenntnis hatte, erbebte leicht und sah sich um. Sein Blick fiel auf einen Offizier, der mit seinen funkelnden Augen, seinem schwarzen Schnauzbart und der imposanten Adlernase ein Muster militärischer Schönheit war.
»Es ist wahr,« sprach dieser Haudegen und warf sein langes, graues Haar in den Nacken, »hinterrücks und meuchlerisch ist er niedergestoßen worden.« – »Und weil der Blutfleck auf den Dielen,« fuhr der Herzog von Orléans fort, »nicht auszumerzen war, sind ganze Stücke des Holzes herausgebrochen worden, wie Majestät bemerken werden.« – »Lassen Sie uns weitergehen, mein Herr Oheim,« sagte der König leise.
Als er sein Schlafzimmer betreten hatte, übernahm der Offizier mit der Adlernase den Kammerdienst, untersuchte plötzlich alle Zugänge und Nebengemächer und quartierte sich mit zehn Musketieren im Vorgemach ein.
Gleich darauf geleitete Monsieur, der Herzog, auch Mazarin in seine Gemächer, und Madame, die Herzogin, führte Anna von Oesterreich, die Königin-Mutter, in die ihrigen. Auf den Treppen, vor den Toren, bezogen die Soldaten von der Wache ihre Posten, und überall im Schlosse herrschte Ruhe.
Nicht lange, so fuhr einer dieser Wachtposten aus seinem Halbschlummer empor, reckte sich steif in die Höhe und rief in die nächtliche Stille: »Wer da?« – »Gut Freund!« erklang die Antwort, und die Gestalt eines fremden Mannes, in einen weiten dunkeln Mantel gehüllt, zeigte sich vor ihm. – »Euer Begehr?« – »Ich will mit dem König reden.« – »Das geht nicht an.« – »Führen Sie mich zum Offizier vom Dienst,« antwortete der Fremde. – »So gehen Sie die Treppe da hinauf!« sagte der Soldat, und gleichzeitig rief er nach oben: »Leutnant, es fragt jemand nach Euch!«
Der Offizier rieb sich die Augen und trat aus der Stube. Im nächsten Augenblick stand der Fremde, kein anderer als der Unbekannte aus dem Gasthause »Zu den Medicis«, vor ihm und wiederholte: »Ich muß mit dem König reden.« – Der Leutnant sah den Mann prüfend an und erkannte mit dem Blick eines Kenners, daß er eine hervorragende Persönlichkeit in unscheinbarem Gewande vor sich habe. – »Der König schläft schon oder ist beim Auskleiden. Sie wissen doch wohl auch, daß ohne Audienzschein niemand vorgelassen wird.« – »Wenn er erfährt, wer ich bin,« antwortete der Unbekannte, »so wird er eine Ausnahme machen und mich vorlassen.« – »Nun denn, wen soll ich melden?«
»Seine Majestät Karl II., König von England, Schottland und Irland,« war die Antwort. – Der Offizier unterdrückte einen Ausruf des Erstaunens und trat zurück. »Verzeihung, Majestät,« sagte er, »ich hätte Sie erkennen sollen.« – »Wieso? Haben Sie mich schon früher einmal gesehen?« – »Nein, Majestät, aber ich sah Ihren Vater in einem furchtbaren Augenblick –« Er verstummte und richtete einen tieftraurigen Blick auf den landesflüchtigen König. – »An dem Tage, wo –?« fragte Karl II. – und ein stummes Nicken des Offiziers war die Antwort. 1





























