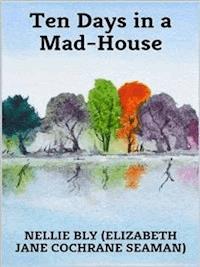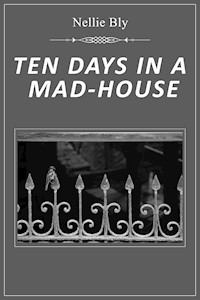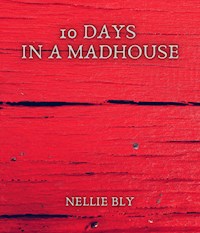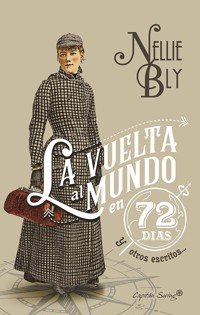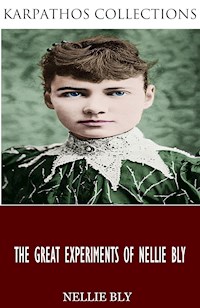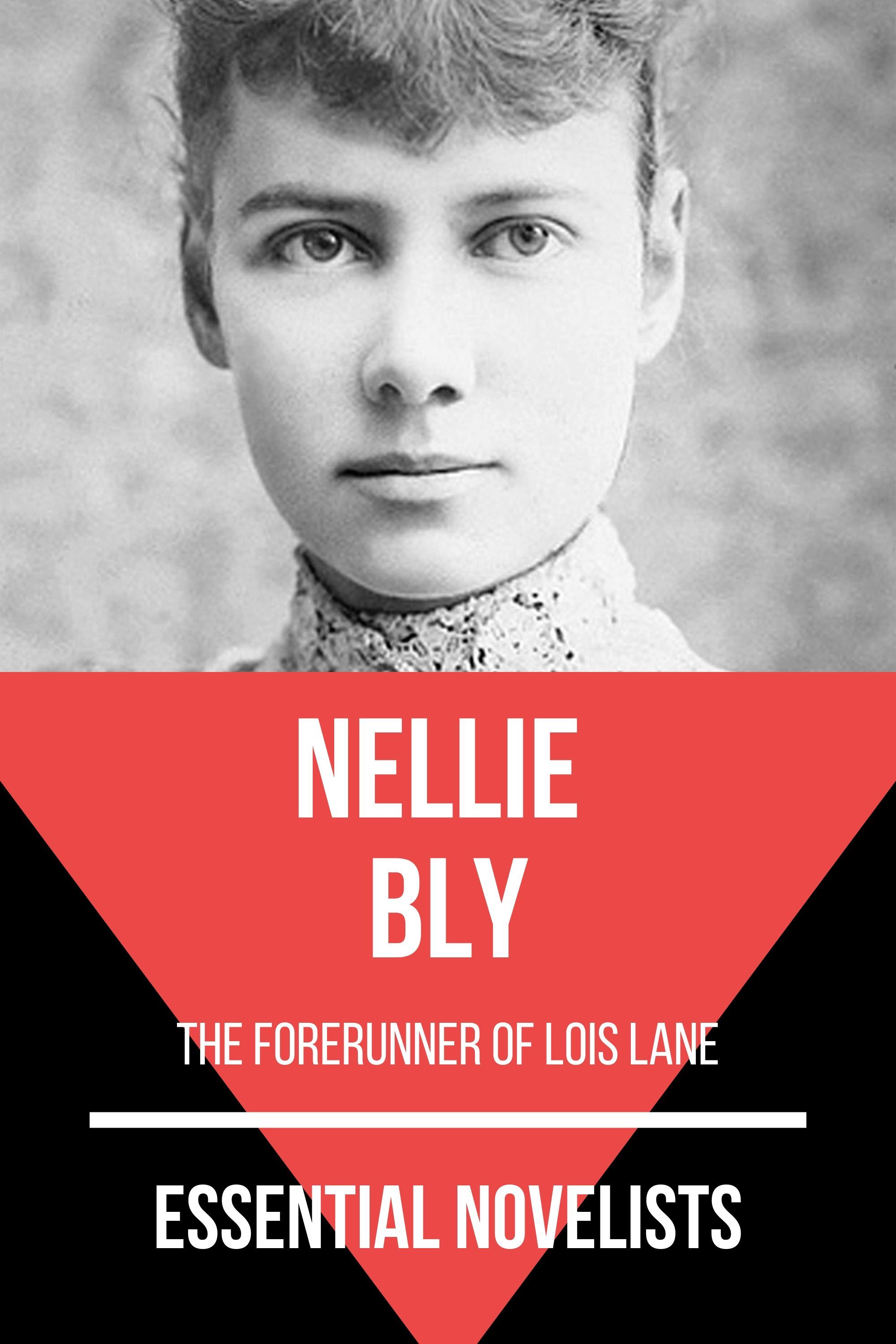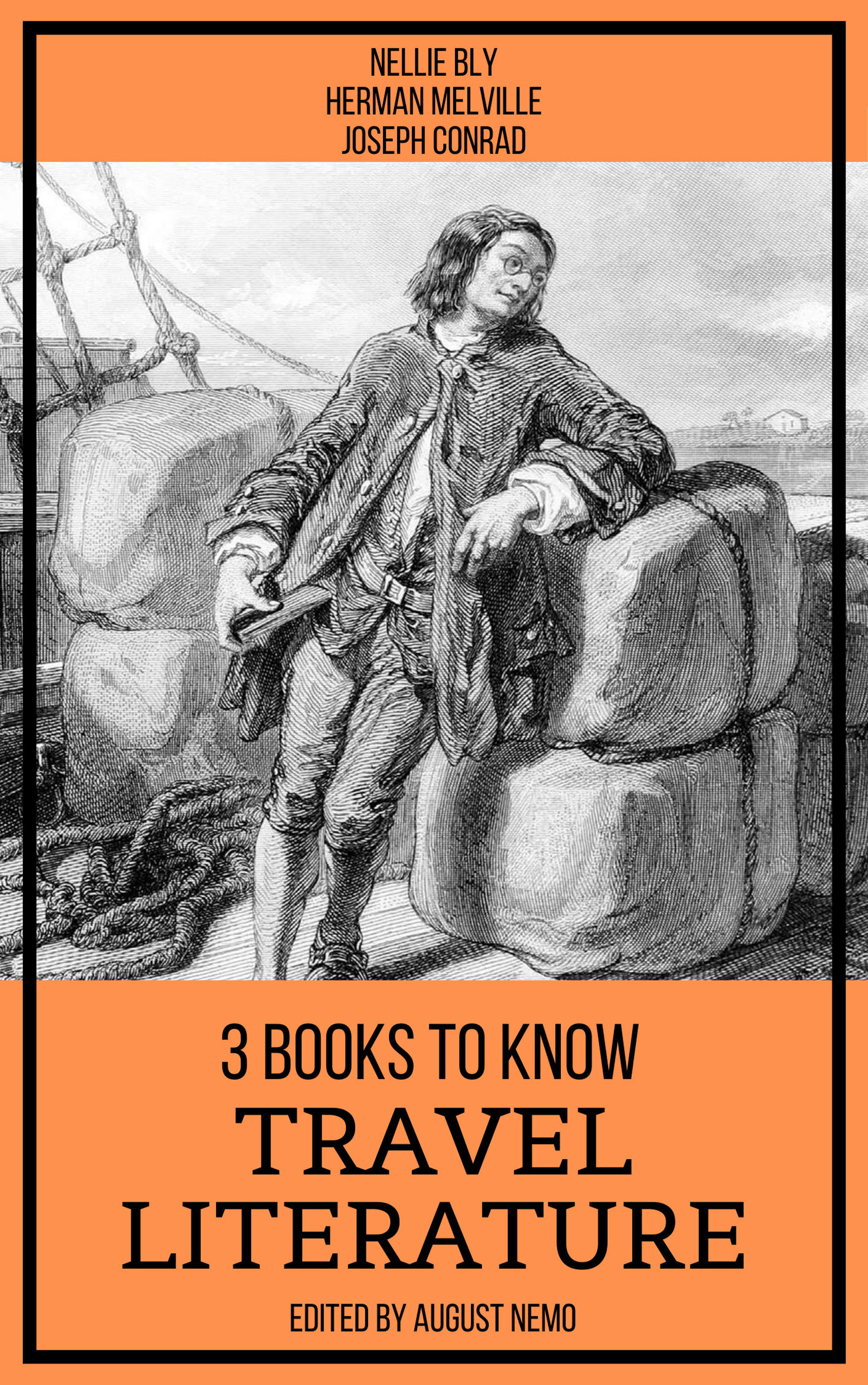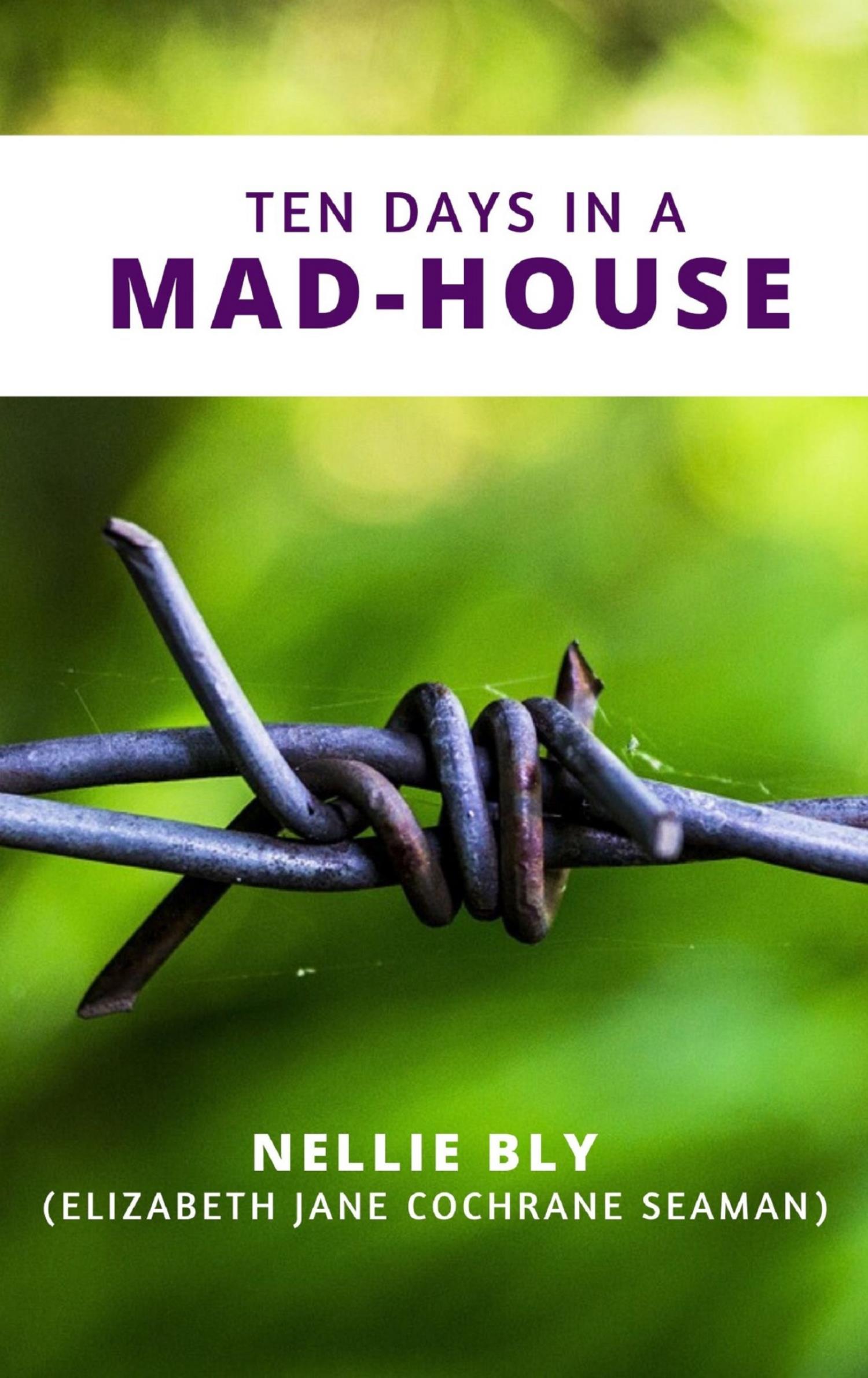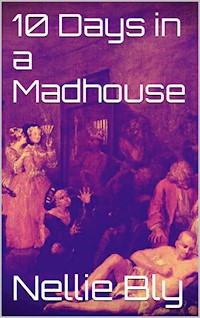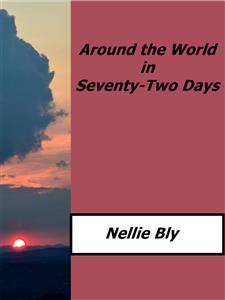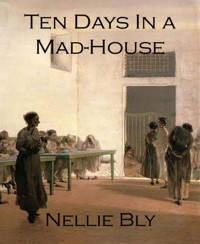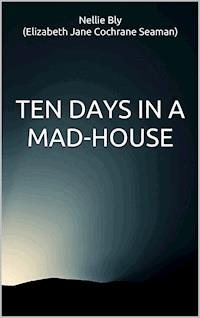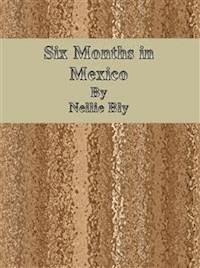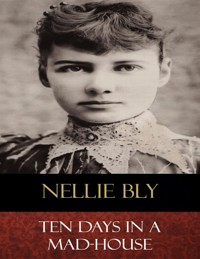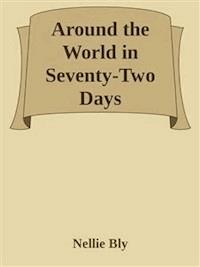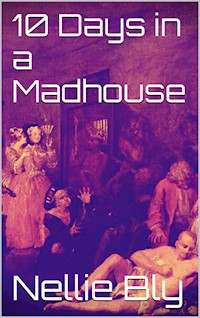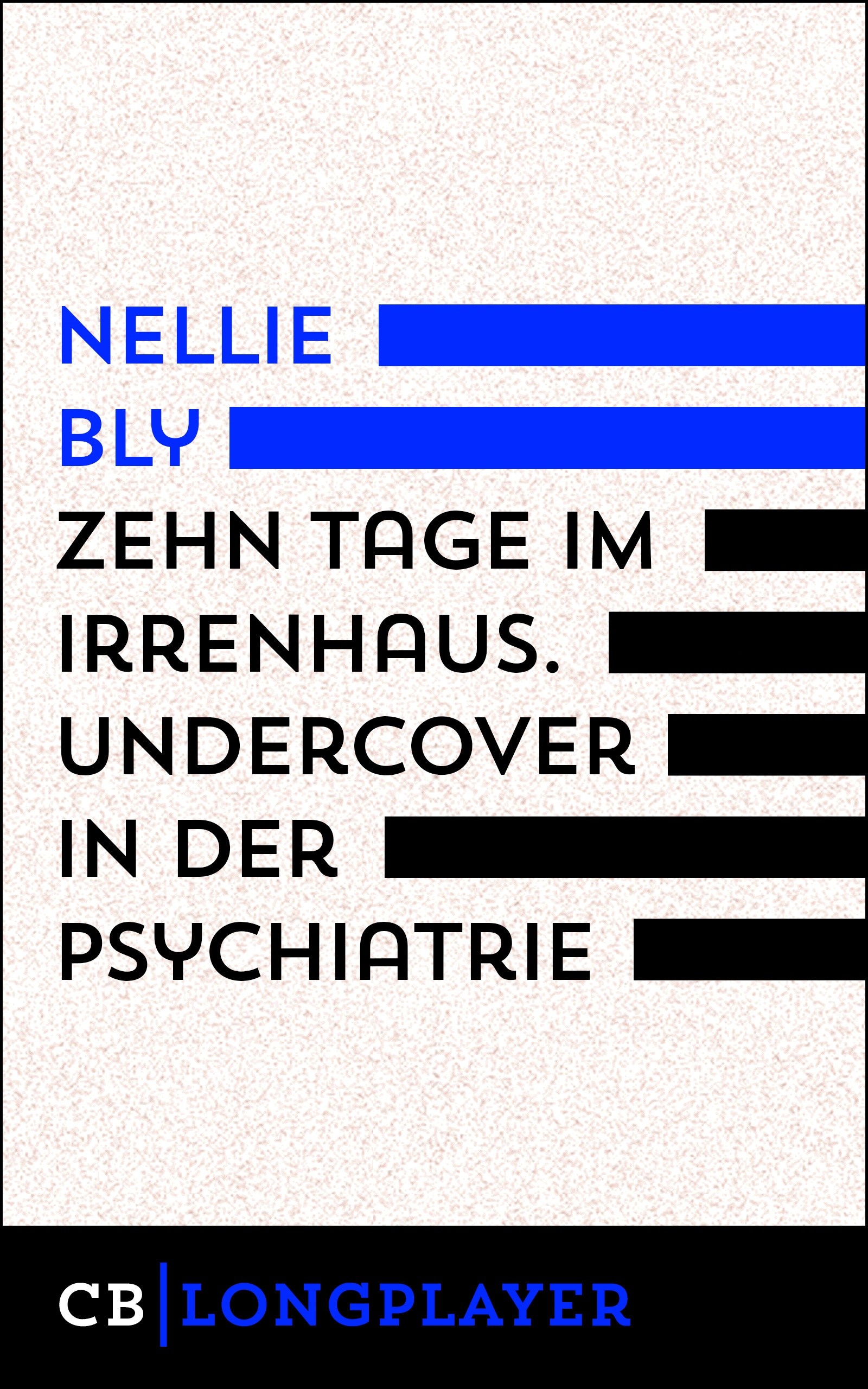
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Meisterlich!« Susanne Alge, BUCHKULTUR »... noch heute nimmt die einfache, undramatische Sprache, in der Bly ihre Erlebnisse schildert, ... gefangen.« Benjamin Maack, Spiegel online/einestages New York, 1887. Für ihren ersten Auftrag als freie Journalistin bei der aufstrebenden Tageszeitung Joseph Pulitzers, New York World, soll Nellie Bly undercover aus der Frauenpsychiatrie auf Blackwell's Island berichten. Ob sie den Mut dazu habe? Die 23-Jährige zögert nicht – natürlich hat sie den. Der Weg in die Anstalt erweist sich als Kinderspiel. Doch Bly merkt schnell: Wer einmal drin ist, dessen Chancen stehen schlecht, jemals wieder herauszukommen. In ihrer bahnbrechenden Reportage berichtet die Undercover-Journalistin Nellie Bly von den desaströsen Zuständen und grauenhaften Misshandlungen, deren Zeugin sie wurde. Zehn Tage im Irrenhaus ist ein Meilenstein des investigativen Journalismus und ein wichtiges Dokument der Psychiatriegeschichte. Pressestimmen »Nellie Bly schreibt scheinbar unschuldig und absolut unverblümt. ... charmant, ehrlich, echt und unmittelbar.« Simone Meier, Tages-Anzeiger / Basler Zeitung »Ihr Entsetzen über das, was den Patientinnen dort widerfuhr, macht ihren Bericht zu einem engagierten und empörten Aufschrei.« Bärbel Gerdes, Virginia »Diese Reportage von Nellie Bly skizziert die Anfänge der Psychiatrie sehr eindrücklich.« DRS 2, Sachbuchtrio »... ein erschreckendes Bild der Behandlung psychisch kranker Menschen in den 1880er Jahren.« Maximilian Plück, Rheinische Post »Ein Buch mit Mehrwert, das bei mir lange nachwirkte.« Sarah Schmidt »Eine mutige Reportage, die über unhaltbare Zustände aufgeklärt hat – und noch heute tief berührt.« Stephanie Hanel, emotion »Martin Wagner ... hat den tollen Fund übersetzt und mit Anmerkungen und einem klugen Nachwort versehen ...« Sebastian Gilli, Der Standard »Die schlichte und eindrucksvolle Reportage ist ein spannendes, gut lesbares Zeitdokument.« Doris Hermanns, junge Welt »Das Buch von und über Nellie Bly konfrontiert uns mit den dunklen Stellen des Lebens...« Verena Liebers, Eppendorfer »Das Buch von Nellie Bly berührt und macht fassungslos. ... Sehr lesenswert!« Gabriele Pagenhardt von Mainberg, Suite101 »Unbedingt lesenswert und mit deutlichem Gruselfaktor!« Jule Blum, Lesbenring INFO »Nellie Blys engagierter Bericht ist ›Psychiatriegeschichte live‹ und außerdem ein spannendes Abenteuer. Sehr zu empfehlen!« Sibylle Prins, Brückenschlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2020
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Aviva 2014
Lektorat: Josefine Haubold
Nach der im AvivA Verlag erschienenen
deutschsprachigen Erstausgabe von 2011
Erscheinungsdatum: Juni 2020
ISBN 978-3-95988-171-5
Über das Buch
New York, 1887. Für ihren ersten Auftrag als freie Journalistin bei der aufstrebenden Tageszeitung Joseph Pulitzers, New York World, soll Nellie Bly undercover aus der Frauenpsychiatrie auf Blackwell's Island berichten. Ob sie den Mut dazu habe? Die 23-Jährige zögert nicht – natürlich hat sie den.
Der Weg in die Anstalt erweist sich als Kinderspiel. Doch Bly merkt schnell: Wer einmal drin ist, dessen Chancen stehen schlecht, jemals wieder herauszukommen.
In ihrer bahnbrechenden Reportage berichtet die Undercover-Journalistin Nellie Bly von den desaströsen Zuständen und grauenhaften Misshandlungen, deren Zeugin sie wurde.
Zehn Tage im Irrenhaus ist ein Meilenstein des investigativen Journalismus und ein wichtiges Dokument der Psychiatriegeschichte.
»Meisterlich!« Susanne Alge, BUCHKULTUR
»... noch heute nimmt die einfache, undramatische Sprache, in der Bly ihre Erlebnisse schildert, ... gefangen.« Benjamin Maack, Spiegel online/einestages
Über die Autorin
Die Autorin Nellie Bly wird am 5. Mai 1864 als Elizabeth Jane Cochran in Pennsylvania geboren. Mit einem Leserbrief gelingt ihr 1885 der Einstieg in den Journalismus. Kurze Zeit später geht sie nach New York. Für Joseph Pulitzers Zeitung New York World lässt sie sich in eine Psychiatrie einliefern und verfasst daraufhin die investigative Reportage »Ten Days in a Mad-House«. Bald darauf erscheint die ebenfalls sehr erfolgreiche Reisereportage »Around the World in Seventy-Two Days«, für die sie sich in der Tradition von Jules Vernes Romanhelden Phileas Fogg auf eine Weltreise begeben hatte. 1895 heiratet Bly den 70-jährigen Industriellen Robert Seaman, dessen Unternehmen sie nach seinem Tod 1904 leitet. Nach dessen Bankrott kehrt sie zum Journalismus zurück und wird 1914 Kriegskorrespondentin in Österreich. Am 27. Januar 1922 stirbt Nellie Bly an einer Lungenentzündung.
Nellie Bly
Zehn Tage im Irrenhaus
Undercover in der Psychiatrie
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Seit meine Erlebnisse in der Irrenanstalt von Blackwell’s Island in der New York World(1) veröffentlicht worden sind, habe ich Hunderte von Briefen erhalten. Die Ausgabe, die meine Reportage enthielt, ist seit langem ausverkauft und ich wurde gebeten, sie zur Publikation in Buchform freizugeben, um damit all jenen entgegenzukommen, die nach Exemplaren verlangen.
Ich freue mich, verkünden zu können, dass die Stadt New York aufgrund meines Besuchs in der Anstalt und der darauf folgenden Enthüllungen eine Million Dollar mehr pro Jahr für die Pflege der Geisteskranken bewilligt hat. (2) So verspüre ich immerhin die befriedigende Gewissheit, dass die armen Unglücklichen aufgrund meiner Arbeit in Zukunft besser umsorgt sein werden.
1. Kapitel Ein heikler Auftrag
Am 22. September wurde ich von der New York World gefragt, ob ich mich in eine der New Yorker Anstalten für Geisteskranke einweisen lassen könnte, um einen schlichten und ungeschminkten Bericht über die Behandlung der dortigen Patientinnen, die Methoden der Verwaltung usw. zu verfassen. Ob ich den Mut hätte, mich derart hart auf die Probe stellen zu lassen, wie es dieser Auftrag verlangte? Könnte ich die Merkmale des Wahnsinns gut genug vortäuschen, um die Ärzte zu überzeugen und um eine Woche unter den Verrückten zu leben, ohne dass die Aufseher dort herausfänden, dass ich bloß ein Störenfried war, der sich Notizen macht? Ich sagte, dass ich es zu können glaube. Ich hatte einiges Vertrauen in meine Fähigkeiten als Schauspielerin und hielt mich für fähig, den Wahnsinn lange genug vorspielen zu können, um jeden mir anvertrauten Auftrag zu erfüllen. Würde ich eine Woche in der Irrenanstalt auf Blackwell’s Island verbringen können? Ich sagte, dass ich es könnte und dass ich es tun würde. Und ich tat es.
Meine Anweisungen bestanden allein darin, mit meiner Arbeit zu beginnen, sobald ich mich bereit fühlte. Ich sollte meine Erlebnisse treu aufzeichnen und die Abläufe innerhalb der Anstaltsmauern, die von den Schwestern mit den weißen Hauben sowie von den Gittern und Schlössern stets so erfolgreich vor der Kenntnisnahme der Öffentlichkeit verborgen gehalten werden, beobachten und beschreiben.
»Wir verlangen nicht von Ihnen, dorthin zu gehen, um sensationelle Entdeckungen zu machen. Schreiben Sie die Dinge so auf, wie Sie sie vorfinden, seien sie nun gut oder schlecht; loben Sie oder verurteilen Sie, wie es Ihnen am besten scheint, und halten Sie sich immer an die Wahrheit. – Ein wenig besorgt bin ich allerdings wegen Ihres chronischen Lächelns«, sagte der Herausgeber. »Ich werde nicht mehr lächeln«, sagte ich, und damit machte ich mich auf, meinen heiklen und, wie sich herausstellte, schwierigen Auftrag auszuführen.
Ich glaubte nicht, dass ich, wenn ich denn in die Anstalt hineinkommen sollte – was ich kaum zu schaffen hoffte –, etwas anderes zu erzählen hätte als eine einfache Geschichte vom Anstaltsleben. Dass eine solche Einrichtung schlecht geführt, dass Misshandlungen unter ihrem Dach stattfinden könnten, hielt ich nicht für möglich. Ich hatte stets den Wunsch gehegt, das Leben in der Irrenanstalt genauer kennenzulernen – den Wunsch, mich zu überzeugen, dass die Hilflosesten unter allen Geschöpfen Gottes, die Geisteskranken, gütig und gründlich umsorgt werden. Die vielen Geschichten, die ich über Misshandlungen in solchen Einrichtungen gelesen hatte, hatte ich stets für weit übertrieben, wenn nicht gar für bloße Märchen gehalten. Dennoch verspürte ich das Verlangen, das sicher zu wissen.
Ich schauderte bei der Vorstellung, dass die Geisteskranken vollständig in der Gewalt ihrer Wärter waren, und wie gänzlich vergeblich man um Freilassung bitten und flehen würde, wenn den Wärtern nicht der Sinn danach stand. Voller Erwartung nahm ich den Auftrag an, die inneren Abläufe der Irrenanstalt von Blackwell’s Island zu studieren.
»Wie werden Sie mich herausholen«, fragte ich meinen Herausgeber, »wenn ich einmal drin bin?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete er, »aber wir werden Sie herauskriegen, und wenn wir sagen müssen, wer Sie sind und aus welchem Grund Sie den Wahnsinn vorgetäuscht haben – schaffen Sie es nur hinein.«
Ich hatte geringes Vertrauen in meine Fähigkeit, die Experten zu täuschen, und ich vermute, mein Herausgeber hatte ein noch geringeres.
Alle Vorbereitungen für meine Feuerprobe blieben meiner eigenen Planung überlassen. Nur eine Sache wurde vereinbart, nämlich, dass ich das Pseudonym Nellie Brown annehmen solle, dessen Initialen mit meinem eigenen Namen und mit meiner Wäsche übereinstimmten, so dass es keine Probleme geben würde, meine Bewegungen zu verfolgen und mir aus allen Schwierigkeiten oder Gefahren, in die ich geraten könnte, herauszuhelfen. Es war möglich, in die Station für Geisteskranke hineinzukommen, nur wusste ich noch nicht wie. Zwei Wege kamen für mich in Betracht: Entweder konnte ich im Haus von Freunden Wahnsinn vortäuschen und mich aufgrund der Entscheidung zweier zuständiger Ärzte einweisen lassen oder ich konnte mein Ziel über die Polizeigerichte (3) erreichen.
Nach einiger Überlegung erschien es mir klüger, nicht meinen Freunden zur Last zu fallen oder irgendwelche gutmütigen Ärzte dazu zu bewegen, mir bei meinem Vorhaben beizustehen. Außerdem hätten meine Freunde, damit ich nach Blackwell’s Island komme, Armut vortäuschen müssen. (4) Unglücklicherweise aber, im Falle meines Vorhabens, war meine Bekanntschaft mit den bitter Armen, abgesehen von meiner eigenen Person, nur sehr oberflächlich. Und so entschloss ich mich zu jenem Vorgehen, das mir zu der erfolgreichen Erfüllung meines Auftrags verhelfen sollte. Es gelang mir, in die Abteilung für Geisteskranke auf Blackwell’s Island eingewiesen zu werden, wo ich zehn Tage und Nächte verbrachte und wo ich Erfahrungen machte, die ich nie vergessen werde. Ich nahm es auf mich, die Rolle des armen, unglückseligen, verrückten Mädchens zu spielen, und ich sah es als meine Pflicht an, mich vor keiner der unangenehmen Folgen zu drücken, die das mit sich brachte. Ich wurde für diese Zeit zu einem der städtischen Mündel. Ich erlebte viel und sah und hörte noch mehr über die Behandlung, der dieser hilflose Teil unserer Bevölkerung ausgesetzt ist. Und als ich genug gesehen und gehört hatte, wurde sofort für meine Entlassung gesorgt. Ich verließ die Irrenanstalt mit Freude und mit Bedauern – Freude darüber, dass ich einmal mehr die Luft der Freiheit atmen durfte; und Bedauern darüber, dass ich nicht einige der armen Frauen mit mir nehmen konnte, die mit mir dort gelebt und gelitten hatten, und die, wie ich überzeugt bin, genauso bei Verstand sind, wie ich es damals war und heute bin.
Aber erlauben Sie mir an dieser Stelle noch eine Bemerkung: Von dem Moment an, da ich die Station für Geisteskranke auf der Insel betrat, machte ich keinen Versuch mehr, meine Rolle der Geisteskranken weiter aufrechtzuerhalten. Ich redete und verhielt mich genau so, wie ich es auch sonst im Alltag tue. Und doch, so merkwürdig es klingt: Je vernünftiger ich redete und handelte, für desto verrückter hielt man mich – mit der einzigen Ausnahme eines Arztes, dessen Freundlichkeit und Sanftmut ich so schnell nicht vergessen werde.
2. Kapitel Vorbereitungen auf die Prüfung
Doch zurück zu meiner Arbeit und zu meinem Auftrag. Ich kehrte also, nachdem ich meine Anweisungen erhalten hatte, nach Hause zurück, und als es Abend wurde, begann ich jene Rolle zu proben, in der ich am nächsten Morgen mein Debüt geben sollte. Ich stellte es mir schwierig vor, fremden Menschen vorzumachen, dass ich geisteskrank sei. Ich war in meinem Leben niemals zuvor in der Nähe von Geisteskranken gewesen und hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, wie sie sich aufführten. Und dann sollte ich von einer Gruppe ausgebildeter Ärzte untersucht werden, die auf Geisteskrankheiten spezialisiert sind und täglich mit Geisteskranken in Berührung kommen! Wie konnte ich mir einbilden, an diesen Ärzten vorbeizukommen und sie davon zu überzeugen, dass ich verrückt war? Ich befürchtete, dass sie sich nicht täuschen lassen würden. Mein Auftrag erschien mir zunehmend hoffnungslos, doch er musste erledigt werden. Und so lief ich zum Spiegel und studierte mein Gesicht. Ich rief mir alles ins Gedächtnis, was ich über das Verhalten der Verrückten gelesen hatte. Zunächst mussten sie einen starren Blick haben. Ich riss also meine Augen weit auf und starrte, ohne zu blinzeln, auf mein eigenes Spiegelbild. Glauben Sie mir, der Anblick war sogar mir selbst nicht ganz geheuer, besonders so spät in der Nacht. Um mich aufzumuntern, schaltete ich das Licht an, was nur bedingt half. Aber ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich in wenigen Nächten nicht mehr hier, sondern mit einer Schar von Verrückten in einer Zelle eingesperrt sein würde.
Obwohl es nicht kalt war und dem Schweiß zum Spott, der langsam aber sicher die Locken in meinem Pony glättete, rannen mir eiskalte Schauer über den Rücken, wenn ich daran dachte, was auf mich zukam. Wenn ich nicht gerade vor dem Spiegel übte oder mir meine Zukunft als Wahnsinnige ausmalte, las ich Ausschnitte unwahrscheinlicher und unmöglicher Geistergeschichten. Und als die Morgendämmerung schließlich die Nacht verdrängte, fühlte ich mich in der passenden Stimmung für meinen Auftrag – wenn auch immer noch hungrig genug, um nach meinem Frühstück zu verlangen. Träge und trübselig nahm ich mein morgendliches Bad und verabschiedete mich dabei im Stillen von einigen der kostbarsten Gegenstände der modernen Zivilisation. Zärtlich legte ich meine Zahnbürste weg, und während ich ein letztes Mal über die Seife rieb, flüsterte ich: »Vielleicht ist es für ein paar Tage, vielleicht für länger.« Dann zog ich die alten Kleider an, die ich für diese Gelegenheit ausgewählt hatte. Ich war in der Stimmung, alles sehr ernsthaft zu betrachten. Es konnte nicht schaden, einen letzten wehmütigen Blick auf die Dinge zu werfen, dachte ich mir. Denn wer könnte sagen, ob die Anstrengung, mich verrückt zu stellen und mit einer Horde von Irren eingesperrt zu sein, mich nicht selbst verrückt machen würde, so dass ich niemals zurückkommen würde? Aber nicht ein einziges Mal stellte ich meinen Auftrag in Frage. Zumindest äußerlich ruhig machte ich mich auf zu meinem verrückten Geschäft.
Zunächst erschien es mir am besten, zu einer Pension zu gehen und, sobald ich eine Unterkunft gefunden hätte, der Vermieterin oder dem Vermieter – wer auch immer es gerade sein würde – im Vertrauen zu sagen, dass ich Arbeit suchte, um dann nach einigen Tagen dem Anschein nach den Verstand zu verlieren. Aber als ich den Plan noch einmal überdachte, fürchtete ich, dass seine Umsetzung zu lange dauern könnte. Da fiel mir ein, dass es viel einfacher wäre, es in einem Heim für Arbeiterinnen (5) zu versuchen. Ich wusste, dass, wenn ich erst einmal ein Haus voller Frauen von meinem Wahnsinn überzeugt hätte, diese nicht ruhen würden, bis ich außerhalb ihrer Reichweite und sicher weggesperrt wäre.
Ich suchte mir aus einem Adressbuch das Behelfsheim für Frauen, No. 84 Second Avenue, heraus. Während ich die Second Avenue hinunterlief, beschloss ich mein Bestes zu geben, um die Reise nach Blackwell’s Island und in die Irrenanstalt recht schnell anzutreten.
3. Kapitel Im Behelfsheim
Und so begann meine Karriere als das geisteskranke Fräulein Nellie Brown. Während ich die Straße hinunterlief, bemühte ich mich, den Gesichtsausdruck aufzusetzen, den Dienstmädchen auf »Träumend« betitelten Bildern tragen. Solche »Ganz-weit-weg«-Gesichter haben einen Anflug von Verrücktheit. Ich ging über den kleinen gepflasterten Hof zum Eingang des Heims. Ich zog an der Klingel, die so laut wie eine Kirchenglocke war, und wartete ungeduldig darauf, dass die Tür zu jenem Heim geöffnet würde, das mich – so mein Plan – schon bald fortschicken und der Obhut der Polizei übergeben sollte. Die Tür wurde mit einem Schwung aufgerissen, und vor mir stand ein kleines blondes Mädchen von vielleicht dreizehn Jahren.
»Ist die Heimleiterin da?«, fragte ich mit schwacher Stimme.
»Ja, sie ist da, aber sie ist beschäftigt. Gehen Sie ins Hinterzimmer«, antwortete das Mädchen laut und ohne jede Bewegung in ihrem merkwürdig alt wirkenden Gesicht.
Ich folgte dieser nicht übermäßig freundlichen Anweisung und kam in ein dunkles, ungemütliches Hinterzimmer. Dort erwartete ich die Ankunft meiner Wirtin.
Ich wartete etwa zwanzig Minuten, bis eine schlanke Frau in einem einfachen dunklen Kleid hereintrat und, indem sie vor mir stehen blieb, kurz angebunden fragte: »Nun?«
»Sind Sie die Heimleiterin?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete sie. »Die Heimleiterin ist krank. Ich bin ihre Stellvertreterin. Was wollen Sie?«
»Ich will für ein paar Tage hier bleiben, wenn Sie mich aufnehmen können.«
»Wir sind überfüllt, es gibt kein Einzelzimmer. Aber wenn Sie ein Zimmer mit einem anderen Mädchen teilen würden, kann ich das für Sie arrangieren.«
»Das wäre schön«, antwortete ich. »Wie viel kostet es?« Ich hatte nur rund siebzig Cent mitgenommen, denn ich wusste sehr wohl, dass man mich umso schneller hinauswerfen würde, je eher meine Reserven aufgebraucht waren. Und hinausgeworfen zu werden, war schließlich mein Ziel.
»Wir nehmen dreißig Cent pro Nacht«, antwortete sie mir. Ich bezahlte für eine Übernachtung und dann ließ sie mich unter dem Vorwand, etwas anderes erledigen zu müssen, allein. Da ich mir nun selbst überlassen war, studierte ich zunächst meine Umgebung. Sie war, um es harmlos auszudrücken, nicht allzu erfreulich: Ein Kleiderschrank, ein Schreibtisch, ein Bücherregal, eine Orgel und mehrere Stühle machten die Einrichtung des Zimmers aus, in das kaum Tageslicht kam.
Als ich mit meinem Quartier vertraut geworden war, erscholl im Tiefparterre eine Glocke, deren Lautstärke es mit der Türklingel aufnehmen konnte, und Frauen aus allen Teilen des Hauses strömten die Treppen hinunter. Offenbar wurde das Mittagessen serviert. Aber da niemand etwas zu mir gesagt hatte, machte ich keinerlei Anstalten, mich der hungrigen Schar anzuschließen. Dennoch wünschte ich, irgendjemand würde mich auffordern mitzukommen. Denn selbst wenn man nicht hungrig ist, erzeugt es immer ein Gefühl von Heimweh und Einsamkeit, wenn man weiß, dass andere essen und man selbst keine Gelegenheit dazu hat. Ich war deshalb froh, als die stellvertretende Heimleiterin zu mir kam und fragte, ob ich nicht etwas essen wolle. Ich bejahte dies, und dann fragte ich sie nach ihrem Namen. »Mrs. Stanard«, sagte sie, und ich schrieb es mir sofort in ein Heft, das ich eigens mitgenommen hatte, um mir Notizen zu machen, und in dem ich für interessierte Wissenschaftler mehrere Seiten mit heillosem Unsinn beschrieben hatte. So erwartete ich den Gang der Ereignisse.
Für mein Mittagessen folgte ich nun Mrs. Stanard die nackten Stufen hinab ins Tiefparterre, wo eine große Anzahl von Frauen bereits beim Essen war. Mrs. Stanard wies mich an einen Tisch mit drei anderen Frauen.
Das kurzhaarige Dienstmädchen, das mir die Tür geöffnet hatte, erschien nun als Kellnerin. Sie stemmte die Hände in die Hüften und brachte mich mit ihrem starren Blick ganz aus der Fassung, während sie fragte: »Gekochtes Hammelfleisch, gekochtes Rindfleisch, Bohnen, Kartoffeln, Kaffee oder Tee?«
»Rindfleisch, Kartoffeln, Kaffee und Brot«, antwortete ich.
»Brot gehört dazu«, erklärte sie, während sie sich nach hinten zur Küche aufmachte. Es dauerte nicht lange, bis sie mit meiner Bestellung auf einem arg ramponierten Tablett zurückkehrte, das sie vor mir niederknallte. Ich begann mein schlichtes Mahl. Es war nicht besonders appetitlich, und so beobachtete ich die anderen, während ich so tat, als ob ich aß.
Wie oft habe ich gegen die abstoßende Form gepredigt, die die Wohlfahrt annimmt! Dies war ein Heim für bedürftige Frauen. Aber was für ein Hohn war dieser Name! Die Fußböden waren nackt, und die kleinen hölzernen Tische waren mit modernen Verschönerungsmitteln wie Lack, Politur oder Tischdecken noch nie in Berührung gekommen. Es ist ganz vergeblich, über den geringen Preis von Leinentüchern und ihren großen Einfluss auf die Zivilisation zu sprechen. Diese ehrlichen Arbeiterinnen, die bedürftigsten aller Frauen, müssen diesen kahlen Ort ihr Heim nennen.
Als die Mahlzeit beendet war, ging jede Frau zu dem Schreibtisch in der Ecke, an dem Mrs. Stanard saß, und beglich ihre Rechnung. Ich bekam von jenem eigenartigen Exemplar der Menschheit in Gestalt meiner Kellnerin einen reichlich abgenutzten roten Rechnungsschein in die Hand gedrückt. Meine Rechnung belief sich auf dreißig Cent.
Nach dem Mittagessen ging ich wieder hinauf und nahm meinen Platz im Hinterzimmer ein. Mir war ziemlich kalt und ich fühlte mich unwohl. Mir wurde klar, dass ich diese Art von Beschäftigung nicht lange würde aushalten können. Je eher ich also die Rolle der Geisteskranken annahm, desto eher würde ich aus dieser aufgezwungenen Untätigkeit erlöst werden. Ach, dies war wirklich der längste Tag meines Lebens! Teilnahmslos beobachtete ich die Frauen im Vorderzimmer, wo außer mir alle saßen.
Eine von ihnen tat nichts anderes als zu lesen, sich am Kopf zu kratzen und gelegentlich sanft »Georgie« zu rufen, ohne dabei ihre Augen von ihrem Buch zu heben. »Georgie« war ihr überdrehter Sohn, der mehr Lärm machte als jedes andere Kind, das ich jemals zuvor gesehen hatte. Er tat wirklich alles, was irgendwie gemein oder unanständig war, aber seine Mutter sagte nie etwas dazu, außer wenn sie jemand anderen mit ihm schimpfen hörte. Eine andere Frau schlief ständig ein und wachte dann von ihrem eigenen Schnarchen auf, und ich dachte boshaft, dass sie zum Glück wenigstens nur sich selbst damit aufweckte. Die meisten Frauen saßen bloß untätig da, aber es gab einige, die klöppelten und strickten. Die gewaltige Türglocke läutete ununterbrochen, und das kurzhaarige Mädchen lief ständig hin und her. Dieses Mädchen hatte übrigens die Angewohnheit, andauernd Bruchstücke aus allen Schlagern und Kirchenliedern zu singen, die in den letzten fünfzig Jahren komponiert wurden. Es gibt auch heute noch so etwas wie Folter. Das Läuten der Glocke brachte weitere Frauen herein, die eine Unterkunft für die Nacht suchten. Abgesehen von einer Frau, die vom Land kam und zum Einkaufen in der Stadt war, handelte es sich um Arbeiterinnen, einige von ihnen hatten ihre Kinder dabei. Als es Abend wurde, kam Mrs. Stanard zu mir und fragte: »Was fehlt dir? Hast du irgendwelche Sorgen oder Probleme?«
»Nein«, sagte ich, beinahe überrascht von ihrer Annahme. »Warum?«
»Na, weil«, antwortete sie einfühlsam, »ich es in deinem Gesicht lesen kann. Es erzählt von großen Leiden.«
»Ja, alles ist so traurig«, sagte ich in einer verstörten Weise, die meinen Wahnsinn zum Ausdruck bringen sollte.
»Aber das darf dich nicht bekümmern. Wir alle haben unsere Sorgen, aber wir werden sie schnell genug wieder los. Was für eine Arbeit suchst du?«
»Das weiß ich nicht. Es ist alles so traurig«, antwortete ich.
»Möchtest du eine Kinderschwester sein und eine weiße Haube und eine weiße Schürze tragen?«, fragte sie.
Ich verdeckte mein Gesicht mit meinem Taschentuch, um ein Grinsen zu verbergen, und sagte mit erstickter Stimme: »Ich habe nie gearbeitet. Ich weiß nicht, wie man das macht.«
»Du musst es aber lernen«, mahnte sie mich. »Alle Frauen hier arbeiten.«
»Wirklich?«, flüsterte ich aufgeregt. »Sie erscheinen mir alle so schrecklich, ganz als ob sie verrückt wären. Ich habe eine solche Angst vor ihnen.«
»Sie sehen nicht sehr freundlich aus«, antwortete sie zustimmend, »aber es sind gute, ehrliche Arbeiterinnen. Wir haben keine Verrückten hier.«
Ich bediente mich noch einmal meines Taschentuchs, um mein Lächeln zu verbergen. Denn noch vor dem nächsten Morgen, so dachte ich mir, würde sie zumindest glauben, eine Verrückte unter ihrer Schar zu haben.
»Sie sehen alle verrückt aus«, bekräftigte ich noch einmal, »und ich fürchte mich vor ihnen. Es gibt so viele Verrückte, bei denen man nie weiß, was sie tun werden. Dann werden so viele Morde begangen, und die Polizei fängt niemals die Mörder«, endete ich mit einem Seufzer, der einen Saal voller blasierter Kritiker erweicht hätte.
Mrs. Stanard zuckte zusammen, und ich wusste, dass ich meinen ersten Treffer gelandet hatte. Es war amüsant, wie erstaunlich wenig Zeit sie brauchte, um von ihrem Stuhl hochzukommen und eilig zu flüstern: »Ich komme dann später noch einmal, um weiter mit Ihnen zu reden.« Ich wusste, dass sie nicht wiederkommen würde. Und sie kam auch nicht wieder.
Als die Glocke zum Abendessen erklang, ging ich mit den anderen ins Tiefparterre und nahm an der gemeinsamen Mahlzeit teil. Sie glich dem Mittagessen, nur dass die Rechnung geringer ausfiel und mehr Leute teilnahmen, da die Frauen, die tagsüber außerhalb beschäftigt waren, inzwischen heimgekehrt waren. Nach dem Abendessen gingen wir gemeinsam in die Aufenthaltsräume, wo wir teils saßen, teils standen, weil es nicht genügend Stühle für alle gab.
Es war ein trübseliger Abend, und das dämmrige Licht der einsamen Gaslampe im Aufenthaltsraum und der Öllampe im Flur verdüsterte unsere Gemüter. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht viel von dieser Stimmung brauchte, um mich reif für den Ort zu machen, an den ich wollte.