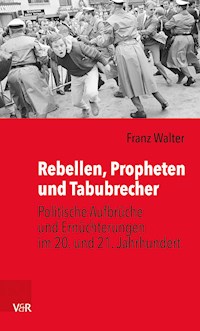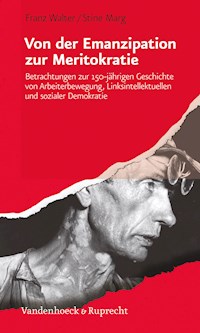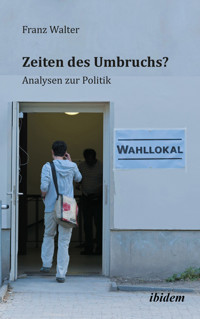
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Deutschen erleben gerade eine demokratische Ambiguität. Und sie tun sich nicht leicht damit. Sie genießen, auf der einen Seite, die gewachsene Vielfalt an Marktoptionen und individuellen Rollenentscheidungen. Aber sie reagieren, auf der anderen Seite, verunsichert darauf, dass sich die gesellschaftliche Enthomogenisierung nun auch in das Parteiensystem übersetzt. Denn zersplitterte Parteiensysteme erschweren Kooperation und Koalition, auf deren Gelingen aber gerade fragmentierte Gesellschaften elementar angewiesen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Mühen der Macht
Die Ratlosigkeit früherer Volksparteien
Zwischen alternativem Protest und Statusmilieu: Neubürgerliche Ambivalenzen
Gewalt und demokratische Linke
Ende der politischen Erzählungen?
Wissenschaft und Wahrheiten
Empirische Studien
Politische Bücher
Impressum
Vorwort
Immer schon hat der Verfasser die „kleine Form“ der Darstellung und Analyse gemocht: den Essay, die Kolumne, den zugespitzten Kommentar, das Meinungsstück für eine Zeitung. Zuletzt war ihm angesichts schwieriger Lebensumstände auch kaum mehr als die „kleine Form“ noch möglich, wenn denn überhaupt noch Kraft genug zum Lesen und Schreiben blieb. Vieles von dem, was im Folgenden zu finden ist, hat er im Blog seines früheren Instituts (für Demokratieforschung in Göttingen) schon so oder ähnlich vorgestellt, einiges auch an anderen Orten. Ein Zusammenhang zwischen den Einzelteilen dieser Präsentation ist hoffentlich dennoch zu erkennen, da es nicht nur punktuell um die Fragen gesellschaftlicher und politischer Kohäsion versus Desintegration, um die Spannungen zwischen Pragmatismus und Ideenverlangen, um die Balance von Partizipationsbedürfnissen und Effizienzerwartungen, um die Gefährdungen des klassischen Typus der Volksparteien durch den neu gewandten Populismus vornehmlich (jedoch nicht nur) von rechts, um die zyklisch aktualisierte Frage nach der Gewalt in der Politik, den Wahrheiten und Wirklichkeiten zeitgenössischer Diagnostiken wissenschaftlichen Anspruchs, um den ewigen Wandel fundamentaler Oppositions- und Emanzipationsbewegungen in Richtung Adaption und Affirmation der Verhältnisse, die durch die erreichte Transformation entstanden sind, geht.
Für das Lektorat, die Korrektur und den Satz habe ich Katharina Trittel, Jeanina Fischbach und Niklas Schröder sehr zu danken.
Göttingen, im Frühjahr 2018
Die Mühen der Macht
Leicht hat es die politische Klasse in diesen Jahren nicht. Im Scheinwerferlicht der TV-Gesellschaft und vor dem Diktat rigider Transparenzansprüche der Foren- und Bloggerszene entblättert sich schnell die Autorität politischer Leitfiguren. Politische Anführer heute kommen durch den Totalitätsanspruch auf permanente Bürgernähe und öffentliche Präsenz weder zur gründlichen Lektüre noch zur mußereichen Reflexion ihres Tuns.1 Zeit für Originalität und Konzeption ist kaum vorhanden, weshalb sich die Papageiensprache gerade in der Politik – wenngleich keineswegs nur da – so verbreitet hat. Die Träger des Politischen vermögen mittlerweile bestenfalls Schwämme zu sein, die Stimmungen aufsaugen; aber sie sind keine Vordenker, die Entwicklungen von morgen rechtzeitig aufspüren, deuten und prägen können. Zur Führung ist die politische Chefetage insofern kaum mehr fähig; geistig kann sie nicht antizipieren, sozialmoralisch nicht wenden, wie man bereits und spätestens in der Ära Kohl wohl ernüchtert zur Kenntnis nehmen musste.
Sorgen also darf man sich schon machen, dass die Demokratie und ihre Institutionen es in den nächsten Jahrzehnten nicht leicht haben werden – und dies natürlich aus anderen Gründen als noch vor einem Vierteljahrhundert. Es sind nicht so sehr äußere, ideologisch totalitäre Feinde, welche die Demokratie bedrohen. Es sind vielmehr Entwicklungen aus dem Inneren der demokratischen Marktgesellschaften selbst, welche die Handlungsfähigkeiten gerade auch des Parlamentarismus zurückdrängen. Die Marktdemokratien haben die Freiheit des Konsumenten entfesselt, wodurch allerdings auch das Politische aus der Sicht von Konsumenten betrachtet wird – launisch, ungeduldig, jederzeit fordernd. Der Kunden-Bürger schaut sich in den Regalen des politischen Angebots um, wählt aus, was seine Konsumbedürfnisse rasch und preiswert befriedet. Der Zeitrhythmus von Kunden ist ein anderer als derjenige vernünftiger Politik. Sobald der Bürger in seiner Rolle als Kunde sein Bedürfnis – per Klick – geäußert hat, erwartet er auch die sofortige Bedürfnisbefriedigung durch prompte Offerte. Solide Politik dagegen ist notwendigerweise an lange Fristen gebunden, gewissermaßen auf die innere Fähigkeit zum Aufschub angewiesen. Problemfindung, Erörterung, Bündnissuche, Konfliktaustragung, Konsensherstellung und Ausgleich dauern nun mal.
Vor allem die Transparenzgesellschaft der Medienrevolution hat klassische politische Führung aus den Angeln gehoben. Jede Schwäche wird jetzt kompromisslos offengelegt, jede Verfehlung rigide lutherisch an den Pranger gestellt, jede Popularitätseinbuße demoskopisch ermittelt und der öffentlichen Häme preisgegeben. Der Druck hat sich dadurch auf alle Parteien enorm erhöht, die im Unterschied zu früheren Jahrzehnten nur noch wenig Nachsicht für zeitweilig unglücklich operierende Parteivorsitzende aufbringen. Parteichefs in der Baisse werden jetzt rasch, nicht selten hektisch, zuweilen gar panikartig in die Wüste geschickt. Man konnte das in den beiden letzten Jahrzehnten besonders illustrativ bei den Sozialdemokraten beobachten.
Mit der faktischen Erosion von Führungsressourcen in der Medien- und Internetgesellschaft kollidiert die Wahrnehmung des politischen Geschehens durch die Bevölkerung. Denn in einer solchen Gesellschaft erscheint Politik streng zentralisiert, hierarchisch, höfisch. Das Zentrum ist das Berliner Regierungsviertel; das Kanzleramt bildet den Hof; und ganz oben thront derzeit noch Angela, die Erste. Mit den Möglichkeiten und Beschränkungen moderner Politik hat das wenig zu tun. Natürlich wussten die Politiker stets, wie eng ihr Handlungsspielraum war. Sie wussten, wie stark die Verhandlungs- und Vermittlungszwänge ihre politische Souveränität einschnürten und begrenzten. Aber sie begaben sich doch ganz gerne in die Positur der kraftvollen und souveränen Lenker der Staatsgeschäfte. Die auf diese Weise erzeugten Ansprüche wurden dann verlässlich frustriert; die Verdrossenheitswerte an der gesellschaftlichen Basis, für die man das Schauspiel inszenierte, nahmen kontinuierlich zu.
Die Ausnahmezeit innerhalb dieses fortschreitenden Trends indes bilden Krisen und Katastrophen. Dann schlägt die Stunde der Kraftnaturen, Abenteurer, aber auch der kaltblütigen Taktiker der Macht. Denn jetzt weitet sich für einen kurzen Zeitraum das politische Spielfeld. Die Vetomächte müssen ihre Routineeinwände unter dem Druck der aufgeschreckten Öffentlichkeit zurückstellen. Der Exekutive werden in den Zeiten des Notfalls außerordentliche Befugnisse eingeräumt. Die sonst sperrigen Institutionen dürfen zwischenzeitlich übergangen werden. Helmut Schmidt, der Heros im Kampf gegen Hamburger Fluten und international agierende Terroristen, war ein großer Nutznießer solcher Konstellationen, auch Gerhard Schröder, dem ebenfalls die Wassermengen der Elbe zur rechten Zeit zur Heldenattitüde verhalfen. Und auch in der Außenpolitik gibt es historische Knotenpunkte, an denen die innenpolitischen Blockademächte nicht beteiligt sind und Spielräume sich öffnen. In einem solchen „Weltenmoment“ kann man als politischer Anführer einer Nation dann Geschichte machen, so Adenauer in den 1950er, Brandt in den frühen 1970er Jahren, Kohl 1989/90. Und Angela Merkel versuchte es zuweilen, wenn auch gedämpfter, ebenso.
Ist der Moment vorüber, hat der Held erledigt, was zu vollbringen war, dann wird die Geschichte ihn wegwerfen „wie leere Hülsen“, um den großen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu zitieren. Das ist dann kein Charakteristikum der neuen Netzdemokratie oder der Empörungs- und Erregungsgesellschaft. Das ist die ewige Räson von Machtpolitik und politischem Zyklus. Adenauer erfuhr dieses Schicksal 1963, Brandt erlebte das Drama 1974. Und auch der amtierenden Bundeskanzlerin wird es natürlich mindestens in mittlerer Zukunft keineswegs anders ergehen.
Wanja und die moderne Politik
Doch bleibt bemerkenswert, dass Angela Merkel wurde, was sie ist – und sich an der Spitze der Bundesregierung verblüffend lange halten konnte. „Woher nimmt sie nur die Kraft?“, titelte bereits im Dezember 2011 der Stern. Versuchen auch wir eine Antwort. Bedienen wir uns einer der beliebten russischen Volkssagen, nämlich der, die von den Abenteuern des starken Wanja handelt. Der Kinder- und Jugendbauchautor Otfried Preußler hat eine eigene Version davon Ende der 1960er Jahre als Buch veröffentlicht.2 Der starke Wanja, so wird erzählt, mied in seiner Jugend die schwere Feldarbeit. Stattdessen ruhte er sieben Jahre lang in der Bauernstube auf dem Ofen, nährte sich von Sonnenblumenkernen – und tat sonst rein gar nichts. Keiner seiner Brüder mochte ihn leiden. Verständlicherweise. Aber nach sieben Jahren der Muße stand Wanja vom Ofen auf, war ausgeruht und stark wie ein Bär. Er zog aus, bekämpfte die Bösen. Zum Schluss wurde er Zar im Land jenseits der Weißen Berge. Natürlich ist das eine ganz unrealistische Geschichte. Wir alle wissen schließlich, dass nach sieben Jahren des aktivitätslosen Phlegmas die Muskeln erschlafft sind, dass man nicht stark, sondern schwach ist. Und doch hat auch diese Geschichte, wie es bei Volkssagen so üblich ist, einen wahren Kern. Im Zustand der deutschen Politik der letzten Jahre können wir diesen Kern wunderbar erkennen, bei Angela Merkel also.
Im Grunde hätte sie kaum eine Chance auf eine politische Karriere haben dürfen. Denn sie besaß nichts von dem, was nach der festen Überzeugung aller Kenner des Politischen unabdingbare Voraussetzung dafür ist, um in der Parteiendemokratie ganz oben tatsächlich zu reüssieren. Merkel verfügte nicht über ‚Stallgeruch‘, hatte keine ‚Ochsentour‘ absolviert, durfte sich nicht auf geschlossene Bataillone eines mächtigen Landesverbandes verlassen, war nicht in Seilschaften und einflussreiche Netzwerke oder Sauna-Gemeinschaften eingefügt. Und dennoch wurde sie Kanzlerin, dennoch führt sie die CDU seit nunmehr 18 Jahren – weit länger als dies Ludwig Ehrhard, Kurt Kiesinger, Rainer Barzel oder Wolfgang Schäuble gelang, die allesamt keine ganz kleinen Kaliber in der deutschen Politik waren.
Bleiben wir mithin bei unserer Geschichte. Angela Merkel hatte einiges vom starken Wanja. 35 Jahre lebte sie in der DDR, bis die Mauer fiel. Es sei ein entschleunigtes Leben gewesen, wurde oft berichtet.3 Merkel jedenfalls nahm sich alle Zeit der Welt, um geruhsam in den Tag hinein zu promovieren, profilierte sich nicht durch staatlich erwünschten Aktivismus, investierte aber auch keine Kraft in Oppositionsaktivitäten; dergleichen hielt sie für verlorene Liebesmüh. Die meisten Gegner der SED-Herrschaft waren, anders als sie, im Herbst 1989 bereits zermürbt und verschlissen, hatten sich in Konspirationen und Verdächtigungen verbissen. Angela Merkel hingegen betrat die politische Bühne der Bundesrepublik als Wanja: ausgeruht, neugierig, ohne den verzerrenden Blick abgekämpfter Lebenslangaktivisten.
Das war die Differenz Merkels nicht nur zu den früheren Ost-Dissidenten; das war auch der Unterschied zu ihren gleichaltrigen Rivalen an der Spitze christdemokratisch geführter Landesregierungen vom Pacto Andino. Sie alle waren schon rund drei Jahrzehnte im Geschäft, waren die Karriereleiter von der ersten bis zur vorletzten Sprosse hochgeklettert, von der Schüler Union über die Junge Union, den RCDS, die Kommunalpolitik, die Landespolitik und so weiter. Sie waren bestens versäult, sie kannten die Rituale und Konventionen ihrer Partei, die Sprachformeln und Symbole ihrer Milieus. Immer hieß es, dass sei die Voraussetzung schlechthin, um in der Parteiendemokratie zu reüssieren.
Aber in den Nach-Kohl-Jahren standen Parteien nicht mehr im Zentrum, waren nicht mehr Ausdruck elementarer und kraftvoller Soziallagen. Wer dort Tag für Tag geackert hatte, galt nicht mehr unbedingt als Experte für Hoffnungen und Ängste der tragenden Lebenswelten in dieser Republik. Insofern sind Parteien für den politischen Prozess, für Rekrutierung, Orientierung und Mobilisierung nicht mehr so zwingend wichtig wie früher – mit der Folge, dass die intime Kenntnis der inneren Mechanismen des Parteienbetriebes an Bedeutung verliert. Die Kochs, Merzens, Müllers, Beusts, Wulffs, Rüttgers, Böhrs und wie sie alle hießen und heißen hätten gegen Merkel das Spiel leicht gewinnen müssen – hätten es drei Jahrzehnten zuvor gewiss auch noch souverän gewonnen -, wären die klassischen parteidemokratischen Fundamente nach wie vor intakt und vital gewesen. Aber mit der Vitalität war es vorbei. Und doch absorbiert das Engagement dort, gleichsam von Kindesbeinen an, viel Zeit, Energie und Phantasie für introvertierte Händel in einer nunmehr randständig gewordenen, fast absonderlichen Gesellungsform. Das Tun dort erdet nicht mehr, sorgt nicht für Wurzeln und Erfahrungen, nicht für Commonsense und Wirklichkeitssinn. Die Binnenbetriebsamkeit in diesem Biotop verschleißt enorm viel Lebenskraft, zieht die Tag für Tag Engagierten von wirklich substanziellen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ab. Und so sind die Aktivisten von früher Jugend an meist schon erschöpft, wenn sie da ankommen, wo sie immer hinwollten – und werden dann noch dazu härter denn je in der bundesdeutschen Geschichte in wutbürgerlichen Lebenswelten als abgehobene und egoistische Postenjäger beschimpft.
Über die Ambivalenzen des Bürgerengagements
Dabei war bereits in den 1970er in Pamphleten und Essays akademischer Neo-Marxisten Jahren viel und gern von den „Legitimationsproblemen des bürgerlichen Staates und der Demokratie“ die Rede gewesen. Indes: Damals stand das Gros der Wahlbürger noch keineswegs im tiefen Groll den Institutionen der repräsentativen Demokratie gegenüber. Doch in jüngerer Zeit indessen hat sich die Sichtweise der Deutschen weitreichend verschoben. Das Ansehen besonders der Parteien, Parlamentarier und Regenten ist mit Aplomb zurückgegangen. So existiert das Problem, das vor 45 Jahren noch keines war, derzeit tatsächlich. Zumal: Moderne Demokratien sind, besonders im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, gleichsam in paradoxer Reaktion auf gesellschaftliche Vielfachdifferenzierung und partizipatorische Transparenz- und Beteiligungsverlangen, mehr und mehr zu Verhandlungsexekutiven in verschlossenen Räumen und informellen Strukturen minoritärer Runden von Entscheidungsträgern mutiert. Die Vereinbarungen der politischen Klassen mit anderen potenten Akteuren in Ökonomie und Gesellschaft vollziehen sich zunehmend jenseits parlamentarischer Foren und ihrer Einwirkungsmöglichkeiten.
Die Parteien in Deutschland scheinen sich dem nicht zu widersetzen. Man kann seit Jahren Parteitage erleben, auf denen „Europa“ als eines unter mehreren Themen auf der Tagesordnung steht. Sobald der Punkt aufgerufen wird, erheben sich etliche Delegierte – nicht anders als die journalistischen Beobachter – von ihren Sitzen, um in der Lounge Kaffee und Brötchen zu sich zu nehmen. Das Gros der nationalen politischen Mandatsträger hält sich vom Terrain transnationaler Entscheidungen längst fern, akzeptiert nahezu fatalistisch die eigene Einflusslosigkeit auf diesem Gelände. Statt der über Jahre in präsidialen Reden und Akademieansprachen belobigten Partizipation wurde Depolitisierung das politische Stil- und Herrschaftsmittel im frühen 21. Jahrhundert.4
Bürgerbeteiligung, zivilgesellschaftliches Engagement, Mitsprache – all diese Begriffe und Losungen, die primär in der sozialliberalen Reformära der frühen 1970er Jahre generationsprägend zirkulierten, erleben durchaus ein veritables Revival.5 Schließlich zieht das politische System aus alledem auch seinen Nutzen. Hinter dem Engagement von Bürgern stehen Wissen, Information, Ideen, Einfälle und beträchtliche Energien, derer sich der Staat in allerlei Feldern, die nicht zum Kernbereich politischer Macht, dafür zum Aufgabenset erwartbarer Dienstleistungen gehören, gewinnbringend bedienen kann.6 Überdies: Das institutionalisierte Gemeinwesen kann sparen, wenn emsige Bürger die Löcher stopfen, die aufgrund von Streichungen bei den Haushaltsplänen durch die öffentliche Hand gerissen worden sind. Selbst der dezidierte, oft bedrohlich erscheinende Bürgerprotestprotest kann dem System, ob beabsichtigt oder nicht, wertvolle Dienste leisten. Auch deshalb schauten akademische Marxisten schon in den 1970er Jahren misstrauisch auf die diversen Bürgerinitiativen. Die radikale Linke wertete deren Treiben als „systemstabilisierend“, ordnete ihnen süffisant die Funktion eines „Frühwarnsignals“ für die ansonsten ahnungslos gebliebenen Herrschenden zu, welche dann den Unmut durch reformistische Palliativmittel pazifizieren und letztlich unschädlich machen konnten. Rundum falsch war diese Interpretation nicht. Die von konservativen Professoren zeitgleich befürchtete „Unregierbarkeit“7 der modernen, fragmentierten demokratischen Gesellschaften trat jedenfalls nicht ein, trotz zahlreicher Protestwellen, einhergehend mit sozialen und kulturellen Konflikten, gerade in den Jahren des Sozialliberalismus nach der Ära Willy Brandt. Die gesellschaftlichen Eruptionen dieser Zeit trugen vielmehr dazu bei, dass sich das Parteiensystem erweiterte und dadurch die neuen rebellischen Kohorten und Bewegungen integrativ domestizierte, auch, dass sich die politische Elite ergänzte und somit Repräsentationslücken schloss, schließlich, dass sich der westdeutsche Kapitalismus durch ökologische Anstöße modernisierte und Wettbewerbsvorteile in den Umwelttechnologien auf dem Weltmarkt errang. Insofern wirken Partizipationsströme wie Fermente für rechtzeitige systemimmanente Innovation, die andernfalls zu spät hätte kommen können.
Andererseits: Protest und Partizipation erfordern ihren physischen und psychischen Tribut. Man hält nur eine Zeit lange die eitlen Auseinandersetzungen und artifiziellen Aufgeregtheiten des aktiven Lebens aus, braucht dann die kontemplative Ruhe und das meditative Schweigen, wenngleich öffentlicher Aktivismus nicht ganz wenige, die ihn betreiben, in Sucht und Abhängigkeit geraten lässt.8 In der Zeit, die dem Engagement folgt, sind die erschöpften Akteure froh über Institutionen und Repräsentativorgane, die entlasten. Das konnte man seit Mitte der 1980er Jahre gut beobachten. Die junge Partizipationsgeneration der sozialliberalen Jahre nahm während der Kohl-Ära eine Auszeit im kollektivem Engagement, da sie, in der Rushhour des Lebens angekommen, durch Beschleunigung und Multiplikation beruflich-privater Anforderungen keine freien Energien für zivilgesellschaftliche Intervention mehr besaß. Die viel beklagte Entpolitisierung der Kohl-Jahre war keineswegs allein eine gezielt politisch-kulturelle Restauration der regierenden Konservativen, sie wurde auch von denen, die sich weiterhin kritisch gaben, stillschweigend fundiert.9
Darauf hat in den letzten Jahren Ingolfur Blühdorn, Politologe an der englischen Universität Bath, wieder und wieder hingewiesen. Blühdorn sah im Rückzug aus der politischen Partizipation allerdings keine temporäre Erscheinung einer im Lebenszyklus vorübergehend erschöpften Generation. Der Politikwissenschaftler geht erheblich weiter, radikalisiert gewissermaßen das Paradigma der „Postdemokratie“. Blühdorn bezweifelt, dass die Demokratie jemals eine adäquate Ordnung für moderne Gesellschaften war; und er glaubt nicht daran, dass sie noch ein attraktives Modell für die Mehrheit der Bürger im 21. Jahrhundert bleiben wird. Schlachtrufe der Art von „Democracia real YA!“ oder Losungen wie „mehr Demokratie wagen“ erscheinen ihm hohl, gar abschreckend. Das Gros der Bürger habe in den hochkomplexen Gesellschaften genug mit dem Management der mittlerweile vielfältigsten Probleme und Aufgaben des Alltags zu tun, so dass zusätzliche Partizipationsanstrengungen im öffentlichen Raum für die überforderten Subjekte nicht mehr zu verkraften seien. Nicht zuletzt deshalb hätten die ehemaligen postmaterialistischen Mittelschichtsbürger so freudig die Metapher vom „politischen Konsum“ aufgegriffen, um damit ohne weitere Engagementsleistungen das samstägliche Shopping zum zeitgemäßen Ausdruck weltverbessernder politischer Aktivität veredeln zu können.10 Blühdorn sieht in einem solchen umdefinierten Partizipations- und Politikverständnis – von ihm als „simulative Demokratie“ bezeichnet – gerade auch unter ökologischen Gesichtspunkten eine ernsthafte Gefahr für die Zukunft der Gesellschaften. Würden Bürger in einer im Grunde „reaktionär gewordenen Demokratie“ in Konsumentengesellschaften zu zusätzlichen Beteiligungsansprüchen ermuntert werden, dann könne dies nur auf Kosten einer ressourcenschonenden Nachhaltigkeit gehen. Die innere Dynamik von Demokratie und Partizipation läuft Blühdorn zufolge auf Erweiterung hinaus, auf einen Zuwachs individueller (Konsumenten-) Autonomie und auf eine Anhebung des materiellen Lebensniveaus für organisations- und forderungsstarke Gruppen. Gerade diese Art von Emanzipation aber erachtet er als besondere Gefahr. Denn so stehe zu befürchten, so Blühdorns düsteres Orakel, „dass gerade unter den Bedingungen fortgeschrittener Gesellschaften ‚mehr Demokratie‘ vor allem mehr Naturzerstörung und soziale Ausgrenzung bedeuten könnte“.11 Jahrzehnte vor Blühdorn hatte bereits ein liberal-konservativer Intellektueller zu bedenken gegeben: „Demokratisierung bedeutet im Regelfall nicht Demokratie, sondern Oligarchie. Es sollen ein paar neue Gremien eingerichtet, ein paar neue Räte besetzt werden.“12 Und Herfried Münkler, ein sozial-liberaler Denker und Politologe unserer Tage, urteilt gleichermaßen skeptisch, dass „das Demokratisierungsprojekt der Demokratie eher geschadet als genutzt“13 habe. „Albtraum Partizipation“?14
Gleichviel. Der Partizipationsbedarf jedenfalls ist, auch wegen der gewachsenen Zahl an zeitreichen, gut qualifizierten „jungen Alten“, gewiss zuletzt eher gestiegen. Schon und gerade der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder und andere sozialdemokratische Regierungschefs des sogenannten Dritten Weges reagierten darauf mit einer bewussten Strategie der Depolitisierung15, gleichsam als Technik moderner Gouvernementalität, um durch den Imperativ der „Alternativlosigkeit“ Gegenpositionen zu delegitimieren. In der Tat: Der unzweifelhaft gestiegene Wunsch nach vielfachen Beteiligungen der Bürger an politischen Vorhaben verkomplizierte den Entscheidungsprozess. Das wiederum erzürnte das Gros der Bürger, deren Ansprüche auf ein rasches, konzises und effektives Regierungshandeln ebenfalls angestiegen sind, was in der Vetogruppendemokratie, zu der der Partizipationsimpetus unweigerlich führt, schlechterdings nicht zu realisieren ist. Der Bürger, der es in seiner Rolle als Konsument gewohnt ist, dass sein je individuelles Bedürfnis prompt befriedigt wird, reagiert politisch verdrossen, da die Politik den Bürgern nicht geben kann, was diese als Konsumenten verlangen und als Partizipanten zugleich verunmöglichen. Auch dürfte schwer zu leugnen sein, dass sich durch partizipatorischen Impetus die rechtlichen Regelungen im Resultat ausweiten, was in der Folge zu jener Überregulierung des öffentlichen Lebens führt, welche die Bürger dann gegen Staat und Politik in Wallung bringt.16 Zusammen: Je heterogener die Bedürfnisstruktur von Gesellschaften ohne homogene sozialmoralische Vergemeinschaftung ausfällt, desto schwieriger gestaltet sich der Aushandlungsakt von Politik, die nur noch mühselig und inkohärent aggregieren kann, was die aufgesplitterte Gesellschaft an unterschiedlichsten Begehrlichkeiten an sie heranträgt und ihr abverlangt.17
Aber das goldene Zeitalter fest strukturierter Weltanschauungslager ist nun mal passé. Doch was bedeutet das? Bietet das Grund zur Besorgnis oder vielmehr Anlass zur Erleichterung, da die früheren Lagerkulturen einen unzweifelhaft antiindividuellen Disziplinierungscharakter besaßen? Unter Interpreten überragt – und sicher nicht zu Unrecht – die positive Interpretation des gesellschaftlichen Dekompositionsprozesses. Man goutiert die sonnigen Seiten der Individualisierung, lebt die Opulenz der Optionen, schätzt die Möglichkeit des Auszugs aus beengenden, kontrollierenden, einhegenden Kollektiven. Das ist fraglos attraktiv – jedenfalls für diejenigen, die über Bildung, Mobilität, Selbstbewusstsein und Kreativität verfügen.
Nur: In den vom gelungenen Fortschritt entkoppelten Teilen der Gesellschaft bedeutet der Abschied von den bergenden Lagern in der Regel nicht das glückliche Entree in ein Reich neuer Möglichkeiten und Chancen. Hier geht die Erosion der sozialmoralischen Vergemeinschaftungen einher mit der Wahrnehmung eigener Überflüssigkeit.18 Die alten Milieus hatten nicht allein Wärme und Nähe geboten, sondern ebenso zahlreiche Funktionen und Tätigkeiten im weit gefächerten Organisationssystem, was ihnen Bedeutung und Selbstbewusstsein verschaffte. Mit dem Zerfall der sozialmoralischen und politischen Vergemeinschaftungen ist diese aktivierende, ermutigende und inkludierende Wirkung großflächiger Organisationszusammenhänge der Selbsthilfe verloren gegangen. Die postindustriegesellschaftliche Individualisierung ist daher für diejenigen ohne hinreichend eigene Handlungspotentiale und wissensgesellschaftliche Kompetenzen negativ, hoffnungsarm und im Grunde zukunftslos. Natürlich, ein Zurück zu den mitunter abträglich nach innen homogenisierenden und nach außen scharf konfrontativen Groß-Lagern wird es nicht geben. Schließlich vollzog sich die Herauslösung aus der Kollektivität, die Dekomposition der großorganisatorischen Hierarchien seit den 1970er Jahren nicht zufällig. Aber man kann es sich auch nicht zu einfach machen und nun fröhlich und selbstgewiss kurzerhand die „Bürger“- oder „Zivilgesellschaft“ als probaten Ersatz für die überkommenen wie verschlissenen Milieus preisen.19
Die gegenwärtig gelobte Zivilgesellschaft jedenfalls bietet jenen wenig Hoffnungen und Aussichten. Gerade die modernen Partizipationsinitiativen liefern keine Lösung des Ungleichheitsproblems, laufen vielmehr noch stärker auf eine Art Zensusdemokratie hinaus. Es behaupten sich im zivilgesellschaftlichen Engagement im Wesentlichen diejenigen, die über besonderes Kapital verfügen, die Interessen wirksam zu organisieren vermögen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, die Bündnispartner aufgrund des eigenen gesellschaftlichen Gewichts gezielt mobilisieren können. Wer hingegen über dergleichen rhetorische, organisatorische, kommunikative, natürlich auch materielle Quellen nicht verfügt, steht außerhalb der Teilhabe- und Mitwirkungsgesellschaft.20 Das Unbehagen darüber hält sich erkennbar in Grenzen, obwohl im Akt der Partizipation und des aktiven Protests gar ein Treibmittel der Ungleichheitsverschärfung steckt. Eine wesentliche Quelle für zivilgesellschaftliches Engagement ist die biographisch mehrfach gestützte Erfahrung von Selbstwirksamkeit.21 Personen, die bereits von Kindheit an die Wirkmächtigkeit ihres Tuns erleben durften, Zuspruch fanden, Lob ernteten, verfügen über feste Polster an Selbstvertrauen. In den neuen Unterschichten dagegen muten die biographischen Schlüsselerlebnisse anders an: In der Bilanz überwiegen Abbrüche, Risse, Zurückweisungen, Verletzungen, nicht die psychisch stärkenden Augenblicke des Gelingens und des Erfolgs.
Allein deshalb bevölkern Mittelschichtzugehörige mit akademischen Titeln und Abschlüssen die Bürgerbegehren, aber kaum diejenigen ohne solchen Hintergrund.22 Und im kollektiven Engagement setzt sich die Kompetenzerweiterung bei denjenigen, die bereits reichlich mit Wissen, Informationen, oratorischen Fähigkeiten versorgt sind, nochmals fort. Denn bei der Organisation von gemeinschaftlichem Engagement sammeln sich ebenfalls Fertigkeiten an. Die Aktiven müssen in der Lage sein, Organisationsstrukturen aufzubauen, Medienkontakte zu unterhalten, mit sattelfesten Begründungen ihres Anliegens bei Behörden Druck und Eindruck zu machen, in den Details der Rechtsprechung kundig zu wirken.
Man kann auf diese Weise zum Professionellen des gesellschaftlichen Aktivismus avancieren. Immerhin werden derzeit erste Stimmen auch im zivilgesellschaftlichen Spektrum selbst laut, die davor warnen, dass sich eine elitäre Binnengruppe von expert citizens herausschält, welche durch ihre hohe Professionalität im Umgang mit Bürokratien, Verbänden, Parteiapparaten und Medienrepräsentanten gewissermaßen einen Partizipationslobbyismus begründet, um zwischen den Wahltagen und trotz widriger parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse die exklusiven Interessen der sie tragenden, zuwendungsfähigen Bürgertummilieus durchzusetzen. In einer solchen Zivilgesellschaft geht es nicht anders zu als in Wettbewerbsgesellschaften generell: Diejenigen mit hohem Ressourcenpotenzial verknüpfen ihre Interessen, nutzen die so kumulierte Marktmacht, erweitern schließlich im Prozess und Ergebnis der zivilgesellschaftlichen Konflikte Zug um Zug ihre Positionen und ihren Einfluss. Die anderen, ohne dieses komfortable Depot an Kapital, Kompetenz und Kontakten, halten nicht mit, geraten noch stärker in die gesellschaftliche Defensive.
Etwas seltsam ist es deshalb schon, dass gerade in Deutschland „Partizipation besonders hemmungslos verklärt“23 wird. Denn die neuere deutsche Gesellschaft gibt vor allem mit Blick auf die Jahre von 1925 bis 1932 einige Hinweise darauf, dass „Organisation und Aktivierung“24 von Bürgervereinigungen jenseits von Staat und Parteienwesen keineswegs zur Stabilisierung von Demokratie und Zivilität beitragen müssen. Die militante Polarisierung und dogmatische Entfesselung der zivilgesellschaftlichen Destruktionskräfte in den 1920er und frühen 1930er hat eins gezeigt: Eine in konfrontative Weltanschauungen und Eigenwelten geteilte Zivilgesellschaft, die schwachen staatlichen Institutionen und Repräsentativorganen gegenübersteht, kann parlamentarisch verfasste Demokratien nicht festigen, sondern nur unterminieren.25
Nun sind die politischen Institutionen in der bundesdeutschen Gesellschaft natürlich weit stabiler als in jenen unglücklichen Jahren der Weimarer Republik. Auch hat sich gerade die politische Kultur des mittleren deutschen Bürgertums seit den 1960er Jahren kontinuierlich verändert. Eine reaktionäre Zivilgesellschaft steht nicht vehement rüttelnd vor dem Zaun. Da Mitwirkung und Selbstverantwortung den Bürgen seit Jahren gezielt in allen möglichen Sektoren ihres Lebens abverlangt werden, ist ein Zuwachs an Partizipation in der Politik schwerlich zu desavouieren. Die Zahl der Bundesbürger, die über gefestigtes Selbstbewusstsein und beträchtliche Wissensbestände verfügen, ist so stark gewachsen, dass eine unhinterfragte Subordination gegenüber der Autorität von Politikern und Ministerialbeamten nicht mehr zu erwarten ist.
Schließlich haben sich Umfang, Bedeutung und Dauer besonders von Großprojekten in einem solchen Maß potenziert, dass ein einmaliges, durchaus ordnungsgemäß verlaufendes Verfahren nicht mehr reicht, um deren Legitimation zu sichern.26 Dehnt sich allein die Planungs- und Bauzeit auf zehn bis zwanzig Jahre aus, sind die Eingriffe solcher gigantischer Bauunternehmen in die Lebensformen der Bürger tief und von Dauer, zumindest kaum zu korrigieren, dann haben nachgewachsene Alterskohorten, die wegen mangelnder Mündigkeit zu Beginn des Verfahrens als Wähler nicht einmal zumindest indirekt in die Willensbildung einbezogen waren, einiges Recht, vor neuen Hintergründen neue Einwände zu formulieren und sich dem Vollzug der Planungsschritte in den Weg zu stellen.
Die Reversibilität von Entscheidungen gehört bekanntlich zum innersten Kern demokratischer Legitimation, die sich im 21. Jahrhundert stärker als zuvor durch eine fortlaufende Begründung und Erörterung ihrer selbst ausweisen muss.27 Man mag das eine „doppelte Demokratie“28 nennen, um auf die Ergänzung der parlamentarischen Methode durch direktdemokratische Elemente der Willensäußerung zu drängen; man kann auch für eine „zugleich responsive und partizipatorische Demokratie“29 plädieren oder die „Demokratisierung der repräsentativen Demokratie“30 postulieren. Vom basisdemokratischen Furor werden all diese Vorschläge nicht angefeuert. Aber ihre Autoren verschließen nicht die Augen davor, dass das erreichte Partizipationsniveau in der Gesellschaft mehr und mehr in eine Spannung mit der Beschränkung des Bürgers im parlamentarischen Feld auf den Wahlakt gerät, dass also eine neue Balance gefunden werden muss, für die im Entstehungsakt des Parlamentarismus in der Frühmoderne noch keine Notwendigkeit existierte. Bemerkenswert ist hier die Begründung, die der Politikwissenschaftler Herfried Münkler für eine neue Varianz demokratischer Artikulation gibt. Auch ihn beunruhigt, dass in der Gesellschaft zu den schon länger bekannten „Verdrossenen“ (meist der unteren Schichten) mit der Zeit auch noch die „Empörten“ (überwiegend aus der Mitte) hinzugekommen sind. Deren „Problem ist, dass sie nicht wirklich wissen, was und wie etwas anders gemacht werden kann. Sie drücken Empörung aus, ohne konkrete Alternativen ins Spiel bringen zu können. Der Zerfall des Volkes in Verdrossene auf der einen und Empörte auf der anderen Seite ist für die Demokratie gefährlich. Hier können direktdemokratische Verfahren hilfreich sein, wenn sie die Verdrossenen aus ihrer Lethargie holen und die Empörten zwingen, Alternativen zu formulieren und dafür Mehrheiten zu gewinnen.“31
Der Mangel an überzeugenden Alternativkonzepten wird den Protestgruppen häufig vorgeworfen. Aber oft geht es den demonstrierenden Bürgern gar nicht um eine große umstürzlerische Alternative, um einen weiteren hochmodernen Zukunftsentwurf. Ihnen ist die Gegenwart schon viel zu sehr von Zukunft durchdrungen, da seit Jahren in immer kürzeren Abständen Innovationsbedarf angemeldet und Veränderungen in Permanenz apodiktisch – um der Zukunftsfähigkeit willen – ausgerufen werden. Die Normen dieser „Zukunftsfähigkeit“ der Erwerbsgesellschaft – jederzeit professionelles Verhalten, flexible Einpassungsbereitschaft, elastische Mobilitätsfähigkeit – haben die früher abgetrennte Sphäre des Berufs verlassen und den gesamten Alltag besonders der Mitte vereinnahmt. Gerade deshalb benötigen die Betroffenen Ruhepunkte, Oasen, Nischen, um auszuhalten und zu ertragen, was der Primat der Ökonomie täglich dem bürgerlichen Einzelnen abverlangt. Die Moderne hat stets Räume des Nichtmodernen gebraucht, in denen sich sozialmoralische Mentalitäten, kulturelle Eigenarten, eigenwillige Zeitstrukturen konservierten, um Orte der Kompensation, auch Stätten des Widerstands gegenüber dem sonst ungehemmt wuchernden Destruktionstrieb des Kapitalismus zu besetzen. Diese vormodernen Räume, welche die kapitalistischen Marktgesellschaften durch Begrenzung stützten, die aber auch die Erinnerung an Lebensweisen und Sinnmuster jenseits davon bewahrten, Nester des Widerstands mit Tagträumen des „ganz Anderen“ bildeten, sind rar geworden.
Doch fragen wir nicht nur nach den Ressourcen für Nonkonformität und Eigensinn, sondern auch nach dem, was man vor rund 20 Jahren besonders gern und viel thematisiert hat und als „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ bezeichnet. Die Debatte darüber war zwischenzeitlich auffällig verebbt, wenngleich innergesellschaftliche Heterogenitäten und Disparitäten währenddessen gar zugenommen hatten. Im Jahr 2015 aber ist, in Anschluss an Pegida, die rasant gestiegenen Flüchtlingszahlen, die Terroranschlägen der IS, die Frage nach dem Kohäsionsstoff, der in modernen Demokratien ohne ein verbindlich vorausgesetztes Werteset gleichwohl ein ziviles Miteinanderauskommen von Bürgern sehr unterschiedlicher Provenienz zu ermöglichen vermag, wieder stärker zurückgekehrt. Der Deutsche Bundestag hat gar etliche Millionen Euro für den Aufbau eines „Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ bewilligt. Denn die „anzunehmenden Zweifel an den Grundlagen von Staat und Gesellschaft erfordern eine umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Strukturen und Wahrnehmungen gesellschaftlicher Zugehörigkeit“32, wie das jetzt zuständige Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu begründend ausführt.
In der Tat: Wirklich weit vorangeschritten sind die Erörterung über diese Frage noch nicht. Die klassische Integrationsformel für den bundesdeutschen Verfassungsstaat bot anfangs der Staatsrechtler Rudolf Smend, die er aus dem Scheitern der auch von ihm als Deutschnationalem in jenen Jahren nicht geschätzten Weimarer Republik analytisch gewonnen hatte.33 Die Weimarer Gesellschaft, die in zum Teil blutig ausgetragene weltanschauliche und soziale Konflikte gespalten war, hätte, so Smend, Erlebnisse der Einheit, einen von allen Bürgern geteilten Sinn, benötigt, welcher sich durchgängig in einer erlebten Gemeinschaft reproduzieren müsse. Die Integration der Gesellschaft, durch die der Staat sich erst wirklich als Staat realisiere, habe sich in einer anerkannten und die Konflikte überwölbenden Führungsgestalt zu erfüllen. Wichtig hierfür war für Smend zudem der Erlebnischarakter34 von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. Und die Integration brauchte Symbole, Manifestationen und Rituale in Form von national-einträchtigen Gesängen, Feiertagen, Gedenkveranstaltungen, Fahnen. Das alles zusammen bildete seinerzeit die berühmte Smend‘sche Faktorentrias gelungener Einbindung: Vergemeinschaftung über Persönlichkeit, Sachlichkeit und Funktionalität. Smend forderte überdies die Integration von den Staatsbürgern selbst ein; ihnen war die Aufgabe gestellt, aktiv an der Einheit von Werten und Staatsanpassung mitzuwirken.35 Der Einzelne hatte die Pflicht zur Gemeinschaft, zum Dienst am Staat, zur bereitwilligen Subordination unter den Imperativ der Geschlossenheit.
Nur: Wie realitätsadäquat ist das alles (noch)? Schaut man sich die aktuellen Fragmentierungen in der europäischen Politik an, dann könnte man auf den ersten Blick für eine Reaktualisierung von Smend plädieren. In der Europäischen Union fehlt schließlich alles, was hiernach an Faktoren für eine erfolgreiche Integration zusammenkommen sollte: einbindende, sammelnde und orientierende politische Führung, das Erlebnis einer gemeinsamen politischen Öffentlichkeit, emotionalisierende und Homogenität stiftende Symbole für die Gemeinschaft eines europäischen Volkes. Die massiven Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 haben die Kontroverse um die Integrationsformeln weiter verschärft. Viele Muslime, geben Experten zu bedenken, stören sich an der Beliebigkeit der Wertevorstellungen, die im Westen, ihrer neuen Heimat, gang und gäbe ist: „Es gebe keine Regeln, keine allgemeingültigen Werte mehr, man könne alles so oder auch andersherum sehen“36, lautet die Klage. Auf der anderen Seite fürchten Konservative aus dem deutschen Politikspektrum, dass die Überlast an muslimischen Flüchtlingen „die Identität und Integrität unserer deutschen Kulturnation“37 gefährde. Und dazwischen äußern sich Zugehörige einer kommunitaristisch orientierten, bildungsbürgerlich-ökologisch gesinnten Mitte schon seit Jahren in Sorge darüber, dass die hochindividualisierten Gesellschaften des Westens nicht einmal mehr ein Minimum an verbindlicher Ethik, auch an gesellschaftlichem Konsens, hervorbringe, was Solidaritäten zerstöre, Antinomien züchten müsse.
Kurz: Nötig scheint ein Integrationsmaterial, das die gesellschaftliche Entwicklung nicht nur nicht recht hervorbringt, sondern geradezu konterkariert, vereitelt. Moderne Gesellschaften zerfallen immer stärker in Teilmilieus, Einstellungspräferenzen, spirituelle Vorlieben, ethnische Herkünfte und Zuordnungen, Überzeugungen und Lebensstile, man mag zudem sagen: in autonome Subsysteme mit je eigenen Codes und Logiken. Und auch die politisch-gesellschaftlichen Partizipationspraxen der letzten Jahre erleichtern Integration nicht unbedingt, da die Aktivitäten zumeist gut ausgebildeter und selbstbewusster Bürger vielfach allein projektbezogen und dabei robust interessenorientiert sind, die politische Moderation und balancierenden Ausgleich nicht ganz einfach machen.38 Insofern lautete die zwar trotzig formulierte, jedoch wohl auch aufmunternd gemeinte, im Grunde aber resignierte Empfehlung des Sozialwissenschaftlers Helmut Dubiel schon vor gut zwanzig Jahren: „Die demokratische Gesellschaft hingegen sollte auf jede – und noch so schwache – Suggestion von Einheit verzichten. Im Unterschied zu einem so interpretierten Totalitarismus bezeichnet Demokratie das Projekt einer Gesellschaft, die sich einzig in der institutionalisierten Anerkennung ihrer normativen Desintegration integrieren kann.“39 Es seien einfach „nicht mehr Ähnlichkeiten des religiösen Bekenntnisses, ethnischer Merkmale oder nationaler Traditionen, die moderne Gesellschaften integrieren, sondern einzig ihr historisches Kapital ertragener Divergenz.“40 Ganz geheuer aber war Dubiel sein eigener Ratschlag wohl auch nicht. Denn zum Ende seiner Überlegungen gab er zugleich zu bedenken: „Und am Phänomen des Konfliktes ansetzende Theorien politischer Integration – wie die unsere – müssen die Grenze bedenken, jenseits deren Konflikte nur noch desintegrativ wirken.“41