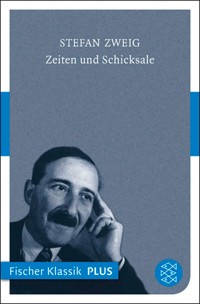
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Mit einem Nachwort von Knut Beck. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Stefan Zweig wollte mit seinen Essays und Vorträgen, »ohne aktuell zu polemisieren... durch ein Symbol vieles Heutige deutlich und verständlich« machen. Den Schlussstein seines biographisch-essayistischen Werkes versuchte er noch in den letzten Wochen seines Lebens zu setzen, mit seiner Studie über Montaigne, den »homme libre«, den »Vorkämpfer für innere Freiheit« – stellvertretend als einen Dank für alle seine geistigen Vorbilder in hellen wie in dunklen Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Stefan Zweig
Zeiten und Schicksale
Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1902-1942
Fischer e-books
Mit einem Nachwort von Knut Beck.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
IZeit und Welt
Die indische Gefahr für England
(Anläßlich der politischen Mordtat eines jungen Hindu) 1909
Die vier Revolverschüsse, mit denen ein junger Hindu, Madar Lal Dhingra aus Amritsar, an einem Festabend in London den Aide-de-Camp [den persönlichen Adjutanten] des Vizekönigs von Indien, Sir William Curzon Wyllie, ermordete, haben die ganze englische Nation aufgeschreckt. Vergessen ist für einen Augenblick die Germanophobie über der alten lastenden Gefahr, die einen so entschlossenen Boten gesandt hat. Und ängstlich horchen nun alle nach Osten, ob von dem fernen Riesenreiche grollendes, gefährliches Echo käme, das langgefürchtete Gewitter: der Aufstand Indiens. Oder ob dies nur die vereinzelte Tat eines überreizten Fanatikers war, ein bedeutungsloses Wetterleuchten am politischen Himmelsrand. Es ist verlockend und gefährlich, über diese Möglichkeiten zu reden. Verlockend vor allem: denn das Blatt der Geschichte, auf dem die Befreiung Indiens von den Engländern geschrieben sein wird, muß ebenso grandios, erregend und überraschungsvoll sein wie jenes andere – bei uns viel zu selten aufgeschlagene – der Eroberung eines solchen Riesenreiches durch eine Handvoll Kaufleute und einen genialen Konquistador. Aber gefährlich zugleich. Denn zu tief sind die Kräfte verborgen, zu unübersichtlich die Dimensionen, zu unsicher die Quellen, zu tendenziös verkleinert oder vergrößert die Symptome. Eine Reise ins Land und selbst vielfältiges Gespräch mit den Beamten der Regierung gibt bestenfalls einen Einblick ins Gegenwärtige: und dies schon ist in Indien pittoresk und großartig genug, um die Phantasie auf das höchste anzuspannen. Denn das Imperium der Engländer in Indien ist einer der grandiosesten Versuche, durch geistige Gewalt, nationale Geschlossenheit und moralische Suprematie [Überordnung] einen gigantischen Widerstand zu paralysieren: grandios wie jeder Kampf gegen ein Unmögliches, aufreizend wie jede tödliche Gefahr.
Sowenig man vom heutigen Indien weiß: dies ist bekannt, daß 200000 Europäer, oder eigentlich ein Bruchteil dieser Summe, daß 70000 englische Soldaten 300 oder 400 Millionen einheimischer Bevölkerung niederhalten. Nackte Zahlen als Ausdruck eines realen Verhältnisses sind präzise, aber nicht plastisch. Das Vorstellungsvermögen kann sich 70000 Menschen noch in einer Vision veranschaulichen: das grüne Parkett unseres Schönbrunn vermag so viel zu fassen. Aber die unsägliche Winzigkeit dieser Anzahl gegenüber den Hunderten Millionen läßt sich nicht mehr ausdenken. Dieser Tropfen, in den Blutorganismus des indischen Reiches eingemischt, zerfließt, ohne den Farbton zu ändern. Und doch – dies ist das Undenkbare für den Fernen – diese Wenigen geben dem heutigen Indien die Signatur. Das Schiff, das in den Hafen von Bombay steuert oder den niederen Hooghly hinauf nach Kalkutta, sieht zuerst hohe Kathedralen, stattliche Bauten im englisch-gotischen Stil, Docks wie in Glasgow und Liverpool: die Front, die Stirne, der erste Eindruck gegen die Ferne ist England. Und dann im Lande selbst wächst das unwahrscheinliche Verhältnis ins Grenzenlose. Da sind Städte von 100000, 200000 Einwohnern mit fünf oder sechs Europäern. Aber diese fünf haben in ihren Händen die ganze Macht: die Bahn, die Bank, den Telegraph, das Residenzschloß, die Justiz und die Festung. Sie sind die Verwalter Englands. Millionen und Milliarden strömen durch ihre Hände zu der fernen kleinen Insel. Die hier noch Herrscher heißen, die Maharadjas, die mit ihren Prunkschlössern, mit den juwelenbesetzten Schwertern, den kostbaren Gewändern königlicher scheinen als alle Herrscher des Abendlandes, sind Drahtpuppen, Popanze, denen es als höchste Ehre dünkt, beim state-ball in Kalkutta vom Vizekönig empfangen zu werden. Diese Organisation, dies Bändigen eines ungeheuren Widerstandes durch Politik, Gewalt und geistige Superiorität, ist für einen modernen Menschen das größte Wunder in Indien. Die meisten suchen dort das Geheimnisvolle bei den Schlangenbeschwörern und Fakiren, den heimlichen Riten der Brahminen. Ich weiß nicht, ob es in Indien trotz der herrlichen, oft traumhaft schönen Bauten der Mogulen etwas geistig Faszinierenderes gibt, als die sinnfällige Unwahrscheinlichkeit und ebenso sinnfällige Tatsächlichkeit des englischen Imperiums.
Wie dieses Indien von den Engländern erobert wurde, das zu erinnern, ist so spannend, wie die Taten des Cortez und Pizarro. Jener bei uns zu selten gelesene Essay Macaulays über Lord Clive erzählt es rasch und feurig: wie der junge Lieutenant Lord Clive von Madras mit zweihundert schlechten Soldaten ausrückt, bei Arcot und Seringapatam siegt und zwei Monate später in den Millionen der Schatzkammern eines Nabobs wühlt. Unterhandlungen, Betrug, Bestechung vollenden, was die Bravour begonnen hat. Und um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts sind die Engländer trotz des Scheinherrschertums mancher Maharadjas die Besitzer Indiens von Ceylon bis hinauf an die Grenze Afghanistans. Da bricht plötzlich wie aus heiterem Himmel der Aufstand der Sepoys aus. Das Jahr 1857 ist das vielleicht heroischeste der Geschichte Englands. Nicht Trafalgar und nicht Waterloo weisen solche Taten auf, wie den Marsch von Kalkutta nach Delhi und Lucknow in der brütenden Hitze des tropischen Sommers, ein paar Regimenter gegen einen hundertfach überlegenen Feind. Wie zu Heiligtümern gehen heute die Engländer zu den zerschossenen Schanzen von Lucknow und Cawnpore, zu den Gräbern der hingeschlachteten Offiziere. Damals stand die ganze Herrschaft Englands in Indien auf dem Spiel: mit bittersten Anstrengungen wurde sie wiedergewonnen, eisern befestigt. Aber wieder ist die Spannung gewachsen, unterirdisches Rollen erschüttert das Land. Die indische Gefahr ist wach geworden. Und bei jedem Symptom, bei jeder Bombe, jeder Verschwörung und nun vor allem bei dieser Ermordung schauert man in England zusammen in Erinnerung an die Schreckenstage der »Mutiny« [Meuterei].
Ist nun diese Angst proportional einer wirklichen Gefahr oder nur eine nervöse Überreizung wie die Germanophobie? Der Einblick in die eigentlichen Tatsachen ist verschlossen, die indische Regierung verlautbart nur, was nicht zu verschweigen ist. Und der äußere Anblick ist selbstverständlich unmaßgeblich. Allerorts begegnet der Reisende Höflichkeit und einer – anfangs verblüffenden – Devotion. Die persönliche Sicherheit ist größer als in europäischen Residenzen, größer als im Londoner Whitechapel oder im Pariser Batignolles. Jedesfalls: der Haß sprüht einem nicht ins Gesicht, die Fäuste sind nicht offen geballt. Auflehnung ist sicherlich vorhanden, aber es ist kaum möglich, zu bestimmen, wie weit sie organisiert oder vereinzelt, untätig oder vorbereitet ist, unmöglich zu sagen, wie der Inder über die englische Herrschaft denkt. Vor allem weil »der« Inder ein nicht existierender Begriff ist. Indien ist ein Konglomerat differenter Rassen. Über hundert Sprachen werden gesprochen, 70 Millionen Mohammedaner, viele Millionen Buddhisten sind den Hindus eingesprengt, die Hindus selbst durch die Schranken der Kasten in unsagbarem Abstand von einander gehalten. Diese Gegensätzlichkeiten – das Fundament, auf dem die englische Herrschaft überhaupt erstehen konnte – schließen eine Einigkeit schon des Empfindens und vor allem des Handelns aus. Vielleicht existieren geschlossene Kreise – der »Bund der Söhne Sivas, des Verderbers« ist wohl ein Phantasieprodukt derer, die in Indien alles partout mystisch sehen wollen, selbst eine Revolution –, aber man kann ihre Tätigkeit kaum abgrenzen. Daß Unruhe im Lande stärker und stärker wühlt, erkennt man eigentlich nur an der steigenden Unruhe der Engländer, an den Konzessionen der Regierung und dem Wetterleuchten der Attentate.
Ein Aufstand nährt seine Kraft nur aus Unzufriedenheit. Es wäre nun nach den Gründen jener Unbefriedigung zu fragen. Die Mutiny von 1857 war klar in ihren Motiven oder ist es zumindest heute: sie war eine religiöse Revolte. Man hatte den durch schlechte Bezahlung ohnehin schon gereizten Soldaten Patronen mit Kuhfett überwiesen. Nun ist dem Hindu die Kuh, die Milch spendende »Mutter des Menschen«, das heiligste Tier, und die Sepoys antworteten auf die Zumutung mit der Revolte. Der Aufstand flog – der Telegraph konnte ihn damals noch nicht überholen – blitzschnell über das Land und wurde zur blutigen Warnung. Seither wurde mit doppelter Sorgfalt das religiöse Gefühl geachtet. Und die Bewegung von heute ist keine religiöse mehr (eher eine der Irreligiösen, derer, die durch die Engländer ihre Zugehörigkeit verloren haben). Und auch eigentlich keine nationale, denn die Inder sind Konglomerat, aber keine Masse. Sie sind darum auch nicht fremdenfeindlich. Seit Jahrhunderten ist diese durch Mangel an Fleischgenuß, durch die Passivität ihres religiösen Empfindens geschwächte Rasse gewohnt, die Beute von Invasionen zu sein. Seit tausend Jahren sind sie abwechselnd die Knechte der Mohammedaner, der Mongolen, der Perser, der Mahratten, der Franzosen und Portugiesen, und schließlich erst der Briten. Auch kommerziell haben sie sich nie abgeschlossen, jede Hafenstadt hat ihr Chinesenviertel, die fremdesten Rassen reißen ihnen den Handel aus den Händen. Und die große Masse war von je am meisten bedrückt von den herrschenden Kasten, von den Brahminen und den Kriegern. Sie blieben immer die Knechte, hatten nichts zu gewinnen und zu verlieren, und blieben daher die ewig Gleichgiltigen.
Und sind es noch heute, obzwar gerade ihnen die Herrschaft der Engländer unendlichen Vorteil gebracht hat. Denn selbst der Gereizte und Feindliche kann die grandiose Kulturleistung der Engländer in Indien nicht verringern. Sie haben mit Eisenbahnen das ungeheure Land von einem Ende zum andern durchzogen, haben Hospitale gebaut, die Hungersnot – die früher oft fünf Millionen Menschen hinraffte – gemildert, sie haben die Inder mit tausend kleinen Nützlichkeiten vertraut gemacht. Dem Wucher, der entsetzlichsten sozialen Plage Indiens, haben sie durch Banken gesteuert, den Reichtum gemehrt. So viele M illionen sie auch diesem Lande erpreßt haben, es ist doch reicher geworden, seit sie die Baumwolle anpflanzten, das Öl, die Kohle, Magnesit und andere kostbare Erze aus dem brachen Boden holten. Die große englische Besinnung der Toleranz hat nur an die ärgsten Auswüchse des Kultes gerührt, an die Witwenverbrennung und den Selbstmord vor dem Dschaggernath, dem zermalmenden Wagen, ganz vorsichtig und ohne ihren gewohnten Eifer haben sie Missionen gefördert, um das religiöse Empfinden nicht zu reizen. Sie haben den Maharadjas klug alle Ehren und den Schein der Herrschaft gelassen, haben sie geschickt an den Bahnen und Finanzunternehmen beteiligt, sie von politischer Tätigkeit durch Spielzeug, wie Automobile, Museen und Schlösser, abgelenkt, ihre Rivalität und ihre Kriege ganz unterbunden. Das darf nicht vergessen sein. In der Verwaltung haben sie durch die beiden edelsten Tugenden der angelsächsischen Rasse – durch schrankenlose, von strengster, wenn auch konventioneller Moral getragene Gerechtigkeit und durch absolute Unbestechlichkeit – den Europäer vertrauenswürdig und zuverlässig in den Augen der Heimischen erscheinen lassen. Und haben, indem sie als neue Kaste sich über die andern stellten, die Unterschiede entwertet, die einen Abgrund aufrissen zwischen den Indern. Der Paria, der früher wie ein krätziger Hund rettungslos aus dem Kreise der Menschen ausgestoßen war, kann nun als Diener, als Beamter der Regierung den Schein einer Würde erlangen. Dadurch ist das Gesetz, das sie und alle ihre ungeborenen Kinder auf Ewigkeiten zu niederen Tieren verdammte, gebrochen, ein Schimmer von Hoffnung diesen Millionen gegeben, Möglichkeiten des Besitzes, gar des Reichtums. Man kann ruhig sagen, daß es niemals, unter keinem der Eroberervölker, den Einwohnern Indiens ähnlich gut ergangen ist.
Wer verursacht also diese nicht abzuleugnende Unruhe und Mißstimmung, die von Jahr zu Jahr fühlbarer wird? So paradox es klingt: die Engländer selbst und eben durch ihre Bemühungen. Sie haben die Inder zum Welthandel, zum Industrialismus, zur Bildung erzogen, sie haben sie reif gemacht und ihnen damit selbst die Waffen gegen die englische Herrschaft in die Hand gegeben. Neben den englischen Unternehmern sind in den letzten Jahrzehnten die Einheimischen emporgekommen, sie haben Fabriken, Plantagen, sie sind Großhändler von erstaunlichem Talent geworden, die sofort gegen die aus England kommenden Fabrikate opponierten. Die erste revolutionäre Tat war eine kommerzielle: der Boykott der englischen Waren, die Swadeshi-Bewegung, die dem Volke den ausschließlichen Konsum heimischer Fabrikate predigt und die in kürzester Zeit glänzende Erfolge aufzuweisen hat. Auf diese Art war es verhältnismäßig leicht, den Geldstrom von Indien nach England zu sperren. Die zweite Zufuhr wäre aber nur durch eine totale Umänderung der politischen Verhältnisse abzudämmen, und sie gerade erzeugt die weithingehende Erbitterung. Das ist die hohe Bezahlung der englischen Beamten aus dem indischen Staatsschatz und die Verschwendung an Pensionsgeldern. Der Staat besoldet den Europäer – den Engländer – glänzend. Für die Unbill des Klimas, für die Teuerung des Lebens, die Entfernung von der Heimat, die Schädigung an Gesundheit, den Verzicht auf Familienleben kann nur eine übermäßige Bezahlung Kompensation bieten. Der englische Beamte des civil service und ebenso der Offizier hat zwanzig Jahre Dienstzeit, davon jedes fünfte Jahr ein Urlaubsjahr ist. Dann erhält er die volle Pension aus der indischen Staatskasse. Er tritt etwa mit zwanzig Jahren ein, mit vierzig geht er nach England zurück und dorthin muß ihm dann die indische Regierung – oft dreißig und vierzig Jahre lang – seine 10000 oder 20000 Shilling jährlich zahlen, die indische Regierung dem Engländer, der in England lebt. Das zieht eine ungeheure Schwächung der so prosperierenden Finanzen nach sich und fördert die Erbitterung der gebildeten Inder, die mit Recht behaupten, für einen Teil des Gehalts die gleichen Dienste zu tun, während England mit Recht sich nur Herrscher fühlt, wenn englische Beamte Heer und Staat verwalten. Hier ist der Kontrast am stärksten: die Inder wollen Indien für sich, die Engländer es für England verwalten.
Die Gebildeten und die Vermögenden unter den Indern – sie sind die wirklichen Feinde der Engländer. Nichts hat die Stellung Englands so untergraben als gerade die Generosität und der Eifer, womit sie in Schulen europäische Bildung unter den Hindus verbreiteten. Freilich, vorerst aus Interesse. Ein Millionenreich läßt sich nicht bloß durch Europäer verwalten, die Post, die Bahn, die Bank, das Office braucht Handlanger, Schreiber, geschulte, gebildete Menschen, Tausende und Abertausende, die niedrige Stellen für einen noch niedrigeren Gehalt versehen. Denn so kostspielig das Leben für den Europäer ist – er braucht ein Haus mit dreißig Dienern, einen Wagen, vielerlei Komfort, der hier unerschwinglich teuer ist – so bescheiden lebt der Hindu, dessen Wohnung eine Hütte, dessen Nahrung Curry und Reis ist. Um ein Beamtenmaterial zu schaffen, um Ärzte, Advokaten, Kaufleute heranzubilden, mußten Schulen und Universitäten im ganzen Lande gegründet werden. Überall sieht man dort die jungen Inder in europäischer Kleidung, nur mit einem Turban oder einer Kappe auf dem schwarzen, fettigen Haar, mit den Büchern über die Straßen gehen, sieht sie beim Fußball ganz wie in den englischen Colleges. Ihre Augen blicken unter den Brillen, die sie gerne tragen, nicht mehr so rätselhaft fremd wie die des dumpfen Volkes, ihre ganze Art ist lebendiger, feuriger und belebter geworden. Man rühmt ihnen großen Eifer nach, und sie stehen hinter dem englischen Studenten kaum mehr zurück. Damit entschwindet aber jener Nimbus von Göttlichkeit, der die Europäer bei den niederen Klassen umgibt. Dieser Inder empfindet sie als seine Lehrer, aber nicht seine Herren. Und ein anderes erwacht durch sie: das nationale Gefühl. Wie in allen Ländern, wo die Bildung der breiten Massen gering ist – bei den Russen und den Ruthenen besonders – fühlen sich die Studenten als die politischen Führer der Nation. Die Überlegenheit ihres Wissens berechtigt sie, Lenker und Führer des Volkes zu sein. Aber in Indien ist ihnen jede Teilnahme versagt. Sie werden in eine ewige Unzufriedenheit verbannt, mit niederem Posten abgefunden: und aus diesen Kreisen stammen die politischen Feinde, stammt der Mörder des englischen Regierungsbeamten.
Denn das ist die tragische Schuld der Engländer, daß sie heute, nach hundertfünfzig Jahren, in Indien immer noch eine Kaste über den Kasten geblieben sind, daß sie den gebildeten Inder und selbst den Half-Cast, den Mischling, gesellschaftlich nicht anerkennen. Sie heben ihn empor, lassen ihn die Überlegenheit der europäischen Gesellschaft erkennen – und stoßen ihn dann zurück. Ich weiß kaum ein härteres Schicksal als es die Half-Cast-Kinder, die Knaben und die Mädchen, zu Tausenden erdulden. Oft sind es Kinder eines vermögenden englischen Vaters, der sie in England erziehen läßt. Dort in den Pensionaten werden sie für vollwertig genommen; und wirklich, kaum merkt man bei den so zarten Mädchen am leicht getönten Teint, an der dünnen Vogelstimme das Mischblut. Selten sieht man ihnen die Halbinderin an, keiner macht es ihnen zum Vorwurf, sie leben glückliche Jahre der Gleichberechtigung. Aber im Augenblick, wo sie zu ihren Eltern nach Indien zurückkehren, sind sie geächtet. Kein vornehmer Engländer wird sie heiraten, wenig Familien nehmen sie auf – und zu den Hindus zurück ist ihnen siebenfach der Weg verschlossen, dort sind sie geringer als der Paria. Alle hohen Stellungen im Lande sind dem Engländer reserviert. Der Inder konnte im eigenen Lande, in seiner Heimat, bei gleicher Bildung nur eine niedere oder mittlere Stufe der Verwaltung einnehmen: das war der Anfang der Verstimmung. Denn die Gebildeten wissen, daß, wären die Engländer nicht, ihnen die Herrschaft gehörte. Das hat ihr Nationalbewußtsein erschaffen, den Ruf: Indien für die Inder. Selbstverwaltung wollen sie, wenn auch unter englischer Abhängigkeit. Denn die Engländer sind nie Anglo-Inder geworden, sind immer Engländer geblieben. Nicht wie in Amerika, Australien, Rhodesia haben sie sich amalgamiert, sind sie seßhaft geworden, sondern wie Deportierte leben sie dort und zählen die Jahre der Heimkehr. Was wir, die Fremden, dort bewundern, ist für sie auf die Dauer kein Reiz. Sie lieben das Land nicht, das ihre Gesundheit aussaugt, ihr Familienleben zerreißt, Heimat heißt für sie immer noch England. Die jungen Inder aber sprechen anders das Wort Heimat aus. Sie haben sich heute gruppiert, predigen in Zeitungen – denen der englische Liberalismus eine wirklich staunenswerte Redefreiheit läßt – den nationalen Gedanken und seine Verteidigung mit Streik und selbst mit dem Revolver. Die Industrialisierung der Zentren gibt ihnen das Millionenmaterial der Massen, das solchen Drohungen erst den nötigen Nachdruck verleiht, langsam aber unaufhaltsam bildet sich ein organisierter Widerstand, ein entschlossenes Volksbewußtsein im niedergehaltenen Volke.
Wie verhält sich nun die englische Regierung gegenüber dieser Bewegung, gegenüber »der indischen Gefahr«. Die Meinung des Parlaments ist geteilt, die beiden historischen Gruppierungen, die konservative und die liberale, befeinden sich heftig in ihren Auffassungen. Die eine ist für eine Art Militärdiktatur. Das Gebot der Freiheit in Wort und Schrift solle für Indien als erobertes Land nicht gelten, man solle die Zeitungen, falls sie revolutionär sich gebärden, unterdrücken, mit dem glühenden Eisen die eiternde Wunde ausbrennen. Die andere Gruppe – fußend auf dem Prinzip, daß englische Herrschaft identisch sein müsse mit absoluter Freiheit – empfiehlt Nachgiebigkeit, Erweiterung der Rechte der Einheimischen, Erfüllung ihrer wichtigsten Wünsche. Und tatsächlich, die Reform Lord Morleys im letzten Jahre berief – zu größter Entrüstung der Anglo-Inder – zwei, wohl sehr verläßliche, Inder in den Kronrat des Reiches. Keir Hardie, der Arbeiterführer, ein Bernard Shaw der Politik, wie jener klug und paradox zugleich und beseelt von der ironischen Freude, immer das zu tun, was seine Landsleute am meisten entsetzt, ist sogar nach Indien gegangen, um den Indern den Parlamentarismus zu predigen, wehrt aber jetzt, nach dem Attentat, allerdings mit beiden Händen die Beschuldigung ab, Anstifter und Begünstiger einer Revolte gewesen zu sein. Eine Revolte ist auch nicht gut denkbar – eher ein Generalstreik –, denn gegen einen bewaffneten Aufstand hat die weitausblickende englische Regierung seit der Mutiny alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Die Einfuhr von Explosivstoffen ist verboten, kein Eingeborener darf Schußwaffen besitzen, die militärischen Depots, die Kanonen und Zeughäuser werden nie farbigen Soldaten anvertraut. Die Bahnhöfe sind außerhalb der Städte angelegt, meist noch durch das dazwischenliegende Cantonment [Quartier] geschützt, alle Lokomotivführer, alle Stationsleiter sind Engländer – daher auch der ungeheure Aufwand an hohen Gehalten und Pensionen. Das kartographische Material ist außer für Militär unzugänglich, die Häfen beherrscht von Festungen, die Flußmündungen zu sperren, und die einzige Einbruchsstelle im Norden, der Kyberpaß, eines der stärksten Festungswerke der Welt. Die so entwaffnete Menge wird überdies noch durch den religiösen Zwist der Mohammedaner und Hindus geteilt, die Kraftentladung sorgfältig gegeneinander gewendet, durch kleine Artigkeiten die Vornehmsten gefesselt, die Maharadjas durch Geschenke, die Reichen durch Verleihung der englischen Baronie. Seit hundert Jahren arbeitet eine Generation von Politikern nach der andern mit der zähen englischen Energie an der Befestigung, an der Verteidigung der englischen Macht.
Aber nur mit ungeheuerster, konstanter Anspannung, mit einer fortwährenden Anpassung an den Moment, bald durch Härte, bald durch Milde wird die Balance des Übergewichtes zu erhalten sein. Indien ist noch immer – wie zu Napoleons Zeiten – die Achillesferse Englands. Nur wenn man die Furcht vor der indischen Gefahr nicht übersieht, kann man die Furcht Englands vor dem deutschen Krieg, die Intervention zu Gunsten der Mohammedaner in der bosnischen Angelegenheit verstehen. Jede kleine Erschütterung im Westen kann für sie im Osten eine ungeheure Schwankung werden. Darum dies Aufflackern in Angst vor der indischen Gefahr bei jedem Anlaß. Wie ein Tierbändiger zwischen den geduckten Tigern mit ewig wacher Willensanspannung jedes Zucken einer Pranke, jedes Murren und Blinzeln der Bestien verfolgt, um sich vor einem jähen Ansprung zu schützen, so lauscht man in England angstvoll auf jedes – in Europa sonst ganz gleichgiltig betrachtete – Symptom einer Unruhe im indischen Reich. Und nur darum konnte die kleine weiße Rauchkringel an der Mündung des entladenen Revolvers zu einer so dichten dunklen Wolke werden, die nun mit der Schwüle eines furchtbaren Gewitters über ganz England lastet.
Die gefangenen Dinge
Gedanken über die Brüsseler Weltausstellung 1910
Man hat zur Weltausstellung alle Dinge des modernen Lebens hergebracht, die notwendigen des Alltags und die kostbaren des schöpferischen Überflusses, hat alles, was irgendwo aus den ewigen Stoffen der Erde heute durch menschliche Kraft und Geschicklichkeit gemodelt wird, Stück für Stück von der Heimat weg in diese ungeheure Schaubude zwischen der lauten Stadt und dem stillen Bois gesandt. Und nun stehen diese tausenderlei Dinge, die eines vom andern nichts wissen, in buntem Durcheinander eingeschlossen in gläsernen Kästen und über diesem Wald von Schränken wölbt sich als Himmel die Halle der Nation mit wehendem Wimpel. Alles ist da, was man sich nur erdenken kann, das Kleinste und das Gewaltigste, mikroskopische Präparate, wo die Urzellen aus ihrer zerrinnenden Winzigkeit ins Sichtbare gezwungen werden, und daneben ganze Eisenbahnzüge mit Maschinen, Waggons und den Verladern, Stoffe, Bilder, Gläser, Bücher, Maschinen, Kleider, und all dies in den edelsten, reinsten und gelungensten Exemplaren. Es ist eine Heerschau unseres zwanzigsten Jahrhunderts, und man müßte all dies nur so stehen lassen wie es ist, sorgsam einzäunen, und es wäre in hundert, zweihundert Jahren das vollständigste Museum unserer Zeit: man würde dann abschätzen können, was uns als Vollendung galt, würde vielleicht lächeln über das, was uns als groß und als klein erschien, und manches als ein schon Entschwundenes wehmütig lieben, wie wir heute die Biedermeierzeit und Altwien. Denn alles ist hier versammelt: in hunderttausend Stücke verstreut liegt hier in diesen gläsernen Särgen unsere ganze Welt, man muß sie sich nur zusammenzusetzen wissen, um sie zu beleben und ihren heißen, zitternden Atem zu fühlen.
Und doch, in diesem Wald von Dingen, wo Wunder an Wunder sich drängt, alle Farben ihre feinsten Übergänge zittern lassen, die Formen eine nie geahnte Tausendfalt zeigen, immer und immer ergreift mich beim Durchschreiten ein leises abmahnendes Nebengefühl, das dem reinen freudigen Staunen wehrt. Es ist etwa das Gleiche, das in den Menagerien einen hindert, sich an der eigenartigen Schönheit der zur Schau gestellten Tiere zu freuen: eben weil man fühlt, daß in diesem »Zurschaugestelltsein«, diesem Nachaußenkehren der Eigenart das Innerste, das eigentliche Wesen den Tieren genommen ist. Wie läßt sich die Geschmeidigkeit eines Panthers begreifen, wenn sein Sprung an den Stäben zerbricht, die Gewalt eines Büffels, die Geschwindigkeit eines Rentieres? Nur das vom Leben, aber nicht vom innersten Leben bewegte Fell sieht man, und alle Bewunderung trübt sich unwillkürlich durch Mitleid. Leben wird hier zum Bild erniedrigt: und so fühle ich auch hier mit den tausend Dingen, die hilflos in den Schränken liegen und fast nie ihre innere Absicht zeigen dürfen, irgendein Mitleid, weil sie so gefangen sind, so abgesperrt von ihren Wirklichkeiten. Wie die Tiere bloß ihr Fell, so dürfen auch sie nur meist ihre Außenfläche zeigen: auch sie sind in Glasgittern eingesperrt, weit von ihrer wirklichen Tätigkeit, Opfer einer müßigen spaziergängerischen Schaulust, täglich angestarrt von Tausenden leeren Augen und fast nie in ihrer Seele, in ihrer Absicht erfühlt. Was sagen diese vielen Dinge aus, was sind sie mehr als Illustrationen zu den Etiketten auf den Schränken? Da sind Toiletten gereiht, eine an die andere, jede ein Wunderwerk von Geschmack und Eleganz. Sie müßten Frauen herrlich machen, dürften weich sich um ihren Nacken legen, ihre Formen zärtlich nachfühlen, beim Schreiten die Bewegung zugleich mit dem sanften Druck des Windes nachzeichnen, in dieser Biegsamkeit selbst ahnend und lebendig sein. Aber sie liegen steif und kalt um Wachspuppen, die mit erfrorenem Lächeln einen anstarren, bleiben Stoff und Spitze, ein Totes und bei aller Schönheit Wesenloses. Da sind Möbel: in ein Zimmer gereiht, würden sie eine drückende Leere bezwingen, eine reine Symmetrie auslösen, irgendein Gefühl der Harmonie, würden Menschen ruhig und ruhend machen. Hier stehen sie vierschrötig wie vergessen herum, gepolsterte Stücke Holz. Bücher zeigen dem Beschauer immer die eine Seite: meist ist sie schon gelb geworden vor Sonne, aber niemand liest sie, die Lettern stehen nutzlos wie schwarze Flecken auf dem weißen Papier. Diese Dinge sind erstorben in der Gefangenschaft, ihre Seele ist im Käfig zerbrochen wie dem Adler die Flügel. Und dieses Zurschaustellen eines Unsichtbaren wird hier, ohne daß die Leute es merken, manchmal zur Lächerlichkeit. Da sind Stöße von Schokoladen aufgehäuft, ganze Türme: aber man schmeckt sie nicht, sieht sie nicht einmal, sondern nur das Papier der Pakete. Und hier stehen tausend Flaschen, in denen der Duft aller Blumen der Erde versammelt ist, Parfüms in glitzernden Flakons: aber sie sind verschlossen und wie will man Duft mit dem Auge wahrnehmen? Und nur für das Auge ist hier ausgestellt. Aber wie wenig faßt das Auge vom Wirklichen des Lebens, wie Weniges vom Wesentlichen verrät die Außenfläche seiner Formen: und wie wenig von der Seele der Dinge zeigt eigentlich dieser bunte Jahrmarkt der Nationen.
Am stärksten empfindet man die Sinnlosigkeit dieser Art von Schaustellung bei den Maschinen, denn deren Kraft ist ganz unterirdisch, ganz in der geheimnisvollen Verkettung ihrer Bewegung gelegen. Und hier ruhen sie. Ehern stehen sie in der ungeheuren Halle mit ihren spiegelblank blinkenden, stahlblauen Körpern, stehen unbeweglich und kalt, sie, deren innerste Seele das Feuer und die Schnelligkeit ist. Da sind Maschinen, die aus der Tiefe der Erde Wasser Hunderte Meter hoch tragen können, und solche, die mit ihren stählernen Kinnbacken Metalle kneten können wie Wachs, und solche wieder, die selbst Hunderte Maschinen rasen machen können in geregeltem Umschwung; Kraft von Abertausenden Menschen, eine unirdische Kraft steht da und verleugnet sich durch Untätigkeit. Unwillkürlich fühlt man sie an: ja, sie sind wirkliches Erz, kühl und glatt, man staunt ihre riesigen Arme an, ahnt die Hitzigkeit ihres Umschwunges. Aber man ahnt nur und sieht nichts von diesen Wundern unserer Zeit. Es ist so, als zeigte man einem eine Hand voll Dynamit und sagte: Damit kann man ein Haus in die Luft sprengen. Man erlebt nicht das Wunderbare einer so ungeheuren Komprimierung von Kraft durch ein Wort, durch einen Blick. Ein eisiges Schweigen herrscht in dieser Halle, die zischen müßte und brodeln von der schwingenden Kraft, jenes heilige Sausen müßte darin sein, das einst in den Eichenwäldern der Götter war, ein Vibrieren des aufgestauten Lebens. Manchmal wird eine Maschine gezeigt; und schon dies ist herrlich, wenn diese eine inmitten der anderen schlafenden zu rasen beginnt und mit ihren Armen die Luft mäht; nur dies Arbeiten schon – obzwar man nicht sieht, wohin eigentlich diese fiebernde Kraft wirkt – ist befreiend. Aber man stellt sie wieder ab, die schwingenden Flügel sinken zurück, und es ist wieder Stille in dem gigantischen Schaukasten.
Und so stehen diese Dinge jetzt für Monate und niemand gibt ihnen ihren Zweck, ihr wirkliches Leben. Und ich weiß: von hier werden sie zur nächsten Weltausstellung nach Buenos Aires geschickt und von dort 1912 nach Rom, nie werden sie ihre wahrhafte Bestimmung erreichen. Nie werden sie sagen können, wer sie sind und was sie wollen, obwohl sie echt sind und ganz echt wie die Palmen in den Treibhäusern. Aber weiß denn einer, was eine Palme wirklich ist, der sie nicht auf dem kobaltblauen Himmel der Tropen in der linden Luft zittern gesehen hat, wird je einer unsere Zeit begreifen können aus diesen gefangenen, eingesargten Dingen? Vielleicht wird man bald das Einsehen haben, Weltausstellungen mehr sein zu lassen als ein Vielerlei und ein Nebeneinander. Diese ist noch ein Durcheinander von Auslagen, ist wie eine Stadt ohne Stockwerke, ohne Wohnungen, wo nur die Gassen mit den Läden und Restaurants stehen geblieben sind, sie zeigt nur das Fertige und nicht das Werdende, die starre Form, nicht die Bewegung, den Körper der Dinge, nicht ihre Seele. Hagenbeck hat als erster versucht, die Tiere nicht in Käfigen zu zeigen, sondern in einer Art von Freiheit, wo sie ihr wahrhaftes Wesen entwickeln können: so wird man auch versuchen müssen, künftig die Dinge zu zeigen in einem Abglanz ihres wirklichen Lebens. Die Deutschen haben sich hier schon bemüht, ihre Ausstellung als Organismus zu gestalten, als Lebendiges also, die einzelnen Dinge in der Über- und Unterordnung darzustellen, und auch in anderen Abteilungen erlebt man Sekunden wirklichen Schauens. Da ist zum Beispiel eine kleine Fabrik amerikanischer Schuhe: man sieht den Urstoff, das rohe Leder, wie es durch alle Prozeduren mit der Geschwindigkeit weniger Minuten sich zum Produkt, zum fertigen Schuh formt, fühlt die Entstehung eines dieser Dinge mit und erlebt etwas Unvergeßliches. Dürfte man so an der Entstehung oder der Wirkung aller Dinge teilnehmen, so wäre diese Ausstellung ein wahrhafter Gewinn, eine lebendige Erinnerung. Aber fast alles wird schon fertig gezeigt, in jener leblosen Sekunde nach der Entstehung und vor dem Gebrauch: und nichts bleibt dem Gefühl als das Vielerlei, multa, non multum.
Aber den Leuten scheint es zu gefallen: unablässig strömen sie in die Säle, rastlos wird geschaut, bewundert, bestaunt. Man darf sich dadurch nicht betrügen lassen: dieser Eifer der Masse ist eigentlich Bequemlichkeit. Die meisten Menschen schauen Dinge nur an, wenn ihnen irgend jemand oder etwas sagt: Schau hin! Sie sehen Menschen nur an, wenn man ihnen sagt: »Das ist der Graf X.«, und Bilder, wenn darunter Rembrandt oder ein anderer großer Name steht. Und da diese Weltausstellung nichts anderes ist als ein dröhnendes, in hundert Sprachen geschriebenes »Schau hin!«, so sehen sie für ihren Franc Entree vom Morgen bis Abend. Eigentlich könnten sie ja alle diese Dinge viel besser, viel lebendiger sehen. Zwei Stunden von hier, bei Cockerill in Seraing, kann man die gewaltigsten Eisenhämmer der Welt am Werke sehen und die Toiletten ebenfalls zwei Stunden von hier am Ostendener Strand, die Bilder in den Ausstellungen, die Schiffe, statt wie hier in winzigen Modellen, gigantisch und voll atmenden Lebens in Antwerpen. Die Schnellzugsmaschinen, die sie hier bestaunen, ratterten ja vor dem Zug, der sie herschleppte, aber dort sagte niemand: »Schau hin!« Alles, was hier zu sehen ist, kann man in jeder Großstadt in seinem Wirkungskreis lebendig und mit bewegter Seele sehen: aber hier scheint es bequemer und so strömen sie her in bunten Scharen aus allen Richtungen der Welt, ein dunkler rauschender Strom der Neugier, umfluten die Dinge, so wild, daß sie nur wie Inseln aus dem unablässig wallenden Meer herausragen. Mit Tausenden von Augen tastet die Menge all die Werke ihrer eigenen Kraft ab, Millionen Wünsche zittern gierig um die Verlockungen, heißer Atem weht an die kalt ausgebreitete Pracht der gefangenen Dinge.
Und diese Fülle von Menschen, dieser schäumende Springbrunn der Masse, der von unsichtbaren Quellen genährt, unablässig hier aufschäumt, ist auch der unvergleichlichste Eindruck der Ausstellung. Es ist aufreizend, den einzelnen nachzugehen, wie sie von Saal zu Saal stürzen in der geheimen Angst, etwas zu versäumen, zu vergessen, und dann zu sehen, wie diese Unruhe sich langsam verbreitet, wie in dem ganzen Auf und Nieder eine gewaltige, sinnlose und doch schöne Erregung ist. Musik aus allen Winkeln, von allen Plätzen aufreizend, steigert noch die Unruhe dieses Hin und Her, und wahrhaft pantagruelistisch sind dann die Stunden, wo die Masse zur Sättigung schreitet, wo an hundert Stellen zugleich Speise und Trank gefordert wird, wo – wenn die Pavillons geschlossen werden – plötzlich das Gefühl der Mattigkeit wie eine Schwüle über die ganze Menge fällt. Die Grandiosität, die Vielköpfigkeit dieser aus allen Ländern hergeströmten Masse ist ein Unvergeßliches. Und nie werde ich ihren Schrei vergessen, diesen Schrei, als plötzlich in unendlicher Höhe ein weißer Vogel auftauchte, ein Aeroplan, und die Leute, plötzlich aus den Hallen und Sälen stürzend, in einem einzigen Schrei hinaufjubelten zu dem Fernen, der sie nicht hören konnte, mit diesem einzigen Schrei der Ekstase, dem Schrei einer Masse, die sich selbst und den Triumph der Zeit in diesem Überschwang feierte.
Aber nicht in der Ausstellung allein: das Fieber der Erregung flammt in der ganzen Stadt. Brüssel, sonst träg, schwerblütig, eine Kleinstadt mit einem einzigen internationalen Boulevard, ist wie verwandelt: es ist wie weggeschwemmt von dem Strom der Menschen, die durchwandern, seine Eigenart ist verloren, selbst seine Sprache. Die Hauptstraßen sind gedrängt von Menschen, die in allen Zungen Europas reden, die Wagen fahren rascher, die Tramways bersten vor Fülle, alles dampft von ungeduldigen, fiebrigen Gestalten. Das zigeunernde Gelichter der Händler und Verkäufer füllt die Trottoirs mit ihren Rufen, provinzlerische Vereine durchziehen mit Musik die Straßen, abends flammt der Boulevard Anspach mit unzähligen Flammen. Man muß nur eine halbe Stunde am Gare du Nord ruhig stehen bleiben, um die ganze Wucht dieses Katarakts zu fühlen, der einem seinen Schaum von Lärm und Hitze ins Gesicht sprüht. Jede paar Minuten quillt ein neuer Gischt Menschen heraus, stürzt wie in Attacke gegen das hohe Carrée der Hotels rings um den Bahnhof, zerschellt dort, wird zurückgeworfen hinein in die Stadt. Und schon wieder kommt eine neue Welle, Arbeitervereine, Kinder mit Priestern, ein Expreß, von früh bis wieder früh schäumts durch die enge Tür. Und alle diese Menschen glühen prachtvoll von Ungeduld. In der Ausstellung sind sie schon gedämpfter, sicherer, aber jetzt, da sie noch nicht ihre vier Wände für die Nacht sich gekauft haben, nicht wissen, wo sie essen sollen, und endlich, endlich am Ziel sind, scheinen sie wie verzehnfacht in ihrer Vitalität. Sie rennen und schreien, tosen in einem wunderbaren Tumult, und wie sie endlich verschwunden sind, ist schon eine neue Welle da und schäumt in gleicher Erregung. Es ist, als stünde man auf einem hohen Gipfel und immer käme von einer Seite Sturm an einen heran, immer Lärm, die brausende Stimme des Lebens: man atmet sie ein, fühlt die eigene Kraft, die eigene Lust daran wachsen und freut sich dieser wilden, gierigen Menschen, die kommen, ein einziges Schauspiel zu sehen, und nicht ahnen, daß sie selber es sind.
Die Monotonisierung der Welt
1925
Monotonisierung der Welt. Stärkster geistiger Eindruck von jeder Reise in den letzten Jahren, trotz aller einzelnen Beglückung: ein leises Grauen vor der Monotonisierung der Welt. Alles wird gleichförmiger in den äußeren Lebensformen, alles nivelliert sich auf ein einheitliches kulturelles Schema. Die individuellen Gebräuche der Völker schleifen sich ab, die Trachten werden uniform, die Sitten international. Immer mehr scheinen die Länder gleichsam ineinandergeschoben, die Menschen nach einem Schema tätig und lebendig, immer mehr die Städte einander äußerlich ähnlich. Paris ist zu drei Vierteln amerikanisiert, Wien verbudapestet: immer mehr verdunstet das feine Aroma des Besonderen in den Kulturen, immer rascher blättern die Farben ab und unter der zersprungenen Firnisschicht wird der stahlfarbene Kolben des mechanischen Betriebes, die moderne Weltmaschine, sichtbar.
Dieser Prozeß ist schon lange im Gange: schon vor dem Kriege hat Rathenau diese Mechanisierung des Daseins, die Präponderanz [das Übergewicht] der Technik als wichtigste Erscheinung unseres Lebensalters prophetisch verkündet, aber nie war dieser Niedersturz in die Gleichförmigkeit der äußeren Lebensformen so rasch, so launenhaft wie in den letzten Jahren. Seien wir uns klar darüber! Es ist wahrscheinlich das brennendste, das entscheidendste Phänomen unserer Zeit.
Symptome: Man könnte, um das Problem deutlich zu machen, Hunderte aufzählen. Ich wähle nur schnell ein paar der geläufigsten, die jedem gewärtig sind, um zu zeigen, wie sehr sich Sitten und Gebräuche im letzten Jahrzehnt monotonisiert und sterilisiert haben.
Das Sinnfälligste: der Tanz. Vor zwei, drei Jahrzehnten noch war er an die einzelnen Nationen gebunden und an die persönliche Neigung des Individuums. Man tanzte in Wien Walzer, in Ungarn den Csardas, in Spanien den Bolero nach unzähligen verschiedenen Rhythmen und Melodien, in denen sich der Genius eines Künstlers ebenso wie der Geist einer Nation sichtbarlich formten. Heute tanzen Millionen Menschen von Kapstadt bis Stockholm, von Buenos Aires bis Kalkutta denselben Tanz, nach denselben fünf oder sechs kurzatmigen, unpersönlichen Melodien. Sie beginnen um die gleiche Stunde: so wie die Muezzim im orientalischen Lande Zehntausende um die gleiche Stunde des Sonnenunterganges zu einem einzigen Gebet, so wie dort zwanzig Worte, so rufen jetzt zwanzig Takte um fünf Uhr nachmittags die ganze abendländische Menschheit zu dem gleichen Ritus. Niemals außer in gewissen Formeln und Formen der Kirche haben zweihundert Millionen Menschen eine solche Gleichzeitigkeit und Gleichförmigkeit des Ausdruckes gefunden wie die weiße Rasse Amerikas, Europas und aller Kolonien in dem modernen Tanze.
Ein zweites Beispiel: die Mode. Sie hat niemals eine solche blitzhafte Gleichheit gehabt in allen Ländern wie in unserer Epoche. Früher dauerte es Jahre, ehe eine Mode aus Paris in die anderen Großstädte, wiederum Jahre, ehe sie aus den Großstädten auf das Land drang, und es gab eine gewisse Grenze des Volkes und der Sitte, die sich ihren tyrannischen Forderungen sperrte. Heute wird ihre Diktatur im Zeitraume eines Pulsschlages universell. New York diktiert die kurzen Haare der Frauen: innerhalb eines Monats fallen, wie von einer einzigen Sense gemäht, fünfzig oder hundert Millionen weiblicher Haarmähnen. Kein Kaiser, kein Khan der Weltgeschichte hatte ähnliche Macht, kein Gebot des Geistes ähnliche Geschwindigkeit erlebt. Das Christentum, der Sozialismus brauchten Jahrhunderte und Jahrzehnte, um eine Gefolgschaft zu gewinnen, um ihre Gebote über so viel Menschen wirksam zu machen, wie ein Pariser Schneider sie sich heute in acht Tagen hörig macht.
Ein drittes Beispiel: das Kino. Wiederum unermeßliche Gleichzeitigkeit über alle Länder und Sprachen hin, Ausbildung gleicher Darbietung, gleichen Geschmackes (oder Ungeschmackes) auf Tausend-Millionen-Massen. Vollkommene Aufhebung jeder individuellen Note, obwohl die Fabrikanten triumphierend ihre Filme als national anpreisen: die Nibelungen siegen in Italien und Max Linder aus Paris in den allerdeutschesten, völkischesten Wahlkreisen. Auch hier ist der Instinkt der Massenhaftigkeit stärker und selbstherrlicher als der Gedanke. Jackie Coogans Triumph und Kommen war stärkeres Erlebnis für die Gegenwart als vor zwanzig Jahren Tolstois Tod.
Ein viertes Beispiel: das Radio. Alle diese Erfindungen haben nur einen Sinn: Gleichzeitigkeit. Der Londoner, Pariser und der Wiener hören in der gleichen Sekunde dasselbe, und diese Gleichzeitigkeit, diese Uniformität berauscht durch das Überdimensionale. Es ist eine Trunkenheit, ein Stimulans für die Masse und zugleich in allen diesen neuen technischen Wundern eine ungeheure Ernüchterung des Seelischen, eine gefährliche Verfügung zur Passivität für den einzelnen. Auch hier fügt sich das Individuum, wie beim Tanz, der Mode und dem Kino, dem allgleichen herdenhaften Geschmack, es wählt nicht mehr vom inneren Wesen her, sondern es wählt nach der Meinung einer Welt.
Bis ins Unzählige könnte man diese Symptome vermehren, und sie vermehren sich von selbst von Tag zu Tag. Der Sinn für Selbständigkeit im Genießen überflutet die Zeit. Schon wird es schwieriger, die Besonderheiten bei Nationen und Kulturen aufzuzählen als ihre Gemeinsamkeiten.
Konsequenzen: Aufhören aller Individualität bis ins Äußerliche. Nicht ungestraft gehen alle Menschen gleich angezogen, gehen alle Frauen gleich gekleidet, gleich geschminkt: die Monotonie muß notwendig nach innen dringen. Gesichter werden einander ähnlicher durch gleiche Leidenschaft, Körper einander ähnlicher durch gleichen Sport, die Geister ähnlicher durch gleiche Interessen. Unbewußt entsteht eine Gleichhaftigkeit der Seelen, eine Massenseele durch den gesteigerten Uniformierungstrieb, eine Verkümmerung der Nerven zugunsten der Muskeln, ein Absterben des Individuellen zugunsten des Typus. Konversation, die Kunst der Rede, wird zertanzt und zersportet, das Theater brutalisiert im Sinne des Kinos, in die Literatur wird die Praxis der raschen Mode, des »Saisonerfolges« eingetrieben. Schon gibt es, wie in England, nicht mehr Bücher für die Menschen, sondern immer nur mehr das »Buch der Saison«, schon breitet sich gleich dem Radio die blitzhafte Form des Erfolges aus, der an allen europäischen Stationen gleichzeitig gemeldet und in der nächsten Sekunde abgekurbelt wird. Und da alles auf das Kurzfristige eingestellt ist, steigert sich der Verbrauch: so wird Bildung, die durch ein Leben hin waltende, geduldig sinnvolle Zusammenfassung, ein ganz seltenes Phänomen in unserer Zeit, so wie alles, das sich nur durch individuelle Anstrengung erzwingt.
Ursprung: woher kommt diese furchtbare Welle, die uns alles Farbige, alles Eigenförmige aus dem Leben wegzuschwemmen droht? Jeder, der drüben gewesen ist, weiß es: von Amerika. Die Geschichtsschreiber der Zukunft werden auf dem nächsten Blatt nach dem großen europäischen Kriege einmal einzeichnen für unsere Zeit, daß in ihr die Eroberung Europas durch Amerika begonnen hat. Oder mehr noch, sie ist schon in vollem reißenden Zuge, und wir merken es nur nicht (alle Besiegten sind immer Zu-langsam-Denker). Noch jubelt bei uns jedes Land mit allen seinen Zeitungen und Staatsmännern, wenn es einen Dollarkredit bekommt. Noch schmeicheln wir uns Illusionen vor über philanthropische und wirtschaftliche Ziele Amerikas: in Wirklichkeit werden wir Kolonien seines Lebens, seiner Lebensführung, Knechte einer der europäischen im tiefsten fremden Idee, der maschinellen.
Aber solche wirtschaftliche Hörigkeit scheint mir noch gering gegen die geistige Gefahr. Eine Kolonisation Europas wäre politisch nicht das Furchtbarste, knechtischen Seelen scheint jede Knechtschaft milde, und der Freie weiß überall seine Freiheit zu wahren. Die wahre Gefahr für Europa scheint mir im Geistigen zu liegen, im Herüberdringen der amerikanischen Langeweile, jener entsetzlichen, ganz spezifischen Langeweile, die dort aus jedem Stein und Haus der numerierten Straßen aufsteigt, jener Langeweile, die nicht, wie früher die europäische, eine der Ruhe, eine des Bierbanksitzens und Dominospielens und Pfeifenrauchens ist, also eine zwar faulenzerische, aber doch ungefährliche Zeitvergeudung: die amerikanische Langeweile aber ist fahrig, nervös und aggressiv, überrennt sich mit eiligen Hitzigkeiten, will sich betäuben in Sport und Sensationen. Sie hat nichts Spielhaftes mehr, sondern rennt mit einer tollwütigen Besessenheit, in ewiger Flucht vor der Zeit: sie erfindet sich immer neue Kunstmittel, wie Kino und Radio, um die hungrigen Sinne mit einer Massennahrung zu füttern, und verwandelt die Interessengemeinschaft des Vergnügens zu so riesenhaften Konzernen wie ihre Banken und Trusts.
Von Amerika kommt jene furchtbare Welle der Einförmigkeit, die jedem Menschen dasselbe gibt, denselben Overallanzug auf die Haut, dasselbe Buch in die Hand, dieselbe Füllfeder zwischen die Finger, dasselbe Gespräch auf die Lippe und dasselbe Automobil statt der Füße. In verhängnisvoller Weise drängt von der anderen Seite unserer Welt, von Rußland her, derselbe Wille zur Monotonie in verwandelter Form: der Wille zur Parzellierung des Menschen, zur Uniformität der Weltanschauung, derselbe fürchterliche Wille zur Monotonie. Noch ist Europa jetzt das letzte Bollwerk des Individualismus, und vielleicht ist der überspannte Krampf der Völker, jener aufgetriebene Nationalismus, bei all seiner Gewalttätigkeit doch eine gewissermaßen fieberhafte unbewußte Auflehnung, ein letzter verzweifelter Versuch, sich gegen die Gleichmacherei zu wehren. Aber gerade die krampfige Form der Abwehr verrät unsere Schwäche. Schon ist der Genius der Nüchternheit am Werke, um Europa, das letzte Griechenland der Geschichte, von der Tafel der Zeit auszulöschen.
Gegenwehr: Was nun tun? Das Kapitol stürmen, die Menschen anrufen: »Auf die Schanzen, die Barbaren sind da, sie zerstören unsere Welt!« Noch einmal die Cäsarenworte ausschreien, nun aber in einem ernsteren Sinne: »Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter!« Nein, wir sind nicht mehr so blindgläubig, um zu glauben, man könne noch mit Vereinen, mit Büchern und Proklamationen gegen eine Weltbewegung ungeheuerlicher Art aufkommen und diesen Trieb zur Monotonisierung niederschlagen. Was immer man auch schriebe, es bliebe ein Blatt Papier, gegen einen Orkan geworfen. Was immer wir auch schrieben, es erreichte die Fußballmatcher und Shimmytänzer nicht, und wenn es sie erreichte, sie verstünden uns nicht mehr. In all diesen Dingen, von denen ich nur einige wenige andeutete, im Kino, im Radio, im Tanze, in all diesen neuen Mechanisierungsmitteln der Menschheit liegt eine ungeheure Kraft, die nicht zu überwältigen ist. Denn sie alle erfüllen das höchste Ideal des Durchschnittes: Vergnügen zu bieten, ohne Anstrengung zu fordern. Und ihre nicht zu besiegende Stärke liegt darin, daß sie unerhört bequem sind. Der neue Tanz ist von dem plumpsten Dienstmädchen in drei Stunden zu erlernen, das Kino ergötzt Analphabeten und erfordert von ihnen nicht einen Gran Bildung, um den Radiogenuß zu haben, braucht man nur gerade den Hörer vom Tisch zu nehmen und an den Kopf zu hängen und schon walzt und klingt es einem ins Ohr – gegen eine solche Bequemlichkeit kämpfen selbst die Götter vergebens. Wer nur das Minimum an geistiger und körperlicher Anstrengung und sittlicher Kraftaufbietung fordert, muß notwendigerweise in der Masse siegen, denn die Mehrzahl steht leidenschaftlich zu ihm, und wer heute noch Selbständigkeit, Eigenwahl, Persönlichkeit selbst im Vergnügen verlangte, wäre lächerlich gegen so ungeheure Übermacht. Wenn die Menschheit sich jetzt zunehmend verlangweiligt und monotonisiert, so geschieht ihr eigentlich nichts anderes, als was sie im Innersten will. Selbständigkeit in der Lebensführung und selbst im Genuß des Lebens bedeutet jetzt nur so wenigen mehr ein Ziel, daß die meisten es nicht mehr fühlen, wie sie Partikel werden, mitgespülte Atome einer gigantischen Gewalt. So baden sie sich warm in dem Strome, der sie wegreißt ins Wesenlose; wie Tacitus sagte: »ruere in servitium«, sich selbst in Knechtschaft stürzen, diese Leidenschaft zur Selbstauflösung hat alle Nationen zerstört. Nun ist Europa an der Reihe: der Weltkrieg war die erste Phase, die Amerikanisierung ist die zweite.
Darum keine Gegenwehr! Es wäre eine ungeheure Anmaßung, wollten wir versuchen, die Menschen von diesen (im Innersten leeren) Vergnügungen wegzurufen. Denn wir – um ehrlich zu sein –, was haben wir ihnen noch zu geben? Unsere Bücher erreichen sie nicht mehr, weil sie längst nicht mehr das an kalter Spannung, an kitzliger Erregung zu leisten vermögen, was der Sport und das Kino ihnen verschwenderisch geben, sie sind sogar so unverschämt, unsere Bücher, geistige Anstrengung zu fordern und Bildung als Vorbedingung, eine Mitarbeit des Gefühles und eine Anspannung der Seele. Wir sind – gestehen wir es nur zu – allen diesen Massenfreuden und Massenleidenschaften und damit dem Geist der Epoche furchtbar fremd geworden, wir, denen geistige Kultur Lebensleidenschaft ist, wir, die wir uns niemals langweilen, denen jeder Tag zu kurz wird um sechs Stunden, wir, die wir keine Totschlageapparate brauchen für die Zeit und keine Amüsiermaschinen, weder Tanz noch Kino noch Radio noch Bridge noch Modenschau. Wir brauchen nur bei einer Plakatsäule in einer Großstadt vorüberzugehen oder eine Zeitung zu lesen, in der Fußballkämpfe mit der Ausführlichkeit von homerischen Schlachten geschildert werden, um zu fühlen, daß wir schon solche Outsider geworden sind wie die letzten Enzyklopädisten während der Französischen Revolution, etwas so Seltenes, Aussterbendes im heutigen Europa wie die Gemsen und das Edelweiß. Vielleicht wird man um uns seltene letzte Exemplare einmal einen Naturschutzpark anlegen, um uns zu erhalten und als Kuriosa der Zeit respektvoll zu bewahren, aber wir müssen uns klar sein darüber, daß uns längst jede Macht fehlt, gegen diese zunehmende Gleichmäßigkeit der Welt das mindeste zu versuchen. Wir können nur in den Schatten jenes grellen Jahrmarktslichtes treten und wie die Mönche in den Klöstern während der großen Kriege und Umstürze in Chroniken und Beschreibungen einen Zustand aufzeichnend schildern, den wir wie jene für eine Verwirrung des Geistes halten. Aber wir können nichts tun, nichts hindern und nichts ändern: jeder Aufruf zum Individualismus an die Massen, an die Menschheit wäre Überheblichkeit und Anmaßung.
Rettung: so bleibt nur eines für uns, da wir den Kampf für vergeblich halten: Flucht, Flucht in uns selbst. Man kann nicht das Individuelle in der Welt retten, man kann nur das Individuum verteidigen in sich selbst. Des geistigen Menschen höchste Leistung ist immer Freiheit, Freiheit von den Menschen, von den Meinungen, von den Dingen, Freiheit zu sich selbst. Und das ist unsere Aufgabe: immer freier werden, je mehr sich die anderen freiwillig binden! Immer vielfältiger die Interessen ausweiten in alle Himmel des Geistes hinein, je mehr die Neigung der anderen eintöniger, eingleisiger, maschineller wird! Und alles dieses ohne Ostentation! Nicht prahlerisch zeigen: wir sind anders! Keine Verachtung affichieren für alle diese Dinge, in denen vielleicht doch ein höherer Sinn liegt, den wir nicht verstehen. Uns innen absondern, aber nicht außen: dieselben Kleider tragen, von der Technik alle Bequemlichkeiten übernehmen, sich nicht vergeuden in prahlerischen Distanzierungen, in einem dummen ohnmächtigen Widerstand gegen die Welt. Still, aber frei leben, sich lautlos und unscheinbar einfügen in den äußeren Mechanismus der Gesellschaft, aber innen einzig ureigenster Neigung leben, sich seinen eigenen Takt und Rhythmus des Lebens bewahren! Nicht hochmütig wegsehen, nicht frech sich weghalten, sondern zusehen, zu erkennen suchen und dann wissend ablehnen, was uns nicht zugehört, und wissend erhalten, was uns notwendig erscheint. Denn wenn wir uns der wachsenden Gleichförmigkeit dieser Welt auch mit der Seele verweigern, so wohnen wir doch dankbar treu im Unzerstörbaren dieser Welt, das immer jenseits aller Wandlungen bleibt. Noch wirken Mächte, die aller Zerteilung und Nivellierung spotten. Noch bleibt die Natur wandelhaft in ihren Formen und schenkt sich Gebirge und Meer im Umschwung der Jahreszeiten ewig gestaltend neu. Noch spielt Eros sein ewig vielfältiges Spiel, noch lebt die Kunst im Gestalten unaufhörlich vielfachen Seins, noch strömt Musik in immer anders tönender Quelle aus einzelner Menschen aufgeschlossener Brust, noch dringt aus Büchern und Bild Unzahl der Erscheinung und Erschütterung. Mag all das, was man unsere Kultur nennt, mit einem widrigen und künstlichen Wort immer mehr parzelliert und vernüchtert werden – das »Urgut der Menschheit«, wie Emil Lucka die Elemente des Geistes und der Natur in seinem wunderbaren Buche nennt, ist nicht ausmünzbar an die Massen, es liegt zu tief unten in den Schächten des Geistes, in den Minengängen des Gefühls, es liegt zu weit von den Straßen, zu weit von der Bequemlichkeit. Hier im ewig umgestalteten, immer wieder neu zu gestaltenden Element erwartet den Willigen unendliche Vielfalt: hier ist unsere Werkstatt, unsere ureigenste, niemals zu monotonisierende Welt.
Die moralische Entgiftung Europas
Ein Vortrag für die Europatagung der Accademia di Roma, 1932
Wenn wir Europa als einen einzigen geistigen Organismus betrachten – und dazu geben uns die zweitausend Jahre gemeinsam aufgebauter Kultur ein unbedingtes Recht –, so können wir uns der Erkenntnis nicht verschließen, daß dieser Organismus im gegenwärtigen Augenblicke einer schweren seelischen Verstörung anheimgefallen ist. In allen oder beinahe allen Nationen zeigen sich dieselben Erscheinungen starker und rascher Reizbarkeit bei großer moralischer Ermüdung; ein Mangel an Optimismus, ein plötzlich aufspringendes, aus jedem Anlaß sich entzündendes Mißtrauen, jene typische Nervosität und Unfreudigkeit, die aus dem Gefühle der allgemeinen Unsicherheit stammt. Die Menschen haben seelisch, so wie die Nationen ökonomisch, eine ständige Anstrengung notwendig, um sich im Gleichgewicht zu erhalten; schlechte Nachrichten werden leichter geglaubt als die hoffnungsfreudigen, und sowohl die Individuen als die Staaten scheinen eher bereit, einander gegenseitig zu hassen, als in vergangenen Epochen, das gegenseitige Mißtrauen erweist sich unermeßlich stärker als das Vertrauen. Ganz Europa steht unter einer Föhnstimmung und Schirokkoluft, welche das lustvolle Spiel der freien Kräfte hemmt, auf die Stimmung drückt und, ohne eine wirkliche Aktion zu fördern, die Nerven gefährlich reizt.
Daß dieser Spannungszustand im letzten noch immer einen Rückstand im Blutkreislaufe aus dem Kriege bedeutet, ist zu klar, als daß es weiterhin noch bewiesen werden müßte. Die Kriegsjahre haben die Menschen in allen Ländern an höhere und heftigere Spannungen des Gefühles gewöhnt. Da Kriege nicht kühl und kalt geführt werden können und nicht nur rein rechnungsmäßige Exempel von Zahlen und Maschinen darstellen, war ein ungeheurer Einschuß gesteigerter Leidenschaft notwendig, um eine so fürchterliche und lange Frist wie den vierjährigen Weltkrieg bis zum Ende zu führen. Ein gewisses »Dumping«, ein ständiges Anfachen der Instinkte des Hasses, des Zornes, der Erbitterung war notwendig in allen Staaten, um immer und immer wieder die Teilnehmer von der Notwendigkeit des Einsatzes äußerster Gefühlskräfte zu überzeugen, denn nach Goethes Wort ist Begeisterung »keine Heringsware, die man einpökeln kann auf viele Jahre«; sie ist an sich nur ein kurzer Emotionszustand, ein seelendynamischer Superlativ, und diese kurze Frist mußte unbedingt ausgedehnt und verlängert werden. So wurde unablässig in allen Ländern der Haß gegen den Gegner immer neu genährt und diszipliniert, Millionen eigentlich indifferenter Naturen zu einem höheren Gefühlsverbrauch an Haß genötigt, als ihnen organisch und natürlich war. Mit dem Friedensschluß wurde dann diese Pflicht zum Haß mit einmal abgestellt und für unnötig erklärt. Aber ein Organismus, einmal an ein Rauschgift gewöhnt, kann es nicht plötzlich entbehren. Wer jahrelang Narkotika oder Stimulantia ständig verbraucht hat, dessen Körper kann sich nicht von einer Stunde zur anderen völlig zu Entbehrungen umschalten, und so ist – leugnen wir dies nicht – das Bedürfnis nach politischer Spannung, nach kollektivem Haß bei unserer Generation weiterhin latent geblieben. Er hat sich nur vom äußeren Landesfeind umgeschaltet in andere Richtungen, Haß von System zu System, von Partei zu Partei, von Klasse zu Klasse, von Rasse zu Rasse, aber im wesentlichen sind seine Formen dieselben geblieben: das Bedürfnis, sich als Gruppe feindselig gegen andere Gruppen zu ereifern, beherrscht noch heute Europa, und man muß an jene alte Sage denken, wo längst nach der Schlacht noch die Schatten der Toten in den Lüften weiter miteinander kämpfen. Dieser verhängnisvolle Zustand der Unsicherheit, der seelischen Unruhe, des Mißtrauens und der gegenseitigen Feindseligkeit wird aber von allen geistigen Menschen Europas in allen Ländern gleich schmerzlich empfunden, und das Problem tritt an uns gebieterisch heran, wie eine moralische Entgiftung des Organismus wieder vorzunehmen wäre, auf welche Weise die seelische Depression, die gleichzeitig mit der wirtschaftlichen unser Abendland belastet – wobei die seelische die wirtschaftliche, die wirtschaftliche die seelische unablässig steigert – durch eine systematische Aktion vermindert werden könnte.
Mit soviel Mut und Entschlossenheit er dieses Problem auch anzugehen geneigt ist, muß der Aufrichtige sich zunächst eingestehen, daß auf eine plötzliche brüske Umschaltung eines Zustandes, der schon Millionen von Seelen innerlich ergriffen hat, nicht zu hoffen ist. Bei seelischen Erkrankungen gibt es nicht die magna therapia sterilisans, die einmalige plötzliche Wunderkur, sondern wie bei jeder Vergiftungserscheinung kann nur eine allmähliche Entziehungskur einsetzen, eine logische, systematische Entwöhnungskur für die seinerzeitige plötzliche irrationale Gewöhnung. Wir dürfen uns keinen Hoffnungen auf plötzlichen Umschwung hingeben, wir müssen vielleicht – schmerzlich dies zu sagen und uns einzugestehen! – auf eine völlige Heilung unserer eigenen Generation, der Kriegsgeneration, schon verzichten und unsere ganze Kraft dahin wenden, daß wenigstens das nächste Geschlecht, die kommende und wahrhaft aufbauende Generation, nicht mehr der falschen und unglückseligen Haßmentalität der unseren verfällt. Mit Proklamationen, Aufrufen, Konferenzen, Bündnissen und Manifestationen guten Willens an die Menschen von heute ist nicht genug getan. Es muß eine zähe, vorbedachte, systematische Arbeit geleistet werden, um die Seele der neuen, der nächsten Generation reiner, fester, heller und klarer zu kristallisieren, als die unsere es gewesen, welcher der Krieg mit seinem furchtbaren Hammer die ursprüngliche Form zerschlagen hat. Wir dürfen nicht mehr daran denken, das Zersplitterte zusammenzusetzen, sondern einzig, das noch Ungeformte neu und zu fruchtbarerer Form aufzubauen.
Dieser Aufbau einer neuen Generation muß selbstverständlich an dem Punkte des geistigen Erwachens beginnen, in der Schule, also in der Lebensstunde, wo noch weich, zart und wie plastisches Wachs sich die Geistigkeit des werdenden Menschen der verständigen Hand des Lehrers darbietet. Alles wird richtig entschieden sein, wenn die neue Jugend Europas gleichzeitig in allen Ländern Europas richtig belehrt wird. Diese neue Erziehung aber muß von einer veränderten Auffassung der Geschichte ausgehen, und zwar von dem Grundgedanken, die Gemeinsamkeit zwischen den Völkern Europas stärker zu betonen als ihren Widerstreit. Diese Auffassung, die mir und manchem als die notwendigste erscheint, ist bisher immer unterdrückt worden zugunsten der rein politischen und nationalpolitischen Geschichtsauffassung. Dem Kinde wurde gelehrt, seine Heimat zu lieben, eine Auffassung, der wir nicht widersprechen und der wir nur noch hinzuzutun wünschten, daß ihm gleichzeitig gelehrt würde, die gemeinsame Heimat Europa und die ganze Welt, die ganze Menschheit zu lieben, den Begriff Vaterland nicht feindselig, sondern in einer Verbundenheit mit den anderen Vaterländern darzustellen. Dieser Auffassung, die wir wünschen, widerspricht aber bei allen Nationen die Darstellung der Geschichte, die in jedem Lande in demselben Sinne gelehrt wird, nämlich, daß immer und überall der jeweilige historische Gegner des Landes seit Tausenden und Tausenden Jahren als der Feind, als der im Unrecht befindliche dargestellt wird und das eigene Vaterland als im Recht; daß im Schulbuche alle Kriege als vom Gegner gewaltsam aufgezwungene und nur zur Verteidigung vom eigenen Vaterlande geführte geschildert werden. Vielleicht – dies sei willig zugegeben – kann politische Geschichte, Nationalgeschichte, nicht anders geschrieben werden und nicht anders gelehrt; vielleicht drückt diese Art, Geschichte zu schreiben und zu lehren, sogar einen moralischen Gedanken aus; denn nur die naiven Völker im Urzustande haben den Mut gehabt, sich zu rühmen, kühn und frech Kriege aus reiner Lust begonnen zu haben; und es ist typisch, daß diese Art der Geschichtsschreibung, die jeden Krieg und jede Eroberung als erzwungen darstellt, gerade mit dem ersten geistigen Menschen beginnt, der zugleich Krieger und Darsteller seines Krieges war, mit Julius Cäsar. Als erster zeigt dieser große Charakter schon eine gewisse Scham, einzugestehen, er habe Gallien, Britannien und Germanien nur erobert, um die Macht Roms zu vergrößern, um seine eigene Macht zu steigern; sondern unablässig erklärt er sich von den einzelnen Völkerstämmen als provoziert, als herausgefordert, und indem er seine Siege rühmt, wagt er in einer edlen Scham doch nicht zuzugestehen, aus reinem Eroberungsdrange bis ans Ende Europas vorgedrungen zu sein. Je mehr wir moralisch empfinden, je mehr wir den bloß um der Eroberung willen produzierten Krieg als eine unhumane und dem sittlichen Gesetz zuwiderhandelnde Sache betrachten und nur den aufgezwungenen Krieg, den Krieg der Verteidigung, als entschuldbar, desto mehr werden in allen Ländern die Lehrer und die Schulbücher gezwungen sein, jeden historischen Krieg im Geschichtsunterricht als eine Provokation des Gegners und die eigene Nation als die angegriffene darzustellen. Alle nationale Geschichte bei allen Nationen muß darum notwendigerweise, um bei der Jugend ehrliche Begeisterung zu erwecken, dem Nachbarlande die Schuld zuweisen. Das ist eigentlich unvermeidlich, und wenn heute auf Kongressen gefordert wird, aus den Schulbüchern wenigstens die groben Angriffe oder Verdächtigungen zu entfernen, so ist damit der eigentliche Kern des Problems nicht berührt. Denn immer wird der junge, glühende Mensch den Heroismus seiner Väter und Ahnen nur ganz würdigen und begreifen können, wenn er ihren Kampf als einen Kampf des Rechtes und der Redlichkeit ansieht. Darum wird und muß alle politische Geschichte in allen Ländern niemals objektiv sein und nie völlig objektiv gemacht werden können. Geben wir die Hoffnung auf, dies zu ändern, und setzen wir unsere Kraft lieber ein für wirklich erreichbare Ziele.
Die wirkliche Änderung, die ich zur Entgiftung der moralischen Sphäre bei der Jugend für fruchtbar halte, müßte viel gründlicher sein und tiefer greifen; sie müßte eine Umschaltung des Lehrplanes in allen Staaten und Ländern von der politischen, der militärischen Geschichte zur Kulturgeschichte bringen. Zu lange und zuviel hat man Geschichte nur als eine Aufeinanderfolge von Kriegen dargestellt, als ob die militärische Leistung die einzige und einzig heroische jedes Landes und sein wesentlicher Anspruch an die Menschheit in den zwei oder drei Jahrtausenden unserer geistigen Existenz gewesen wäre. Von einer übernationalen Warte gesehen, von einem Universalstandpunkte aber ergibt nun dieser Aspekt der Geschichte als Kriegsgeschichte eigentlich eine völlige Sinnlosigkeit. Völker schlagen Völker, Armeen Armeen, Feldherren besiegen Feldherren, Städte werden zerstört, Länder werden groß und wieder klein, Reiche schwellen auf oder schwinden zusammen, immer andere, immer andere, es ist ein ewiges Weiter und Weiter und kein Aufstieg und kein Zusammenhang. Neben dieser Geschichte besteht aber glücklicherweise noch eine zweite der Menschheit: der Aufbau der Kultur, die großen Erfindungen, die Entdeckungen, die Fortschritte in Sitte, Wisenschaft und Technik, und während die bloße Geschichte der Kriege als Gesamtheit nur ein ständiges Auf und Ab ergibt, zeigt die Kulturgeschichte ein ständiges unaufhaltsames Hinauf, ein immer und immer höheres Empor. Während die Kriegsgeschichte dartut, was die einzelnen Länder aneinander verschuldet, wie Frankreich Deutschland plündert und Deutschland Frankreich, wie Griechenland Persien schädigt und Persien Griechenland, während sie in den Nachfahren unweigerlich Haß erregt und nachträgliche Erbitterung, zeigt die andere, die Kulturgeschichte, was eine Nation der anderen verdankt, und erschafft so das großartige Register aller Errungenschaften und Entdeckungen. In der Kriegsgeschichte erscheinen sich die Völker einzig als Feinde, in der Kulturgeschichte als Brüder, durch sie begreifen sie, wie ein Land das andere befruchtet, wie Erfindung mit Erfindung sich ergänzt hat, wie von einem Volke zum anderen gleichsam Ströme des schöpferischen Willens hinübergehen und jede einzelne Leistung, im Gegensatze zu den kriegerischen, das gemeinsame Wohl steigert. Die Geschichte als Kriegsgeschichte, wie sie heute noch fast ausschließlich gelehrt wird, zeigt, wie Europa sich ununterbrochen zerstört hat, die Kulturgeschichte, die heute leider noch nicht genug Gegenstand der Schulen ist, lehrt, wie die Völker Europas sich dank der gemeinsamen Leistung Roms, Griechenlands, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Englands, Spaniens, Hollands, Skandinaviens immer mehr zu einem herrlichen und größeren geistigen Begriffe aufgebaut haben. Die Kriegsgeschichte lockt die Jugend, Gewalt zu bewundern, Kulturgeschichte lehrt sie, den Geist zu verehren, jene den Krieg, diese den Frieden als die höchste menschliche Leistung zu empfinden. Blicken wir das Geschehen der Welt durch die Kulturgeschichte an, so fördern wir unbewußt den Geist der Gemeinsamkeit und das Gefühl des Optimismus, denn hier ist Aufstieg ohne Ende, eine in immer höhere Sphären aufklingende Harmonie.





























