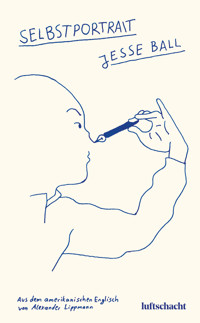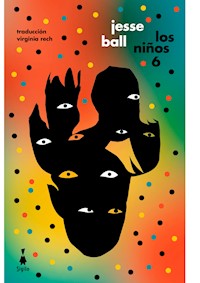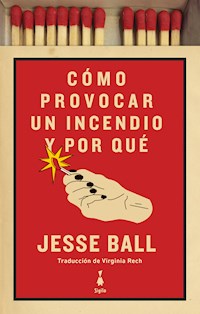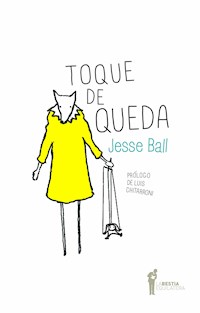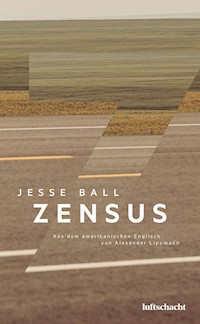
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ein Witwer von seinem Arzt die Nachricht erhält, dass er nicht mehr lange zu leben hat, stellt sich ihm die Frage, wer sich um seinen erwachsenen Sohn kümmern soll – einen Jungen mit Down-Syndrom, den er über alles liebt. Ohne einen Ausweg zu wissen und mit dem Wunsch, auf einer letzten Reise das Land zu sehen, meldet sich der Mann als Volkszähler bei einer mysteriösen Regierungsbehörde und verlässt mit seinem Sohn die Stadt. Auf ihrer Reise durch Städte, die nur nach aufsteigenden Buchstaben des Alphabets benannt sind, begegnen der Mann und sein Sohn einer großen Bandbreite menschlicher Erfahrungen. Während einige Leute sie in ihren Häusern willkommen heißen, bleiben andere misstrauisch. Als sie an den Rand der Zivilisation vordringen, wird die Landschaft wilder, die Orte liegen weiter auseinander und sind vom industriellen Verfall gezeichnet. Als sie sich "Z" nähern, muss sich der Mann eine Reihe von Fragen stellen: Was ist der Zweck der Volkszählung? Ist er mitschuldig an ihrer Mission? Und wie wird er lernen, sich von seinem Sohn zu verabschieden? "Zensus" ist ein mysteriöser und aufrüttelnder Roman über den freien Willen, die Trauer, die Macht der Erinnerung und die Wildheit der elterlichen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als ein Witwer von seinem Arzt die Nachricht erhält, dass er nicht mehr lange zu leben hat, stellt sich ihm die Frage, wer sich um seinen erwachsenen Sohn kümmern soll – einen Jungen mit Down-Syndrom, den er über alles liebt. Ohne einen Ausweg zu wissen und mit dem Wunsch, auf einer letzten Reise das Land zu sehen, meldet sich der Mann als Volkszähler bei einer mysteriösen Regierungsbehörde und verlässt mit seinem Sohn die Stadt.
Auf ihrer Reise durch Städte, die nur nach aufsteigenden Buchstaben des Alphabets benannt sind, begegnen der Mann und sein Sohn einer großen Bandbreite menschlicher Erfahrungen. Während einige Leute sie in ihren Häusern willkommen heißen, bleiben andere misstrauisch. Als sie an den Rand der Zivilisation vordringen, wird die Landschaft wilder, die Orte liegen weiter auseinander und sind vom industriellen Verfall gezeichnet. Als sie sich „Z“ nähern, muss sich der Mann eine Reihe von Fragen stellen: Was ist der Zweck der Volkszählung? Ist er mitschuldig an ihrer Mission? Und wie wird er lernen, sich von seinem Sohn zu verabschieden?
Zensus ist ein mysteriöser und aufrüttelnder Roman über den freien Willen, die Trauer, die Macht der Erinnerung und die Wildheit der elterlichen Liebe.
JESSE BALL wurde in New York geboren. Er ist Autor von sechzehn Büchern und seine Werke wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des Lehrkörpers der School of the Art Institute of Chicago, hat den Plimpton Prize for Fiction der Paris Review gewonnen und stand auf der Longlist für den National Book Award. Er wurde von Granta als einer der besten jungen Romanautoren ausgezeichnet und war Stipendiat der NEA, Creative Capital und der Guggenheim Foundation.
ALEXANDER LIPPMANN, *1978 in St. Pölten. Lebt und arbeitet als Autor, Musiker und Übersetzer aus dem Englischen in Wien.
Jesse Ball
Zensus
Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Lippmann
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Census
Copyright © 2017 by Jesse Ball.
ISBN 978-0-06-267613-9
Published by Ecco – An Imprint of HarperCollinsPublishers
195 Broadway, New York, NY 10007.
Ecco® and HarperCollins® are trademarks of HarperCollins Publishers.
Alle abgedruckten Fotos stammen aus der Privatsammlung des Autors.
© Luftschacht Verlag – Wien
luftschacht.com
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten.
1. Auflage Oktober 2022
Umschlaggestaltung: Matthias Kronfuss studio – matthiaskronfuss.at
Übersetzung: Alexander Lippmann
Lektorat: Teresa Profanter
Satz: Paul Frenzel
Gesetzt aus der Metric und der Noe.
Druck und Herstellung: Finidr s.r.o.
Papier: Munken Print Cream 90 g/m2, Surbalin glatt 115 g/m2
ISBN: 978-3-903422-09-4
ISBN E-Book: 978-3-903422-10-0
Der Verlag dankt Moritz Müller-Schwefe für die nachdrückliche Empfehlung von Jesse Ball.
In erwachsener Verbundenheit für Abram Ball.
Für Abram Ball
Inhalt
ZENSUS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S,T
U,V
W,X
Y
Z
Mein Bruder Abram Ball starb 1998. Er war vierundzwanzig Jahre alt und hatte das Down-Syndrom. Zum Zeitpunkt seines Todes war er schon jahrelang an ein Beatmungsgerät angeschlossen, war seit Jahren querschnittgelähmt, war Dutzende Male operiert worden. Sein Unglück war kompliziert, aber sein großartiges, wundervolles Naturell veränderte sich nicht. Er war älter als ich, wenn auch kleiner, und ich habe viele Stunden an seinem Bett im Krankenhaus verbracht.
Aber vor dieser Zeit, als wir beide Kinder waren, als er noch gehen und spielen konnte, wusste ich, obwohl ich noch jung war, dass ich mich eines Tages um ihn würde kümmern müssen, dass ich eines Tages sein Begleiter sein würde, und dass wir miteinander leben würden, glücklich miteinander leben könnten. Als Kind ging ich diese Verpflichtung in meiner Vorstellung ein und sie wurde ein Teil von mir. Ich entwarf verschiedene Szenarien, wie das aussehen könnte. Als Junge machte ich mir sogar Sorgen, ob ich eine Partnerin finden würde, die mit mir und meinem Bruder leben wollen würde.
Vergangenen Monat kam mir der Gedanke, dass ich gerne ein Buch über meinen Bruder schreiben würde. Ich war immer der Meinung, und bin es noch, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht wirklich verstanden werden. Was ich in meinem Herzen fühle, wenn ich über ihn und sein Leben nachdenke, ist so gewaltig, so strahlend, dass ich mir dachte, ich müsse ein Buch schreiben, das Menschen dabei hilft zu verstehen, wie es ist, wenn man einen Jungen oder ein Mädchen mit Down-Syndrom kennt und liebt. Es ist nicht so, wie man sich das erwarten würde, und es ist nicht so, wie das üblicherweise dargestellt und erklärt wird. Es ist etwas anderes, etwas, das sich davon unterscheidet.
Aber es ist nicht einfach, ein Buch über jemanden zu schreiben, den man kennt, noch dazu, wenn er schon lange tot ist, wenn die Erinnerung an ihn sich wie ein niedergetrampelter Garten anfühlt. Ich wusste nicht genau, wie ich das anstellen sollte, bis mir klar wurde, dass ich ein Buch schreiben würde, das einen Hohlraum enthält. Ich würde ihn in der Mitte platzieren und größtenteils um ihn herumschreiben. Auf diese Art wäre er darin enthalten.
Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass die Beziehung, die ich mit meinem erwachsenen Bruder haben würde, der Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn sehr ähnlich wäre, also beschloss ich, ein Buch über einen Vater zu schreiben, der, im Angesicht seines Todes, mit seinem erwachsenen Sohn verreist. In diesem Buch, in der Handhabung der Details, in und zwischen den Wörtern, würde ein Porträt von Abram entstehen als Sohn, ein Porträt, das auch anderen erlaubt zu sehen, wie ein solcher Junge ist oder sein kann.
Auf diese Weise war es mir in einem gewissen Sinn möglich, wieder in die Welt aus Gedanken und Ideen einzutreten, die ich als Kind hatte – und die ich gerade erwähnt habe: dass ich mich eines Tages um ihn kümmern würde und wie das dann wäre. Ein Leben dauert lange, und wir sind Viele, in unterschiedlichen Gestalten, unter verschiedenen Umständen, aber etwas an uns bleibt gleich, und was ich als Junge gefühlt habe, fühle ich auch jetzt noch – eine traurige und kraftvolle Sehnsucht nach einer Zukunft, die nie gekommen ist, mit all den damit verbundenen Sorgen und Ängsten.
Ich denke, dass einige von euch auf diesen Seiten eigene Erfahrungen wiedererkennen werden. Ich hoffe, dass sie andere dazu anspornen, neue Erfahrungen zu machen.
ZENSUS
Als ich mich umdrehte, um meine Schaufel gegen das rostige Grau des Wagens zu lehnen, fiel mein Blick hinunter in das Grab, das ich ausgehoben hatte, und dort sah ich, entlang der Oberfläche beziehungsweise entlang der Wand, in zitternden Wurzeln, den Pfad, den ich in den vergangenen Monaten bereist hatte, um den Zensus in die entlegensten Bezirke zu bringen. Wie zufällig folgte mein Blick den feingliedrigen, roten Wurzeln weit, weit nach unten ins Grab, erst links, dann links, dann links, dann links, dann rechts, dann links, dann links, dann rechts, dann links, dann links und stets nach unten. Es war, als könnte ich meine Hand auf dem Lenkrad spüren, als ich auf diesen Straßen unterwegs war, die die Felder umgaben, und ich fühlte mich beinahe in die Person zurückversetzt, die ich einst war – jemand, der mir ähnlich ist, den ich vielleicht gekannt haben könnte, jemand, der zu mir unterwegs ist, der tatsächlich wie ein Pfeil auf mich zurast, auf mein Herz und auf die Stelle, an der ich jetzt stehe. Hatte ich ihn gekannt? Wer kann schon von sich behaupten, über seine eigene Erscheinung, seine eigenen Ideen jederzeit Bescheid zu wissen? Und doch kehren wir wieder und wieder in uns selbst zurück – es muss ein Wiedererkennen geben, irgendetwas noch so Unbedeutendes. Muss es das?
Für mich, ich kehre zu mir zurück, ich kehre zurück und was ich finde ist – das, was mich umgibt. Die Hügellandschaft, die ich betrachte – sie setzt sich ohne Unterbrechung in meinem Inneren fort. Da ist so wenig in mir, das jetzt zu einem Schrei anheben kann.
Ich warte, und während ich warte, kreisen die Bilder – meines Lebens, meines Sohnes, der letzten Tage. Alles Weitere ist trüb und wird immer trüber, auch wenn manchmal etwas Klares durchkommt, etwas Klares, das den Rahmen sprengt und dann, vielleicht besonders dann, vergesse ich, wer ich bin und wann.
Wer kann die Leere verstehen? Wir sind als Menschen so voller Sehnsucht; was leer ist, entzieht sich uns. Leer zu sein, eine Leere im Innersten zu umfassen, muss ein Talent sein – man muss es haben, muss es wohl von Anfang an haben. Ich hatte es stets.
Zu meiner Zeit hatte ich Dinge gelesen, Dinge wie:
Ein Volkszähler muss – mehr als alles andere – nach Leere streben, sich sogar nach ihr sehnen.
Die Tatsache, dass wir unsere Eindrücke, die Szenen, in denen wir auftreten, allein durch unsere Anwesenheit trüben –, das ist etwas, von dem die Volkszähler vorsichtig, sogar behutsam vorgeben, es nicht zu wissen. Wüssten wir es, wir könnten unser grundlegendstes Vorhaben noch nicht einmal beginnen. Für uns ist der Zensus eine Art Kreuzzug ins Unbekannte. Jemand nannte es einst, mit einer Laterne in das Unwetter gehen. Mit einer Laterne in das Unwetter gehen – ich habe diese Worte schon oft vor mir hergesagt, aber für mich ist das Gefühl dabei nicht heroisch, eher komisch. Ein Volkszähler hat etwas Hilfloses. Die Grenzen dessen, was getan werden kann, sind klar. Vielleicht zieht aber auch genau das die Menschen an, die diese schreckliche und absolut undankbare Arbeit machen. Denn egal, welchen Nutzen sie zu haben scheint, es kann darin keinerlei Sinn liegen, schon gar nicht in einem kleinen Teil dieses unfassbar großen Unterfangens. Meine verstorbene Frau würde mich auslachen, wenn sie mich dabei sehen könnte, wie ich mich in einem alten Mantel den Häusern nähere. Aber ich fühle sie noch immer, die Wärme der kleinen Laterne, den Sturm des Unwetters.
Es war vor allem mein Sohn, der mich auf diese Arbeit vorbereitet hat, der mir, nicht durch seine Worte, sondern durch seine alltäglichen Handlungen gezeigt hat, dass wir einander von Natur aus ein Maßstab sind, dass wir einander jeden Moment gegenseitig vermessen. Das war jener Zensus, den er mit seiner Geburt begann, den er bis heute fortsetzt. Es war sein Zensus, der zu unserem geführt hat, dazu, dass wir den Zensus aufgenommen haben, zu unserer Reise in den Norden.
Durch sein Leben, seine Art zu denken, wurde die Arbeit als Volkszähler überhaupt erst denkbar, sogar unausweichlich.
Aber davor, bevor ich überhaupt das Büro betreten konnte, um Volkszähler zu werden, erhielt ich eine Nachricht, nicht über den Zensus, nicht über etwas Bestimmtes, sondern im Gegenteil: über alles, eine Nachricht über alles. In gewisser Hinsicht traf ein Bote ein, der mir einen Umschlag übergab, und in diesem Moment wusste ich, dass ich bald sterben würde. Bei anderer Betrachtung, so würde es wohl von außen betrachtet wirken, ging ich einfach meinen Geschäften nach, sprach mit einer Krankenschwester in meiner Praxis, stehend, im Gang gestikulierend. Als Nächstes lag ich auf dem Rücken in einem Untersuchungszimmer und betroffene Gesichter schauten mich an, als würden sie mich zum ersten Mal sehen.
Ich ging zu einem Arzt, einem meiner Freunde, der mich untersuchte. Er stocherte herum, stieß hinein, schaute missmutig.
Er sagte, ich könne mich Tests unterziehen, aber ich denke, wir wissen beide, was das Ergebnis wäre.
Er lachte. Das war seine Art.
Wir saßen eine Weile da und schließlich klopfte er mir auf die Schulter.
Aber dein Sohn, was wird er tun? Würde ihn jemand aufnehmen? Wer wäre das? Würde er in ein Heim kommen?
Die Art, wie er Heim sagte, war furchtbar. Ich schüttelte den Kopf.
Ich sagte, es gebe da eine Frau, die ich kenne und die mit mir und meiner Frau eine Vereinbarung getroffen habe. Sie habe versprochen, auf meinen erwachsenen Sohn aufzupassen und sich um ihn zu kümmern, sollte mir oder meiner Frau etwas passieren. Sie lebe nur ein Stück die Straße hinunter, sei unauffällig, nicht beeindruckend, sanft, großartig.
Ich verließ den Raum, er brachte mich zur Tür und hielt inne. Er richtete meinen Kragen und nickte sich selbst zu.
Ich glaube, du solltest aufhören zu arbeiten. Ich glaube, du solltest irgendwohin gehen, wo es trocken ist, irgendwo in der Nähe von Z. Die Reise würde dir guttun. Denk darüber nach. Es gibt keinen Grund, dort zu sterben, wo man gelebt hat. Das ist nicht ehrenhafter.
Ich holte meinen Sohn von dort ab, wo er gerade war, von den Leuten, bei denen er war. Sie wussten nicht, was passiert war. Ich sagte ihnen, dass wir eine Reise unternehmen würden, dass mein Sohn eine Weile nicht kommen würde. Sie machten eine große Sache daraus, dass er verreisen werde, wie schön es sei, eine Reise zu machen. Er freute sich darüber, war zufrieden. Er zeigte mir etwas, das er aus Stöcken gebaut hatte. Ich sagte ihm, dass es mir gefalle, und fragte ihn, was es sei. Er fand es nicht gut, dass ich es nicht erkannte. Unser Haus, sagte er. Natürlich, sagte ich, natürlich ist das unser Haus, ich habe es nur falsch angeschaut.
Als wir zurück nach Hause kamen, ging ich durch die Zimmer, von Zimmer zu Zimmer. Ich dachte, jetzt werde ich nicht mehr hier leben. Selbst mein Sohn würde nicht mehr hier leben. Eigentlich kann jetzt niemand mehr hier leben.
Ich ließ meinen Sohn für eine Stunde allein und ging die Straße hinunter.
Du siehst wirklich aus, als würdest du bald sterben, sagte sie. Ich hätte nie gedacht, dass du deine Frau überlebst.
Das habe ich, sagte ich.
Aber nur knapp.
Ich werde eine Reise machen, sagte ich. Ich werde für den Zensus nach Norden gehen. So haben wir etwas zu tun, eine letzte gemeinsame Zeit, eine Bestimmung, die so viel Sinn hat wie möglich, ohne dabei irgendeinen Zweck zu erfüllen. Ich kann mit meinem Sohn zusammen sein. Wir sehen die gleichen Dinge und können sie gemeinsam anschauen. Ich halte mich nahe an der Zugstrecke, und wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden, wird mein Sohn zurückreisen. Ich sende dir eine Nachricht, damit du weißt, dass du ihn vom Zug abholen kannst.
Sie sagte, dass sie das nicht so planen würde, aber sie verstand, warum ich es auf diese Art machen wollte.
Eine letzte Reise, mein Sohn und ich. Und vielleicht werde ich wieder gesund.
Das könnte sein, sagte sie.
Ich begann darüber zu sprechen, wie man sich um meinen Sohn kümmern muss, über bestimmte Tatsachen, über bestimmte Bedürfnisse.
Das weiß ich alles.
Bitte lass es mich trotzdem sagen.
Du kannst es sagen, wenn du willst, aber ich weiß es schon. Ich kümmere mich um ihn, keine Sorge. Es wird so sein, wie es früher war, was auch immer das gewesen ist.
Ich weiß, du hast meine Frau nicht gemocht, begann ich.
Dein Sohn wird bei mir leben, nicht deine Frau, dem Himmel sei Dank. Keine Sorge.
Am nächsten Morgen ging ich in das Büro des Zensus. Ich war lange dort und ich verließ es mit einem neuen Auftrag, einem neuen Beruf.
Meine Frau und ich wollten uns immer auf den Weg machen. Warum machen wir unsnicht auf den Weg?, sagte sie immer. Aber irgendwie kam es nie dazu. Auch wenn mein Sohn in gewissem Sinn der beste Grund war, sich auf den Weg zu machen, verhinderte er auch, dass wir uns auf den Weg machen konnten. Sei es, wie es sei, solange meine Frau lebte, hatten wir uns nicht auf den Weg gemacht, und konnten es auch nicht. Gleich nach ihrem Tod hatte ich allerdings das Gefühl, dass mir nichts anderes mehr übrig blieb, als mich auf den Weg zu machen. Es scheint, als wäre es mir bestimmt, einen Weg zu finden, und der Zensus war so eine Möglichkeit, ein klarer Pfad, der nirgendwohin führte und dann nirgendwohin und dann nirgendwohin und dann nirgendwohin. Plötzlich erschien es mir offensichtlich: Ich konnte Volkszähler werden und mein Sohn und ich würden uns auf den Weg machen und es gab keinerlei Hindernisse.
Ich holte meinen Sohn und wir gingen zum Haus, wir ließen das Haus hinter uns, wir machten uns auf den Weg.
Ich fühlte mich schwach. Allerdings fühlte ich mich seit Jahren schwach. Ich habe weitergemacht, habe weitergearbeitet, auch wenn ich vielleicht nicht mehr als Arzt hätte praktizieren sollen, weil ich meinem Sohn ein schönes Haus erhalten wollte, mit schönen Dingen. Seit seiner Geburt hatte sich mein Leben, das Leben meiner Frau um ihn gebogen wie ein Schild.
Er seinerseits lebte ohne Bedauern. Es ist schwer zu glauben, dass einem jemand, der ohne Bedauern lebt, etwas schuldet. Was man für diese Person tut, tut man für sich selbst, ist es nicht so?
Die Menschen kamen oft aus ihren Häusern, um uns zu begrüßen. An diesem ersten Tag, auf dem Land in der Nähe von B, passierten wir die Außengrenze des Kreises, der, so konnte man vermuten, schon erledigt war, der bereits abgearbeitet worden sein musste – ein Kreis, den ich im Büro auf einer mehrere hundert Fuß großen Karte gesehen hatte; wir hatten die Grenze überschritten – also war es Zeit zu beginnen. Ich bog von der Straße ab und rumpelte über einen schmalen Weg zu einem hohen Haus, einem Haus, das über einem einzelnen, lang gezogenen Feld thronte. Auf der anderen Seite lag ein See und dahinter war der Waldrand. Unser Auto machte beträchtlichen Lärm und das konnte man auch als Vorteil betrachten – zu keinem Zeitpunkt unserer Reise war unsere Ankunft für irgendjemanden eine Überraschung.
Wie gesagt, kamen sie zusammen aus dem Haus, ein Mann und eine Frau. Die Leute kommen recht schnell auf einen zu, nicht wahr? Und dann bleiben sie in der Entfernung stehen, die sie für sicher halten – aber es ist nie dieselbe Entfernung. Ich zeigte ihm meine Dokumente und der Mann lachte. Er zog sein Hemd hoch und zeigte mir die Markierungen. Das da, der neunte Zensus, und diese hier der achte, und das da der siebente. Beim sechsten und fünften war ich auf Erkundungstour – noch nicht mal in der Nähe, und beim vierten war ich noch nicht auf der Welt.
Auch seine Frau trug die Markierung und ich dankte ihnen; wir wollten uns schon auf den Weg machen, aber das ließen sie nicht zu. Wir sollten doch noch mit ihnen Tee trinken, und dabei lernte ich, wenn auch nicht direkt etwas über den Zensus selbst, so doch über das Geschäft des Zensus. Folgende Dinge gehörten dazu: mit einer Tasse am Fenster eines Bauernhauses sitzen und durch ein Fenster auf einen lang gezogenen See schauen, wo sich eigentlich Vögel drängen müssten, auch wenn gerade keine zu sehen sind. In der Ferne ein schmaler Streifen des Mondes. Eine Wolke zog vorbei. Mein Sohn war im Nebenraum mit ein paar Dingen beschäftigt, die sie für ihn gefunden hatten, aber als ich meinen Tee ausgetrunken hatte, verabschiedeten wir uns und machten es uns wieder im Auto bequem.
Wie viele Besuche sollte man an einem Tag schaffen? Wie viele Meilen sollte man reisen? Bei dieser Art von Arbeit gibt es keine klaren Antworten. Wir gehen, wohin wir gehen können, tun, was wir tun können, und stellen sicher, dass unsere Kraft nicht schwindet. In dieser Nacht fanden wir ein Motel – in der Nebensaison stand es völlig leer. Ich kann euch nicht dazu zwingen zu bezahlen, sagte der Besitzer. Nicht wenn ihr im offiziellen Auftrag hier seid.
Er war der Erste, den ich tätowierte, indem ich die Markierung auf die korrekte Rippe setzte. So wussten wir, ob jemand schon gezählt worden war. Manche sagen, der Zensus sei barbarisch, und führen das als Beweis an. Aber hatte ich nicht selbst einem Volkszähler bei vergangenen Zählungen erlaubt, mich zu markieren, und meinen Sohn, und meine Frau?
Jeder Zensus hat seine eigene Form und muss auf der vereinbarten Rippe platziert werden. Kann sein, dass es hier eine Redundanz gibt, aber nicht jeder Volkszähler ist Arzt und vielleicht hatte man Angst davor, dass die falsche Rippe ausgewählt werden könnte. Ich denke, dass jeder Volkszähler dazu in der Lage sein sollte, die dritte oder vierte Rippe zu finden, aber gleichzeitig habe ich bei den Gesprächen, die ich als Bürger mit den Volkszählern geführt habe, die Erfahrung gemacht, dass es sich dabei oft um unachtsame Dummköpfe handelt. Meine Frau sagte immer, die machen das nur, weil sie sonst nichts zu tun haben, nichts, wonach sie streben. Dieser Scherz lastete schwer auf mir, als ich diesen Job annahm, weil er für mich eine Art Tod signalisierte. Würde ich den Zensus immer weiter hinaustragen? An welchem Punkt würde ich damit aufhören?
Gerhard Mutter, allem Anschein nach ein Mann, tatsächlich aber der Künstlername von Lotta Werter, die als Bürgermeisterin einer Stadt in der Nähe von Stuttgart ein öffentliches Amt bekleidete, schrieb zeit ihres Lebens zwanghaft über Kormorane. Für sie hatte alles mit diesen Tieren zu tun. Ganz gleich, welche Prinzipien sie tagtäglich entdeckte, alle waren sie mit diesen dunklen, flinken Augen, mit diesem flüsternden, wilden, ungreifbaren Eintauchen verschlungen. Es muss schrecklich sein, schreibt sie, wieder und wieder, in den immer gleichen Worten (sie verwendet immer wieder dieselben Sätze – bis es aufhört, ein Selbstplagiat zu sein und als Refrain betrachtet werden muss), es muss schrecklich sein, schreibt sie, ein Fisch zu sein und zu wissen, dass dich ein Kormoran im Blick hat. Nicht zu sterben ist schrecklich, meint sie. Es ist einfach schrecklich, belauert zu werden und der Gefahr damit hilflos ausgeliefert zu sein. Egal, wie weit der Fisch auch schwimmt, er kann sich nicht retten. Sobald der Fisch bemerkt wurde, bleibt ihm nur mehr ein Moment der Gnade, der, quälend langsam, durch das Bajonett des Schnabels beendet wird.
Als ich mich einem Haus auf der Hauptstraße sechs Meilen nach B näherte, beschlich mich das Gefühl, dass auch der Zensus eine Art von Lauer darstellt, und – sollte das der Fall sein – was ist dann der Schnabel, wann kommt der Schnabel ins Spiel, und was ist, unter Berücksichtigung des Schnabels, die Natur der gewährten Gnade? Lotta Werter war dafür bekannt, dass sie eine dunkle Fellmütze trug, die sie, nach allem, was bekannt war, niemals abnahm. Einer ihrer Biografen hat einen Witz festgehalten, den sie erzählte: Das ist meine Perücke oder Das ist eine Perücke oder Ich trage eine Art Perücke. Das sagte sie oft über ihre dunkle Fellmütze, die in Wahrheit eine aus einer ganzen Reihe von Fellmützen war, die sie in einem Geschäft in Stuttgart gekauft hatte. Offenbar handelte es sich immer um Seehundfell. Diese Tatsache wird auch durch eine Seite in den Gold-Teichen untermauert, wo sie schreibt: Der Seehund ist eine Entsprechung des Kormorans, aber wo sich der Kormoran in Geduld übt, ist der Seehund ständig damit beschäftigt, seinem Vergnügen nachzujagen, und er wird deshalb, im Lauf von tausend Jahren, verschwenderisch. Was ist nun aber die Bedeutung des Tragens dieser Seehundfellmütze? Eine revidierte Biografie zieht dies überhaupt in Zweifel. Offenbar gab es in Deutschland zu dieser Zeit gar keine Seehundfellmützen. Solche Mützen waren immer aus Nerz. Wie auch immer, es gibt jedenfalls ein Gemälde, das ich schon oft in der Staatsgalerie Stuttgart betrachtet habe, von einem Kormoran, der in einem Baum hockt, eingefroren in dieser unauslöschlichen Haltung. Der gewaltsame Akt des Kormorans ist in die Bäume und das Wasser eingeschrieben – eingeschrieben sogar, so könnte man sagen, in die Fische, die unten schwimmen.
Die Frau, die zur Tür kam, war ungefähr fünfunddreißig und trug ein weites, ärmelloses Kleid. Sie hieß meinen Sohn und mich willkommen und wir saßen wie drei Verschwörer in ihrem Salon, die Köpfe zusammengesteckt.
Wie kann es sein, dass drei Leute plötzlich miteinander lachen können, über alles, das gesagt wird? So waren wir – unerbittlich angezogen von zügelloser Freude –, um dann dankbar an ihren Rändern entlangzuwirbeln. Sie beantwortete meine Fragen. Sie war dem Zensus noch nie begegnet – ich war sein erster Bote, also markierte ich sie, bevor wir sie verließen. Sie öffnete ihr Kleid: etwas, das eine gewöhnliche Person vielleicht verwirren oder besorgen könnte, aber für mich, der ich Arzt gewesen war, war das ganz normal. Ich fand die Rippe und setzte die Markierung. Sie sagte etwas – sie erzählte eine Geschichte, und zwar davon, dass ihr Haus einst von einem Mann ausgeraubt worden war, den sie kannte. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Haus und stand hinter den Vorhängen. Als die Einbrecher durch die Räume gingen, Dinge an sich nahmen, redeten sie miteinander über das Haus und über sie. Sie kümmerte sich nicht um die Dinge, die die Einbrecher mitgehen ließen. Sie verfügte über eine Erbschaft und benötigte nicht viel. Alles, was sie benötigte, könnte sie sich wieder kaufen und der Aufwand würde ihr vielleicht sogar Freude bereiten. Aber, und darum ging es: Die Einbrecher reden zu hören, zu hören, wie sie ihre Sachen betrachteten und darüber sprachen – das fand sie entzückend. Sie sagte, dass sie beinahe laut losgelacht hätte.
Als der Mann sie den anderen beschrieb und sie sich vorstellen konnte, wie die Männer sie mit dem Haus und den Besitztümern in Verbindung brachten, überkam sie ein Kichern – sie hatte sich in diesem Schwellenraum wohl angemessen eingerichtet. Bis heute hat es mich nicht losgelassen, sagte sie. Als wir fortgingen, küsste sie meinen Sohn auf die Wange und umarmte mich ungestüm. Ich glaube, dass irgendwann einmal etwas Schreckliches mit ihrem rechten Arm geschehen sein muss, aber sie sprach nicht darüber. Auf den Fotografien neben der Tür war sie, wie sie es ausdrückte, eine Braut, und darauf bin ich eine Braut, und darauf eine Braut, und hier ein Kind und darauf eine Witwe. Aber du bist ja selbst Witwer, du erkennst mich auf diesem Bild, egal wie dunkel meine Kleidung ist.
Das ist ein Beispiel für den perfekten geistigen Gleichklang, in den wir drei gerieten. Ich musste nur durch die Tür treten, mich nur vorstellen und meine Papiere vorweisen, und dann passierte so etwas. Es wurde mir erst später klar – als wir schon wieder unterwegs waren, und ich über die Begegnung nachdachte –, aber während wir uns an ihrem Tisch im Salon zusammengekauert hatten, griff sie nach meiner Hand, und mich überkam kein Schauer, und mein Sohn, er umfasste ihren verkümmerten Arm. Es gibt nichts, das nicht natürlich sein kann.
Die unterschiedlichen Gegenden der Schweiz nennt man Kantone. Für mich hat das immer reizvoll geklungen. Als Kind dachte ich, was für erlesene Dinge müssen es sein, die sich in diesen Kantonen zutragen. So manch einer verfügt über eine seelische Verfassung – so wie ich –, der alles Fremde wundervoll, alles Heimische ermüdend erscheint. Ich habe beim Lesen oft versucht, die Welt mit den Augen derjenigen zu betrachten, für die noch das Vertrauteste Anlass endloser Tagträume ist. Ich weiß, dass das geht. Ich habe es so oft gesehen! Aber diese Wende – irgendwo ist da eine Wende, und ich kann diese Wende nicht nachvollziehen, wenn man mir nicht dabei hilft.
Meine Frau sagte immer, alles Fleisch setzt sich fort. Damit meinte sie, alles Fleischliche könne andere fleischliche Dinge spiegeln, könne auf bestimmte Art fühlen, was jenes fühlt, und dass es manchmal sogar möglich sei, jemand anderen von dem zu überzeugen, was man selbst fühlt.
Der Mauteintreiber an der Brücke von B nach C, er kannte sie, meine Frau. Ich konnte es kaum glauben. Er hatte sie auftreten gesehen. So war es dazu gekommen: Wir hielten den Wagen an und näherten uns dem Mauthäuschen zu Fuß, was im Nachhinein seltsam war und den Mauteintreiber sicherlich aufmerksam werden ließ. Trotzdem begann unsere Unterhaltung freundlich und ging auch so weiter. Ich erklärte, was wir taten. Als Mauteintreiber hatte er das Gefühl, wie er es ausdrückte, dass wir im gleichen Gewerbe waren, und er machte da gerne mit, auch wenn er manchmal unterbrechen musste, um die Maut einzuheben. Werdet ihr die auch ansprechen?, fragte er und bezog sich dabei auf die Passanten. Vielleicht besuchen wir sie in ihren Häusern, sagte ich. Und wenn sie weit weg wohnen? Wohin sie auch gehen, dort werden wir sie irgendwann auch finden. Wir haben keine Eile.
Ich zeigte ihm meine Papiere, auf denen er den Namen meiner Frau sah, der, und das stimmt, seltsam ist. Er sagte ihn laut, den Namen meiner Frau. Sie war meine Frau, sagte ich zu ihm.
Ja, aber war sie das? Ist sie …