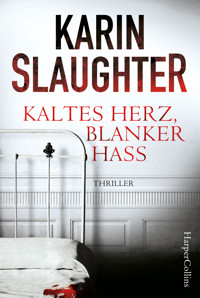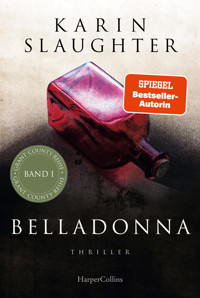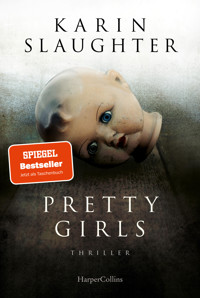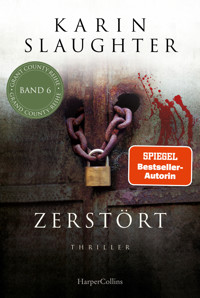
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grant-County-Serie
- Sprache: Deutsch
Reese, Georgia: In einem ausgebrannten Auto wird eine Leiche gefunden – und ausgerechnet Detective Lena Adams ist die Hauptverdächtige in der anschließenden Mordermittlung. Denn Lena ist in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, in einen Ort, der von Gewalt, Drogen und Lügen regiert wird und der sie vor vielen Jahren fast gebrochen hätte. Natürlich ist Chief Jeffrey Tolliver zur Stelle, um seiner besten, aber gefährlich labilen Ermittlerin zu helfen, aber seine Frau, die Ärztin und Gerichtsmedizinerin Sara Linton, braucht ebenfalls jede mögliche Unterstützung. Trotzdem begleitet sie Tolliver – doch beide müssen schnell feststellen, dass Lenas Fall bizarrer ist als angenommen. Bald finden sie sich im Kreuzfeuer wieder …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Eine Leiche in einem ausgebrannten Auto, unter Mordverdacht steht niemand Geringeres als Detective Lena Adams. Dann taucht eine zweite Leiche auf – in deren Rücken steckt Lenas Messer. Lena braucht Jeffrey Tollivers Hilfe. Dabei macht seine Frau, Gerichtsmedizinerin Sara Linton, gerade selbst die Hölle durch: Sie soll Schuld tragen am Tod eines Patienten. Sara schließt sich widerwillig Jeffreys Ermittlungen an, denn nur sie beide können Lena aus dem Netz an Lügen, das sie gefangen hält, befreien. Doch in Reese, Georgia, riskiert jeder, der sich einmischt, sein Leben …
Zur Autorin:
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen und Schöpferin von über 20 New-York-Times-Bestseller-Romanen. Dazu zählen Cop Town, der für den Edgar Allan Poe Award nominiert war, sowie die Thriller Die gute Tochter und Pretty Girls. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich über 40 Millionen Mal verkauft. Ihr internationaler Bestseller Ein Teil von ihr ist 2022 als Serie mit Toni Collette auf Platz 1 bei Netflix erschienen. Eine Adaption ihrer Bestseller-Serie um den Ermittler Will Trent ist derzeit eine erfolgreiche Fernsehserie, weitere filmische Projekte werden entwickelt. Slaughter setzt sich als Gründerin der Non-Profit-Organisation »Save the Libraries« für den Erhalt und die Förderung von Bibliotheken ein. Die Autorin stammt aus Georgia und lebt in Atlanta.
Karin Slaughter
Zerstört
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Klaus Berr
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Beyond Reach bei Bantam Dell, Random House, Inc., New York
© 2007 by Karin Slaughter
Ungekürzte Ausgabe im HarperCollins Taschenbuch
by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2009 für die deutschsprachige Ausgabe by Blanvalet Verlag München, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH
Die Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Klaus Berr liegen beim Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung von Slim Smith / Trevillion Images
E-Book Produktion von GGP Media Gmbh, Pößneck
ISBN 9783749907861
www.harpercollins.de
Barb, Sharon und Susan – danke für alles
Prolog
Was hatten sie ihr gegeben? Was hatten sie ihr mit dieser Nadel in die Venen gejagt? Die Augen konnte sie kaum offen halten, die Ohren waren dagegen überempfindlich. Durch ein lautes, durchdringendes Klingeln hindurch konnte sie einen Aussetzer des Automotors hören, das Pa-rump-parump der Reifen auf unebenem Gelände. Der Mann, der neben ihr auf dem Rücksitz saß, sprach leise, fast, als würde er einem Kind ein Schlaflied singen. Sein Tonfall hatte etwas Beruhigendes, und sie merkte, wie ihr der Kopf auf die Brust sank, während er redete, und sie ihn dann, bei Lenas knappen, schneidenden Erwiderungen, wieder hochriss.
Ihre Schultern schmerzten, weil sie die Arme verkrampft auf dem Rücken hielt. Es war ein dumpfes Pochen, das dem Hämmern ihres Herzens entsprach. Sie versuchte, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, auf das Gespräch zum Beispiel, das im Auto geführt wurde, oder darauf, wohin Lena das Auto steuerte. Stattdessen registrierte sie jedoch, dass sie sich fast wie eine Spirale in den eigenen Körper zurückzog, sich in jede neu aufkeimende Empfindung einhüllte wie ein kleines Kind in eine Kuscheldecke.
Die Rückseiten ihrer Schenkel brannten vom Leder des Autositzes, aber sie wusste nicht, warum. Draußen war es kühl. Im Nacken spürte sie sogar einen Zug. Sie erinnerte sich noch, wie sie einmal während einer langen Fahrt nach Florida in der Chevette ihres Vaters saß. Das Auto hatte keine Klimaanlage, und es war Mitte August. Alle vier Fenster waren geöffnet, doch die Hitze blieb unerträglich. Das Radio knisterte. Es lief keine Musik, denn es gab keinen Sender, auf den sie sich alle hätten einigen können. Vorne stritten sich die Eltern über die Fahrtroute, die Benzinkosten, darüber, ob sie zu schnell fuhren oder auch nicht. Hinter Opelika sagte dann ihre Mutter zu ihrem Vater, er solle an einem Laden anhalten, damit sie sich eisgekühlte Cokes und Orangenkekse kaufen konnten. Dann erschraken alle, als sie aussteigen wollten, denn die Haut ihrer Arme und Beine klebte an den Sitzen, als hätte die Hitze ihre Körper mit dem Vinyl verschmolzen.
Jetzt spürte sie, wie das Auto ruckelte, als Lena die Automatikschaltung auf Parken stellte. Der Motor lief noch, und das leise Surren vibrierte in ihren Ohren.
Da war noch etwas – nicht im Auto, sondern weiter entfernt. Der Wagen stand auf einem Sportplatz. Sie erkannte die Anzeigentafel, riesige Buchstaben schrien: »Go, Mustangs!«
Lena hatte sich umgedreht und starrte sie beide an. Der Mann neben ihr bewegte sich. Er steckte seine Waffe in den Bund seiner Hose. Er trug eine Skimaske, wie man sie aus Horrorfilmen kennt, nur die Augen und der Mund waren zu sehen. Doch das reichte aus. Sie kannte ihn, könnte seinen Namen sagen, wenn nur ihr Mund sich bewegen würde.
Der Mann sagte, dass er Durst habe, und Lena reichte ihm einen großen Styroporbecher. Das Weiß des Bechers war intensiv, fast blendend. Plötzlich verspürte auch sie Durst wie noch nie in ihrem Leben. Allein der Gedanke an Wasser trieb ihr die Tränen in die Augen.
Lena versuchte ihr etwas mitzuteilen, ohne die Stimme zu benutzen.
Plötzlich rutschte der Mann über den Rücksitz, kam ihr so nahe, dass sie die Hitze seines Körpers spüren, den herben Geruch seines Rasierwassers riechen konnte. Sie fühlte, wie seine Hand sich um ihren Nacken legte, seine Finger dort verweilten. Die Berührung war weich und sanft. Sie konzentrierte sich auf seine Stimme, wusste, dass wichtig war, was gesagt wurde, dass sie unbedingt zuhören musste.
»Haust du jetzt ab?«, fragte der Mann Lena. »Oder willst du lieber hierbleiben und dir anhören, was ich zu sagen habe?«
Lena hatte sich von ihnen abgewandt, vielleicht hatte sie die Hand am Türgriff. Jetzt drehte sie sich wieder um und sagte: »Reden Sie.«
»Wenn ich dich hätte umbringen wollen«, sagte er, »wärst du schon tot. Das weißt du.«
»Ja.«
»Deine Freundin hier …« Er sagte noch etwas, aber seine Wörter verschmolzen irgendwie miteinander, und als sie ihre Ohren erreichten, hatten sie keine Bedeutung mehr. Sie konnte nur Lena ansehen und an der Reaktion der anderen Frau abschätzen, wie ihre eigene sein sollte.
Angst. Sie sollte sich fürchten.
»Tun Sie ihr nichts«, flehte Lena. »Sie hat Kinder. Ihr Mann …«
»Ja, es ist traurig. Aber man muss seine Wahl treffen.«
»Sie nennen das eine Wahl?«, zischte Lena. Es kam noch mehr, aber alles, was sie erreichte, war Entsetzen. Der Wortwechsel ging noch weiter, dann spürte sie plötzlich Kälte auf ihrem Körper. Ein vertrauter Geruch erfüllte das Auto – schwer und stechend. Sie wusste, was es war. Sie hatte es schon einmal gerochen, aber ihr Verstand konnte ihr nicht sagen, wo und wann.
Die Tür ging auf. Der Mann stieg aus, stand dann da und sah sie an. Er wirkte weder traurig noch aufgeregt, sondern einfach resigniert. Sie hatte diesen Blick schon einmal gesehen. Sie kannte ihn – kannte die kalten Augen hinter der Maske, die feuchten Lippen. Sie kannte ihn schon ihr ganzes Leben lang.
Was war das nur für ein Geruch? Sie konnte sich an diesen Geruch genau erinnern.
Er murmelte ein paar Worte. Etwas blitzte in seiner Hand auf – ein silberfarbenes Feuerzeug.
Jetzt begriff sie. Die Panik jagte Adrenalin durch ihren Körper, das den Nebel durchschnitt und ihr direkt ins Herz stach.
Feuerzeugbenzin. Der Becher hatte Feuerzeugbenzin enthalten. Er hatte es über ihren Körper gegossen. Sie war damit durchtränkt – sie triefte.
»Nein!«, schrie Lena und versuchte mit gespreizten Fingern über die Rückenlehne hinweg dazwischenzugehen.
Das Feuerzeug fiel ihr in den Schoß, die Flamme entzündete die Flüssigkeit, die Flüssigkeit verbrannte ihre Kleidung. Ein entsetzliches Kreischen war zu hören – es kam aus ihrer eigenen Kehle, während sie hilflos dasaß und zusah, wie die Flammen an ihrem Körper emporleckten. Ihre Arme schnellten in die Höhe, Zehen und Füße krümmten sich nach innen wie bei einem Baby. Noch einmal dachte sie an diese längst vergangene Fahrt nach Florida, die erschöpfende Hitze, den scharfen, unerträglichen Biss des Schmerzes, als ihr Fleisch mit dem Sitz verschmolz.
Montagnachmittag
1
Sara Linton blickte auf ihre Armbanduhr. Die Seiko war ein Geschenk ihrer Großmutter zu ihrer bestandenen Abschlussprüfung an der Highschool gewesen. Als Granny Emma selbst die Schule abgeschlossen hatte, lagen noch vier Monate bis zu ihrer Hochzeit vor ihr, eineinhalb Jahre bis zur Geburt ihres ersten von sechs Kindern und achtunddreißig Jahre bis zum Verlust ihres Mannes an den Krebs. Höhere Bildung war etwas, das Emmas Vater als Geld- und Zeitverschwendung betrachtet hatte, vor allem bei einer Frau. Emma hatte deswegen nicht gestritten – sie war in einer Zeit aufgewachsen, in der Kinder nicht einmal daran dachten, ihren Eltern zu widersprechen –, aber sie hatte dafür gesorgt, dass die vier ihrer Kinder, die überlebten, aufs College gingen.
»Trag sie, und denk an mich«, hatte Granny Emma gesagt, während sie das silberfarbene Uhrenarmband an Saras Handgelenk befestigte. »Du wirst alles schaffen, wovon du träumst, und du sollst wissen, dass ich immer bei dir sein werde.«
Als Studentin an der Emory University hatte Sara ständig auf die Uhr geschaut, vor allem in den Vorlesungen über Biochemie, angewandte Genetik und menschliche Anatomie, die anscheinend per Gesetz von den langweiligsten und einsilbigsten Professoren, die es gab, gehalten werden mussten. Während des Medizinstudiums dann hatte sie ungeduldig auf diese Uhr geblickt, wenn sie am Samstagvormittag vor dem Labor stand und wartete, dass der Professor kam und die Tür aufschloss, damit sie ihr Experiment abschließen konnte. In ihrer Zeit als Assistenzärztin am Grady Hospital hatte sie das weiße Zifferblatt mit verquollenen Augen angestarrt und versucht, die Zeigerstellung zu erkennen, damit sie wusste, wie viel von ihrer Sechsunddreißig-Stunden-Schicht noch vor ihr lag. In der Heartsdale Children’s Clinic hatte sie den Sekundenzeiger nicht aus den Augen gelassen, während sie die Finger aufs dünne Handgelenk eines Kindes drückte, die Herzschläge zählte, die unter der Haut pochten, und herauszufinden versuchte, ob ein »Mir tut alles weh« eine ernsthafte Krankheit bedeutete oder nur, dass das Kind an diesem Tag nicht in die Schule gehen wollte.
Seit fast zwanzig Jahren trug Sara nun diese Uhr. Das Glas war zweimal ausgetauscht worden, die Batterie noch öfter, und einmal sogar das Armband, weil Sara den Gedanken nicht ertragen konnte, das getrocknete Blut einer Frau, die in ihren Armen gestorben war, nicht vollständig entfernen zu können. Auch bei Granny Emmas Begräbnis hatte Sara sich dabei ertappt, wie sie das glatte Gehäuse um das Glas herum berührte, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen und ihr bewusst wurde, dass sie nun nie mehr das schnelle, offene Lächeln und den funkelnden Blick ihrer Großmutter sehen würde, wenn sie von den neuesten Großtaten ihrer ältesten Enkelin erfuhr.
Als sie nun auf die Uhr schaute, war Sara zum ersten Mal in ihrem Leben froh, dass ihre Großmutter nicht bei ihr war, nicht den Zorn in Saras Augen sehen und die Demütigung spüren konnte, die in ihrer Brust brannte wie ein unkontrollierbares Feuer, während sie in einem Gerichtssaal saß und unter Eid in einem Kunstfehlerprozess aussagen musste, den die Eltern eines toten Patienten gegen sie angestrengt hatten. Alles, wofür Sara je gearbeitet hatte, jeder Schritt, der ihrer Großmutter noch unmöglich gewesen war, den sie aber getan hatte, jede Leistung, jedes Diplom wurde bedeutungslos gemacht von einer Frau, die Sara als Kindsmörderin bezeichnete.
Die gegnerische Anwältin beugte sich über den Tisch und starrte mit erhobenen Augenbrauen und gespitzten Lippen herüber, als Sara auf die Uhr schaute. »Dr. Linton, haben Sie eine dringendere Verpflichtung?«
»Nein.« Sara versuchte, mit ruhiger Stimme zu sprechen, die Wut zu unterdrücken, die die Anwältin in den letzten vier Stunden ganz offensichtlich in ihr zu schüren versucht hatte. Sara wusste, dass sie manipuliert werden sollte, dass die Frau versuchte, sie zu ködern, sie zu einer unbedachten Aussage zu verleiten, die dann von dem kleinen Protokollführer, der sich in der Ecke über seinen Laptop beugte, für alle Ewigkeit aufgezeichnet werden würde.
»Ich habe Sie jetzt die ganze Zeit Dr. Linton genannt.« Die Anwältin las in der Akte, die aufgeschlagen vor ihr lag.
»Sollte es nicht Dr. Tolliver heißen? Ich sehe, dass Sie vor sechs Monaten Ihren Ex-Gatten, Jeffrey Tolliver, ein zweites Mal geheiratet haben.«
»Linton ist schon richtig.« Unter dem Tisch schlenkerte Sara den Fuß so heftig, dass sie beinahe ihren Schuh verloren hätte. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr Unterkiefer schmerzte, weil sie die Zähne so fest zusammenbiss. Eigentlich sollte sie gar nicht hier sein. Sie sollte jetzt zu Hause sein und ein Buch lesen oder mit ihrer Schwester telefonieren. Sie sollte Patientenakten studieren oder alte medizinische Fachzeitschriften sortieren, zu deren Lektüre sie nie ausreichend Zeit fand.
Sie sollte vertrauenswürdig sein.
»Nun gut«, fuhr die Anwältin fort. Die Frau hatte zu Beginn der Anhörung ihren Namen genannt, aber Sara hatte ihn vergessen. Das Einzige, worauf sie sich zu der Zeit hatte konzentrieren können, war der Ausdruck auf Beckey Powells Gesicht gewesen. Jimmys Mutter. Die Frau, deren Hand Sara so oft gehalten hatte, die Freundin, die sie getröstet hatte, die Person, mit der sie unzählige Stunden telefoniert und dabei versucht hatte, in allgemein verständliche Sprache zu übersetzen, was die Onkologen in Atlanta der Mutter in Fachchinesisch an den Kopf warfen, um ihr zu erklären, warum ihr zwölfjähriger Sohn würde sterben müssen.
Von dem Augenblick an, als sie den Saal betreten hatten, hatte Beckey Sara angestarrt, als sei sie eine Mörderin. Der Vater des Jungen, ein Mann, mit dem Sara zur Schule gegangen war, hatte es nicht geschafft, ihr in die Augen zu schauen.
»Dr. Tolliver?«, fragte die Anwältin noch einmal.
»Linton«, korrigierte Sara, und die Frau lächelte, wie immer, wenn sie gegen Sara einen Punkt gemacht hatte. Das passierte so oft, dass Sara schon versucht war, die Anwältin zu fragen, ob sie an einer ungewöhnlich lächerlichen Form des Tourette-Syndroms leide.
»Am Morgen des Siebzehnten – das war der Tag nach Ostern – erhielten Sie die Laborergebnisse der Blastzellenanalyse, die Sie für James Powell in Auftrag gegeben hatten. Ist das korrekt?«
James. Sie ließ ihn so erwachsen klingen. Für Sara würde er immer der Sechsjährige bleiben, den sie vor so vielen Jahren kennengelernt hatte, der kleine Junge, der gerne mit seinen Plastikdinosauriern spielte und hin und wieder mal eine Malkreide verschluckte. Er war so stolz gewesen, als er ihr erzählte, er heiße Jimmy, so wie sein Dad.
»Dr. Tolliver?«
Buddy Conford, einer von Saras Anwälten, ergriff endlich das Wort. »Lassen wir doch den Blödsinn, Honey.«
»Honey?«, wiederholte die Anwältin. Sie hatte eine dieser heiseren, tiefen Stimmen, die die meisten Männer unwiderstehlich finden. Sara merkte, dass Buddy zu dieser Sorte gehörte, sie merkte aber auch, wie die Tatsache, dass der Mann seine Gegnerin begehrenswert fand, seine Streitlust verstärkte.
Buddy lächelte, weil nun er einen Punkt gemacht hatte.
»Bitte weisen Sie Ihre Mandantin an, die Frage zu beantworten, Mr. Conford.«
»Ja«, antwortete Sara, bevor die beiden noch weitere Sticheleien austauschen konnten. Sie hatte festgestellt, dass Anwälte bei dreihundertfünfzig Dollar pro Stunde ziemlich wortreich sein konnten. Wenn die Uhr tickte, würden sie sogar die Definition des Wortes »Definition« hinterfragen. Und Sara hatte zwei Anwälte: Melinda Stiles war die rechtliche Vertreterin der Global Medical Indemnity, einer Versicherungsgesellschaft, an die Sara im Verlauf ihrer medizinischen Karriere fast dreieinhalb Millionen Dollar gezahlt hatte. Buddy Conford war Saras persönlicher Anwalt, den sie engagiert hatte, damit er sie vor der Versicherungsgesellschaft beschützte. Das Kleingedruckte in den Kunstfehlerpolicen der Versicherung schränkte die Haftbarkeit der Gesellschaft ein, wenn die Schädigung eines Patienten die direkte Folge einer bewussten Leichtfertigkeit des Arztes war. Buddy war hier, um dafür zu sorgen, dass es dazu nicht kam.
»Dr. Linton? Der Morgen des Siebzehnten?«
»Ja«, antwortete Sara. »Nach meinen Unterlagen erhielt ich an diesem Morgen die Laborergebnisse.«
Sharon, fiel Sara jetzt wieder ein. Die Anwältin hieß Sharon Connor. So ein harmloser Name für eine so grässliche Person.
»Und was haben die Laborergebnisse Ihnen gezeigt?«
»Dass Jimmy mit großer Wahrscheinlichkeit an akuter lymphatischer Leukämie litt.«
»Und die Prognose?«
»Das fällt nicht in mein Gebiet. Ich bin keine Onkologin.«
»Nein. Sie überwiesen die Powells an einen Onkologen, einen Freund von Ihnen aus dem College, einen Dr. William Harris in Atlanta?«
»Ja.« Der arme Bill. Auch sein Name tauchte in dem Verfahren auf, auch er hatte einen Anwalt engagieren müssen und stritt sich jetzt mit seiner Versicherungsgesellschaft.
»Aber Sie sind Ärztin?«
Sara atmete einmal tief durch. Buddy hatte ihr eingeschärft, nur auf Fragen zu reagieren, nicht auf spitze Kommentare. Sie bezahlte ihm bei Gott genug für seinen Rat. Da konnte sie ja jetzt anfangen, ihn zu befolgen.
»Und als Ärztin wissen Sie doch sicher, was eine akute Myelodysplasie ist?«
»Darunter versteht man eine Gruppe maligner Erkrankungen, für die es charakteristisch ist, dass normales Knochenmark durch abnormale Zellen ersetzt wird.«
Connor lächelte und rasselte die Fachterminologie herunter. »Und es beginnt mit einer einzelnen, somatischen, hämatopoetischen Progenitorzelle, die sich in eine Zelle verwandelt, die zu normaler Differenzierung nicht mehr in der Lage ist?«
»Die Zelle verliert die Fähigkeit zur Apoptose.«
Noch ein Lächeln, wieder ein Punkt für die Anwältin.
»Und bei dieser Krankheit gibt es eine fünfzigprozentige Überlebenschance.«
Sara schwieg, wartete, dass die Axt heruntersauste.
»Und das Timing ist von grundlegender Bedeutung für die Behandlung, ist das korrekt? Bei einer solchen Krankheit – einer Krankheit, bei der die Zellen des Körpers sich buchstäblich gegen sich selbst wenden, die Apoptose abschalten, wie Sie es nennen, was der normale genetische Prozess des Zelltodes ist – ist das Timing von grundlegender Bedeutung.«
Achtundvierzig Stunden hätten dem Jungen das Leben nicht gerettet, aber Sara hatte nicht vor, das laut auszusprechen, wollte nicht, dass es in einem juristischen Dokument protokolliert wurde, nur damit Sharon Connor es ihr später mit all der Gefühllosigkeit, die sie aufbringen konnte, ins Gesicht schleuderte.
Die Anwältin blätterte in einigen Papieren, als suche sie ihre Notizen. »Und Sie studierten an der Emory Medical School. Und wie Sie mich zuvor so freundlich korrigierten, gehörten Sie nicht nur zu den besten zehn Prozent Ihres Jahrgangs, sondern schlossen Ihr Studium als Sechstbeste Ihrer Klasse ab.«
Buddy klang, als würden ihn die Mätzchen der Frau langweilen. »Dr. Lintons Qualifikationen und Referenzen haben wir doch bereits hinreichend diskutiert.«
»Ich versuche mir nur ein Bild zu machen«, entgegnete die Frau. Sie hielt eins der Blätter in die Höhe und überflog die Zeilen. Schließlich legte sie es wieder weg. »Und, Dr. Linton, Sie bekamen diese Information – diese Laborergebnisse, die so gut wie sicher einem Todesurteil gleichkamen – am Morgen des Siebzehnten, und dennoch hielten Sie es nicht für nötig, den Eltern die Information sofort mitzuteilen, sondern erst zwei Tage später. Und zwar, weil …?«
Sara hatte noch nie so viele Sätze gehört, die mit dem Wörtchen »Und« anfingen. Sie nahm an, dass Grammatik im Lehrplan der Fakultät, die diese fiese Anwältin hervorgebracht hatte, keinen sehr großen Stellenwert eingenommen hatte. Dennoch antwortete sie: »Sie waren in Disney World, um Jimmys Geburtstag zu feiern. Ich wollte, dass sie diesen Ausflug genossen, weil ich glaubte, dass es für eine ziemlich lange Zeit der letzte gemeinsame Familienausflug sein würde. Ich traf deshalb die Entscheidung, es ihnen erst bei ihrer Rückkehr zu sagen.«
»Sie kamen am Abend des Siebzehnten zurück, aber Sie sagten es ihnen erst am Morgen des neunzehnten, zwei Tage später.«
Sara öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber die Frau schnitt ihr das Wort ab.
»Und Ihnen kam nie der Gedanke, dass sie für eine sofortige Behandlung zurückkehren und so vielleicht das Leben ihres Kindes retten könnten?« Es war klar, dass sie keine Antwort erwartete. »Ich könnte mir vorstellen, dass die Powells, wenn sie die Wahl hätten, heute ihren lebendigen Sohn den Fotos von ihm, wie er im Magic Kingdom herumsteht, vorziehen würden.« Sie schob das fragliche Foto über den Tisch. Es glitt an Beckey und Jim Powell und an Saras beiden Anwälten vorbei und blieb wenige Zentimeter vor Sara liegen.
Sie hätte nicht hinschauen sollen, aber sie tat es.
Der kleine Jimmy drückte sich an seinen Vater, beide trugen Micky-Maus-Ohren und hielten Wunderkerzen in der Hand. Hinter ihnen marschierte eine Parade von Schneewittchens Zwergen. Sogar auf dem Foto sah man, dass der Junge krank war. Seine Augen waren dunkel umrandet, und er war so dünn, dass sein zartes Ärmchen aussah wie ein Stück Seil.
Sie waren einen Tag früher von dem Ausflug zurückgekehrt, weil Jimmy lieber zu Hause sein wollte. Sara wusste nicht, warum die Powells sie nicht angerufen oder Jimmy noch am selben Tag in die Klinik gebracht hatten, damit sie ihn untersuchen konnte. Vielleicht hatten seine Eltern auch ohne die Testergebnisse, auch ohne die endgültige Diagnose gewusst, dass die Zeit, in der sie ein normales, gesundes Kind hatten, vorüber war. Vielleicht hatten sie ihn nur noch für einen letzten Tag bei sich behalten wollen. Er war so ein wunderbarer Junge gewesen: liebenswürdig, intelligent, fröhlich – alles, was Eltern sich erhoffen konnten. Und jetzt war er nicht mehr da.
Sara spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen, und sie biss sich auf die Lippe, damit die Tränen vor Schmerz und nicht vor Kummer rollten.
Buddy schnappte sich verärgert das Foto. Er schob es Sharon Connor wieder zurück. »Sie können Ihr nächstes Eröffnungsplädoyer auch zu Hause vor dem Spiegel einstudieren, Sweatheart.«
Connors Mund verzerrte sich zu einem Grinsen, als sie das Foto wieder an sich nahm. Sie war der lebende Beweis dafür, dass die Theorie, nach der Frauen fürsorgliche Brutpflegerinnen waren, absoluter Blödsinn war. Sara erwartete beinahe, verfaulendes Fleisch zwischen ihren Zähnen zu sehen.
Die Frau sagte: »Dr. Linton, an diesem speziellen Tag, dem Tag, an dem Sie James’ Laborergebnisse erhielten, passierte da sonst noch etwas, das Sie besonders beschäftigte?«
Sara spürte ein Prickeln am Rückgrat, ein warnendes Kribbeln, das sie nicht unterdrücken konnte. »Ja.«
»Und können Sie uns sagen, worum es sich dabei handelte?«
»In der Toilette unseres örtlichen Diners fand ich eine Frau, die ermordet worden war.«
»Vergewaltigt und ermordet. Ist das korrekt?«
»Ja.«
»Das bringt uns zu Ihrer Nebenbeschäftigung als Coroner für unser County. Ich glaube, Ihr Ehemann – zum Zeitpunkt dieser Vergewaltigung und Ermordung noch Ihr Ex-Ehemann – ist der Polizeichef dieses Bezirks. Bei derartigen Fällen arbeiten Sie beide eng zusammen.«
Sara wartete auf mehr, aber die Frau hatte das offensichtlich nur gesagt, damit es ins Protokoll kam.
»Frau Kollegin?«, fragte Buddy.
»Einen Augenblick, bitte«, murmelte die Anwältin, nahm einen dicken Ordner zur Hand und blätterte ihn durch.
Sara schaute auf ihre Hände hinunter, um sich zu beschäftigen. Os pisiforme, Erbsenbein. Os triquetrum, Dreiecksbein. Os hamatum, Hakenbein. Os capitatum, Kopfbein. Os trapezoideum, kleines Vieleckbein. Os trapezium, großes Vieleckbein. Os lunatum, Mondbein. Os scaphoideum, Kahnbein … Sie zählte alle Knochen in ihrer Hand auf, damit sie nicht in die Falle tappte, die ihr die Anwältin so geschickt stellte.
Während Saras Assistenzzeit am Grady hatten Headhunter sie so gnadenlos verfolgt, dass sie nicht mehr ans Telefon gegangen war. Partnerschaften. Sechsstellige Gehälter mit Boni am Jahresende. Chirurgische Privilegien an jedem Krankenhaus ihrer Wahl. Persönliche Assistenten, Laborkapazitäten, voll ausgestattetes Sekretariat, sogar ein eigener Parkplatz. Sie hatten ihr alles angeboten, und doch hatte sie sich am Ende entschieden, nach Grant zurückzukehren, um für beträchtlich weniger Geld und noch weniger Achtung als Ärztin zu praktizieren, weil sie es wichtig fand, dass auch ländliche Gegenden medizinisch versorgt wurden.
War ein Teil davon auch Eitelkeit? Sara hatte sich selbst als Rollenmodell für die Mädchen der Stadt gesehen. Die meisten von ihnen kannten nur männliche Ärzte. Die einzigen Frauen, die etwas zu sagen hatten, waren Krankenschwestern, Lehrerinnen und Mütter. In ihren ersten fünf Jahren in der Heartsdale Children’s Clinic hatte sie fast die halbe Zeit damit zugebracht, junge Patienten – und oft auch ihre Mütter – davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich eine voll ausgebildete Ärztin war. Kein Mensch glaubte, dass eine Frau intelligent genug und gut genug sein konnte, um eine solche Position zu erreichen. Auch als Sara ihrem älteren Partner die Klinik abkaufte, als der in den Ruhestand ging, blieben die Leute skeptisch. Sie hatte Jahre gebraucht, um sich am Ort Respekt zu verschaffen.
Und jetzt das hier.
Sharon Connor schaute endlich von ihren Papieren hoch.
Sie runzelte die Stirn. »Dr. Linton, Sie wurden selbst auch Opfer einer Vergewaltigung. Oder etwa nicht?«
Sarah spürte, wie ihr Mund trocken wurde. Die Kehle wurde ihr eng, und die Haut brannte, während sie mit einer unangenehmen Scham kämpfte, die sie nicht mehr empfunden hatte, seit sie das letzte Mal von einem Anwalt nach ihrer Vergewaltigung befragt worden war. So wie damals bekam sie erst einen Tunnelblick, und dann verschwamm ihr alles vor Augen, sodass sie nichts mehr sah, nur noch die Wörter hörte, die ihr in den Ohren schrillten.
Buddy sprang auf, protestierte wütend und deutete mit dem Finger auf die Anwältin, die Powells. Melinda Stiles von Global Medical Indemnity, die neben ihm saß, sagte nichts. Buddy hatte Sara vorhergesagt, dass dies passieren würde, dass Stiles nur stumm dabeisitzen und zulassen würde, dass die Gegenseite Sara zerfleischte, dass sie nur den Mund aufmachen würde, wenn global eine Gefahr drohte. Noch eine Frau, noch ein misslungenes Rollenmodell.
»Und das will ich in dem gottverdammten Protokoll sehen!«, rief Buddy zum Abschluss und setzte sich so heftig, dass sein Stuhl vom Tisch wegrutschte.
»Notiert«, sagte Connor. »Dr. Linton?«
Saras Sicht wurde wieder klar. Es rauschte in ihren Ohren, als wäre sie unter Wasser geschwommen und plötzlich wieder aufgetaucht.
»Dr. Linton?«, wiederholte Connor. Sie benutzte weiterhin den Titel, doch bei ihr klang es wie etwas Böses, nicht wie etwas, wofür Sara ihr Leben lang gearbeitet hatte.
Sara schaute Buddy an, doch der zuckte nur die Achseln und schüttelte den Kopf. Er hatte prophezeit, dass diese Anhörung nichts als ein Fischen im Trüben sein würde, mit Saras Leben als Köder.
Connor sagte: »Doktor, brauchen Sie ein paar Minuten, um mit Ihren Gefühlen ins Reine zu kommen? Ich weiß, dass es Ihnen schwerfällt, über diese Vergewaltigung zu sprechen.« Sie deutete auf eine dicke Akte vor ihr auf dem Tisch. Es musste das Gerichtsprotokoll von Saras Fall sein. Die Frau hatte alles gelesen, kannte jedes widerliche Detail. »Wie ich gelesen habe, war der Angriff auf Sie äußerst brutal.«
Sara räusperte sich und zwang sich, nicht nur mit verständlicher, sondern auch starker und furchtloser Stimme zu sprechen. »Ja, das war er.«
Connors Ton wurde nun fast versöhnlich. »Ich habe früher im Büro des Bezirksstaatsanwalts in Baton Rouge gearbeitet. Ich kann ehrlich sagen, dass ich in meinen zwölf Jahren als Staatsanwältin noch nie etwas so Brutales und Sadistisches mitbekommen habe wie das, was Sie erlebt haben.«
Buddy blaffte: »Sweetheart, können Sie sich die Krokodilstränen abwischen und zu der Frage kommen?«
Die Anwältin zögerte einen Augenblick und fuhr dann fort: »Nur fürs Protokoll: Dr. Linton wurde in der Toilette des Grady Hospitals, wo sie als Assistentin in der Notaufnahme arbeitete, vergewaltigt. Offensichtlich drang der Täter über die Zwischendecke in die Damentoilette ein. Dr. Linton befand sich in einer der Kabinen, als er sich buchstäblich auf sie herabstürzte.«
»Notiert«, sagte Buddy. »Führt das zu einer Frage, oder halten Sie nur gerne Ansprachen?«
»Dr. Linton, die Tatsache, dass Sie brutal vergewaltigt wurden, hatte großen Einfluss auf Ihre Entscheidung, ins Grant County zurückzukehren, oder etwa nicht?«
»Es gab auch andere Gründe.«
»Aber würden Sie sagen, dass die Vergewaltigung der Hauptgrund war?«
»Ich würde sagen, das war einer von vielen Gründen für meine Entscheidung zur Rückkehr.«
»Führt das irgendwohin?«, fragte Buddy. Die Anwälte diskutierten wieder, und Sara versuchte, nicht zu zittern, als sie nach dem Wasserkrug auf dem Tisch griff und sich ein Glas einschenkte.
Sie spürte eher, als dass sie sah, wie Beckey Powell sich bewegte, und fragte sich, ob die Frau ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie Sara nun als menschliches Wesen sah und nicht als Monster. Sara hoffte es. Sie hoffte, dass Beckey sich an diesem Abend in ihrem Bett herumwerfen würde und erkannte, dass, gleichgültig, wie schlecht sie und ihre Anwältin Sara auch machten, nichts ihren Sohn zurückbringen würde. An der Tatsache, dass Sara alles für Jimmy getan hatte, was sie hatte tun können, war nicht zu rütteln.
»Dr. Linton?«, fuhr Connor fort. »Ich kann mir vorstellen, dass es angesichts der brutalen Vergewaltigung, die Sie selbst durchlitten haben, für Sie emotional eine ziemliche Qual gewesen sein muss, in diese Toilette zu gehen und eine Frau zu finden, die ebenfalls sexuell angegriffen worden war. Vor allem, da es fast auf den Tag genau zehn Jahre her war, dass Sie vergewaltigt wurden.«
»Ist das eine Frage?«, blaffte Buddy.
»Dr. Linton, Sie und Ihr Ex-Ehemann – verzeihen Sie, Ehemann – versuchen jetzt, ein Kind zu adoptieren, nicht wahr? Weil Sie als Folge dieser brutalen Vergewaltigung keine eigenen Kinder mehr bekommen können?«
Beckeys Reaktion war unmissverständlich. Zum ersten Mal seit Beginn dieser Anhörung konnte Sara die Frau in ihr sehen. Sie sah Beckeys Blick sanfter werden, ein Aufwallen des Mitgefühls für eine Freundin, aber diese Empfindung verschwand ebenso schnell, wie sie gekommen war, und Sara konnte den Vorwurf, der sie wieder auslöschte, beinahe lesen: Du hast kein Recht, Mutter eines Kindes zu sein, wo du meinen Sohn umgebracht hast.
Connor hielt ein vertraut aussehendes Dokument in die Höhe und sagte: »Doktor, Sie und Ihr Mann, Jeffrey Tolliver, haben vor drei Monaten beim Staat Georgia eine Adoption beantragt. Ist das korrekt?«
Sara versuchte sich zu erinnern, wann sie das Antragsformular ausgefüllt hatten, was sie gesagt hatten bei diesen staatlich verordneten Elternkursen, die in den letzten Monaten fast jede freie Minute ihrer Zeit beansprucht hatten. Was für Belastungsmaterial würde die Anwältin aus diesem endlosen, scheinbar harmlosen Prozedere herauspressen? Jeffreys hohen Blutdruck? Dass Sara eine Lesebrille brauchte? »Ja.«
Connor blätterte in einigen Papieren und sagte: »Einen Augenblick, bitte.«
Der Raum wurde winzig, luftlos. Es gab keine Fenster, keine Bilder an der Wand, die man hätte anstarren können. In einer Ecke stand eine sterbende Palme mit hängenden, traurigen Blättern. Dieses ganze Verfahren würde keinem etwas bringen. Kein Schuldspruch würde ein Kind zurückbringen. Und kein Freispruch würde einen ruinierten Ruf wiederherstellen.
Sara beschäftigte sich erneut mit der Anatomie ihrer Hand und betrachtete ihr Gelenke: Ligamenta metacarpalia dorsalia, stützende Bänder der Metakarpalgelenke. Ligamenta carpometacarpalia dorsalia, Verstärkungsbänder der Karpometakarpalgelenke. Ligamenta intercarpalia dorsalia, Flächenbänder an den dorsalen Flächen der Handwurzelknochen …
Sara hatte Jimmy in der Woche, bevor er starb, besucht, hatte stundenlang seine schwache, kleine Hand gehalten, während er stockend von Football und Skateboarding und all den Dingen erzählte, die er vermisste. Sara hatte ihn damals schon sehen können, den Blick des Todes in seinen Augen. Der Blick war das genaue Gegenteil dessen, was sie in den Augen seiner Mutter gelesen hatte, der Hoffnung, die Beckey Powell hatte, obwohl sie die Prognose kannte und zugestimmt hatte, die Behandlung abzubrechen, um Jimmys Leiden nicht zu verlängern. Diese Hoffnung war es, die Jimmy davon abgehalten hatte loszulassen, die Angst, die jedes Kind hatte, seine Mutter zu enttäuschen.
Sara war mit Beckey in die Cafeteria gegangen, hatte sich mit der verwirrten Frau in eine stille Ecke gesetzt und ihre Hand gehalten, wie wenige Augenblicke zuvor Jimmys. Sie hatte Beckey erläutert, wie es passieren, wie der Tod ihren Sohn holen würde. Seine Füße würden kalt werden, dann seine Hände, wenn der Kreislauf langsam herunterfuhr. Seine Lippen würden blau werden. Die Atmung würde unregelmäßig werden, aber das sollte man nicht als Zeichen des Leidens sehen. Er würde Schwierigkeiten beim Schlucken haben. Vielleicht würde er auch die Kontrolle über seine Blase verlieren. Seine Gedanken würden schweifen, aber Beckey dürfe nicht aufhören, mit ihm zu reden, ihn zu beschäftigen, weil er noch immer da sein würde. Er würde ihr Jimmy sein, bis zur allerletzten Sekunde. Es wäre ihre Aufgabe, ihm bei jedem Schritt zur Seite zu stehen, und dann – das Schwierigste von allem –, ihn ohne sie gehen zu lassen.
Sie müsse stark genug sein, um Jimmy gehen zu lassen.
Connor räusperte sich, um Saras Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen. »Sie haben den Powells nach Stellung der Diagnose weder die Labortests noch die Beratungsgespräche in Rechnung gestellt«, sagte sie. »Warum nicht, Dr. Linton?«
»Ich habe, um genau zu sein, keine eindeutige Diagnose gestellt«, korrigierte Sara und versuchte dabei, sich wieder zu konzentrieren. »Ich konnte ihnen nur sagen, was ich befürchtete, und sie an einen Onkologen verweisen.«
»Ihren Freund aus dem College, Dr. William Harris«, ergänzte die Anwältin. »Und auch die Labortests und die Gespräche, die auf diese Überweisung folgten, haben Sie den Powells nicht in Rechnung gestellt.«
»Um Abrechnungen kümmere ich mich nicht.«
»Aber Sie geben Ihrem Büro doch Anweisungen, oder etwa nicht?« Connor hielt einen Augenblick inne. »Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie unter Eid stehen?«
Sara verkniff sich die scharfe Erwiderung, die ihr auf der Zunge lag.
»Nach Aussage Ihrer Büroleiterin Nelly Morgan gaben Sie ihr den Auftrag, die knapp zweitausend Dollar, die die Powells Ihnen schuldeten, als Verlust abzuschreiben. Stimmt das?«
»Ja.«
»Warum, Dr. Linton?«
»Weil ich wusste, dass sie mit existenzbedrohenden Kosten für Jimmys Behandlung zu rechnen hatten. Ich wollte mich nicht in die Schlange der Gläubiger einreihen, von denen ich wusste, dass sie Forderungen stellen würden.« Sara sah Beckey an, doch die Frau wich ihrem Blick aus. »Darum geht es hier doch, oder? Laborrechnungen. Krankenhausrechnungen. Radiologen. Apotheker. Man schuldet den Leuten doch ein Vermögen, nicht?«
Connor sagte: »Dr. Linton, Sie sind hier, um meine Fragen zu beantworten, nicht, um eigene zu stellen.«
Sara beugte sich zu den Powells, versuchte, eine Verbindung zu ihnen herzustellen, sie zur Einsicht zu bringen. »Wisst ihr denn nicht, dass ihn das nicht zurückbringt? Nichts von alldem hier wird Jimmy je zurückbringen.«
»Mr. Conford, bitte weisen Sie Ihre Mandantin an …«
»Wisst ihr, was ich aufgegeben habe, um hier zu praktizieren? Wisst ihr, wie viele Jahre ich …«
»Dr. Linton, sprechen Sie meine Mandanten nicht direkt an.«
»Das ist der Grund, warum ihr nach Atlanta gehen und einen Spezialisten aufsuchen musstet«, fuhr Sara fort. »Diese Prozesse sind der Grund, warum das Krankenhaus geschlossen wurde, warum es im Umkreis von hundert Meilen nur fünf Ärzte gibt, die es sich leisten können, zu praktizieren.«
Sie schauten sie nicht an, reagierten nicht.
Sara lehnte sich erschöpft zurück. Es konnte hier nicht nur um Geld gehen. Beckey und Jimmy wollten mehr, eine Erklärung dafür, warum ihr Sohn gestorben war. Die traurige Tatsache aber war, dass es keine Erklärung gab. Menschen starben – Kinder starben –, und manchmal gab es niemanden, dem man die Schuld dafür geben konnte, gab es nichts, das den Tod aufhalten konnte. Und die Folge dieses Prozesses wäre, dass in einem Jahr oder in fünf Jahren ein anderes Kind krank, eine andere Familie unglücklich sein würde, und dass es dann niemanden mehr gäbe, der es sich leisten könnte, ihnen zu helfen.
Niemand würde da sein, um ihnen die Hand zu halten, ihnen zu erklären, was passierte.
»Dr. Linton«, setzte Sharon Connor erneut an. »Zu Ihrem Versäumnis, den Powells die Labortests und Gespräche in Rechnung zu stellen: Ist es nicht so, dass Sie sich schuldig fühlten an Jimmys Tod?«
Sie wusste, welche Antwort Buddy auf diese Frage von ihr hören wollte, wusste auch, dass Melinda Stiles, die Anwältin von Global Medical Indemnity, von ihr erwartete, das abzustreiten.
»Dr. Linton?«, fragte Connor nach. »Haben Sie sich schuldig gefühlt?«
Sara schloss die Augen, sah Jimmy in diesem Krankenhausbett liegen und über Skateboarding reden. Sie spürte noch seine Finger in ihrer Hand, während er ihr geduldig den Unterschied zwischen einem Hellflip und einem Ollie erklärte.
Articulationes interphalangeales, Zwischengliedergelenke.
Articulationes metacarpophalangeales, Finger-Grundgelenke. Capsula articulationis radioulnaris distalis …
»Dr. Linton?«
»Ja«, gab sie schließlich zu und ließ den Tränen freien Lauf.
»Ja. Ich habe mich schuldig gefühlt.«
Sara fuhr durch die Innenstadt von Heartsdale, der Tacho ihres BMW335ci zeigte kaum fünfundzwanzig Meilen. Sie fuhr am Discounter vorbei, am Bekleidungsgeschäft, am Eisenwarenladen. Vor Burgess’s Cleaners blieb sie mitten auf der leeren Straße stehen und überlegte sich, ob sie weiterfahren sollte oder nicht.
Vor ihr standen die Tore des Grant Institute of Technology offen. Als Kobolde oder Superhelden verkleidete Studenten kamen die Auffahrt herunter. Halloween war bereits in der letzten Nacht gewesen, aber die Studenten des Grant Tech neigten dazu, aus jedem Feiertag eine wochenlange Sause zu machen. Sara hatte sich dieses Jahr nicht einmal die Mühe gemacht, Süßigkeiten zu kaufen. Sie wusste, dass keine Mutter und kein Vater ihrem Kind erlauben würde, an ihre Tür zu klopfen. Seit Eröffnung dieses Kunstfehlerprozesses ächtete die ganze Stadt sie. Sogar Patienten, die sie jahrelang behandelt hatte, Leute, denen sie wirklich geholfen hatte, wichen im Supermarkt oder in der Apotheke ihrem Blick aus. In Anbetracht dieser Atmosphäre hatte Sara es für nicht sonderlich klug gehalten, ihr gewohntes Hexenkostüm anzuziehen und zur Kirchenparty zu gehen, wie sie es die letzten sechzehn Jahre gemacht hatte. Sara war im Grant County geboren und hier aufgewachsen. Sie wusste, dass dies eine Stadt war, die Hexen verbrannte.
Achteinhalb Stunden hatte sie in der Anhörung verbracht, und jeder Aspekt ihres Lebens war durchleuchtet worden. Über hundert Eltern hatten Freigabeerklärungen unterschrieben, damit die Krankenakten ihrer Kinder von Sharon Connor durchgekämmt werden konnten, und die meisten hatten gehofft, dass am Ende des Prozesses vielleicht auch Geld für sie herausspringen könnte. Melinda Stiles, die sich erstaunlich hilfsbereit gezeigt hatte, nachdem die Zeugen den Raum verlassen hatten, erklärte ihr, das komme ziemlich häufig vor. Ein Kunstfehlerprozess mache aus Patienten Geier, erläuterte sie, und es könne passieren, dass im Verlauf des Powell-Prozesses noch mehr anfingen, über ihrem Kopf zu kreisen. Die Leute von Global Medical Indemnity würden alles durchrechnen, die Verluste gegen die Stärke von Saras Verteidigung abwägen und dann entscheiden, ob sie sich auf einen Vergleich einlassen würden oder nicht.
In diesem Fall wäre all das – die Demütigung, die Erniedrigung – völlig sinnlos.
Einer der Collegestudenten auf der Straße schrie, und Sara erschrak und rutschte mit dem Fuß von der Bremse. Es war ein junger Mann, der ein Chiquita-Bananen-Kostüm trug, einschließlich einer blauen Caprihose und eines Wickeltops, das einen haarigen, runden Bauch zeigte. Wäre Jimmy Powell auch ein so alberner junger Mann geworden? Wenn er weitergelebt hätte, hätte er die gebeugte Haltung und den mageren Körperbau seines Vaters bekommen oder das rundliche Gesicht und die fröhliche Art seiner Mutter? Sara wusste, dass er Beckeys schnelle Auffassungsgabe gehabt hatte und ihren Hang zu derben Späßen und schlechten Witzen. Alles andere würde kein Mensch je erfahren.
Sara bog nach links auf den Parkplatz der Klinik ein. Der Parkplatz ihrer Klinik, die sie vor etlichen Jahren von Dr. Barney gekauft und für die sie in der ganzen Zeit nebenbei als Coroner gearbeitet hatte, damit sie sich diesen Arbeitsplatz überhaupt leisten konnte. Das Schild war ausgebleicht, die Treppe brauchte einen neuen Anstrich, und die Seitentür klemmte an warmen Tagen, aber die Klinik gehörte ihr. Ihr allein.
Sie stieg aus und schloss die Vordertür mit ihrem Schlüssel auf. Letzte Woche hatte sie die Klinik geschlossen, aus Wut über die Patienten, die Freigabeerklärungen unterzeichnet hatten, weil sie hofften, abkassieren zu können, aus Wut über die Stadt, die sie verraten hatte. Sie sahen in Sara nichts anderes als einen Goldesel, als wäre sie nichts als ein Schlüssel, der ihnen den Zugriff auf die Millionen in den Truhen der Versicherungsgesellschaft ermöglichte. Keiner bedachte die Konsequenzen dieses Zertrümmerns und Abkassierens, die Tatsache, dass die Prämien für Kunstfehlerversicherungen in die Höhe schnellen würden, dass Ärzte ihre Praxen aufgeben müssten, dass Gesundheitsversorgung, die für viele bereits jetzt unerschwinglich war, sehr bald für die allermeisten unerreichbar sein würde. Keiner kümmerte sich um die Lebensentwürfe, die er oder sie auf ihrem Weg zum Millionärsdasein zerstörte.
Sollten sie doch darüber nachdenken, während sie eineinhalb Stunden nach Rollings fuhren, der nächsten Stadt mit einem Kinderarzt.
Sara ließ die Lichter aus, als sie durch die Lobby der Klinik ging. Trotz der kühlen Oktoberluft war das Gebäude warm, und sie zog ihre Kostümjacke aus und legte sie auf die Empfangstheke, bevor sie zum Waschraum ging.
Das Wasser aus dem Hahn war eiskalt, und Sara beugte sich über das Becken, um ihr Gesicht zu bespritzen, den Dreck abzuwaschen, der ihr die Haut verklebte. Sie wollte ein langes Bad und ein Glas Wein, aber das waren Dinge, die sie nur zu Hause bekommen konnte, und im Augenblick wollte sie nicht nach Hause. Sie wollte allein sein, ihr Selbstwertgefühl wiederfinden. Gleichzeitig wünschte sie sich zu ihren Eltern, die in diesem Augenblick irgendwo in Kansas waren, genau in der Mitte ihres seit Langem geplanten Trips quer durch Amerika. Tessa, ihre Schwester, war in Atlanta und nutzte dort endlich ihren Collegeabschluss, indem sie Obdachlose beriet. Und Jeffrey … Jeffrey war zu Hause und wartete, dass Sara von der Anhörung zurückkehrte und ihm erzählte, was alles passiert war. Vor allem mit ihm wollte sie jetzt zusammen sein, und andererseits wollte sie ausgerechnet ihn überhaupt nicht sehen.
Sie starrte ihr Spiegelbild an und bemerkte schockiert, dass sie sich nicht mehr erkannte. Ihre Haare waren straff am Hinterkopf zusammengefasst, und sie wunderte sich beinahe, dass diese keinen Belastungsbruch erlitten hatten. Vorsichtig zog sie das Band heraus und zuckte vor Schmerz zusammen, weil sie dabei einige Haare ausriss. Ihre gestärkte weiße Bluse zeigte ein paar Wasserflecken, aber Sara war es egal. Sie kam sich lächerlich vor in diesem Kostüm, das wahrscheinlich das teuerste Kleidungsstück war, das sie je besessen hatte. Buddy hatte darauf bestanden, dass sie sich den schwarzen Stoff perfekt maßschneidern ließ, damit sie bei der Anhörung aussah wie eine reiche Ärztin und nicht wie die Tochter eines Kleinstadtklempners, die Kinderärztin geworden war. Sie dürfe in diesem Gerichtssaal ruhig sie selbst sein, hatte Buddy ihr gesagt. Sie dürfe Sharon Connor ihr wahres Wesen zeigen, aber erst dann, wenn es der Gegenseite am meisten schadete.
Sara hasste dieses doppelte Spiel, hasste es, sich als Teil ihrer Verteidigungsstrategie in eine männlich wirkende, arrogante Kuh verwandeln zu müssen. In ihrer ganzen Karriere hatte sie sich geweigert, ihre Weiblichkeit zu verleugnen, nur damit sie in die Männerdomäne der Medizin passte. Und jetzt hatte ein Gerichtsverfahren sie zu alldem gemacht, was sie verachtete.
»Alles okay?«
Jeffrey stand in der Tür. Er trug einen anthrazitfarbenen Anzug mit dunkelblauem Hemd und Krawatte. Sein Handy klemmte an der einen Seite seines Gürtels, sein Waffenhalfter an der anderen.
»Ich dachte, du bist zu Hause.«
»Habe mein Auto in die Werkstatt gebracht. Was dagegen, mich mitzunehmen?«
Sie nickte und lehnte sich mit der Schulter an die Wand.
»Hier.« Er hielt ihr ein Gänseblümchen hin, das er wahrscheinlich im überwucherten Hof gepflückt hatte. »Das habe ich dir mitgebracht.«
Sara nahm die Blume, die kaum mehr als Unkraut war, und legte sie auf den Beckenrand.
»Willst du drüber reden?«
Sie verschob das Gänseblümchen und legte es rechtwinklig zum Hahn. »Nein.«
»Willst du allein sein?«
»Ja. Nein.« Schnell schloss sie die Distanz zwischen ihnen, legte ihm die Arme um die Schultern und drückte ihr Gesicht an seinen Hals. »Mein Gott, es war so furchtbar.«
»Das kommt schon alles wieder in Ordnung«, erwiderte er tröstend und strich ihr mit der Hand über den Rücken. »Lass dich von denen nicht fertigmachen, Sara. Lass dir von ihnen nicht dein Selbstvertrauen nehmen.«
Sie drückte sich an ihn, weil sie den Trost seines Körpers an ihrem brauchte. Er war den ganzen Tag auf dem Revier gewesen und roch nach dem Bereitschaftssaal – diese merkwürdige Mischung aus Waffenöl, verbranntem Kaffee und Schweiß. Da ihre Familie verstreut war, war er im Augenblick die einzige Konstante in ihrem Leben, der einzige Mensch, der ihr helfen konnte, wieder zu sich zu finden. Wenn sie es sich genau überlegte, war das seit sechzehn Jahren so. Auch als sie sich von ihm hatte scheiden lassen, auch in der Zeit, als sie versuchte, an alles Mögliche zu denken außer an Jeffrey, war er in ihrem Hinterkopf doch immer da gewesen.
Sie strich ihm mit den Lippen langsam und zärtlich über den Hals, bis seine Haut reagierte. Sie ließ die Hände über seinen Rücken zur Taille gleiten und zog ihn an sich auf eine Art, die unmissverständlich war.
Er schaute überrascht, aber als sie ihn auf den Mund küsste, küsste er zurück. In diesem Augenblick wollte Sara weniger Sex als die Intimität, die dazugehörte. Wenigstens war dies etwas, das sie wirklich gut konnte.
Jeffrey löste sich wieder von ihr. »Lass uns nach Hause fahren, okay?« Er steckte ihr eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Ich koche uns etwas, und dann legen wir uns auf die Couch und …«
Sie küsste ihn noch einmal, knabberte an seiner Lippe, drückte ihn wieder an sich. Er brauchte nie viel Überredung, aber als seine Hand zum Reißverschluss ihres Rockes glitt, wanderten ihre Gedanken zu Dingen, die zu Hause zu erledigen waren: der Stapel Wäsche, der zusammengelegt werden musste, der tropfende Wasserhahn im Gästezimmer, das zerrissene Einlegepapier in den Schubladen der Küchenschränke.
Schon die Vorstellung, ihre Strumpfhose auszuziehen, empfand sie als Überforderung.
Er löste sich mit einem schmalen Lächeln wieder von ihr.
»Komm«, sagte er, nahm sie bei der Hand und führte sie aus dem Waschraum. »Ich fahre dich nach Hause.«
Mitten in der Lobby bimmelte sein Handy. Er schaute Sara fragend an, als brauche er ihre Erlaubnis, um ranzugehen.
»Mach nur«, sagte sie, weil sie wusste, dass derjenige, der anrief, es noch einmal versuchen oder, noch schlimmer, zu ihnen nach Hause kommen würde. »Geh nur ran.«
Er wirkte noch immer widerwillig, zog aber dennoch das Handy vom Gürtel. Sie sah ihn die Stirn runzeln, als er auf die Anruferkennung schaute und sich dann meldete: »Tolliver.« Sara lehnte sich an die Empfangstheke und verschränkte die Arme, während sie versuchte, seine Miene zu interpretieren. Sie war schon viel zu lange die Frau eines Polizisten, um noch zu glauben, dass es so etwas wie einen einfachen Anruf gab.
»Wo ist sie jetzt?«, fragte Jeffrey. Er nickte, und seine Schultern verkrampften sich, als er die Antwort hörte. »Okay«, sagte er und schaute auf seine Uhr. »Ich kann in drei Stunden dort sein.«
Er beendete die Verbindung und drückte dann das Handy so fest, dass Sara schon meinte, er würde es zerbrechen.
»Lena«, sagte er knapp, als Sara ihn eben fragen wollte, was los sei. Lena Adams war Detective in seiner Truppe und neigte dazu, immer in Schwierigkeiten zu geraten und Jeffrey mit hineinzuziehen. Allein schon die Erwähnung ihres Namens bedeutete nichts Gutes.
Sara sagte: »Ich dachte, sie ist im Urlaub.«
»Es gab eine Explosion«, antwortete Jeffrey. »Sie ist im Krankenhaus.«
»Alles in Ordnung mit ihr?«
»Nein«, sagte er und schüttelte den Kopf, als könnte er nicht glauben, was er eben gehört hatte. »Sie wurde verhaftet.«
Drei Tage zuvor
2
Lena behielt eine Hand am Lenkrad, während sie mit der anderen die Radiosender durchsuchte. Jedes Mal, wenn wieder ein hirnloses Mädchen aus den Lautsprechern kreischte, zuckte sie zusammen; seit wann war Dummheit eigentlich ein Talent, das man vermarkten konnte? Sie gab die Suche auf, als sie zu den Country-Music-Sendern kam. Im Kofferraum hatte sie einen 6-CD-Wechsler, aber sie hatte die Nase voll von jedem einzelnen Song auf jeder einzelnen Disc. Verzweifelt griff sie hinter sich auf den Boden vor dem Rücksitz und tastete nach einer einzeln herumliegenden CD. Hintereinander klaubte sie drei leere Schutzhüllen auf und fluchte bei jeder lauter. Sie wollte schon aufgeben, als ihre Fingerspitzen eine Kassette unter ihrem Sitz berührten.
Ihr Celica war etwa acht Jahre alt und hatte noch einen Kassettenrekorder, aber Lena hatte keine Ahnung, was diese Kassette enthielt oder wie sie überhaupt in ihr Auto gekommen war. Trotzdem steckte sie sie in den Schlitz und wartete. Da keine Musik kam, drehte sie lauter und fragte sich, ob die Kassette vielleicht leer war oder die sengende Hitze des letzten Sommers sie beschädigt hatte. Sie drehte noch lauter und hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als die ersten Trommelschläge von Joan Jetts »Bad Reputation« durchs Auto dröhnten.
Sibyl. Ihre Zwillingsschwester hatte das Band zwei Wochen vor ihrem Tod aufgenommen. Lena erinnerte sich noch gut, wie sie vor sechs Jahren genau diesen Song gehört hatte, als sie vom Georgia Bureau of Investigation in Macon, wo sie etwas abgeliefert hatte, über den Highway zurück ins Grant County gerast war. Die Fahrt war ganz ähnlich gewesen wie die, die sie heute machte: schnurgerade auf einer von Kudzugestrüpp gesäumten Interstate, die wenigen PKW auf der Straße sausten an Neunachsern vorbei mit Wohnwagen, die zu wartenden Familien transportiert wurden. Unterdessen wurde ihre Schwester im Grant County von einem Sadisten gequält und ermordet, während Lena aus voller Kehle mit Joan Jett mitsang.
Sie ließ die Kassette herausschnellen und schaltete das Radio aus.
Sechs Jahre. Sie hatte gar nicht das Gefühl, als wäre schon so viel Zeit vergangen, andererseits schien es eine Ewigkeit her zu sein. Lena war gerade jetzt an dem Punkt, da ihre Zwillingsschwester nicht mehr das Erste war, woran sie dachte, wenn sie am Morgen aufwachte. Erst später, wenn sie in der Arbeit etwas Lustiges sah oder eine verrückte Geschichte hörte, dachte sie an Sibyl und daran, dass sie es ihr unbedingt erzählen musste, und wurde sich erst Sekundenbruchteile später wieder bewusst, dass Sibyl gar nicht mehr da war.
Lena hatte Sibyl immer als ihre einzige Familie betrachtet. Ihre Mutter war dreizehn Tage nach der Geburt gestorben. Ihr Vater, ein Polizist, war von einem Mann erschossen worden, den er wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten hatte. Er hatte nie erfahren, dass seine junge Frau schwanger war. Und da es so gut wie keine anderen Verwandten gab, hatte Hank Norton, der Bruder ihrer Mutter, die beiden Mädchen großgezogen. Lena hatte ihren Onkel nie als Familie betrachtet. In ihrer Kindheit war Hank ein Junkie gewesen und in ihren Teenagerjahren ein nüchternes, selbstgerechtes Arschloch. Lena betrachtete ihn mehr als Wächter denn als jemanden, der die Regeln aufstellte und alle Macht hatte. Von Anfang an hatte Lena nur ausbrechen wollen.
Sie schob die Kassette wieder hinein und drehte so leise, dass der Song nur ein wütend geflüstertes Knurren war.
I don’t give a damn about my bad reputation …
Die Schwestern hatten es als Teenager gesungen. Es war ihr Protest gegen Reese, das Provinzkaff, in dem sie lebten, bis sie alt genug waren, um sich aus dem Staub zu machen. Mit ihrer dunklen Haut und dem allgemein exotischen Aussehen, das sie von ihrer mexikanischen Großmutter geerbt hatten, waren sie beide nicht sonderlich beliebt gewesen. Die anderen Kinder waren gemein, und Lenas Strategie war es, sie sich einzeln vorzunehmen, während Sibyl sich ganz aufs Lernen konzentrierte und schwer arbeitete, um die Stipendien zu erhalten, die sie für ein Studium brauchte. Nach der Highschool hatte Lena eine Weile untätig herumgehangen und war dann auf die Police Academy gegangen, wo Jeffrey Tolliver sie aus einer Gruppe von Rekruten herausgepflückt und ihr einen Job angeboten hatte. Sibyl war zu der Zeit bereits Professorin am Grant Institute of Technology, was Lenas Entscheidung, den Job anzunehmen, sehr viel leichter machte.
Lena erinnerte sich an ihre ersten beiden Wochen im Grant County. Nach Reese hatte Heartsdale wie eine Metropole gewirkt. Sogar Avondale und Madison, die beiden anderen Städte im Grant County, waren für ihre Kleinstadtaugen eindrucksvoll. Die meisten Kinder, mit denen Lena zur Schule gegangen war, hatten Georgia noch nie verlassen. Ihre Eltern arbeiteten Zwölfstundenschichten in der Reifenfabrik oder bekamen Arbeitslosengeld, sodass sie herumsitzen und trinken konnten. Urlaube waren für die Reichen – Leute, die es sich leisten konnten, ein paar Tage frei zu nehmen, und trotzdem in der Lage waren, die Stromrechnung zu bezahlen.
Hank hatte eine Bar am Rand von Reese, und nachdem er aufgehört hatte, sich den Gewinn in die Adern zu jagen, hatten Sibyl und Lena im Vergleich zu ihren Nachbarn ein relativ komfortables Leben geführt. Sicher, das Dach ihres Hauses war verbogen, und soweit sie zurückdenken konnte, stand im Hinterhof auf Waschbetonblöcken ein 1963er-Chevytruck, aber sie hatten immer Essen auf dem Tisch, und zu Beginn jedes neuen Schuljahrs fuhr Hank mit ihnen nach Augusta, um ihnen neue Kleidung zu kaufen.
Lena hätte dankbar sein sollen, aber sie war es nicht.
Sibyl war acht gewesen, als Hank sie betrunken mit dem Auto anfuhr. Lena hatte mit einem alten Tennisball mit ihrer Schwester Fangen gespielt. Sie warf zu weit, und als Sibyl auf die Einfahrt lief und sich bückte, um den Ball aufzuheben, hatte die hintere Stoßstange von Hanks zurücksetzendem Auto sie an der Schläfe getroffen. Es war kaum Blut zu sehen gewesen, nur eine dünne Linie am Haaransatz, aber der Schaden war angerichtet. Danach hatte Sibyl nicht mehr sehen können, und gleichgültig, wie viele Treffen der Anonymen Alkoholiker Hank besuchte oder wie fürsorglich er zu sein versuchte, insgeheim sah Lena immer vor sich, wie sein Auto ihre Schwester traf, und den überraschten Blick auf Sibyls Gesicht, als sie zu Boden stürzte.
Und doch – im Augenblick benutzte Lena einen ihrer kostbaren Urlaubstage, um nach dem alten Mistkerl zu sehen. Hank hatte zwei Wochen lang nicht angerufen, und das war merkwürdig. Obwohl sie seine Anrufe selten erwiderte, sprach er ihr jeden zweiten Tag eine Nachricht aufs Band. Gesehen hatte sie ihren Onkel zum letzten Mal vor drei Monaten, als er – ungebeten – ins Grant County gekommen war, um ihr beim Umzug zu helfen. Sie hatte Jeffreys Haus angemietet, nachdem der herausgefunden hatte, dass die Vormieter, zwei Collegestudentinnen, es als Privatbordell missbraucht hatten. Hank hatte beim Kistenschleppen nur ein paar Worte über die Lippen gebracht, und Lena war ähnlich gesprächig gewesen. Bei seiner Abfahrt hatte ihr schlechtes Gewissen sie dazu gebracht, ein Abendessen in dem neuen Steakhaus im Viertel vorzuschlagen, aber er stieg mit irgendeiner Ausrede in seinen klapprigen, alten Mercedes, bevor sie den Satz zu Ende bringen konnte.
Sie hätte merken müssen, dass etwas nicht stimmte. Hank ließ nie eine Gelegenheit aus, mit ihr zusammen zu sein, wie schmerzhaft die Begegnung auch sein mochte. Dass er sofort nach Reese zurückgefahren war, hätte für sie ein Hinweis sein müssen. Mann, sie war Detective. Sie musste erkennen, wenn etwas ungewöhnlich war.
Außerdem hätte sie nicht zwei ganze Wochen vergehen lassen dürfen, ohne ihn anzurufen und sich nach ihm zu erkundigen.
Letztendlich war es Charlotte gewesen, eine von Hanks Nachbarinnen, die Lena angerufen und ihr gesagt hatte, sie müsse kommen und nach ihrem Onkel sehen.
»Er ist in keiner guten Verfassung«, hatte sie gesagt. Als Lena versuchte, mehr aus ihr herauszuholen, hatte Charlotte nur gemurmelt, eins ihrer Kinder brauche sie, und aufgelegt.
Lena spürte, wie ihr Rücken sich streckte, als sie die Stadtgrenze von Reese erreichte. O Gott, sie hasste diese Stadt. In Grant war sie wenigstens keine Außenseiterin. Aber hier würde sie immer die Waise sein, die Unruhestifterin, Hank Nortons Nichte – nein, nicht Sibyl, Lena, die Böse.
Kurz hintereinander kam sie an drei Kirchen vorbei. Vor dem Baseballplatz stand eine große Reklametafel, auf der stand: Vorhersage für heute: Jesus regiert!
»O Gott«, murmelte sie und bog links auf die Kanuga Road ein. Ihr Körper lief auf Autopilot, während sie durch die Nebenstraßen rollte, die zu Hanks Haus führten.
Obwohl das Unterrichtsende erst in einer Stunde war, verließen bereits genug Autos die Highschool, um einen Stau zu verursachen. Lena bremste, gedämpfte Tonfetzen konkurrierender Radiosender drangen ihr ans Ohr, während aufgemotzte Macho-Autos Gummi auf den Asphalt brannten.
Ein Kerl in einem blauen Mustang, ein altes Modell, das sich fuhr wie ein Transporter und ein Armaturenbrett aus Metall hatte, das einem den Kopf abtrennen konnte, wenn man gegen den richtigen Baum krachte, fuhr auf der Nachbarspur neben sie. Lena drehte den Kopf und sah einen Teenager, der sie unverblümt anstarrte. Goldketten funkelten in der Nachmittagssonne an seinem Hals, und seine rötlich-blonden Haare waren mit so viel Gel zu Stacheln aufgestellt, dass er aussah wie etwas, das man eher auf dem Grund des Meeres fand als in einer Kleinstadt in den Südstaaten. Ohne zu merken, wie blöd er dabei aussah, wippte er mit dem Kopf zu der Rap-Musik, die aus seinen Autolautsprechern dröhnte, und zwinkerte Lena anzüglich zu. Sie drehte sich weg und dachte, dass sie diesen verzogenen weißen Bengel gern an einem Freitagabend in Downtown-Atlanta sehen würde. Da wäre er zu sehr mit Hosenscheißen beschäftigt, um das Gangsta-Leben wirklich genießen zu können.
An der nächsten Straße bog sie ab und fuhr einen Umweg zu Hank, weil sie von dem Kerl und dem Verkehr wegkommen wollte. Wahrscheinlich ging es Hank gut. Lena wusste, dass sie eins mit ihrem Onkel gemeinsam hatte: den Hang zur Übellaunigkeit. Wahrscheinlich war Hank einfach nur düsterer Stimmung. Und vermutlich wurde er wütend, wenn er die Tür öffnete und Lena sah, die sich in seine Angelegenheiten einmischen wollte. Sie würde es ihm nicht verdenken können.
Ein weißer Cadillac Escalade stand in der Einfahrt hinter Hanks altem Mercedes. Lena fragte sich, wer ihn wohl besuchte, während sie den Celica am Straßenrand abstellte und den Motor ausschaltete. Vielleicht war Hank ja Gastgeber eines AA-Treffens; und in dem Fall hoffte sie, dass der Fahrer des Escalade der Letzte war, der ging, und nicht der Erste, der erschienen war. Ihr Onkel war ebenso abhängig von diesem Selbsthilfeunsinn, wie er süchtig nach Alkohol und Speed gewesen war. Sie hatte mitbekommen, dass Hank sechs Stunden am Stück gefahren war, nur um einen speziellen Redner zu hören, und sofort danach dieselbe Strecke noch einmal zurück, damit er die Bar für die frühnachmittäglichen Säufer öffnen konnte.
Sie musterte das Haus und dachte, dass sich an dem Heim ihrer Kindheit nichts verändert hatte außer seinem Verfallszustand. Das Dach war noch verbogener, die Farbe auf der Holzverschalung blätterte so stark ab, dass ein dünner Streifen weißer Farbpartikel einen Kreidestrich um das Haus zog. Sogar der Briefkasten hatte schon bessere Tage gesehen. Offensichtlich hatte jemand mit einem Baseballschläger auf das Ding eingedroschen, aber Hank hatte, handwerklich geschickt, wie er war, den Kasten mit Isolierband wieder an den verfaulenden Holzpfosten geklebt.
Lena nahm ihren Schlüssel in die Hand, als sie aus dem Auto stieg. Ihre Waden spannten nach der langen Fahrt, und sie beugte den Oberkörper, um die Beine zu strecken.
Ein Schuss zerriss die Luft, Lena schnellte wieder hoch, griff nach ihrem Halfter, realisierte, dass ihre Glock im Handschuhfach lag, und begriff gleichzeitig, dass der Schuss nur das Zuknallen der Haustür gewesen war.
Der Türenknaller war ein stämmiger Kahlkopf mit Armen dick wie Kanonen und einer Haltung, die sie schon aus zwanzig Schritt Entfernung erkannte. Eine große Lederscheide mit einem Jagdmesser hing an seiner rechten Hüfte, und eine dicke Metallkette führte von einer Gürtelschlaufe zu seiner Brieftasche in der linken Gesäßtasche. Er trottete die wackeligen Stufen hinunter und zählte ein Bündel Geldscheine in seiner fleischigen Hand.
Er hob den Kopf, sah Lena und schnaubte nur verächtlich auf, bevor er in seinen weißen Cadillac stieg. Die Zweiundzwanzig-Zoll-Reifen des Geländewagens wirbelten Staub hoch, als er rückwärts aus der Einfahrt stieß und neben ihrem Celica auf die Straße fuhr. Der Escalade war ungefähr einen Meter länger als ihr Auto und mehr als einen halben Meter breiter. Das Dach war so hoch, dass sie nicht darübersehen konnte. Die Seitenfenster waren dunkel getönt, aber die vorderen waren heruntergekurbelt, sodass sie den Fahrer deutlich erkennen konnte.
Er war so dicht herangefahren, dass er sie zwischen den beiden Autos praktisch einklemmte, und seine Glupschaugen starrten Löcher in sie. Die Zeit blieb stehen, und sie sah, dass er älter war, als sie gedacht hatte, und sein rasierter Schädel kein modisches Statement war, sondern eine Ergänzung zu dem großen Hakenkreuz, das er auf den nackten Oberarm tätowiert hatte. Struppige schwarze Stoppeln umrahmten als Schnauzer und Kinnbart seinen Mund, aber das höhnische Grinsen auf seinen fetten, feuchten Lippen konnte sie trotzdem erkennen.
Lena war lange genug Polizistin, um einen Verbrecher zu erkennen, und der Fahrer war lange genug Verbrecher, um eine Polizistin zu erkennen. Keiner wich dem Blick des anderen aus, aber er gewann das Kräftemessen, indem er den Kopf schüttelte, als wollte er sagen: »Was für eine Verschwendung.« Sein Frauenschläger-Shirt zeigte ein kräftiges Muskelspiel, als er den Gang einlegte und davonbrauste.
Lena blieb stehen, wo sie war. Fünf, sechs, sieben … Sie zählte die Sekunden, während sie breitbeinig mitten auf der Straße stand und wartete, bis der Cadillac abbog und der Kerl sie nicht mehr im Rückspiegel hatte.
Kaum war das Auto verschwunden, ging sie zur Beifahrerseite und zog das Fünfzehn-Zentimeter-Klappmesser hervor, das sie immer unter dem Sitz hatte. Sie steckte es sich in die Gesäßtasche und holte die Glock aus dem Handschuhfach. Sie kontrollierte den Sicherungshebel und klemmte sich das Halfter an den Gürtel. Lena wollte dem Mann nicht noch einmal begegnen, vor allem nicht unbewaffnet.
Während sie zum Haus ging, verdrängte sie den Gedanken, was eine solche Person wohl im Haus ihres Onkels zu suchen hatte. In einer Stadt wie Reese fuhr man kein solches Auto, wenn man in der Reifenfabrik arbeitete. Und man verließ auch nicht das Haus eines anderen mit einem Bündel Scheine in der Hand, wenn man nicht sicher war, dass kein Mensch versuchen würde, es einem abzunehmen.