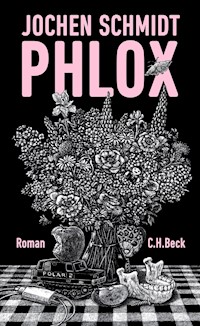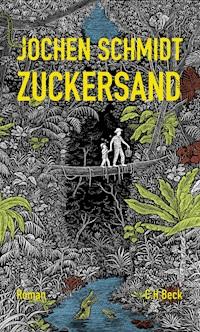17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alte Röhrenbildschirme, die auf den Bürgersteigen liegen wie Weihnachtsbäume im Januar, bieten einen längst vertrauten Anblick. Sie stehen für den Abschied vom Zeitalter des linearen Fernsehens. Wo war Familie mehr Familie als abends vor dem Fernseher? Und auf welchen Gegenstand richten wir in Zukunft die Einrichtung unserer Wohnzimmer aus? Jochen Schmidt befasst sich nicht nur seit Jahren mit der Bewältigung des familiären Fernsehalltags, er konsumiert auch im großen Stil alles, was das Fernsehen aufzubieten hat. Mit seinen Kolumnen schreibt er deutsche Fernsehgeschichte und zeichnet ein ebenso kluges wie unverkennbar witziges Porträt unserer Gesellschaft. Der Fernseher ist ein Auslaufmodel, das lineare Fernsehen steht vor seinem Ende. Doch von welcher Ära verabschieden wir uns damit? Jochen Schmidt ist ein treuer Fernseher, ob Film, Serie, Nachrichten, Werbung oder Trash-TV, er beobachtet das deutsche Fernsehen seit Jahrzehnten. In seinen Kolumnen denkt er darüber nach, welche Rolle es bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Selbstverortung in der Welt und als Produzent von Gesellschaft spielt. Und natürlich birgt auch die Bewältigung des familiären Fernsehalltags – das Arrangement der Fernsehsituation, Paarfernsehen versus Einzelfernsehen – mitunter hohes Konfliktpotential...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jochen Schmidt
ZU HAUSE AN DEN BILDSCHIRMEN
Schmidt sieht fern
C.H.Beck
ÜBER DAS BUCH
Der Fernseher ist ein Auslaufmodel, das lineare Fernsehen steht vor seinem Ende. Doch von welcher Ära verabschieden wir uns damit? Jochen Schmidt ist ein treuer Fernseher, ob Film, Serie, Nachrichten, Werbung oder Trash-TV, er beobachtet das deutsche Fernsehen seit Jahrzehnten. In seinen Kolumnen denkt er darüber nach, welche Rolle es bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Selbstverortung in der Welt und als Produzent von Gesellschaft spielt. Und natürlich birgt auch die Bewältigung des familiären Fernsehalltags – das Arrangement der Fernsehsituation, Paarfernsehen versus Einzelfernsehen – mitunter hohes Konfliktpotenzial …
ÜBER DEN AUTOR
Jochen Schmidt wurde 1970 in Berlin geboren und lebt dort. Bei C.H.Beck sind die Erzählbände «Triumphgemüse» (2000), «Meine wichtigsten Körperfunktionen» (2007), «Der Wächter von Pankow» (2015) und «Ich weiß noch, wie King Kong starb» (2021), die Romane «Müller haut uns raus» (2002), «Schneckenmühle» (2023) und «Ein Auftrag für Otto Kwant» (2019) sowie, gemeinsam mit Line Hoven, «Schmythologie» (2013), «Zuckersand» (2017) und «Paargespräche» (2020) erschienen. Sein Roman «Phlox», der 2022 erschien, war für den Deutschen Buchpreis nominiert.
INHALT
BARES FÜR RARES
GNTM
80S EXTREME
ERNIE & BERT
BAUMSCHNITT
KARAKUM
SNOOKER
WEISSTU, WAS ICH MEINE?
LA LIGUE DES CHAMPIONS
KURZSICHTIG
KÜCHENSCHLACHT
SENDESCHLUSS
DIE OTTO-SHOW
WACKELKONTAKT
TRIMM-TRAB
TRÄUME MIT LUFTSCHRAUBE
FERNBEDIENUNG
ERROR
BAUER SUCHT FRAU
PAPA SCHLÄFT FERN
RUNNING
QUE LE MEILLEUR GAGNE!
KÜCHENSCHLACHT 2
PAT UND MAT – DIE TÜCKE DES OBJEKTS
KÜCHENSCHLACHT 3
STOFFIDAS
HANDBALL
KÜCHENSCHLACHT 4
GNTM 3
GNTM 4
AMEISENLÖWE
KÜCHENSCHLACHT 5
SELBSTVERSORGER
IM FERNSEHEN
EUROVISION
LA LIGUE DES CHAMPIONS 2
KÜCHENSCHLACHT 6
DER LETZTE MOSKITO
WESTFERNSEHEN
YOGA GEGEN STRESS
HOLZWERKENTV
NEUES IRISCHES TAGEBUCH
TESTBILD
NADAL VS. MEDWEDEW
AUFERSTANDEN AUS PLATINEN
STOCKHOCHSPRUNG
2 STUNDEN
MAUERFALL
DNEVNIK
WARTE-TV
STURM DER LIEBE
EROTISCHES ZUR NACHT
INVESTIDURA
BILDUNGSFERNSEHEN
SHOPPING QUEEN
HOTEL BAYERISCHER HOF
SCHWEIGEFUSSBALL
WER WIRD MILLIONÄR?
ALBI THERE
DINOS
TRUMP
JAUCH
BIENE MAYER
AUS ALT MACH ÄLTER
ALF
EIN DICKES EI
HOMESCHOOLING
OHRENSCHMALZ
GORIZONT
RÖHRENBILDSCHIRME
FUSSNÄGEL
MELONEN
AFRIKA
PRESIDENTIAL DEBATE
BAUER SUCHT FRAU 2
DER KLÜGERE GIBT NACH
ELTERN UND TECHNIK
BAUER SUCHT FRAU 3
HOME-SCHOOLING
OLSENBANDE
THE WEST WING
SNACKS
DAS GROSSE UMSTYLING
FERNSEHEN MIT OMA UND OPA
SCHULSCHWÄNZER
WERBUNG
TOM & JERRY
WISSEN IST MATT
EM
UMZUG
EM-AUS
EM-FINALE
OLYMPISCHES FLAIR
SOMMERFERIEN
GOLD
PAPAS ZETTEL
FERNSEHVERBOT
FERNSEHERSCHAM
VIDEOTEXT
UND NUN ZUM WETTER
DIE MENSCHEN AUS DEM FERNSEHEN
WAS VERPASSEN
FARBE
CLÁSICO
INSOMNIE
PAN TAU
SCHULWEG
OPIKRON
KONDENSWASSER
ROSENMONTAG
KRIEG IM TV
PAN TAU 2
LICHTVERSCHMUTZUNG
GNTM 6
HYMNE
HASE UND WOLF
PUTZEN
POKALFINALE
FUSSBALL GUCKEN
MEDITIEREN
SPAREN
CHICHI-WAUWAU
GLAS
#WINNE-TOO
YUMYUM
ASPI-FORUM
BOOMER
CALYPSO
TRÄNEN
VIDEOKUNST
DER GOLDENE PRINGLE
DIE KRÖNUNG DES POPEYE
SILVESTER
SESAMSTRASSE
SAXANA, DAS MÄDCHEN AUF DEM BESENSTIEL
LEMMINGE
PUTZEN 2
SERENGETI
SERVUS EGON!
E.T.
OLCHIS
DANK
BARES FÜR RARES
In vielen Situationen bricht es das Eis, wenn ich bekenne, daß meine Freundin und ich jeden Abend «Bares für Rares» gucken. Es schafft Nähe zwischen Fremden, zuzugeben, sich gerne einmal unter seinem Niveau zu amüsieren. Eines der interessantesten Details aus Christa Wolfs Los-Angeles-Roman «Stadt der Engel» war für mich, daß die Autorin von «Kassandra» während ihres Stipendien-Aufenthalts in Los Angeles jeden Abend im Fernsehen «Star Trek» guckte. Für Schriftsteller gibt es nur Bildungsfernsehen, auch bei «Bares für Rares» lernt man ständig dazu: daß sich helle Möbel besser verkaufen als dunkle, Seestücke besser, wenn keine Schiffe darauf zu sehen sind, sondern nur Meer, Uhren mit weißen Zifferblättern besser als solche mit gelben. Man lernt den schönen Fachwortschatz der Experten: «verböden», «Schaumgold», «Rattenschwanzkette», «boîte à mouches», «Schregersche Linien» (Elfenbein!), «mercerisierte Baumwolle», manchmal fühlt es sich an wie Proust lesen. Wir bewundern das elegante Outfit von Dr. Heide Rezepa-Zabel und den Kunst-Enthusiasmus von Albert Meier. Wir freuen uns über Paare, die nach fünfzig Jahren Ehe noch Händchen halten, wenn sie den «Händlerraum» betreten. (Seltsam fühlt es sich an, wenn ein Verkäufer, der mein Vater sein könnte, genauso alt sein soll wie ich.) Jüngere Verkäufer kommen uns wie Fremdkörper in der Sendung vor, wir wollen ältere Menschen sehen, heitere, kultivierte Damen, die Schmuck verkaufen, den ihnen ihre Männer geschenkt haben (und den sie nie getragen haben), sympathisch-verschrobene Herren, die ihre Spielzeugautos anbieten (fast «unbespielt», weil sie sie als Kind so pfleglich behandelt haben). Wir geben selbst Schätzungen ab und wetteifern darum, wer am Ende näher am Experten liegt, wir staunen, wofür die Verkäufer das eingenommene Geld ausgeben wollen («Eine Musical-Reise mit einem schönen Essen»), wir freuen uns, wenn viele Scheine hingeblättert werden, ein wesentlicher Bestandteil der Sendung, es fühlt sich fast an, als bekäme man selbst das Geld. Und ich überlege immer, ob ich irgendeinen Gegenstand besitze, für den ich «die Händlerkarte» bekommen würde (wo ich doch nichts wegwerfe). Meine Autogrammkarte von Otto? Meine Anstecknadel zum 40. Geburtstag der Stasi, der nie stattgefunden hat (damals aus einem Müllsack auf dem Berliner Stasi-Gelände gefischt)? Der Stuck-Brocken von Ceauşescus Palast in Bukarest, den ich beim Joggen mitgenommen und über die Grenze geschmuggelt habe? Wieviel würde dafür zu «erzielen» sein?
GNTM
Weil «Bares für Rares» heute ausfällt, muß ich mit meiner Tochter «Germany’s Next Topmodel» gucken. Erst dachte ich, sie hätten aus Versehen die Staffel vom letzten Jahr wiederholt, wie damals bei Helmut Kohls Neujahrsansprache. Aber die Werbung, die alle zwei Minuten die Handlung unterbricht, ist neu: «Entdecke ein Make-up wie flüssiger Satin. Feuchtigkeitsserum für bis zu zwölf Stunden!» Und nicht mehr: «Always: Finde die Größe, die zu deiner Figur und Periodenstärke paßt!» Außerdem soll diesmal eine der Kandidatinnen Übergewicht haben. Wir essen überbackene Käsestullen und Wasabi-Nüsse und warten darauf, daß jemand etwas möglichst Dummes sagt. Mein Highlight ist, wenn die Mädchen abends mit ihren Freunden skypen dürfen. Meistens liegen die um die Zeit schon im Bett und würden gerne weiterschlafen. Heute müssen die Mädchen mit einem Männermodel («Er walkt so schön!») für die «nächtliche Catwalk-Challenge» gehen üben. Es zeigt sich, daß bisher noch keine von ihnen gehen kann, dabei hatten sie teilweise zwanzig Jahre Zeit, das zu lernen. Zwei Best Friends Forever haben sich schon am ersten Tag zerstritten. («Warum hast du geweint?» «Weil du mit meinem Freund geschlafen hast.» «Ich kannte dich doch zu dem Zeitpunkt gar nicht.» «Ich finde es megascheiße, mit Freunden meinen Partner zu teilen.») Mir schwant, wie es bei mir zu Hause zugehen würde, wenn ich neunundzwanzig Töchter hätte. Eine andere findet sich häßlich, und eine will sich nicht fotografieren lassen. Shari weint: «Ich hab nicht damit gerechnet, daß das Nackt-Shooting schon so früh kommt.» Für mich kommt es viel zu spät, mit vierzehn hätte mich das interessiert, aber da gab es im Fernsehen nur den «Goldenen Shoot» mit Lou van Burg, den ich nicht nackt sehen wollte. «Eine weitere Challenge beim Nackt-Shooting ist, die richtige Dosis Sexyness zu finden», erklärt Heidi. Gerda hat damit Probleme, sie kann nur sexy: «Ich zeig mich gerne, wie Gott mich geboren hat.» Höhepunkt der Folge ist, daß jeweils zwei Mädchen von einem Podest ins Meer springen, wie Tom Hanks am D-Day in «Saving Private Ryan», und zur Playa Bonita schwimmen, wo die Juroren warten. Wir rätseln immer noch, welche die Dicke sein soll. «Ich war super happy mit euch», sagt Heidi hinterher. Im Internet stehe aber, daß Heidi in Wirklichkeit voll wenig mit den Mädchen rede, sagt meine Tochter. Das große Umstyling solle ich gucken, das sei immer das beste. Ich fand die Dialoge bei der «Bachelorette» einen Tick origineller: «Wie findest du das, daß wir jetzt zu zweit sind?» «Mega.»
80S EXTREME
Nach dem wöchentlichen Fußballtraining mit meinen Autorenkollegen, ohne das die meisten von uns nicht mehr leben könnten, kommen wir immer aus der engen Umkleidekabine, in der es nach Franzbranntwein und Pferdesalbe riecht wie im Schlafzimmer meiner Oma, und treten durch eine Tür, an der ein Poster vom jungen Lukas Podolski hängt, in Rolfs Vereinsbude. Hier sieht es aus wie in der FC-Bayern-Erlebniswelt, außer daß die vielen Pokale, die bei Rolf stehen, nur dem etwas bedeuten, der sie gewonnen hat. Ich bleibe jedes Mal auf ein Bier und trinke zweieinhalb und einen kleinen Feigling, weil immer einer ein Kind bekommen hat und einen ausgibt. Wir gehen alle auf die fünfzig zu, manche noch viele Jahre, manche aber auch nicht mehr lange. Auf zwei riesigen Flachbildschirmen läuft ein Sender, den es vielleicht nur hier bei Rolf gibt, er heißt «deluxemusic» und die Sendung «80s extreme». Egal, wie alt wir sind, wir kommen alle aus den Achtzigern, selbst die, die denken, sie kämen aus der Gegenwart. Wir halten uns die Augen zu, um die Schrift nicht zu lesen, und raten um die Wette das nächste Lied, wobei ich eher froh bin, daß ich immer verliere. Verstörend sind die vielen Bands, die einem völlig unbekannt sind, obwohl man doch damals die Charts auswendig kannte. Es gab sogar in den Achtzigern noch schlechtere Musik als die, die man gut fand! Manche von uns versuchen es sogar bei dieser Gelegenheit mit Niveau («‹The Reflex›, irre, drei Tonarten in einem Song!»), manche haben etwas erlebt («Als ich Knausgård gefragt habe, ob er in Norwegen so bekannt wie Morten Harket ist, hätte er fast das Interview abgebrochen»), und manche hören sogar immer noch Musik und können sich Albumtitel merken. Wir staunen, wie «weit vorne» Yello waren, und fühlen mit Phil Collins mit, dem die Drumsticks inzwischen angeblich an den Händen festgebunden werden müssen. (Zunehmend interessiert es einen, wie Prominente mit dem Alter umgehen.) Mit einem Plus an Lebenserfahrung (Patchworkfamilie), überlegenem intellektuellen Besteck (Heidegger-Lektüre), mit dreißig Jahren mehr Medienkompetenz, mit besseren Englischkenntnissen und dem Wissen darum, wie unwichtig Popmusik in Wirklichkeit ist, betrachten wir staunend den unbeschwert-avantgardistischen DIY-Pop der Achtziger, heilfroh, dem entkommen zu sein, und summen unterwegs nach Hause auf dem Fahrrad (seit neuestem mit gelber Warnweste ausgestattet) leise vor uns hin: «When you’re through with life and all hope is lost, hold out your hand ’cause friends will be friends, right till the end …»
ERNIE & BERT
Wäre ich heute ein besserer Mensch, wenn ich die vielen Fernsehstunden in meiner Kindheit anders genutzt hätte? Meine Eltern haben sogar einen zweiten Schwarzweißfernseher angeschafft, um uns Kinder in den Wochen des Umzugs in die Neubauwohnung zu beschäftigen. Es war herrlich, im neuen, noch unmöblierten Kinderzimmer auf dem PVC-Belag mit der aufgedruckten Holzmaserung zu sitzen und auf das Kinderprogramm zu warten, denn darin bestand Fernsehen oft: warten, daß «was kommt». Leider bin ich heute der Meinung, daß Kinder so lange wie möglich von Bildschirmen ferngehalten werden sollten. Eine Ausnahme ist der Morgen, wenn die Kinder endlich angezogen sind – der rechte Schuh noch ein zweites Mal, weil der Strumpf so gedrückt hat, und weil die neue Mütze nicht akzeptiert wird, muß die alte gesucht werden, aufs Klo müssen auch alle noch mal, also wird der Schneeanzug wieder ausgezogen, mit einer Zange, weil der Reißverschluß klemmt –, und ich mir meinen Sohn auf den Schoß setze, damit wir auf meinem Handy Ernie und Bert sehen können. Ich höre im Hausflur das Nachbarskind schreien, was mich gemeinerweise tröstet, und wir gucken eine dieser kurzen Szenen, die ich inzwischen für bedeutender halte als Brechts Lehrstücke. Daß ausgerechnet die Amerikaner es geschafft haben, so ein intelligentes, komisches, unaufdringlich-pädagogisches Kinderfernsehen zu produzieren, versöhnt mich mit vielem an diesem umstrittenen Land. Daß die «Sesamstraße» anfangs vom Bayerischen Rundfunk nicht ausgestrahlt wurde und deutsche Eltern an die ARD schrieben, weil sie Oscar, der in der Mülltonne wohnte, für ein schlechtes Vorbild hielten, verwundert mich nicht. Für mich waren Ernie und Bert immer eine Version von mir und meinem älteren Bruder, der unter meinem unbeschwert-egoistischen Verhalten litt. Ernie denkt nicht vorausschauend und handelt irrational, wird dafür aber vom Schicksal immer wieder belohnt, wie am Strand, als er, anders als Bert, kein Handtuch, kein Radio, nichts zu essen oder zum Spielen mitgenommen hat, lediglich an einen Regenschirm hat er gedacht, der sich prompt als nützlich erweist, weil es vollkommen unerwartet zu regnen beginnt und Bert mal wieder der Dumme ist. Mit den Jahren habe ich aber auch Bert liebgewonnen, der Tauben, die Farbe Grau und Büroklammern mag. An den beiden ist mir alles sympathisch, ich überlege schon, mir Ernies bunten Wollpullover anzuschaffen und mal wieder meinen Bruder zu besuchen, um ihm das Stück Schokoladenkuchen zu bringen, das ich ihm (angeblich) mit vier Jahren weggegessen habe.
BAUMSCHNITT
Weil die Kinder ein Gefühl für Natur bekommen sollen, haben wir nach kurzem, intensivem Zögern einen Kleingarten übernommen und müssen uns nun weiterbilden, was wann zu tun ist und wie es überhaupt gemacht wird. Leider kann immer nur einer von uns im Garten arbeiten, weil die Kinder sich sofort langweilen und einer auf sie aufpassen muß, damit sie ihre Sonnenmützen aufbehalten und kein Wasser aus Blüten von Glockenblumen trinken, wie es die Ameisen in «Die lustige Grille» tun, einem unserer Kinderbücher. Bis jetzt habe ich alles falsch gemacht, zum Beispiel das Beet umgegraben, erst danach habe ich gelesen, daß die Schäden, die das Umgraben dem Boden zufügt, jahrhundertelang ignoriert wurden. Um nützliche Kleinstlebewesen nicht zu stressen, lockere man nur noch mit dem «Sauzahn». Dann habe ich bergeweise vertrockneter Goldrute abgebrochen und gelernt, daß man die Wurzeln ausgraben muß und den Blütenstand auch nicht auf den Kompost werfen sollte. Als in der Kolonie das Wasser angestellt wurde, lief, weil ein Schräubchen am Wasserhahn (der in Wirklichkeit KFR-Ventil heißt) geöffnet war, eine Grube voll, deren korrekte Bezeichnung ich noch gar nicht kenne. Erst später merkte ich, daß gleichzeitig am Boiler im Haus das Wasser aus einem Ventil spritzte und die Toilette überschwemmte. Zunächst ist das alles ein sprachliches Problem, denn wenn man die Begriffe nicht kennt, bekommt man keine Hilfe. Um es beim Baumschnitt besser zu machen, habe ich «im Netz» lange Abende Filme zum Thema gesehen. Am besten haben mir die des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft gefallen, in denen ein freundlicher Mann, dem die Arbeit leicht von der Hand geht, die Unterschiede zwischen Pflanzschnitt (Leitäste festlegen!), Erziehungsschnitt, Verjüngungsschnitt und Erhaltungsschnitt erklärt. Und das beste war: «Der Sommerschnitt ist groß im Kommen.» Das bedeutet nämlich, daß ich noch warten kann. Im Sommer wird beim Schnitt «das Triebwachstum beruhigt». Vorher kommt der «Juniriß», bei dem «Wasserschosser» oder «Geiltriebe» mit den «schlafenden Knospen» ausgerissen werden. Für alles Weitere brauche ich eine japanische Säge mit Köcher und Gürtelschlaufe, die «auf Zug» arbeitet. Das freut mich, denn bisher war das Schönste am Garten für mich der Einkauf von solidem Equipment im Gartencenter. Vielleicht höre ich auch auf den Rat meines Therapeuten: alle Ambitionen zurückschrauben, mit Kindern kommt man im Garten sowieso zu nichts.
KARAKUM
Ich habe mir unvorsichtigerweise einen hartnäckigen Ohrwurm eingehandelt. Schon beim Aufwachen höre ich in meinem Kopf, wie aus einem Radiowecker, die etwas quäkige Stimme des turkmenischen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow einen Song der russischen Gruppe «Krug» von 1983 singen: «Eto Kara- Kara- Kara- Kara- Kara- Karakum … Eto Kara- Kara- Kara- Kara- Kara- Karakum …» Mein neuer Roman wird in einer fiktiven zentralasiatischen Diktatur spielen, deshalb hatte ich mich auf YouTube über den originellen Personenkult des turkmenischen Präsidenten informiert. Der ehemalige Zahnarzt scheint ein bedeutender Mann zu sein, denn immer, wenn er etwas sagt, schreiben alle Anwesenden konzentriert mit. Es gibt sogar eine Szene aus den Nachrichten, in der er den Generalstaatsanwalt wegen Korruption entläßt – was ungefähr so absurd ist, als würde Tony Soprano Al Capone wegen Diebstahls anzeigen –, und der Betroffene notiert sich jedes Wort. In anderen Beiträgen führt der Präsident seinen Ministern im Fitneßstudio Übungen vor, oder er zeigt einer Armee-Einheit, wie man korrekt mit Waffen umgeht, er wirft sogar mit Messern und signiert anschließend die Zielscheibe. Man sieht ihn bei einem Silvester-Rave im Trainingsanzug am DJ-Pult oder vor begeistertem Publikum auf einem turkmenischen Achal-Tekkiner-Hengst ein Pferderennen gewinnen. Man sieht ihn in Begleitung seiner Minister den «Health Path» in den Bergen vor der Hauptstadt Aschgabat ablaufen, eine kilometerlange, nachts von Laternen beleuchtete Treppe, die an vergoldeten Skulpturen von Bergziegen vorbeiführt. (Der Präsident kämpft gegen das Rauchen und reagiert äußerst gereizt, wenn er zu bemerken meint, daß einer seiner Minister nach Tabak riecht.) Nebenbei hat er die Hauptstadt in eine menschenleere Retortenstadt aus Marmor verwandelt (gebaut von westlichen Baukonzernen). Das klingt alles skurril, aber im Grunde verhält er sich nicht anders als ein deutscher Familienvater bis mindestens in die fünfziger Jahre, nur mit mehr Auswirkungen für die Allgemeinheit: Er erwartet Unterordnung, hält sie vielleicht sogar für Respekt oder Liebe, er weiß alles besser, nimmt sich das größte Stück Fleisch und sorgt sich ständig um seinen Nachruhm. In einem Clip sieht man, wie Hunderte Frauen im Festsaal eines Luxushotels mitklatschen, während auf der Bühne eine Videoaufnahme des Präsidenten gezeigt wird, der für sie anläßlich des Internationalen Frauentags, begleitet von einer Band (Playback im Fernsehen hat er verboten), erstaunlich lässig das schöne Lied über die Wüste Karakum singt. Die Anwesenden genießen sicher nicht das Menschenrecht, nicht begeistert zu sein, aber vielleicht ist es ja noch schlimmer, und sie sind begeistert?
SNOOKER
Im Alter reizen einen meditative Fernsehformate, das merke ich, wenn ich nachts bei diesen Sendungen hängenbleibe, auf denen eine Kamera aus dem Zug heraus irgendwo auf der Welt eine Bahnstrecke filmt. Je mehr in meinem Leben passiert ist, um so weniger muß für meinen Geschmack auf dem Bildschirm passieren. Noch besser war es früher, bei einem Bier dem Defragmentierungsprogramm zuzusehen, das den Speicher vom Rechner aufräumte, was dadurch visualisiert wurde, daß auf einem Bildschirm voller kleiner Quadrate Ordnung einkehrte. Wenn man Familie hat, ist man auch gerne mal allein, deshalb hat Fußballgucken für mich nur als Dauerabsence Sinn, beim Rudelgucken geht der Reiz für mich verloren. Mein Vater hat irgendwann Snooker für sich entdeckt. Während der Snooker-WM (die irgendwie alle paar Monate stattzufinden scheint) färbt sich der Bildschirm in der Wohnung meiner Eltern tagelang grün. Mir ist das recht, denn Snooker ist, vor allem im Vergleich zur Formel 1, die mein Vater leider auch guckt, ein sehr leiser Sport. Meine Mutter sieht zwar nicht zu, aber sie schätzt die «erotische Stimme» des Moderators. Im übrigen würden viele Mitarbeiter ihres germanistischen Instituts jetzt als Rentner Snooker gucken. Vielleicht hat es damit zu tun, daß Snooker, ähnlich wie Darts, es auch unsportlich veranlagten Menschen erlaubt, sich im Wettkampf zu messen. Beim Armeedienst habe ich viel Billard gespielt, der Tisch im «Klubraum» war mit einer blauen FDJ-Fahne bespannt, wir trugen Trainingsanzüge und tranken gelbe Brause, Bier gab es ja nur zu Weihnachten. Der Tisch hatte keine Taschen, deshalb spielten wir Karambolage, allerdings hatten wir nur zwei Kugeln. Wenn ich nicht, sobald das möglich war, zum Zivildienst gewechselt wäre, würde ich jetzt vielleicht bei der Snooker-WM mitspielen (und wäre zuckerkrank wegen der vielen Liter Brause am Tag). Nach der Wende gingen erst mal alle meine Bekannten nächtelang in Kneipen kickern und flippern, weil es das vorher nicht gegeben hatte, und zur Abwechslung Billard spielen, in Billardhallen, die in Ostberlin in neuerdings leerstehenden Fabrikgebäuden eröffneten, wo inzwischen Luxuswohnungen eingerichtet wurden. Mich reizte, wie immer, am meisten das Equipment, vor allem dieser blaue Würfel mit der interessanten Mulde, mit dem habe ich gerne «die Pomeranze gekreidet», obwohl ich beim Stoßen gar keinen Unterschied bemerkte. Manchmal setzt sich ein Spieler auf den Tisch und führt den Stoß mit einer «Brücke» und einer Teleskopverlängerung für den Queue aus, die er hinter seinem Rücken entlangführt. Das ist dann besonders aufregend, ähnlich wie ein Fallrückzieher beim Fußball.
WEISSTU, WAS ICH MEINE?
Vor dem Spielplatz stand neulich eine Gruppe Erwachsener, die auf ihre Handys guckten. Sie suchten nach Pokémons, denn hier befindet sich eine «Arena», wo man «Sachen machen» könne, wie eine Frau mir verriet. Eigentlich habe das ihr Sohn gespielt, aber nun sei sie drauf hängengeblieben. So geht es uns mit «Germany’s Next Topmodel», eigentlich guckt das meine Tochter, und wir gucken nur mit, um ihr die aggressive, unsoziale Ideologie des Formats zu erläutern, aber insgeheim hoffen wir jetzt schon, daß wir auch nächstes Jahr wieder mitgucken müssen. Für mich ist das Format ein sprachliches Füllhorn, weil «die Mädchen» dauernd ihre Gedanken in die Kamera sprechen müssen und dabei versuchen, sich eine Spur gewählter auszudrücken, als sie es gewohnt sind. Dabei begehen sie ständig «grobe Schnitzel». Der Fachbegriff für solche Stilblüten ist «Malapropismus», und bisher war meine Hauptquelle dafür die Online-Ausgabe des «Kicker», wo man Sachen liest wie: «Vielmehr sprach der 69jährige über die mehr als beschauliche Leistung der Spieler auf dem Feld.» Es hat gar nicht unbedingt mit Bildung zu tun, zwischen schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch liegen einfach Welten. Im Haifischbecken der gesprochenen Sprache wird das Deutsch der Zukunft geschmiedet. Wenn «Thomas» sagt: «Es war ein bißchen wenig Varianz in den Gesichtsausdrücken dabei», dann gilt das nicht für die grammatischen Formen. Aber: «Ich hab’ da weniger Probleme als andere, die ’n bißchen versteifter sind.» Als bei einem «Shoot» das Licht für einen Moment perfekt ist, sagt der Fotograf: «Den ganzen Tag haben wir geächzt nach der Sonne.» Wir wetteifern immer, wer zuerst den Fehler findet, hier war wohl «gelechzt» gemeint gewesen. Inzwischen kommt, heute schon zum zehnten Mal, die Werbung für Nivea Sun Sonnenschutz «mit Anti-Flecken-nach-dem-Waschen-Formel». Was studieren eigentlich Werbetexter? Gibt es bald Autos mit «Keine-Verletzungen-nach-dem-Unfall-Formel»? «Er ist sehr aggressiv, aber ich bin dem gerecht», sagt ein «Mädchen» über Wolfgang Joop. «Ich freu mich übertrieben», sagt eine andere über die Begegnung mit ihm, und ich lasse mir erklären, daß «übertrieben» jetzt Jugendsprache sei. Die Mädchen beginnen und beenden auch jeden zweiten Satz mit: «Keine Ahnung». Und an Heidi geht mir die ständige Wendung: «Weißtu, was ich meine?» auf die Nerven. «Bei uns fließen sehr viele Emotionen», sagt ein Mädchen über seinen Auftritt mit einer Dragqueen (der großartig war). «Wir sind ein eingeschweißtes Team.» Nach einer weiteren Werbung für MicellAir-Mizellenwasser sagt Heidi: «Deine Leistung war heute nicht das Eigelb.» Keine Ahnung, aber ich würde ihr das «nicht zum Verhängnis machen».
LA LIGUE DES CHAMPIONS
Wir sind im Urlaub in der Grande Motte, einem Ferienort an der französischen Mittelmeerküste, der ab den späten sechziger Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Man wollte vom Urlauberstrom profitieren, der sich damals schon nach Spanien ergoß. Der leitende Architekt hat über dreißig Jahre praktisch alles selbst entworfen, bis hin zu den Trafohäuschen. Das Problem ist, daß wir keinen Fernseher haben und ich nicht weiß, wo ich das Champions-League-Finale gucken soll. Im Klubraum unserer Résidence, wo ein «House of the Dead»-Spielautomat steht, an dem man «Research Worker» vor Zombies retten soll («Game over, if you shoot a research worker by mistake»), hängt zwar ein Fernseher an der Wand, aber der Raum ist von einer Spezialeinheit der Polizei besetzt, die dort für zwei Wochen ihr Quartier aufgeschlagen hat, um uns vor Terroristen zu schützen. Zu essen gibt es hier auch nichts, nur einen Automaten, der Plüschtiere in Gestalt einer Tüte Pommes ausspuckt. Ich gehe also zur Strandpromenade, um eine Leinwand zu finden, aber die Franzosen essen seelenruhig zu Abend, statt sich für das Finale zu interessieren. Ein Restaurant hat immerhin einen größeren, leeren Saal mit einer Videoleinwand zu bieten, nur daß der Ton ausgeschaltet ist, weil an einem der Tische eine Familie Geburtstag feiert. Das macht aber gar nichts, weil vom Schwimmen sowieso mein linkes Ohr verstopft ist. So sehe ich das Spiel ohne Ton und muß mir denken, warum ständig ein Spieler weint. Erst einer von Liverpool, weil er den Platz verlassen muß, dann muß, wohl der Gerechtigkeit wegen, ein Spieler von Madrid gehen und schluchzt dabei erbärmlich. In der Pause wird eine Quizfrage eingeblendet: «Tentez de gagner un séjour en Thailande». Man muß dafür nur wissen, ob Madrid schon einmal im Finale der Champions League stand. Ich überlege, welche Instanz in mir eigentlich entscheidet, für wen ich bin. Ein bißchen drücke ich Kroos die Daumen, weil er aus Greifswald kommt, dann aber auch Klopp, weil er so menschlich geblieben ist. Wobei mir Zidane ja auch sympathisch ist. Er coacht wie gewohnt telepathisch, ohne eine Miene zu verziehen, er macht das alles mit seiner Ausstrahlung. Am Ende weint auch noch der Torwart von Liverpool, weil er einen Ball nicht gefangen hat. Ich gehe auf der Strandpromenade zurück und bin irgendwie froh, daß ich doch nicht Fußballprofi geworden bin, das wäre sicher mit Streß verbunden. Ich klettere über den Zaun der Résidence, weil ich die Chipkarte vergessen habe, und hoffe, daß mich kein Spezialpolizist für einen Zombie hält und «by mistake» erschießt, auch wenn er dann vielleicht vor Scham weinen würde.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: