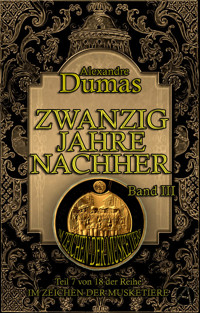
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
ZWANZIG JAHRE NACHHER D’Artagnan, Athos, Porthos und Aramis sind wieder vereint im Kampf gegen das Unrecht. Zu Beginn von “Zwanzig Jahre nachher” ist es 1648: die Rote Sphinx, Kardinal Richelieu, ist tot, Frankreich befindet sich im Bürgerkrieg, und jenseits des Ärmelkanals hängt die Monarchie von König Karl I. am seidenen Faden. Wie d’Artagnan feststellen wird, sind dies Probleme, die sich nicht mit einem Schwerthieb lösen lassen. In “Zwanzig Jahre nachher” sind die Musketiere gereift und stehen vor ihrer größten Herausforderung, nämlich der schmerzlichen Erkenntnis, dass man manchmal scheitert. In der Art und Weise, wie die vier Genossen auf das Scheitern reagieren und sich über das Scheitern erheben, beginnen wir, die wahren Charaktere der großen Helden von Dumas zu erkennen. Die Zeit hat ihre Entschlossenheit geschwächt und ihre Loyalitäten zerstreut. Aber Verrat und List schreien immer noch nach Gerechtigkeit: Der Bürgerkrieg gefährdet den Thron Frankreichs, während in England Cromwell damit droht, Karl I. aufs Schafott zu schicken. Dumas holt sein unsterbliches Quartett aus dem Ruhestand, um die Schwerter mit der Zeit, der Böswilligkeit der Menschen und den Kräften der Geschichte zu kreuzen. Doch ihre größte Bewährungsprobe ist ein titanischer Kampf mit dem Sohn von Lady de Winter, Mordaunt, der das Antlitz des Bösen trägt. Dieses ist der dritte von vier Bänden. Der Umfang des dritten Bandes entspricht ca. 370 Buchseiten. Die Reihe IM ZEICHEN DER MUSKETIERE Die vierbändige Reihe ZWANZIG JAHRE NACHHER ist die zweite eigenständige Sequenz der übergeordneten und insgesamt 18 Teile umfassenden Reihe IM ZEICHEN DER MUSKETIERE, die insgesamt aus drei solchen eigenständigen Sequenzen besteht: DIE DREI MUSKETIERE (4 Teile), ZWANZIG JAHRE NACHHER (4 Teile) und DER GRAF VON BRAGELONNE (10 Teile). Die Geschichte um die drei Musketiere wurde häufig verfilmt. Bekannt ist auch die Verfilmung eines Handlungsstrangs aus dem GRAF VON BRAGELONNE unter dem Titel »Der Mann mit der eisernen Maske«. Die Geschichte rankt um einen möglichen Zwillingsbruder des Königs Ludwig XIV., der in der Bastille gefangen gehalten wurde und eine eiserne Maske tragen musste, um seine wahre Identität zu verbergen. Insgesamt umfasst die komplette Reihe etwa 5.500 Seiten voller Abenteuer, Liebe und Heldenmut. Diese Reihe präsentiert die ungekürzte Übersetzung aus dem Französischen von August Zoller in einer sprachlich überarbeiteten und modernisierten Neuausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
ALEXANDRE DUMAS
ZWANZIG JAHRE NACHHER
HISTORISCHER ROMAN
IN VIER BÄNDEN
BAND III
Ungekürzte, sprachlich überarbeitete und modernisierte Neuausgabe
auf Grundlage der Übertragung aus dem Französischen von August Zoller
ZWANZIG JAHRE NACHHER wurde zuerst veröffentlicht von Braudy, Paris 1845.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von: apebook
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2020
Sprachlich überarbeitete und modernisierte Neuausgabe der ungekürzten Übertragung
aus dem Französischen von August Zoller.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch ist Teil der ApeBook Classics (Nr. 75): Klassische Meisterwerke der Literatur als Paperback und eBook.
Weitere Informationen am Ende des Buches und unter:
www.apebook.de
ISBN 978-3-96130-304-5
Buchgestaltung: SKRIPTART
www.skriptart.de
Alle verwendeten Bilder und Illustrationen sind – sofern nicht anders ausgewiesen – nach bestem Wissen und Gewissen frei von Rechten Dritter, bearbeitet von SKRIPTART.
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2020
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
DIE DREI MUSKETIERE
Band I
Band II
Band III
Band IV
ZWANZIG JAHRE NACHHER
Band I
Band II
Band III
Band IV
DER GRAF VON BRAGELONNE
Band I
Band II
Band III
Band IV
Band V
Band VI
Band VII
Band VIII
Band IX
Band X
KARTE
von
FRANKREICH IM 17. JAHRHUNDERT
Inhaltsverzeichnis
ZWANZIG JAHRE NACHHER. Band III
Frontispiz
Impressum
Karte
Dritter Band
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
Eine kleine Bitte
Direktlinks zu den einzelnen Bänden
Gesamtüberblick IM ZEICHEN DER MUSKETIERE
Buchtipps für dich
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
DRITTER BAND
I.
Mazarin und Madame Henriette.
Der Kardinal stand auf, um die Königin Henriette zu empfangen. Er begegnete ihr mitten in der Galerie vor seinem Kabinett.
Mazarin legte um so mehr Ehrfurcht gegen diese Königin ohne Gefolgt und ohne Schmuck an den Tag, als er wohl fühlte, daß er sich einen Vorwurf über seinen Mangel an Gemüt und über seinen Geiz zu machen hatte.
Aber die Bittsteller wissen ihr Gesicht zu nötigen jeden Ausdruck anzunehmen, und die Tochter von Heinrich IV. lächelte, als sie demjenigen entgegentrat, welchen sie haßte und verachtete.
»Ach,« sagte Mazarin zu sich selbst, »was für ein sanftes Gesicht? Kommt sie etwa, um Geld von mir zu entlehnen?«
Und er warf einen unruhigen Blick auf den Deckel seiner Kasse. Er drehte sogar den Kasten des prächtigen Diamanten nach Innen, dessen Glanz die Augen auf seine übrigens weiße und schöne Hand ziehen konnte. Unglücklicher Weise hatte dieser Ring nicht die Eigenschaft des von Gyges, welcher seinen Herrn unsichtbar machte, wenn er tat, was Mazarin getan hatte.
Mazarin aber hatte in diesem Augenblick wohl unsichtbar zu sein gewünscht, denn er ahnte, daß Madame Henriette kam, um ihn um etwas zu bitten. Wenn eine Königin, welche er so behandelt hatte, mit einem Lächeln auf den Lippen, statt die Drohung im Munde zu haben, erschien, so kam sie als Flehende.
»Herr Kardinal,« sagte die erhabene Dame, »ich hatte Anfangs die Absicht, über die Angelegenheit, welche mich Hierher führt, mit der Königin, meiner Schwester, zu sprechen; aber ich bedachte, daß die politischen Dinge vor Allem die Männer angehen.«
»Madame,« sprach Mazarin, »glaubt mir, daß Eure Majestät mich ganz beschämt durch diese schmeichelhafte Unterscheidung.«
»Er ist sehr höflich,« dachte die Königin; »sollte er mich erraten haben?«
Man war in das Kabinett des Kardinals gelangt, Mazarin ließ die Königin sich setzen, und nachdem sie es sich in ihrem Lehnstuhle bequem gemacht hatte, sprach er:
»Gebt dem ehrfurchtsvollsten von Euren Dienern Eure Befehle.«
»Ach, mein Herr, ich habe die Gewohnheit, Befehle zu geben, verloren, und die, Bitten zu stellen, angenommen. Ich komme, um Euch zu bitten, und bin zu glücklich, wenn meine Bitte erhört wird.«
»Sprecht, Madame.«
»Herr Kardinal, es handelt sich um den Krieg, den der König, mein Gemahl, gegen seine rebellischen Untertanen führt. Ihr wißt vielleicht nicht, daß man sich in England schlägt,« sagte die Königin mit einem traurigen Lächeln, »auf eine viel entscheidendere Art schlagen wird, als man sich bis jetzt geschlagen hat.«
»Ich weiß durchaus Nichts davon, Madame,« erwiderte der Kardinal, diese Worte mit einer leichten Schulterbewegung begleitend. »Ach, unsere eigenen Kriege verzehren völlig die Zeit und den Geist eines unfähigen, schwachen, armen Ministers wie ich bin.«
»Nun wohl, Herr Kardinal,« sagte die Königin, »ich teile Euch also mit, daß Carl I., mein Gemahl, im Begriffe ist, eine entscheidende Schlacht zu liefern. Im Falle einer Niederlage…« Mazarin machte eine Bewegung … »Man muß für Alles vorhersehen,« fuhr die Königin fort, »im Falle einer Niederlage wünscht er sich nach Frankreich zurückzuziehen und hier wie ein einfacher Privatmann zu leben. Was sagt Ihr zu diesem Plane?«
Der Kardinal hatte zugehört, ohne daß eine Fiber seines Gesichtes den Eindruck verriet, den die Worte der Königin auf ihn machten. Wahrend er hörte, blieb sein Lächeln das, was es immer war, falsch, schlau, und als die Königin geendet hatte, antwortete er mit seinem weichsten Tone:
»Glaubt Ihr, Madame, daß Frankreich, so aufgeregt, so brausend es in diesem Augenblicke ist, als ein Hafen des Heils für einen entthronten König betrachtet werden darf? Die Krone ist bereits nichts weniger als fest auf dem Haupte von Ludwig XIV. Wie sollte es eine doppelte Last tragen?«
»Diese Last ist in Beziehung auf das, was mich betrifft, nicht sehr schwer gewesen,« unterbrach ihn die Königin mit einem schmerzlichen Lächeln, »und ich fordere nicht, daß man mehr für meinen Gemahl tun soll, als man für mich getan hat. Ihr seht, daß wir sehr bescheidene Könige sind, mein Herr.«
»Oh Ihr, Madame, Ihr,« sagte der Kardinal hastig, um die Erklärungen, denen er entgegensah, kurz abzuschneiden, »das ist etwas Anderes. Eine Tochter von Heinrich IV., eine Tochter von diesem großen, diesem erhabenen König!«
»Was Euch nicht abhält, seinem Schwiegersohne die Gastfreundschaft zu verweigern, nicht wahr, mein Herr? Ihr solltet Euch jedoch erinnern, daß dieser große, dieser erhabene König eines Tags geächtet, wie es mein Gatte werden wird, Unterstützung von England verlangte und daß England sie ihm bewilligte. Allerdings war die Königin Elisabeth nicht seine Nichte.«
»Peccato!« sprach Mazarin, sich unter dieser so einfachen Logik schüttelnd, »Eure Majestät versteht mich nicht. Sie beurteilt meine Ansichten nicht richtig, ohne Zweifel, weil ich mich im Französischen schlecht ausdrücke.«
»Sprecht Italienisch, mein Herr, die Königin Maria von Medicis, unsere Mutter, hat uns diese Sprache gelehrt, ehe der Kardinal, Euer Vorgänger, sie in die Verbannung schickte, in der sie starb. Wenn etwas von diesem großen, von diesem erhabenen König Heinrich übrig ist, von dem Ihr so eben sprächet, so muß ich erstaunen über die tiefe Bewunderung für ihn, mit der so wenig Mitleid für seine Familie verbunden ist.«
Der Schweiß lief in schweren Tropfen von der Stirne von Mazarin.
»Diese Bewunderung ist im Gegenteil so groß und so wahr, Madame,« sprach Mazarin, ohne das Anerbieten, der Königin, sich einer andern Sprache zu bedienen, anzunehmen, »daß. wenn der König Carl I., den Gott vor jedem Unglück bewahren möge, nach Frankreich käme, ich ihm mein Haus, mein eigenes Haus anbieten würde. Aber leider wäre dies ein durchaus nicht sicherer Aufenthaltsort. Eines Tages wird das Volk dieses Haus niederbrennen, wie es das des Marschall d’Ancre niedergebrannt hat. Armer Concino Concini! er wollte doch nichts, als das Wohl von Frankreich.«
»Ja, Monseigneur, wie Ihr,« versetzte die Königin ironisch.
Mazarin stellte sich, als verstünde er den Doppelsinn des Satzes nicht, den er selbst ausgesprochen hatte, und fuhr fort, über das Schicksal von Concino Concini zu seufzen.
»Aber, Monseigneur,« sagte die Königin ungeduldig, »was antwortet Ihr mir?«
»Madame,« rief Mazarin, »Madame, würde mir Eure Majestät wohl erlauben, ihr einen Rat zu geben? Wohl verstanden, ehe ich mir diese Freiheit nehme, fange ich damit an, daß ich mich Eurer Majestät für Alles, was Ihr gefallen dürfte, zu Füßen lege.«
»Sprecht, mein Herr,« antwortete die Königin, »der Rat eines Mannes, der so klug ist, wie Ihr, muß sicherlich gut sein.«
»Madame, glaubt mir, der König muß sich auf das Aeußerste verteidigen.«
»Er hat es getan, mein Herr, und die Schlacht, die er mit Hilfsmitteln, welche weit unter denen des Feindes stehen, zu liefern im Begriffe ist, beweist, daß er sich nicht ohne Kampf zu ergeben gedenkt. Aber im Falle, daß er besiegt würde?«
»In diesem Falle, Madame, ist mein Rat, … ich weiß, daß ich sehr kühn bin, wenn ich Eurer Majestät einen Rat gebe, … aber mein Rat ist, der König soll fein Reich nicht verlassen. Man vergißt sehr schnell die abwesenden Könige. Geht er nach Frankreich über, so ist seine Sache verloren.«
»Wenn dies Euer Rat ist.« sprach die Königin, »und Ihr wirklich eine Teilnahme für ihn hegt, so schickt ihm einige Hilfe an Mannschaft und Geld, denn ich vermag nichts mehr für ihn. Ich habe, um ihn zu unterstützen, meinen letzten Diamant verkauft. Es bleibt mir nichts mehr; Ihr wißt es besser, als irgend Jemand, mein Herr. Wenn mir ein Juwel geblieben wäre, hätte ich Holz dafür gekauft, um mich und meine Tochter in diesem Winter damit zu erwärmen.«
»Ach! Madame,« versetzte Mazarin, »Ihr wißt nicht, was Ihr von mir verlangt. Von dem Tage an, wo eine Hilfe von Fremden im Gefolge eines Königs erscheint, um ihn wieder auf den Thron zu setzen, gesteht dieser König gleichsam zu, daß er kein? Hilfe mehr in der Liebe seiner Untertanen zu suchen hat.«
»Zur Sache, mein Herr Kardinal,« sprach die Königin, welche die Geduld verlor, diesem feinen Geiste in das Labyrinth der Worte zu folgen, in welchem er sich umhertrieb, »zur Sache. Antwortet mir: ja oder nein, besteht der König darauf, in England zu bleiben, werdet Ihr ihm Hilfe schicken? kommt er nach Frankreich, werdet Ihr ihm Gastfreundschaft gönnen?«
»Madame,« antwortete der Kardinal, die größte Offenherzigkeit heuchelnd, »ich hoffe, Eurer Majestät zu beweisen, wie sehr ich ihr ergeben bin und wie sehr ich eine Angelegenheit zu Ende zu bringen wünsche, die ihr ungemein am Herzen liegt, wonach Eure Majestät an meinem Eifer, ihr zu dienen, nicht mehr zweifeln wird, wie ich denke.«
Die Königin biß sich in die Lippen und bewegte sich auf ihrem Stuhle voll Ungeduld hin und her.
»Nun, was wollt Ihr tun?« sagte sie, »sprecht.«
»Ich will auf der Stelle die Königin über diese Sache um Rat fragen, und wir werden sie dann sogleich dem Parlament vorlegen.«
»Mit dem Ihr in Fehde lebt, nicht wahr? Ihr beauftragt Broussel, Berichterstatter zu sein. Genug, Herr Kardinal, genug. Ich verstehe Euch, oder vielmehr ich habe Unrecht. Geht wirklich zum Parlament, denn von diesem Parlament, dem Feinde der Könige, ist der Tochter des erhabenen Heinrich IV. die einzige Unterstützung zugekommen, welche sie diesen Winter verhindert hat, vor Hunger und Kälte zu sterben.«
Nach diesen Worten erhob sich die Königin mit einer majestätischen Entrüstung.
Der Kardinal streckte die gefalteten Hände gegen sie aus.
»Ah, Madame, Madame! wie schlecht kennt Ihr mich doch.«
Aber, ohne sich nach demjenigen umzuwenden, welcher diese heuchlerischen Tränen vergoß, durchschritt die Königin das Kabinett, öffnete selbst die Tür, ging mitten durch die zahlreichen Wachen Seiner Eminenz, mitten durch die Höflinge, welche sich herandrängten, um ihm ihre Huldigung darzubringen, auf Lord Winter zu, der vereinzelt da stand, und nahm seine Hand — eine arme, bereits gefallene Königin, vor der sich noch Alle aus Etikette verbeugten, die aber in der Tat nur noch einen einzigen Arm hatte, auf den sie sich stützen konnte.
»Gleichviel,« sagte Mazarin, als er allein war, »es hat mir Mühe gemacht, und ich hatte eine harte Rolle zu spielen. Aber ich habe weder dem Einen, noch der Andern etwas gesagt. Dieser Cromwell ist ein scharfer Königsjäger. Ich beklage seine Minister, wenn er je nimmt. Bernouin!«
Bernouin trat ein.
»Man sehe, ob der junge Mann mit dem schwarzen Wamse und den kurzen Haaren, den Du vorhin bei mir eingeführt hast, sich noch im Palaste befindet.«
Bernouin ging ab. Der Kardinal beschäftigte sich während der Zeit seiner Abwesenheit damit, daß er den Kasten seines Ringes umdrehte, den Diamant rieb, das Wasser bewunderte und, da in seinen Augen noch eine Träne rollte, die ihm das Gesicht trübte, den Kopf schüttelte, um sie fallen zu machen.
Bernouin kehrte mit Comminges zurück.
»Monseigneur,« sagte Comminges, »als ich den jungen Mann zurückführte, nach dem Euere Eminenz fragt, näherte er sich der Glastüre der Galerie und beschaute etwas mit großem Erstaunen, ohne Zweifel das schöne Gemälde von Raphael, welches der Tür gegenüber hängt. Dann träumte er einen Augenblick und stieg die Treppe hinab. Ich glaube, ich habe ihn seinen Grauschimmel besteigen und aus dem Hofe des Palastes reiten sehen. Aber geht denn Monseigneur nicht zu der Königin?«
»Was dort tun?«
»Herr von Guitaut, mein Oheim, sagt mir so eben, die Königin habe Nachricht vom Heere erhalten.«
In diesem Augenblick erschien Herr von Villequier. Er kam wirklich im Austrage der Königin, um den Kardinal zu holen.
Comminges hatte gut gesehen, und Mordaunt hatte wirklich getan, wie er erzählte. Die Gallerte durchschreitend, welche mit der großen Glasgalerie parallel lief, erblickte Mordaunt Lord Winter, welcher wartete, bis die Königin ihre Unterredung geschlossen haben würde.
Bei diesem Anblicke blieb der junge Mann plötzlich stille stehen, nicht in Bewunderung vor dem Gemälde von Raphael, sondern wie bezaubert beim Erschauen eines furchtbaren Gegenstandes. Seine Augen erweiterten sich, ein Schauer durchlief seinen ganzen Körper, es war, als wollte er den gläsernen Wall durchdringen, der ihn von seinem Feinde trennte; denn wenn Comminges gesehen hätte, mit welchem Ausdrucke des Hasses sich die Augen dieses jungen Mannes auf Lord Winter hefteten, so würde er keinen Augenblick daran gezweifelt haben, daß dieser englische Edelmann sein Todfeind war.
Aber er blieb stille stehen, ohne Zweifel, um zu überlegen, denn statt sich von seiner ersten Bewegung hinreißen zu lassen, der zu Folge er gerade auf Lord Winter zugehen wollte, stieg er langsam die Treppen hinab, verließ den Palast mit gesenktem Haupte, schwang sich in den Sattel, stellte sich mit seinem Pferde an der Ecke der Rue de Richelieu auf und wartete, die Augen auf das Gitter geheftet, bis der Wagen aus dem Hofe kam.
Er hatte nicht lange zu warten, denn die Königin blieb kaum eine Viertelstunde bei Mazarin aber diese Viertelstunde des Harrens schien dem Wartenden ein Jahrhundert. Endlich kam die plumpe Maschine, die man damals eine Carrosse nannte, ächzend durch das Gitter heraus und Lord Winter, der wieder zu Pferde saß, neigte sich abermals an den Kutschenschlag, um mit der Königin zu sprechen.
Die Pferde liefen im Trab und schlugen den Weg nach dem Louvre ein, in den sie den Wagen führten. Ehe Madame Henriette das Carmeliterkloster verließ, sagte sie zu ihrer Tochter, sie möge sie in dem Palais erwarten, das sie lange bewohnt und nun verlassen hatte, weil ihr ihr Elend in seinen vergoldeten Sälen nur noch drückender vorkam.
Mordaunt folgte dem Wagen, und als er denselben unter die dunkle Arkade hatte fahren sehen, lehnte er sich nur seinem Pferde an eine Mauer, über die sich der Schatten ausdehnte, und blieb unbeweglich wie ein Basrelief, eine Reiterstatue darstellend.
Er wartete, wie er es bereits im Palais-Royal getan hatte.
II.
Wie die Unglücklichen zuweilen den Zufall für die Vorsehung halten.
»Nun, Madame,« sagte von Winter, als die Königin ihre Dienerin entfernt hatte.
»Nun, was ich vorhergesehen hatte, geschieht, Mylord.«
»Er weigert sich?«
»Habe ich es nicht gesagt?«
»Der Kardinal weigert sich, den König zu empfangen? Frankreich verweigert einem unglücklichen Fürsten Gastfreundschaft? Das geschieht zum ersten Male, Madame.«
»Ich habe nicht gesagt, Frankreich, Mylord. Ich habe gesagt der Kardinal, und der Kardinal ist nicht einmal ein Franzose.«
»Aber, die Königin, habt Ihr dieselbe gesehen?«
»Es ist unnütz,« erwiderte Madame Henriette und schüttelte traurig den Kopf, »die Königin wird nie ja sagen, wenn der Kardinal nein gesagt hat. Wißt Ihr nicht, daß dieser Italiener Alles leitet, sowohl auswärts, als im Innern. Mehr noch, ich komme auf das zurück, was ich euch bereits gesagt habe. Ich würde, mich nicht wundern, wenn uns Cromwell zuvorgekommen wäre. Er war verlegen, während er mit mir sprach, und dennoch fest in seinem Willen, sich zu weigern. Habt Ihr ferner die Bewegung im Palais-Royal bemerkt, das Hin- und Herlaufen geschäftiger Leute? Sollten sie Nachrichten bekommen haben, Mylord?«
»Von England kann dies nicht sein, Madame; ich habe mich so sehr beeilt, daß mir sicherlich Niemand zuvorgekommen ist. Ich bin vor drei Tagen abgereist, und wie durch ein Wunder durch die ganze puritanische Armee gelangt. Ich habe mit meinem Lakai Tomy die Post genommen, und die Pferde, welche wir reiten, haben wir in Paris gekauft. Übrigens bin ich fest überzeugt, daß der König, ehe er etwas wagt, die Antwort von Eurer Majestät abwartet.«
Ihr werdet ihm melden, Mylord,« versetzte die Königin in Verzweiflung, »daß ich nichts vermöge, daß ich so viel gelitten habe, als er, mehr sogar als er, ich, die ich genötigt bin, das Brot der Verbannung zu essen und Gastfreundschaft von falschen Freunden zu verlangen, und daß er, was seine Königliche Person betrifft, sich edelmütig aufopfern und als König sterben müsse; ich werde an seiner Seite sterben.«
»Madame, Madame,« rief von Winter, »Eure Majestät überläßt sich der Mutlosigkeit, und es bleibt uns vielleicht noch einige Hoffnung.«
»Wir haben keine Freunde mehr, Mylord, keine Freunde in der ganzen Welt, außer Euch. Oh, mein Gott!« rief Madame Henriette, die Arme zum Himmel emporstreckend, »Haft Du denn alle edle Herzen, welche auf Erden bestanden, hinweggenommen?«
»Ich hoffe daß dies nicht der Fall ist, Madame,« erwiderte von Winter träumerisch, »ich habe Euch von vier Männern gesprochen …«
»Was wollt Ihr mit vier Männern machen?«
»Vier ergebene Männer, vier bis zum Tode entschlossene Männer vermögen viel, glaubt mir, Madame. Und diejenigen, welche ich kenne, haben in einer gewissen Zeit viel getan.«
»Und diese vier Männer, wo sind sie?«
»Das ist es, was ich gerade nicht weiß. Seit etwa zwanzig Jahren habe ich sie aus dem Gesichte verloren und dennoch dachte ich bei allen Gelegenheiten, wo ich den König in Gefahr sah, an dieselben.«
»Und diese Männer waren Eure Freunde?«
»Einer von ihnen hatte mein Leben in seinen Händen und schenkte es mir. Ich weiß nicht, ob er mein Freund geblieben ist, aber seit jener Zeit bin ich wenigstens der seinige geblieben.«
»Und diese Männer sind in Frankreich, Mylord?«
»Ich glaube.«
»Sagt mir ihre Namen, ich habe sie vielleicht nennen hören und könnte Euch in Eurer Nachforschung unterstützen.«
Der Eine von ihnen nannte sich Chevalier d’Artagnan.«
»Oh! Mylord, wenn ich mich nicht täusche, so ist dieser Chevalier d’Artagnan Lieutenant bei den Garden. Ich habe seinen Namen aussprechen hören, aber merkt wohl, ich befürchte, dieser Mann gehört ganz dem Kardinal an.«
»Das wäre mein letztes Unglück,« erwiderte von Winter, »und ich müßte zu glauben anfangen, daß wir wirklich verdammt sind.«
»Aber die Anderen?« sagte die Königin, welche sich an diese Hoffnung anklammerte, wie ein Schiffbrüchiger an die Trümmer seines Fahrzeuges, »die Anderen, Mylord?«
»Der zweite —, ich hörte zufällig seinen Namen, denn ehe sie sich mit uns schlugen, sagten uns diese vier Edelleute ihre Namen — der zweite hieß Graf de la Fère. Die Namen der zwei Anderen habe ich vergessen, weil ich gewohnt war, sie bei ihren entlehnten Namen zu nennen.«
»Oh, mein Gott! es wäre doch vom höchsten Belange, sie wieder zu finden,« sprach die Königin, »da Ihr glaubt, diese würdigen Edelleute dürften dem König nützlich sein.«
»O ja,« sprach von Winter, »denn es sind dieselben … hört wohl, Madame, und ruft alle Eure Erinnerungen in Euch zurück, habt Ihr nicht erzählen hören, die Königin Anna von Österreich wäre einst aus der größten Gefahr, die eine Königin je gelaufen ist, errettet worden?«
»Ja, während ihrer Liebschaft mit Buckingham; es handelte sich um Diamantnestelstifte.«
»So ist es, Madame. Diese Menschen retteten sie. Es wundert mich nicht, wenn die Namen dieser Edelleute Euch nicht bekannt sind, da die Königin sie vergessen hat, während sie die Ersten ihres Königreiches aus ihnen hätte machen sollen.«
»Nun, Mylord, man muß sie suchen. Aber was werden vier Männer ober vielmehr drei vermögen, denn ich sage Euch, man kann nicht auf Herrn d’Artagnan zählen.«
»Das wäre ein tapferer Degen weniger, Madame, doch es blieben immerhin noch drei andere, ohne den meinigen zu zählen. Vier ergebene Männer aber in der Umgebung des Königs, um ihn vor seinen Feinden zu hüten, ihn in der Schlacht zu decken, im Rate zu unterstützen, auf seiner Flucht zu geleiten, das wäre hinreichend, nicht um den König zum Sieger zumachen, doch um ihn zu retten, wenn er besiegt wäre, um ihm über das Meer zu helfen, und befände sich Euer königlicher Gemahl einmal auf der Küste von Frankreich, so würde er, was auch Mazarin sagen mag, so viele Zufluchtsorte finden, als der Seevogel bei den Stürmen findet.«
»Sucht, Mylord, sucht diese Edelleute, und wenn Ihr sie findet und sie willigen ein, mit Euch nach England zu ziehen, so gebe ich jedem von ihnen ein Herzogtum an dem Tage, wo wir wieder den Thron besteigen, und so viel Gold, als man brauchen würde, um den Palast Whitehall zu pflastern. Sucht also, Mylord, sucht, ich beschwöre Euch.«
»Ich würde wohl suchen, Madame,« sagte von Winter, »und fände auch, aber es gebricht mir an Zeit. Vergißt Eure Majestät, daß der König Ihre Antwort erwartet und zwar mit Bangigkeit erwartet?«
»So sind wir also verloren!« rief die Königin mit dem Ausdruck eines gebrochenen Herzens.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, die junge Henriette erschien, und die Königin drängte mit der erhabenen Kraft, welche der Heldenmut der Mutter ist, ihre Tränen bis in den Hintergrund des Herzens zurück und gab Lord Winter ein Zeichen, das Gespräch zu verändern.
Aber diese Reaction, so mächtigste auch war, entging der jungen Prinzessin nicht. Sie blieb auf der Schwelle stille stehen, stieß einen Seufzer aus und sagte, sich an ihre Mutter wendend:
»Warum weint Ihr beständig ohne mich, meine Mutter?«
Die Königin lächelte und sprach, statt Ihr zu antworten:
»Hört, Lord Winter, ich habe wenigstens Eines dadurch gewonnen, daß ich nur noch zur Hälfte Königin bin, das, daß mich meine Kinder Mutter statt Madame nennen.«
Dann sich gegen ihre Tochter wendend, fuhr sie fort:
»Was willst Du, Henriette?«
»Meine Mutter,« antwortete die junge Prinzessin, »es ist ein Reiter im Louvre erschienen und bittet, Eurer Majestät seine Ehrfurcht bezeugen zu dürfen; er kommt vom Heere und hat, wie er sagt, Euch einen Brief vom Marschall von Grammont zu übergeben.«
»Ah, sprach die Königin zu Winter, »das ist einer von meinen Getreuen. Aber bemerkt Ihr nicht, mein lieber Lord, wie wir so armselig bedient sind, daß meine Tochter das Geschäft der Einführerin versehen muß?«
»Madame, habt Mitleid mit mir,« versetzte Lord Winter, »Ihr zerreißt mir das Herz.«
»Und wer ist der Reiter, Henriette?« fragte die Königin.
»Ich habe ihn aus dem Fenster gesehen, Madame. Es ist ein junger Mensch, der kaum sechzehn Jahre alt zu sein scheint und sich Vicomte von Bragelonne nennt.«
Die Königin machte lächelnd ein Zeichen mit dem Kopfe, die junge Prinzessin öffnete die Tür wieder und Raoul erschien auf der Schwelle.
Er machte drei Schritte gegen die Königin, kniete nieder und sprach:
»Madame, ich überbringe Eurer Majestät einen Brief von meinem Freunde, dem Herrn Grafen von Guiche, welcher mir sagte, er habe die Ehre, zu Euern Dienern zu gehören. Dieser Brief enthält eine wichtige Nachricht und den Ausdruck seiner Ehrfurcht.«
Bei dem Namen des Grafen von Guiche verbreitete sich eine Röte über die Wangen der jungen Prinzessin. Die Königin schaute sie mit einer gewissen Strenge an.
»Aber Du Hast mir gesagt, der Brief käme von dem Marschall von Grammont, Henriette?« sprach die Königin.
»Ich glaubte es, Madame, stammelte die Prinzessin.
»Das ist mein Fehler, Madame. Ich meldete mich wirklich, als käme ich von Seiten des Marschalls von Grammont, aber am rechten Arme verwundet konnte er nicht schreiben und der Graf von Guiche diente ihm als Secretär.«
»Man hat sich also geschlagen?« sagte die Königin und gab Raoul ein Zeichen, sich zu erheben.«
»Ja, Madame,« antwortete der junge Mann und übergab den Brief an Winter, welcher vorgeschritten war, um denselben in Empfang zu nehmen, und ihn sodann der Königin einhändigte.
Bei der Nachricht, daß eine Schlacht geliefert worden sei, öffnete die junge Prinzessin den Mund, um eine Frage zu machen, welche sie ohne Zweifel interessierte, aber ihr Mund schloß sich wieder, ohne ein Wort gesprochen zu haben, während die Rosen ihrer Wangen nach und nach verschwanden.
Die Königin sah alle diese Bewegungen und übersetzte sie ohne Zweifel in ihrem mütterlichen Herzen; dann sich abermals an Raoul wendend, fragte sie:
»Dem jungen Grafen von Guiche ist nichts Schlimmes widerfahren? Er gehört nicht allein zu unsern Dienern, mein Herr, sondern auch zu unsern Freunden.«
»Nein, Madame,« antwortete Raoul, »er hat im Gegenteil an diesem Tage einen großen Ruhm errungen und es wurde ihm die Ehre zu Teil, voll, dem Herrn Prinzen auf dem Schlachtfelde umarmt zu werden.«
Die junge Prinzessin klatschte in die Hände, aber ganz beschämt, daß sie sich zu einer solchen Kundgebung der Freude hatte hinreißen lassen, wandte sie sich halb um und neigte sich über eine Vase voll Rosen, als wollte sie den Geruch einatmen.
»Laßt sehen, was uns der Graf schreibt,« sprach die Königin.
»Ich hatte die Ehre, Euerer Majestät zu sagen, daß er im Namen seines Vaters schrieb?«
»Ja, mein Herr.«
Die Königin entsiegelte den Brief und las:
»Madame und Königin,
»Da ich nicht die Ehre haben kann, Euch selbst zu schreiben, wegen einer Wunde, die ich an meiner rechten Hand erhalten, so lasse ich Euch durch meinen Sohn, den Grafen von Guiche, schreiben, von dem Ihr wißt, daß er ein eben so treuer Diener von Euch ist, als sein Vater, um Euch zu melden, daß wir die Schlacht von Lens gewonnen haben und daß dieser Sieg unfehlbar dem Kardinal Mazarin und der Königin eine große Gewalt über die Angelegenheiten von Europa geben muß. Möchte Eure Majestät, wenn sie meinem Rats trauen will, diesen Augenblick benutzen, um zu Gunsten ihres erhabenen Gemahls bei der Regierung des Königs nachdrückliche Schritte zu tun. Der Herr Vicomte von Bragelonne, der Euch diesen Brief übergeben wird, ist der Freund meines Sohnes, dem er aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben gerettet hat. Es ist ein Edelmann, dem sich Eure Majestät vollkommen anvertrauen kann, falls sie mir einen mündlichen oder schriftlichen Befehl zukommen zulassen hätte.
Ich habe die Ehre zu seinMit Ehrfurcht u. s. w.Marschall von Grammont.«
In dem Augenblick, wo von dem Dienst die Rede war, den er dem Grafen geleistet hatte, konnte sich Raoul nicht enthalten, der jungen Prinzessin den Kopf zuzuwenden, und er sah in ihren Augen einen Ausdruck unendlicher Dankbarkeit für seine Person. Es unterlag keinem Zweifel mehr, die Tochter von Karl I. liebte seinen Freund.
»Die Schlacht von Lens gewonnen!« sprach die Königin. »Sie sind glücklich hier, sie gewinnen Schlachten! Ja, der Marschall von Grammont hat Recht, das wird das Angesicht der Dinge verändern. Aber ich befürchte, es wirkt nicht für die Unseren, wenn es ihnen nicht gar schadet. Diese Nachricht ist neu, mein Herr,« fuhr die Königin fort, »ich weiß Tuch Dank, daß Ihr mir dieselbe mit so großer Eile überbracht habt. Ohne Euch, ohne diesen Brief hätte ich sie erst morgen, übermorgen vielleicht, die Letzte in Paris, erfahren.«
»Madame,« sprach Raoul, »der Louvre ist der zweite Palast, in welchen diese Nachricht gelangt ist; Niemand kennt sie noch, und ich habe dem Herrn Grafen von Guiche geschworen, diesen Brief Eurer Majestät zu übergeben, sogar ehe ich meinen Vormund umarmt haben würde.
»Euer Vormund ist ein Bragelonne, wie Ihr?« fragte Lord Winter. »Ich habe einst einen Bragelonne gekannt. Lebt er immer noch?«
»Nein, mein Herr, er ist tot, und von ihm hat mein Vormund, welcher in einem nahen Grade mit ihm verwandt war, das Gut geerbt, dessen Namen ich führe.«
»Und Euer Vormund, mein Herr?« fragte die Königin, welche nicht umhin konnte, an dem schönen jungen Manne Anteil zu nehmen, »wie heißt er?«
»Herr Graf de la Fère,« antwortete der junge Mann, sich verbeugend.
Lord Winter machte eine Bewegung des Staunens, die Königin schaute ihn freudestrahlend an.
»Der Graf de la Fère!« rief sie, »habt Ihr mir nicht diesen Namen genannt?«
Von Winter konnte nicht glauben, was er hörte.
»Der Herr Graf de la Fère!« rief er ebenfalls. »Oh! mein Herr, antwortet mir, ich bitte Euch: ist der Graf de la Fère nicht ein Mann, den ich einst als einen schönen, tapfern Herrn gekannt habe, ein Mann, der Musketier unter Ludwig XIII. war und jetzt ungefähr sieben und vierzig bis acht und vierzig Jahre alt sein kann?«
»Ja, mein Herr, ganz so ist es.«
»Und der unter einem entlehnten Namen diente?«
»Unter dem Namen Athos. Ich hörte kürzlich erst seinen Freund, Herrn d’Artagnan, ihm diesen Namen geben.«
»Es ist so, Madame, es ist so. Gott sei gelobt! Und er befindet sich in Paris?« fuhr der Lord, sich an Raoul wendend, fort. Dann wieder zu der Königin zurückkehrend: »Hofft, hofft, die Vorsehung erklärt sich für uns, da sie macht, daß ich diesen braven Edelmann auf eine so wunderbare Weise wiederfinde. Sagt mir, ich bitte, wo wohnt er, mein Herr?«
»Der Herr Graf de la Fère wohnt in der Rue Guénégaud im Hotel du Grand-Roy-Charlemagne.«
»Ich danke, mein Herr. Sagt diesem würdigen Freunde, er möge zu Hause bleiben; ich komme sogleich, ihn zu umarmen.«
»Mein Herr, ich gehorche mit großem Vergnügen, wenn Ihre Majestät mir Urlaub geben will.«
»Geht, Herr Vicomte von Bragelonne,« sprach die Königin, »geht und seid unserer Wohlgeneigtheit versichert.«
Raoul verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor den zwei Fürstinnen, grüßte Lord Winter und entfernte sich.
Von Winter und die Königin besprachen sich noch eine Zeit lang mit so leiser Stimme, daß die Prinzessin dieselben nicht hörte; aber diese Vorsicht war überflüssig, denn sie unterhielt sich mit ihren eigenen Gedanken.
Als Lord Winter Abschied nehmen wollte, sagte die Königin:
»Hört, Mylord, ich hatte dieses Diamantkreuz, das meiner Mutter gehörte, und diesen Sanct-Michaels-Stern, welchen ich von meinem Gemahl erhielt, bis jetzt bewahrt. Diese beiden Gegenstände sind ungefähr fünfzigtausend Franken Wert. Ich hatte geschworen, eher bei diesen kostbaren Pfändern Hungers zu sterben, als mich derselben zu entäußern; jetzt aber, da diese zwei Juwelen ihm und seinen Verteidigern nützlich sein können, muß man Alles dieser Hoffnung aufopfern. Nehmt sie, und wenn Ihr für Euere Expedition Geld braucht, verkauft sie ohne Scheu, Mylord. Seid Ihr aber im Stande, sie zu behalten, so bedenkt, Mylord, daß ich es betrachte, als hättet Ihr mir den größten Dienst geleistet, den ein Edelmann einer Königin zu leisten vermag, und daß derjenige, welcher mir am Tage unseres Glückes diesen Stern und dieses Kreuz wiederbringt, von mir und meinen Kindern gesegnet sein wird.«
»Madame,« erwiderte von Winter, »Euere Majestät wird von einem treu ergebenen Manne bedient werden. Ich gehe und hinterlege an sicherem Orte diese Gegenstände, welche ich nicht annehmen würde, wenn uns Mittel von unserem ehemaligen Vermögen übrig blieben; aber unsere Güter sind konfisziert, unser bares Geld ist versiegt, und wir sind dahin gekommen, uns aus Allem, was wir besitzen, Hilfsquellen machen zu müssen. In einer Stunde begebe ich mich zu dem Grafen de la Fère, und morgen soll Eure Majestät eine bestimmte Antwort erhalten.«
Die Königin reichte Lord Winter die Hand; er küßte sie ehrfurchtsvoll, und sie sagte, sich gegen ihre Tochter wendend:
»Mylord. Ihr hattet den Auftrag, diesem Kinde etwas von seinem Vater zu überbringen.«
Lord Winter war sehr erstaunt; er wußte nicht, was die Königin damit sagen wollte.
Die junge Henriette schritt lächelnd und errötend vor, bot dem Edelmanne ihre Stirne und sprach:
»Sagt meinem Vater: König oder Flüchtling, Sieger oder besiegt, mächtig oder arm, habe er in mir die gehorsamste und zärtlichste Tochter.«
»Ich weiß es, Prinzessin,« antwortete Lord Winter und berührte mit den Lippen die Stirne von Henriette.
Dann entfernte er sich, durchschritt, ohne zurückgeführt zu werden, die großen, verlassenen, dunkeln Gemächer und trocknete sich die Tränen, deren er sich, so abgestumpft er auch durch ein fünfzig Jahre langes Leben bei Hofe war, bei dem Anblick dieses zugleich so tiefen und so würdigen königlichen Unglücks nicht erwehren konnte.
III.
Der Oheim und der Neffe.
Lord Winter wurde von seinem Pferde und dem Lakaien an der Tür erwartet. Er ritt ganz in Gedanken versunken nach seiner Wohnung und schaute dabei von Zeit zu Zeit zurück, um die schwarze, schweigsame Facade des Louvre zu betrachten. Da erblickte er einen Reiter, der sich so zu sagen von der Mauer losmachte und ihm in einer gewissen Entfernung folgte; er erinnerte sich, bei seinem Ausgange aus dem Palais-Royal einen ähnlichen Schatten gesehen zu haben.
Der Lakai von Lord Winter, der nur einige Schritte hinter ihm war, verfolgte auch mit unruhigem Auge diesen Reiter.
»Tomy!« sprach der Lord und machte dem Bedienten ein Zeichen, sich zu nähern.
»Hier, gnädiger Herr.«
Und der Bediente ritt an die Seite seines Herrn.
»Hast Du den Menschen bemerkt, der uns folgt?«
»Ja. Mylord.«
»Wer ist es?«
»Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß er Eurer Herrlichkeit von dem Palais-Royal an gefolgt ist, im Louvre angehalten hat, um Euern Abgang zu erwarten, und mit Eurer Herrlichkeit wieder vom Louvre weggeritten ist.«
»Ein Spion des Kardinals,« sagte von Winter zu sich selbst. »Wir wollen uns stellen, als bemerkten wir seine Späherei gar nicht.«
Und er gab seinem Pferde die Sporen und drang in das Irrsal der Gassen, welche nach seinem auf der Seite des Marais liegenden Hotel führten. Lord Winter hatte lange auf der Place-Royale gewohnt und nahm ganz natürlicher Weise sein Quartier in der Nähe seiner ehemaligen Wohnung.
Lord Winter stieg vor seinem Gasthause ab und ging in seine Wohnung hinauf, wobei er sich den Spion beobachten zu lassen gelobte. Als er aber seine Handschuhe und seinen Hut auf einen Tisch legte, sah er in einem Spiegel vor sich eine Gestalt, welche auf der Schwelle des Zimmers erschien.
Er wandte sich um, Mordaunt stand ihm gegenüber.
Lord Winter erbleichte und blieb unbeweglich stehen. Mordaunt hielt sich auf der Schwelle, kalt, drohend und der Bildsäule des Gouverneurs ähnlich.
Es herrschte einen Augenblick eisiges Stillschweigen zwischen diesen zwei Männern.
»Mein Herr, ich glaubte Euch bereits begreiflich gemacht zu haben, daß mich diese Verfolgung ermüdet. Entfernt Euch also, oder ich rufe Leute und lasse Euch wegjagen, wie in London. Ich bin nicht Euer Oheim, ich kenne Euch nicht,« sagte der Lord.
»Mein Oheim,« versetzte Mordaunt mit seinem höhnischen Tone, »Ihr täuscht Euch, Ihr werdet mich diesmal nicht wegjagen lassen, wie Ihr es in London getan habt; nein, Ihr werdet es nicht wagen. Was den Umstand betrifft, daß Ihr leugnen wollt, ich sei Euer Neffe, so werdet Ihr Euch dies wohl zweimal überlegen, jetzt, da ich mancherlei Dinge erfahren habe, die ich vor einem Jahre nicht wußte.«
»Ei, was liegt mir an dem, was Ihr erfahren habt,« entgegnete Lord Winter.
»Oh! es liegt Euch viel daran, mein Oheim, das weiß ich gewiß, und Ihr werdet sogleich meiner Meinung sein,« fügte er mit einem Lächeln bei, wobei ein Schauer durch die Adern dessen lief, zu welchem er sprach. »Als ich mich zum ersten Male in London bei Euch einfand, geschah es, um Euch zu fragen, was aus meinem Erbgute geworden wäre. Als ich mich zum zweiten Male bei Euch einfand, geschah es, um Euch zu fragen, wer meinen Namen befleckt hätte. Diesmal stelle ich mich vor Euch, um eine Frage an Euch zu richten, viel furchtbarer, als alle die vorhergehenden, um Euch zu sagen, wie Gott zu dem ersten Mörder gesagt hat: ›Kain, was Hast du mit deinem Bruder Abel gemacht?‹ Mylord, was habt Ihr mit Eurer Schwester gemacht, mit Eurer Schwester, die meine Mutter war?«
Lord Winter wich vor dem Feuer dieser glühenden Augen zurück.
»Mit Eurer Mutter!« sagte er.
»Ja, mit meiner Mutter, Mylord,« antwortete der junge Mann, den Kopf von oben nach unten schüttelnd.
Von Winter machte eine heftige Anstrengung gegen sich selbst, tauchte in seine Erinnerungen, um einen neuen Haß daraus zu holen, und rief:
»Suchet, was aus ihr geworden ist, Unglücklicher, und fragt die Hölle; vielleicht wird Euch die Hölle antworten.«
Der junge Mann schritt nun im Zimmer, vor, bis er Auge in Auge Lord Winter gegenüber stand, und kreuzte die Arme.
»Ich habe den Henker von Bethune gefragt,« sprach Mordaunt mit dumpfer Stimme und das Gesicht leichenblaß vor Schmerz und Zorn, »und der Henker von Bethune hat mir geantwortet.«
Von Winter fiel auf einen Stuhl, als ob ihn der Blitz getroffen hatte, und bemühte sich vergebens, zu sprechen.
»Ja, nicht wahr,« fuhr der junge Mann fort, »mit diesem Worte erklärt sich Alles. Mit diesem Schlüssel öffnet sich der Abgrund. Meine Mutter hatte von ihrem Gatten geerbt, und Ihr habt meine Mutter ermordet! Mein Name sicherte mir das väterliche Erbteil, und Ihr habt mich meines Namens beraubt. Als Ihr mich meines Namens beraubt hattet, beraubtet Ihr mich auch meines Vermögens. Ich wundere mich jetzt nicht mehr, daß Ihr mich nicht anerkennen wollt; wenn man sich Sauber weiß, ist es nicht ganz bequem, den Menschen, welchen man arm gemacht hat, seinen Neffen zu nennen, wenn man sich Mörder weiß, dem Menschen, den man zur Waise gemacht hat, den Titel seines Neffen zu gönnen.«
Diese Worte brachten eine ganz andere Wirkung hervor, als Mordaunt erwartet hatte. Lord Winter erinnerte sich, welches Ungeheuer Mylady gewesen war. Er erhob sich ruhig und ernst und bezwang mit seinem strengen Blicke das exaltierte Auge des jungen Mannes.
»Ihr wollt in dieses furchtbare Geheimnis dringen, mein Herr?« sprach er. »Nun wohl, es sei! Erfahrt also, wer die Frau war, über welche Ihr mir Rechenschaft abfordert: Diese Frau hat aller Wahrscheinlichkeit nach meinen Bruder vergiftet, und um mich zu beerben, wollte sie mich ebenfalls ermorden, dafür habe ich Beweise. Was sagt Ihr hierzu?«
»Ich sage, daß es meine Mutter war!«
»Sie hat einen gerechten, guten und reinen Mann, den Herzog von Buckingham, erdolchen lassen. Was sagt Ihr zu diesem Verbrechen, von welchem ich die Beweise habe?«
»Daß es meine Mutter war!«
»Nach Frankreich zurückgekehrt, hat sie in dem Kloster der Augustinerinnen in Bethune eine Frau vergiftet, welche einen ihrer Feinde liebte. Wird Euch dieses Verbrechen von der Gerechtigkeit der Strafe überzeugen? Ich habe die Beweise für dieses Verbrechen. Was sagt Ihr dazu?«
»Daß es meine Mutter war!« rief der junge Mann, der seinen drei Ausrufungen eine stufenweise zunehmende Verstärkung gegeben hatte.
»Von Mordtaten, von Ausschweifungen belastet, Jedermann verhaßt, drohend wie ein blutdürstiger Panther, unterlag sie den Schlügen von Männern, welche sie in Verzweiflung gebracht hatte, ohne daß ihr je von denselben der geringste Schaden zugefügt worden war. Sie fand Richter, welche ihre schändlichen Attentate hervorriefen, und dieser Henker, den Ihr gesehen habt, der Henker, von dem Euch, wie Ihr behauptet, Alles erzählt worden ist, dieser Henker, wenn er Euch Alles erzählt hat, muß Euch auch gesagt haben, wie er vor Freude bebte, als er an ihr die Schmach und und den Selbstmord seines Bruders rächte. Eine verkehrte Tochter, eine ehebrecherische Gattin, eine entartete Schwester, eine Giftmischerin. eine Mörderin, fluchwürdig bei allen Menschen, die sie kennen lernten, bei allen Nationen, welche sie in ihrem Schoße aufgenommen hatten, starb sie verflucht von dem Himmel und der Erde. Das ist das Bild dieser Frau.«
Ein Schluchzen, stärker als der Wille von Mordaunt, zerriß ihm die Kehle, machte das Blut in sein leichenbleiches Gesicht steigen; er ballte die Fäuste und rief, das Antlitz von Schweiß triefend, die Haare auf der Stirne gesträubt, wie die von Hamlet, von Wut verzehrt:
»Schweigt, mein Herr, es war meine Mutter. Ihren ungeordneten Lebenswandel kenne ich nicht, ihre Verbrechen kenne ich nicht! Aber ich weiß, daß ich eine Mutter hatte, daß fünf Männer, gegen eine Frau verbunden, sie heimlich, nächtlicher Weise, schweigend wie Feige ermordet haben. Ich weiß, daß Ihr dabei wäret, mein Herr, daß Ihr dabei wäret, mein Oheim, daß Ihr, wie die Anderen und stärker als die Anderen, sprächet: Sie muß sterben! Ich sage Euch also, höret wohl auf diese Worte, und sie mögen sich in Euer Gedächtnis einprägen, damit Ihr sie nie vergesset: Dieser Mord, der mir Alles geraubt hat, dieser Mord, der mich namenlos, der mich arm, der mich boshaft und unversöhnlich gemacht hat… ich werde zuerst von Euch und dann von Euern Genossen, sobald ich sie kenne, Rechenschaft darüber verlangen!«
Haß in den Augen, Schaum auf dem Munde, die Fäuste geballt, machte Mordaunt einen Schritt mehr, einen furchtbar drohenden Schritt gegen Lord Winter.
Dieser griff mit der Hand nach dem Degen, und sagte mit dem Lächeln des Mannes, der seit dreißig Jahren mit dem Tode spielt:
»Wollt Ihr mich ermorden, mein Herr? Dann erkenne ich Euch als meinen Neffen, denn Ihr seid der Sohn Eurer Mutter.«
»Nein,« versetzte Mordaunt, und er zwang alle Fibern seines Gesichtes, alle Muskeln seines Körpers, ihren Platz wieder einzunehmen. »Nein, ich werde Euch nicht töten, wenigstens in diesem Augenblicke nicht; denn ohne Euch würde ich die Andern nicht kennen lernen. Aber wenn ich sie kenne, dann zittert! Ich habe den Henker von Bethune erstochen; ich habe ihn ohne Barmherzigkeit erstochen, und er war der am Mindesten Schuldige von Euch Allen.«
Nach diesen Worten entfernte sich der junge Mann, und stieg mit hinreichender Ruhe, um nicht bemerkt zu werden, die Treppe hinab. Dann ging er auf dem inneren Treppenplatze vor Tomy vorüber, der, auf das Geländer gelehnt, nur auf einen Ruf seines Herrn wartete, um zu ihm hinauf zu eilen.
Aber Lord Winter rief nicht. Im höchsten Maaße erschüttert, blieb er mit gespanntem Ohre stehen. Erst als er den Tritt des Pferdes hörte, fiel er halb, ohnmächtig auf einen Stuhl zurück und sprach:
»Mein Gott, ich danke dir, daß er nur mich kennt!«
IV.
Vaterschaft.
Während diese furchtbare Szene sich bei Lord Winter ereignete, saß Athos am Fenster seines Zimmers, den Ellenbogen auf einen Tisch, den Kopf auf seine Hand gestützt, und hörte zugleich mit Augen und Ohren Raoul zu, der ihm die Abenteuer seiner Reise und die einzelnen Begebenheiten der Schlacht erzählte.
Das schöne, edle Antlitz von Athos drückte ein unsägliches Glück bei der Mitteilung dieser ersten, so frischen und so reinen Gemütsbewegung aus. Er sog die Töne dieser jugendlichen Stimme ein, welche sich bereits für schöne Gefühle begeisterte, wie man eine harmonische Musik einsaugt. Er vergaß, was Düsteres in der Vergangenheit, was Wolkiges in der Zukunft lag. Man hätte glauben sollen, durch die Rückkehr dieses vielgeliebten Kindes wären aus seinen Befürchtungen Hoffnungen geworden. Athos war glücklich, glücklich, wie nie zuvor.
»Ihr habt also der großen Schlacht beigewohnt und daran Anteil genommen, Bragelonne?« sprach der ehemalige Musketier.
»Ja, Herr.«
»Und der Kampf war heiß, sagt Ihr?«
»Der Herr Prinz hat elfmal in Person angegriffen.«
»Er ist ein großer Kriegsmann, Bragelonne.«
»Er ist ein Held. Ich habe ihn nicht einen Augenblick aus dem Gesichte verloren. O wie schön ist es, mein Herr, sich Condé zu nennen und seinen Namen so zu tragen!«
»Ruhig und glänzend, nicht wahr?«
»Ruhig wie bei einer Parade, glänzend wie bei einem Feste. Als wir uns dem Feinde näherten, geschah es im Schritte. Man hatte uns verboten, zuerst zu schießen, und wir marschierten gegen die Spanier, welche sich, die Muskete auf dem Schenkel, auf einer Anhöhe hielten. Auf dreißig Schritte zu ihnen gelangt, wandte sich der Prinz nach den Soldaten um und sagte: »Kinder, Ihr werdet eine furchtbare Ladung auszuhalten haben. Hernach aber, seid unbesorgt, habt Ihr geringe Arbeit mit allen diesen Leuten.« Es herrschte eine solche Stille, daß Freunde und Feinde diese Worte hörten. Dann seinen Degen erhebend, rief er:
›Blaset, Trompeter!‹
»Gut, gut, wenn »sich diese Gelegenheit findet, werdet Ihr es eben so machen, Raoul, nicht wahr?«
»Allerdings, Herr, wenn ich es vermag, denn es dünkte mich sehr groß und schön. Als wir noch zehn Schritte näher gekommen waren, sahen wir alle diese Musketen sich wie eine glänzende Linie senken; denn die Sonnenstrahlen funkelten auf den Läufen. ›Im Schritt, Kinder, im Schritt!‹ sprach der Prinz, ›dies ist der Augenblick!‹
»Hattet Ihr bange, Raoul?« sagte der Graf.
»Ja, Herr,« antwortete der Jüngling naiv. »Ich fühlte eine große Kälte in meinem Herzen, und bei dem Worte Feuer, das in spanischer Sprache in den feindlichen Reihen ertönte, schloß ich die Augen und dachte an Euch.«
»Wirklich, Raoul?« sprach Athos und drückte ihm die Hand.





























