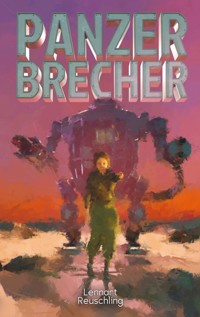Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"ZWERGENSCHRITTE" erzählt die tragikomische Geschichte von Lauchbjörn Pfostenson, einem Zwerg, der so unzwergisch ist, wie man es sich nur vorstellen kann. Als Kräutersammler von seinen Mitzwergen unter Tage oft geringgeschätzt, ändert sich alles, als er auf Rho'sha und Ilyrana trifft. Die orkische Schamanin und die elfische Kriegerin haben sich Aufgaben verschrieben, gegen die Lauchbjörns eigene Probleme plötzlich überraschend unbedeutend erscheinen - und je länger er mit ihnen reist, desto klarer wird ihm, dass es mehr als nur einen Weg gibt, sich des Zwergseins würdig zu erweisen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 949
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 1
Etwa vierzig Wagenräder außerhalb der kleinen Stadt Thôr Kera, am zerklüfteten Ausläufer des Verivane-Gebirges knapp oberhalb der Baumgrenze, wurde eine verirrte Spinnenmotte in einen Luftschacht gesaugt, und damit war ihr Schicksal besiegelt.
Kaum hatten die äußersten Wirbel des stetigen Luftstroms zugegriffen und das winzige, fragile Insekt durch die rostfleckigen Lamellen gezogen, als es auch schon in wilder Fahrt einen langen, gewundenen Tunnel hinabtrudelte, in dem eindringendes Regenwasser jahrzehntelang den Fels abgetragen und rundgeschliffen hatte. Die Motte, desorientiert und völlig überfordert, schlug emsig mit ihren dünnen Flügeln, um sich zu stabilisieren – aber es half nichts. Eine zielgerichtete Kraft, Luft, die irgendwo hinter ihr in den Berg gezogen wurde und scheinbar an einer anderen Stelle wieder austrat, riss sie mit sich und ließ das zappelnde Insekt in einem Malstrom hin und her taumeln, bis es endlich, nach schier endlosen Momenten, von einem weiteren metallenen Lüftungsgitter ausgespuckt wurde und in einem von Fackelschein erleuchteten unterirdischen Raum landete.
Die Spinnenmotte überschlug sich ein paar Mal, flatterte erratisch hin und her, fand ihr Gleichgewicht wieder und ließ sich erschöpft auf der nächstbesten Oberfläche nieder, die sie finden konnte: Einem Gewirr aus dicken, kupferroten Strängen, chaotisch ineinander verheddert und überkreuzt, jedes einzelne so gigantisch, dass die Motte beinahe in dem Meer aus drahtigen Fasern verschwand. Sie setzte ihre feinen Gliedmaßen auf den starren orangeroten Teppich, klappte die Flügel ein und sank erschöpft in sich zusammen.
Dann ertönte ein Schniefen von der Lautstärke eines Orkans direkt neben ihr, und ein erneuter Luftstrom ließ sie im linken Nasenloch eines Zwergs verschwinden, eines kompakten, muskulösen Kerls mit dicker Nase, tiefliegenden grünen Augen und einem Schopf rostroter Haare, die beinahe nahtlos in einen zu dicken Zöpfen geflochtenen Vollbart übergingen.
Lauchbjörn Pfostenson erwachte grunzend, räusperte sich, schluckte und schmatzte irritiert, um den komischen Geschmack auf seiner Zunge loszuwerden.
Er gab ein markerschütterndes Gähnen von sich, streckte die kurzen, kräftigen Arme aus und ließ Schultern und Rücken hörbar knacken. Dann warf er die Felldecke von sich, kroch aus der säuberlich in die Felswand gehauenen Schlafnische und richtete sich auf.
Er befand sich in einem einfachen Raum, dessen Boden mithilfe von Spitzhacken und schweren Walzen begradigt worden war. Ein schlichter hölzerner Tisch, schmucklos und zweckdienlich, sowie eine Bank und eine breite Truhe nahmen einen Großteil des Zimmers ein. Gegenüber der Schlafnische führte eine schmale Steintreppe durch einen kurzen Tunnel aus dem Zimmer hinaus.
Der Zwerg wankte verschlafen zum Tisch, stützte die Hände auf das rissige Holz und versenkte seinen Schädel in einer Metallschüssel voller eiskaltem Wasser. Er prustete und gurgelte, wischte sich mit den flachen Händen durch das Gesicht, und war hinterher zwar nicht sauberer, aber wenigstens endgültig wach.
„Na endlich!“, ertönte eine resolute Stimme jenseits der kleinen Treppe. „Sieh zu, dass du in deine Stiefel kommst, Junge! Der Tag ist längst überreif.“
Lauchbjörn gab einen unartikulierten Laut der Bestätigung von sich. Er öffnete die Kleidertruhe, entnahm ihr einen großen Rucksack, ein Paar dicker kniehoher Stiefel und eine Wildlederweste, deren Dutzende Kratzer, Nähte und Flecken ihr den Eindruck eines Artefakts verliehen, das schon seit Generationen genutzt und weitervererbt worden war. Er zog die Weste über seine schlichte Tunika, schlüpfte in die Stiefel, warf sich den Rucksack über die Schulter und stieg die Stufen empor in den Hauptraum. Das zentrale Zimmer der Wohnung war größer und geräumiger, bot Platz für eine kleine, gemütliche Küche, einen Kamin und einen größeren Tisch, der von zwei Holzbänken gesäumt war. In einer Ecke standen improvisierte Trockengestelle, mit Erde gefüllte Tonschalen und zahlreiche bis zur Blindheit zerkratzte Gläser voller getrockneter, zermahlener oder eingelegter Pflanzen, Utensilien, die die Werkstatt eines Kräutersammlers und Arzneikundigen bildeten.
Als er eintrat, entstieg gerade eine weitere Person einem der anderen niedrigen Durchgänge, der den Hauptraum mit einem weiteren privaten Zimmer verband. Sie ähnelte Lauchbjörn in Statur und den Gesichtszügen, wenngleich sie noch kleiner war als er, hagerer, gebeugter, und mit grauen Strähnen und dichten Falten, die auf ihr fortgeschrittenes Alter hinwiesen. Ihre grünen Augen hingegen, obgleich von beginnender Trübheit durchsetzt, waren wach und voller Eifer.
„Du hast verschlafen, Sohn“, stellte Lotta Isadyr fest.
„Tut mir leid, Mutter“, gab Lauchbjörn zerknirscht von sich. „Der Rückweg gestern Abend war lang, und die Zinnoberrinde musste noch geräuchert werden, und...“
Seine Mutter machte eine fuchtelnde, wegwerfende Geste. „Wenn du deine Zeit anstelle für das Ausdenken von Ausreden einfach für deine Arbeit benutzen würdest, bei den Göttern, würden wir vermutlich mittlerweile im Herzstollen wohnen“, tadelte sie, aber ihre Stimme war von gutmütigem Amüsement geprägt. Als Lauchbjörn verschämt zu ihr hinüber schielte, grinste seine Mutter kaum verhalten. Er entspannte sich und seufzte: „Ich hätte wesentlich mehr Zeit, wenn wir endlich den Transporttunnel zum Fûrne-Ausläufer ziehen würden, wie ich es schon seit Jahren immer wieder vorschlage.“
Seine Mutter schnalzte tadelnd mit der Zunge und winkte ab.
„Junge, du würdest bestimmt ruhiger schlafen, wenn du dir das endlich aus dem Kopf schlägst. Wenn Lukars und Roben sagen, dass es nicht geht, wärst du gut damit beraten, ihnen zu glauben. Sie haben schon Erz aus dem Berg gekratzt, als du noch in den Windeln lagst.“ Während sie sprach, hatte sie ein säuberlich verschnürtes Päckchen Ölpapier aus der Küche zum Tisch gebracht und es geöffnet. Der betörend würzige Duft von Rauchfleisch stieg Lauchbjörn in die Nase, und er nahm sich eine Scheibe des deftigen Bratens.
Seine Mutter fuhr fort: „Und obendrein, Junge, kannst du wohl kaum erwarten, dass deinem kleinen privaten Kräutersammlertunnel mehr Wichtigkeit eingeräumt wird als dem neuen Stollen im Gatterblock. Wer will schon Kräuter fördern, wenn wir Silber direkt vor der Nase haben? Oder Echten Blaustein?“
„Na ja, es juckt sie so lange nicht, bis wieder einer von ihnen eine Triefnase hat. Oder ein Schmerzmittel für einen verstauchten Knöchel braucht. Dann sind sie auf einmal ganz scharf auf unsere Kräuter“, stellte Lauchbjörn laut kauend fest.
„Du klingst wie dein Vater.“ Lotta lächelte ein wenig abwesend. „'Wir Kräutersammler, Jäger, Kundschafter, Händler, Bauern, Boten… Wo wäre Luntor, wo wäre das Zwergenreich, wenn es uns nicht gäbe? Wir sind das Blut, das durch das kalte, steinerne Herz des Berges pumpt.' Das hat er immer gesagt.“
Lauchbjörn brummte: „Vielleicht hätte er als Dichter berühmt werden können. Manche Künstler haben nie eine Hacke gehalten und wohnen trotzdem im Herzstollen. Und wir Oberflächenarbeiter werden noch verspottet. Ist ein Zwerg nicht unter der Erd’...“
„Ist er nichts wert“, vervollständigte seine Mutter den alten Spruch mit einer wegwerfenden Handbewegung. „Ach, Sohn, du gibst ja wohl hoffentlich nichts auf diese archaischen Sprüche?“
„Aber es ist wahr, Mutter!“, ereiferte er sich gedämpft durch einen Mund voll Schinken. „Vater hat sich bis zu seinem Lebensende als Kundschafter die Füße wund gelaufen, und es nie zu Ruhm oder Reichtum gebracht. Alles, was ich kann und tue, habe ich von ihm oder von Meister Torfson gelernt – aber was ist das wert, wenn es zu nichts und wieder nichts führt?“
Er bereute die Worte schon in dem Moment, in dem er sie ausgesprochen hatte. Verhalten sah er zu seiner Mutter hinüber, die ihm ernst eine Hand auf den Arm legte. Aber ihre Stimme war nicht wütend, sondern besänftigend, als sie erwiderte: „Dein Vater war ein guter Zwerg. Er hat uns ernährt und uns einen Platz in dieser Mine erhalten, aber viel wichtiger: Trotz all seinem Gemecker über die Trennung zwischen den Bergleuten und allen anderen hat er immer daran geglaubt, dass wir unseren Platz hier verdient haben.“ Sie nahm seine Hand und drückte sie. „Und wenn er dir nur dieses eine beigebracht hat, dann wäre mir das schon genug.“
Lauchbjörn spürte einen seltsamen Kloß im Hals. Er sah weg und räusperte sich. Nickte, ohne seine Mutter anzusehen. Lotta schien seine Beklemmung zu spüren, denn sie lachte leise, schlug ihm sachte gegen den Oberarm und sprach: „Und jetzt gehst du da raus und findest eine ganze Menge seltener Kräuter, die du für ordentlich Silber verkaufen kannst. Auf, auf! Der Tag hat nur vierundzwanzig Dochte!“
Er straffte die Schultern, nickte und stand auf. Griff nach seinem Werkzeug, das er am Abend zuvor auf den Tisch geworfen hatte. Er schob sich die alte Sichel, deren gekrümmte Schneide mit den Jahren beinahe zu papierner Dünne abgeschliffen worden war, in eine Schlaufe an seinem Gürtel. Dann küsste er seine Mutter auf die Wange, drehte sich um und trat durch die niedrige Eingangstür der Wohnung hinaus in die Stadt.
Das dumpfe Hallen ferner Hacken und Hämmer empfing ihn, gemischt mit den Geräuschen hunderter Schritte und zahlreicher angeregter Gespräche, als er in den Kernstollen hinaustrat. Dieser immense Hohlraum, der das Zentrum der unterirdischen Stadt Luntor bildete, erstreckte sich in Form eines langen, schmalen, aber sehr hohen Quaders bis tief in den Berg hinein. Während die wirklich großen Zwergenstädte angeblich über Höhlen oder Hallen verfügten, in denen man einen Stern hätte unterbringen können, war der Kernstollen von Luntor weniger verschwenderisch angelegt. Er war nur so breit, dass das Licht der regelmäßig verteilten silberbeschichteten Spiegel bis in eine vernünftige Tiefe vordringen konnte, bevor es auf den wirklich niedrigen Ebenen von Fackeln und Laternen unterstützt werden musste. An den längs verlaufenden Wänden reihten sich Stockwerk um Stockwerk von Wohnungen übereinander, ebenso wie jene, aus der Lauchbjörn gerade herausgetreten war. Er selbst befand sich nun auf einem Außengang, der dort, wo die Wohnungstüren im Fels saßen, begann, und sich etwa fünf Schritt weit in den offenen Raum hinein erstreckte, bevor er an einer schlichten, etwa brusthohen steinernen Begrenzung endete. Von dort aus konnte man die gegenüberliegende Seite des Stollens erblicken und dasselbe Bild offenbarte sich: hunderte, vielleicht tausende von Wohnungseingängen, die auf meterdicke Steinplattformen hinausführen, allesamt nach vorne hin begrenzt von schmucklosen Mauern, und getragen von symmetrisch übereinander angeordneten Gruppen von ebenso schmucklosen Säulen. Im Gegensatz zur Gleichförmigkeit dieser grundlegenden Infrastruktur waren die Eingänge zu den Wohnhöhlen selbst umso vielseitiger. Wie in den meisten Zwergenstädten Lymerilions war auch hier in Luntor die Tür eines Zwerges sein Aushängeschild, ein Symbol seiner Zunft und auch der Erfolge, die er in jener zu verzeichnen hatte. Da gab es Türen, in deren steinernen Rahmen kunstvolle Winkel und Bögen aus silbernen und goldenen Metallen eingelegt worden waren, Zeugnisse der Schmiedekunst. Andere wiederum wiesen grobe, unbehauene Stücke von Lapislazuli, Onyx, farbigem Quarzit oder Marmor auf, als Würdigung für die Entdeckung eines besonders großen oder hochqualitativen Vorkommens. Wieder anderen Eingängen waren keine weiteren Materialien hinzugefügt worden, stattdessen hatte man das Holz des Türblatts oder den Stein des Rahmens auf besonders raffinierte und fingerfertige Art behauen und geformt, so dass die große handwerkliche Kunst der dort ansässigen Sippe von Steinmetzen, Bildhauern oder Schreinern zum Ausdruck gebracht wurde.
Lauchbjörn warf einen flüchtigen, beinahe unwilligen Blick auf seine eigene Tür. An dem einfachen, rauen Gesteinsrahmen hing ein vertrockneter Strauß Blumen. Er war schön gewesen, als Lauchbjörn ihn vor einigen Tagen voller Stolz von der Arbeit über Tage mitgebracht hatte. Aber Grünes hielt nicht so lange wie Stein und Erz. Die etwa augapfelgroße Kugel aus Bernstein, die darunter hing, war von einer dicken Schicht gräulichen Baustaubs bedeckt. Lauchbjörn wischte sie mit dem Daumen weg; aus der Tiefe des sonderbar dichten Harzklumpens blickte ihn eine winzige, fingernagelgroße Libelle an.
Er seufzte.
Dann fasste er den Rucksack fester und ging los.
Da er verschlafen hatte, gestaltete sich sein Arbeitsweg etwas weniger mühsam als sonst. An den meisten Tagen war es so, als müsse er gegen den Strom schwimmen; während die meisten anderen Männer und Frauen jeden Morgen als stetige Zwergenmasse in Richtung Norden strebten, den offenen Stollen und den Werkstätten entgegen, war Lauchbjörn einer von vielleicht vierzig, fünfzig Zwergen, die sich stattdessen zum Eingang der Stadt aufmachten, eng an die Wände und Türen der Wohnquartiere gedrückt, oder sich auf der gegenüberliegenden Seite von Säule zu Säule kämpfend. In all den Jahren war Lauchbjörn Pfostenson klar geworden, dass seine Arbeit, seine Aufgabe genauso wichtig für die Erhaltung der Stadt und das Überleben ihrer Bewohner war wie jedes andere Handwerk auch. Aber dieses Wissen konnte die irgendwo tief in ihm schwelende Flamme der Scham nicht ganz ersticken, das Gefühl der Unzulänglichkeit, das er empfand, jeden Morgen, wenn er sich gegen den Strom der Menge in Richtung Ausgang bewegte und die Blicke in den Augen zahlreicher seiner Artgenossen sah, die mit Schaufel und Spitzhacke in die dunklen Eingeweide des Berges hinabstiegen, während er hinaufkletterte zu Sonne, frischer Luft und sprießendem Leben.
Jemand muss es ja tun, sagte er sich, aber es klang selbst in seinem Kopf nach einer Ausrede.
Nach einem beträchtlichen Marsch erreichte er das vordere Ende des Kernstollens, wo die Dutzenden von Galeriegängen sich erst nach innen erweiterten und zu konzentrisch übereinander angeordneten Balkonen wurden, die dann wiederum in einer Wand endeten. In diese waren ein Dutzend großer, befestigter Gänge eingeschlagen worden, jeder davon von einem Bronzeschild gekrönt und beschriftet in den klaren, geometrischen Symbolen der zwergischen Sprache Loc Daun. Die drei zentral gelegenen Öffnungen ignorierte Lauchbjörn. Sie waren mit dem Wort „Aufzug“ betitelt, und die komplexen mechanischen Systeme dienten dem Zweck, große Mengen an wertvollem Gestein für den Handel zur Oberfläche zu bewegen – oder eine Schar gerüsteter Zwerge, wenn es notwendig wurde, die Stadt zu verteidigen. Auch, wenn beides nur sehr selten vorkam und die Aufzüge damit die meiste Zeit stillstanden, hätte niemand für einen kleinen Sammler wie Lauchbjörn die raffinierte Maschinerie angeworfen, um ihn über Tage zu befördern. Also steuerte er eines der außen liegenden Tore an, trat hindurch, und fand sich in einem schmalen Schacht wieder, in dem eine wuchtige, im Zickzack verlaufende Rampe aus naturbelassenem Thurnstein sich in Höhen und Tiefen erstreckte, die vermutlich schwindelerregend und furchteinflößend gewesen wären, hätte man sie zur Gänze erblicken können. Aber es gab keinen freien Raum zwischen den sich überlappenden Steinrampen, so dass nur die zwergischen Nummernrunen über den angrenzenden Durchgängen darauf hinwiesen, auf welcher Ebene man sich gerade befand.
Lauchbjörn seufzte und machte sich an den Aufstieg. Er schien wie immer ewig zu dauern – die durch die dicke Seitenwand dumpf klingende Atmosphäre des geschäftigen Kernstollens wurde nur schleichend leiser, und Lauchbjörns eigene Geräusche, sein schweres Atmen, die Ledersohlen seiner Stiefel auf dem grauen Gestein, das Klappern der Sichel, hallten hohl und vielstimmig von den nackten Steinwänden wider. Wie immer ging er noch eine Rampe, und dann noch eine, und noch eine, immer nur darauf fokussiert, die jeweils nächste zu erklimmen, nicht die danach, mit der würde er sich beschäftigen, wenn er dort ankam...
Er war durstig, außer Atem, und seine Beine taten weh, als seine empfindlichen Zwergenaugen endlich die erste minimale Veränderung der Lichtverhältnisse wahrnahmen. Ein schwacher, kreidefarbener Schimmer, der sich in die drückende Düsternis des Ganges schlich, und mit dem Lauchbjörns Dunkelsicht ein winziges bisschen weniger zu kämpfen hatte als zuvor in der Dunkelheit des Bergs.
Dennoch dauerte es eine weitere gefühlte Ewigkeit, bis er die verbleibenden zehn, zwanzig, dreißig Rampen erklommen hatte, und endlich Tageslicht sah.
Die letzte Rampe endete an einem weiteren Torbogen, der hoch und breit genug für vier Zwerge gewesen wäre, und Lauchbjörns erster Schritt aus dem Rampenschacht hinaus führte ihn von rohem Thurnstein auf polierten schwarzen Marmor.
Er war aus einer Wand herausgetreten, die wie ein umgekehrtes Spiegelbild ihres unten im Berg liegenden Vorbilds aussah, mit einer Ansammlung an beschrifteten Öffnungen, die zu Treppenhäusern, Rampen und Lastenaufzügen führten. Aber hier, wo hoher Besuch sich zum ersten Mal einen Eindruck von der zwergischen Architektur bilden konnte, war die Wand glatt, auf Hochglanz poliert, tief blauschwarz und von feinen alabasterfarbenen Adern durchzogen. Die Türrahmen zu den Abstiegen besaßen silberbeschlagene Verzierungen, und die Schilder darüber waren nicht aus Bronze, sondern aus gestanztem Gold. Und jenseits davon erstreckte sich eine weitläufige Halle, viel kleiner als der Kernstollen, aber dafür in alle Richtungen ähnlich lang, beinahe würfelförmig, so dass Lauchbjörn das Gefühl hatte, hier freier atmen zu können. Was vermutlich stimmte, denn am anderen Ende der mit Marmor verkleideten Eingangshalle erhob sich ein zur Außenwelt offener Torbogen, der beinahe die halbe Höhe des Raumes einnahm, und dessen metallbeschlagene Torflügel sich aus Lauchbjörns Perspektive ausnahmen wie die Silhouetten von Schlachtschiffen, so enorm waren sie. Beinahe schien es, als hätten seine Vorfahren, die vor tausenden von Jahren diese Stadt errichtet hatten, sie für Einwohner gebaut, die viel größer waren als Zwerge, Elfen oder Menschen.
Die Eingangshalle selbst war größtenteils leer. Abgesehen von ungefähr zwanzig in Stahlrüstungen steckenden Wachsoldaten, die das große Tor und die Abstiegspforten bewachten oder durch die Halle patrouillierten, befanden sich noch etwa zwei Dutzend Zivilisten im Raum. Die meisten waren zwergische Händler, die mit ihren Kunden – anderen Zwergen, aber auch dem ein oder anderen Menschen – neben großen Planwagen oder Kisten voller Waren standen und lautstark verhandelten. In einiger Entfernung, rechtsseits des Ausgangs und ein gutes Stück von den grimmig dreinblickenden Torwachen entfernt, hatte sich eine kleine Schar Zwerge um ein offenes Lagerfeuer versammelt, dessen helle Rauchfahne sich ungehindert der weit oben liegenden Decke der Eingangshalle entgegen reckte und zerfaserte, lange, bevor sie sie hätte erreichen können.
Lauchbjörn grinste müde, durchquerte die Halle und ging auf den kleinen Kreis zu.
Einer der Zwerge hob den Kopf, als Lauchbjörn sich näherte, und grinste ebenfalls. „Hey, Meister Kräutersammler, verschlafen?“, rief er, und seine Kumpane wandten sich um, beobachteten den herannahenden Lauchbjörn mit vielsagenden, amüsierten Mienen.
„Wieder zu viel vom eigenen Tee getrunken?“, fügte der Sprecher hinzu. Er war ein ältlicher Zwerg, dessen Nase und Kinn so verkrümmt waren, als zielten sie darauf ab, sich irgendwo weiter entfernt vom Gesicht wieder zu treffen. Seine Haut war roh und ledrig, und die gigantischen grauweißen Augenbrauen schienen seinem Bart Konkurrenz machen zu wollen. Er trug Hose und Weste aus nach innen gewendetem Pelz, deren äußere Lederschicht fleckenweise dunkel gebeizt worden war. An seinem Gürtel baumelten mehrere zu Fangschlingen geknüpfte Lederschnüre, und über seiner Schulter hing ein Köcher mit einem Dutzend Pfeile darin. Der dazugehörige Bogen steckte mit abgespannter Sehne in einem einfachen Stofffutteral.
„Meister Torfson“, grüßte Lauchbjörn den gealterten Jäger seufzend, ohne auf den vermeintlich witzigen Kommentar zu seinem Kräuterkonsum einzugehen. Er drehte sich den anderen Zwergen zu. „Famke. Elfric. Burkhard. Bin wohl nicht der Einzige, der es heute langsam angehen lässt.“
Sie nickten ihm zu und rückten auseinander, damit er sich ebenfalls ans Feuer setzen konnte. Famke Annadyr, eine untersetzte junge Frau mit schmalen Schultern, die ihr eine fast kegelförmige Silhouette gaben, reichte Lauchbjörn einen dampfenden Krug Met. Er nahm ihn dankbar entgegen. Die Zwergin, die ihre blonden Haare zu einem zweckmäßigen, aber dennoch kunstvollen umkränzten Knoten am Hinterkopf gebündelt hatte, trug die aus lappenartigen Schichten bestehende grüne Kleidung einer Kundschafterin, inklusive der weit ausgeschnittenen Kapuze und der mit gewalztem Leder beschichteten Sohlen, die besonders leise beim Laufen waren. „Wohl bekomm's“, brummte sie.
Er pustete vorsichtig auf sein heißes Getränk. Der Met war höchst willkommen – hier, am Feuer, konnte man beinahe vergessen, wie stechend kalt es draußen im Verivane-Gebirge war. Der Abstieg zur Baumgrenze würde eine Weile dauern. Einen Docht, manchmal zwei. Der Aufstieg zurück noch länger, je nachdem, wie viel Beute man mitbrachte. Das war auch der Grund, warum viele Jäger und Sammler drei, manchmal vier Tage im Wald blieben, und das Zerlegen, Konservieren und Verarbeiten der tierischen und pflanzlichen Güter direkt vor Ort erledigten.
„Lauchbjörn? Noch da?“, fragte eine zurückhaltende Stimme neben ihm. Er grinste und riss sich von seinen abschweifenden Gedanken los. „Ja, ich bin hier, Elfric.“ Der junge Zwerg neben ihm, ein muskulöser und für Zwergenstandards beinahe schlanker Typ, schien ungefähr in Lauchbjörns Alter zu sein. Er hatte seine braunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden und trug mehrere hölzerne Perlen und Hülsen in seinen Bart verdrillt. Sein Bogen war kleiner als der von Ulf Torfson, aber dafür saß er auf einer großen ledernen Sitzkiepe, aus der es gelegentlich klirrte und raschelte, wenn der Zwerg sein Gewicht verlagerte. Wie Lauchbjörn wusste, befanden sich darin ein Dutzend verschiedener Fallen, Schlingen, Fußangeln und Stolperdrähte, die Elfric Martynson beinahe kunstvoll einzusetzen wusste. Die beiden zogen oft zusammen los, um jemanden zum Reden zu haben, während Lauchbjörn Kräuter sammelte und Elfric fernab seiner Fallen darauf wartete, dass etwas hineinlief.
„Du hast wieder diesen Blick“, stellte Elfric mit vorsichtigem Lächeln fest. „Als würdest du durch den Stein gucken.“
Bevor Lauchbjörn zu einer Antwort ansetzen konnte, warf der fünfte Zwerg am Feuer mit jovialem Lachen ein: „Das wäre eine Fähigkeit, die man mit Sicherheit brauchbar zu Gold machen könnte.“ Sein Tonfall war basslastig und seine Sprechweise getragen. Burkhard Brockenson war Händler, und diese Eigenschaft schien aus jedem seiner Worte und Taten zu sprechen. Standesgemäß trug der hochgewachsene Zwerg ein verziertes Wams mit dem Aufnäher des Clans Eisenheimer auf der Brust – ein Ring von fünf Stahlbarren vor der Silhouette eines angedeuteten Bergs, die einen Rundschild umgaben –, und war auch ansonsten ein Musterbeispiel für das, was die meisten „Zivilisation“ nannten. Im Auftreten je nach Situation zwischen höflicher Unterwürfigkeit oder übertriebenem Selbstvertrauen hin und her pendelnd. Die schwarzen Haare kurz geschnitten und pomadiert, so dass sie im Licht der Flammen glänzten. Selbst sein Bart war verhältnismäßig kurz getrimmt, ging ihm gerade einmal bis zum Brustbein, und wirkte wie mit einem Winkelmaß begradigt. Der lederne Geldbeutel, der an seinem Gürtel hing, war größer als das Wurfbeil, das er auf der anderen Seite trug.
„Was macht die Sammlerei, Lauchbjörn?“, fuhr er grinsend fort. „In letzter Zeit irgendwas Besonderes gefunden? Seltene Kräuter? Einen Söldner-Kesch? Druuhnen-Gräber?“ Er lachte herzlich über seinen eigenen Witz, blickte Lauchbjörn dann aber kurz und forschend an, so unvermittelt, dass er glaubte, Burkhard spekuliere tatsächlich auf den Fund einer alten Grabstätte. Nur für den Fall. Man konnte sich ja schließlich Verwertungsrechte sichern.
„Nein, Meister Brockenson, keine Gräber“, murmelte Lauchbjörn. „Aber wenn ich eines finde, seid Ihr der Erste, dem ich davon erzähle.“
„Sicher, nachdem du dir den Rucksack mit Gold und Gyrotit vollgestopft hast!“, warf Ulf Torfson, der alte Jäger, ein, und knuffte Lauchbjörn mit spielerischer Kraft auf den Oberarm, so dass dieser genervt seinen Fuß beiseite nehmen musste, um sich nicht einen Schwall Met auf das Hosenbein zu schütten. Diese Gelegenheit nutzte er dann auch direkt, um sein Gesicht im Krug zu versenken, und einen Moment der Notwendigkeit zu entfliehen, seinen Kumpanen antworten zu müssen.
„Die Druuhnen haben kein Gyrotit gekannt, Torfson“, brummte Famke. „Was wir davon wissen und besitzen, stammt aus jüngerer Zeit. Höchstens zweitausend Jahre alt. Die Druuhnen haben vor über fünftausend gelebt.“
Der Händler Brockenson lachte. „Das würde mir auch gefallen. Wenn jemand sich in fünftausend Jahren noch an mich erinnert und mein Grab besucht.“
„Da müsst Ihr Euch wohl mumifizieren lassen, Meister Brockenson. Und diese Kunst ist, zumindest in der Form, wie die Druuhnen sie betrieben haben, längst vergessen.“
Lauchbjörn tauchte wieder aus seinem Krug auf, den Bart vor Met triefend, und runzelte die Stirn: „Warum weißt du überhaupt so viel über die Druuhnen, Famke?“
Sie blickte ihn mit ernster Miene an. „Meine Großeltern waren Druuhnen.“
Die sekundenlange Stille wurde vom brüllenden Gelächter der anderen durchbrochen. Es tönte durch die Eingangshalle, so laut, dass einige der patrouillierenden Wachen kurze, alarmierte Blicke zum Lagerfeuer warfen und dann kopfschüttelnd weitergingen.
„Ich weiß einfach gerne Dinge“, fügte die Kundschafterin schulterzuckend hinzu, nachdem das Gelächter abgeklungen war. „Was bringen mir die leisesten Sohlen und die schnellsten Beine, wenn ich dann beim Ältestenrat vorspreche und ihm nicht sagen kann, unter welchem Wappen und Banner die anrückende Armee steht?“
„Als würdest du jemals beim Ältestenrat vorsprechen!“, höhnte der alte Ulf mit geschauspielerter Geringschätzung.
Famke Annadyr seufzte und drehte sich zu Lauchbjörn: „Erinnere mich daran, genau diesen alten Nervbolzen außen vor zu lassen, wenn ich euch mal wegen eines feindlichen Angriffs aus dem Schlaf reißen sollte.“
Er grinste: „Ich werde daran denken.“
Daraufhin nahm jeder noch einen Schluck von seinem Met. Dann schlug Ulf Torfson in einer unmissverständlichen Geste seine flachen Hände auf die Oberschenkel, sagte „So!“ und stand auf.
„Dann wollen wir mal sehen, ob der Tag heute den einen oder anderen Hirsch für mich bereithält.“ Er blickte in die Runde: „Wer begleitet mich?“
Lauchbjörn sah zu Elfric. Der junge Fallensteller zuckte die Schultern und nickte. Gemeinsam standen sie auf und warfen sich ihre Rucksäcke über die Schulter.
„Famke, bist du dabei?“, fragte Elfric. Die blonde Zwergenfrau winkte ab: „Geht mal ohne mich. Ich warte noch auf den Befehl vom obersten Kundschafter – wenn ich Pech habe, schickt er mich heute wieder zum Kannengipfel.“
Lauchbjörn grinste: „Du hättest ihm eben damals nicht den Befehl verweigern sollen, als...“
„Jaja, hinterher ist man immer schlauer!“, unterbrach Famke ihn mit einer wegwerfenden Handbewegung. „Seht zu, dass ihr loskommt.“
„Sieh zu, dass du dich warm anziehst“, erwiderte Ulf im Vorbeigehen, und duckte sich dann mit einer für sein Alter überraschenden Flinkheit, um dem hölzernen Metbecher zu entgehen, den Famke nach ihm geworfen hatte. Unter gegenseitigen Sticheleien machten sich die drei Zwergenmänner auf den Weg in Richtung des großen Außentors. „Gute Jagd!“, rief ihnen Burkhard hinterher. „Ihr seid das Salz dieser Erde, lasst euch nichts anderes erzählen. Ohne Euch würden wir verhungern... also, ohne Euch, und die anderen Jägergruppen... und die Pilzfarmen...“
„Der alte Dummschwätzer fehlt mir jetzt schon, Jungs“, raunte Ulf Torfson, während er zwischen Lauchbjörn und Elfric einherstapfte.
Sie erreichten die gigantische Schwelle des Eingangstors. Zu Kriegszeiten wurden die riesigen Torflügel geschlossen gehalten und die darin eingelassenen, kleineren Türen benutzt. Aber der letzte Krieg, ob gegen andere Clans oder sonst jemanden, war lange her, und schließlich wollte man Licht in die Halle fallen lassen, um mit dem Prunk der Handwerkskunst vieler Generationen zu prahlen.
Die drei Zwerge marschierten durch den Torsturz, und begannen den Abstieg der zahlreichen marmornen Treppenstufen, die auf ganzer Breite den Höhenunterschied zwischen dem Eingang zur Zwergenstadt und dem davor liegenden Gebirgsgelände ermöglichten. Wind und Wetter hatten über die Jahrhunderte das Gestein der Treppe abgeschmirgelt und glatt poliert, so dass es einerseits zwar keine scharfen Kanten mehr gab, an denen man sich beim Fallen hätte verletzten können, andererseits jedoch die Chance, dass man fiel, nun wesentlich höher war, wenn man nicht aufpasste, wo man hintrat. Lauchbjörn, Elfric und Ulf kam dabei natürlich zugute, dass sie diesen Abstieg alle paar Tage unternahmen, und es dauerte keinen Vierteldocht, bis ihre Stiefel einen letzten Schritt von Marmor taten und auf harter, halb gefrorener Erde landeten.
Nach weiteren anderthalb Dochten Fußmarsch, ungefähr fünf Wagenräder den Berg hinab, begann der Boden unter ihren Füßen langsam weniger steil zu werden. Die Vormittagssonne kroch allmählich über die Gipfel des Verivane-Gebirges in ihrem Rücken und zeichnete schiefe Schatten auf den mit Gras und Moos bewachsenen Abhang. Von den Ausläufern des Gebirges herab kommend, hielten die drei Zwerge auf den bereits gut sichtbaren Waldrand zu, wobei sie gelegentliche Schlangenlinien liefen, um den großen Felsbrocken auszuweichen, die selbst in dieser Höhenlage noch reichlich vorhanden waren. Hätte man sich die Zeit genommen, die Findlinge zu Quadern zu schneiden, hätte man sich daraus vermutlich ein ansehnliches Haus bauen können, ohne das eigentliche Gebirge überhaupt betreten zu müssen. Lauchbjörn und seine Begleiter passierten die gewaltigen Gesteinsbrocken wie schon hunderte Male zuvor und nahmen einen kleinen, ausgetretenen Pfad durch das dichte Gras hinab zum Fûrne-Wald.
Kurz, bevor sie den Waldrand erreichten, trennten sie sich. Elfric ging Richtung Norden an der äußeren Baumreihe entlang, um sich nicht länger als nötig mit dem Unterholz herumschlagen zu müssen, bevor er sein Ziel – ein beliebter Fressplatz für kleineres Waldgetier – erreichte. Ulf Torfson hingegen wandte sich in die entgegengesetzte Richtung und folgte einem kleinen Pfad, der ihn in sein derzeit festgelegtes Jagdrevier führen würde – und damit hoffentlich ein gutes Stück weg von der Stelle, wo Lauchbjörn plante, heute nach Kräutern zu suchen. Immerhin wollten sich die Zwerge nicht gegenseitig in die Quere kommen. Lauchbjörn sah seinen beiden Kumpanen noch einen Moment nach, dann zog er den Rucksack fester über die Schulter und nahm den Weg in westlicher Richtung, direkt in den Fûrne-Wald hinein.
Sobald er in den Schatten der ersten Bäume trat, empfing ihn der Wald mit seiner unverkennbaren Atmosphäre. Das harte, fast grelle Licht der Sonne wurde zu staubigem Zwielicht, gefiltert durch die Baumwipfel, zerstäubt in dutzende kleinerer, weicherer Strahlen. Der stechende Wind, der ihn noch Augenblicke zuvor am Berghang umweht hatte, erstarb zu einem leichten Säuseln zwischen den Bäumen. Die schallfreudige Weite des flachen Landes wich einer gedämpften, meditativen Ruhe, in der jedes Geräusch deutlich vernehmbar war, aber sich trotzdem harmonisch in den Klangteppich der Natur einfügte. Raschelnde Blätter, fiepsende Kleintiere, plätscherndes Wasser. Lauchbjörn liebte den Wald. Er war sein zweites Zuhause.
Er entschied sich, seinen Arbeitsplan zu ignorieren und erst einmal nur der Nase nach zu gehen. Eigentlich gab es für die Jäger und Sammler ein genauso ausgefeiltes Protokoll wie für die Bergarbeiter – inklusive Laufwegen, Rasterquadranten und einer Liste der Rohstoffe, die gerade am nötigsten gebraucht wurden. Aber genauso wenig, wie der Berg das Erz immer genau dorthin packte, wo es statisch oder logistisch am praktischsten gewesen wäre, ließ sich der Wald dazu herab, die Kräuter schön säuberlich, gut sichtbar und farblich geordnet am Rand der vorgesehenen Routen wachsen zu lassen. Und Lauchbjörn kannte die Eigenheiten des Waldes diesbezüglich wie kein anderer. Manchmal, so hätte er schwören können, wuchsen bereits am nächsten Tag wieder genau dort allerlei Heilkräuter, wo er am Tag zuvor erst gesammelt hatte und deswegen laut Raster erst in einigen Wochen wieder hätte vorbeigehen sollen. Aber um diese gar nicht so seltenen Momente überraschender Reichhaltigkeit zu erleben, musste man natürlich dort sein, wenn sie geschahen, und das hieß, sich nicht immer an die Regeln zu halten, die seine Vorfahren in ihren Kammern tief im Berg mit kalter Effizienz auf Pergament gebannt hatten. Der Zwerg grinste und marschierte querwaldein.
Bereits beim Verlassen der ausgetretenen Wege fand er eine großflächige Ansammlung Blutampfer, über die er sich freudig hermachte. Einige Momente später, ein gutes Stück abseits des Pfads, einen Wuchs Gundermann. Kaum hatte er auch dieses Vorkommen großzügig abgeerntet, stolperte er förmlich über ein üppiges Brennnesselfeld, von dem er eigentlich geglaubt hatte, es schon letzte Woche vorerst hinreichend ausgereizt zu haben. Noch keinen ganzen Docht später hatte er bereits genügend Kräuter gefunden, um eine kurze Pause einzulegen und seine Ausbeute im Rucksack zu verstauen. Er hängte den schweren Lederranzen an einen abgebrochenen Ast in passender Höhe und öffnete die beiden Fächer – eines mit einem feuchten Leinentuch ausgelegt für frische Kräuter, das andere gut belüftet für Zutaten, die schnellstmöglich getrocknet werden mussten. Er sortierte seine Beute in das Gepäck ein, dann ließ er den Rucksack erst einmal hängen, wo er war, und sah sich nach weiteren Geschenken des Waldes um.
Nach einem weiteren halben Docht fand er noch einen ganz besonderen Schatz. Im Vorbeigehen an einem kleinen Tümpel flackerte ihn aus dem Augenwinkel ein leichter, opaleszierender Schimmer an. Er folgte dem Lichtreflex die Böschung hinab und ging am Ufer entlang, bis er die Quelle des Glimmens in einem niedrigen Tunnel lokalisiert hatte, wo das Wasser unter einigen überhängenden Steinen hervor aus dem Boden quoll. Dort, nur ein paar Schritte tief im Fels, gerade außerhalb des stetigen Rinnsals, erspähte Lauchbjörn die blassen, silbrig reflektierenden Blätter von Weißfeuer. Kurz entschlossen ließ der Zwerg sich auf die Knie nieder, kroch bäuchlings durch das flache Wasser am Rand des Sees und zwängte seinen kompakten Körper halb in das Loch hinein. Er tastete mit ausgestreckten Fingern, bis er den äußersten Zipfel eines der transluzenten Blätter zu fassen bekam. Dann, mit unendlicher Vorsicht, zog er die Pflanze zu sich heran, bis der Stängel sich spannte und er ihn mit der anderen Hand greifen konnte. „Hab' dich!“, grinste Lauchbjörn, während er das kalte Wasser ignorierte, das ihm Bart und Kinn überspülte und unter die Brust seiner Tunika sickerte. Er ruckte einmal kräftig an dem wertvollen Gewächs, riss es aus der Erde und kroch dann, prustend und Wasser um sich spritzend, rückwärts aus der kleinen Quelle heraus. Keuchend, die Körperfront mit Schlamm bedeckt und vor Wasser triefend, besah er sich die etwa kopfgroße Pflanze mit dem guten Dutzend durchschimmernder Blätter. „Du wirst mir ein ordentliches Sümmchen bringen…“, flüsterte er grinsend. Weißfeuer war ein seltenes und sehr mächtiges Heilkraut, das nur als einzelne Pflanze auftrat und praktisch völlig willkürlich erblühte. Getrocknet und zu Pulver zermahlen konnte es als starkes Aufputschmittel und erstaunlich vielseitiges Gegengift verwendet werden. Lauchbjörn schützte die Pflanze mit seinen behandschuhten Händen, während er sie zu seinem Rucksack zurücktrug. Dort öffnete er eine flache Tasche an der Seite des Beutels und entnahm ihr ein Gewirr aus dünnen Drähten, dass sich nach einer kurzen fachmännischen Drehung als ein kleiner, aufklappbarer Käfig erwies, der die Form einer Glocke hatte und unten offen war. Lauchbjörn schob vorsichtig das Weißfeuer in die trockene Seite des Rucksacks und stülpte dann ebenso behutsam das Drahtgeflecht darüber. „Dass du mir nicht vor der Zeit zu Staub zerfällst…“, murmelte er, warf noch einen letzten prüfenden Blick auf seinen wertvollen Fund und schloss dann die Tasche.
Ein markerschütterndes Kreischen hallte durch den Wald.
Seine Hand flog ans Beil, noch bevor der gellende Schrei komplett verklungen war. Er riss die kleine Handaxt aus dem Gürtel, aber er hatte zu lasch gegriffen, und das Werkzeug fiel zu Boden. Lauchbjörn duckte sich und drehte sich hektisch im Kreis, während er danach tastete, suchte nach einem Zeichen, ob kämpfen oder weglaufen die angemessene Reaktion war. Seine Finger fanden den abgewetzten Holzgriff im Dreck. Dann ertönte der Schrei erneut, und dem Zwerg wurden zwei Dinge klar: Erstens, das Geschrei wurde begleitet vom wütenden, wilden Knurren eines Tieres. Zweitens: Das war Elfric, der da schrie. Und sofort war Lauchbjörn ins Dickicht geprescht, ließ den Rucksack achtlos zurück, rannte, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen.
Niedrig hängende Äste schlugen ihm ins Gesicht, hinterließen blutige Kratzer. Ein weiterer Schrei ertönte, lauter, näher. Etwas weiter rechts. Lauchbjörn sauste um einen weiteren Felsblock herum, tauchte unter einem umgestürzten Baumstamm hindurch. Der Ursprung der Schreie und des Knurrens war jetzt direkt vor ihm.
„Elfric!“, schrie er, stolperte beim Durchbrechen der letzten Sträucher und taumelte ungelenk hinaus auf die Lichtung, das Beil erhoben.
Sein junger Freund kauerte mit zitternden Knien auf dem untersten Ast einer dicken Kiefer, die Arme Halt suchend um den Stamm des Baumes geschlungen. Das linke Bein seiner Hose hing in Fetzen, und tiefrotes Blut floss in unangenehm dicken Rinnsalen aus dem aufgerissenen Fleisch darunter.
„Fork!“, stieß Lauchbjörn einen alten zwergischen Fluch aus, und war für eine Sekunde kaum fähig, sich von dem Anblick loszureißen. Das schien auch Elfric zu erkennen, denn er löste einen Arm von der Rinde des Baumes, zeigte mit einer blutverschmierten Hand auf einen Punkt schräg rechts von Lauchbjörn und wimmerte: „Pass auf!“
Der gewaltige Berg aus Fell, der sich mit langsamen, taktierenden Schritten näherte, überragte Lauchbjörn um mindestens zwei Köpfe. Zottige, gräuliche Haare bedeckten einen widerlich drahtigen, hageren Körper. Ein knochiger Schweif zischte aufgeregt durch die Luft, und aus dem abgeflacht zulaufenden Schädel starrten Lauchbjörn zwei rosafarbene, blutunterlaufene Augen an. Ein Peitschenwolf, schoss es ihm durch den Kopf. Wir sind am Arsch.
Er hob das Beil über den Kopf, holte tief Luft und stieß einen Schrei aus, von dem ihm die eigenen Augen in den Höhlen vibrierten, brüllte den Wolf mit aller Wildheit an, die er in sich finden konnte. Das Tier kniff die Augen zusammen, legte den Kopf schief.
Aber es wich nicht zurück. Lauchbjörns Brüllen versiegte zu einem heiseren Ächzen und dann zur Lautlosigkeit, und der Wolf war immer noch da.
Lauchbjörn ließ das Beil sinken und warf einen Blick über die Schulter. Wenn er es zu Elfric schaffte, auf den Baum, konnte er vielleicht die Blutung stoppen, und sich dann überlegen…
Das Geräusch, mit dem die Hinterläufe des Peitschenwolfs sich in den Erdboden gruben, als er sich abstieß, war verräterisch leise. Lauchbjörn fuhr noch rechtzeitig herum, um im Reflex die Arme hochzureißen – der pfeilförmige Schädel des Raubtiers prallte von seinen stämmigen Unterarmen ab, die spitzen Zähne verfehlten sein Gesicht nur um eine Handbreit und schlugen mit einem feinen, elfenbeinartigen Klicken aufeinander. Dann donnerte der massige Leib des Wolfs in ihn hinein und riss sie beide zu Boden. Er rollte seitlich über den Erdboden. Klammerte sich durch einen Wirbel aus Formen und Furcht hindurch an seiner Handaxt fest. Nie die Waffe verlieren, skandierte er einen alten Rhythmus in seinem Kopf, den er seit Jahren nicht mehr hatte wachrufen müssen.
Sein Gesicht wurde in das stinkende, verfilzte Fell des Raubtiers gepresst, und er überschlug sich gemeinsam mit dem Wolf zwei, drei Mal, bevor er ihn von sich stieß. Mit einem ratternden Fauchen landete die knochige Scheußlichkeit ein paar Schritt neben dem Baum, auf dem Elfric kauerte. Lauchbjörn kam wieder auf die Beine, fühlte sich dabei widerlich ungelenk und behäbig. Wie lange war es her, dass er für mehr als eine Tavernenschlägerei die Faust hatte erheben müssen?
Die stetigen Blutfäden, die von Elfrics Ast heruntertropften, fingen seinen Blick. Ohne den Wolf, der mit gesenktem Kopf um ihn herumschlich, aus den Augen zu lassen, rief Lauchbjörn: „Dein Gürtel! Du musst das abbinden, sonst verlierst...!“
Er wusste nicht, ob seine Worte den Wolf aufgestachelt hatten, aber schon kam er wieder herangeprescht. Diesmal sprang er ihn nicht an, sondern machte einen knappen Satz nach vorne; Lauchbjörn schlug im Reflex mit dem Beil nach ihm, doch das schmale Axtblatt sauste nur durch Luft, verfehlte den Schädel des Tiers. Dann durchzuckte ein greller, lähmender Schmerz Lauchbjörns ganzen Körper, und er vernahm ein Übelkeit erregendes, feuchtes Knirschen, als sich die Zähne des Peitschenwolfs durch sein Hosenbein in seinen Oberschenkel gruben. Er schrie auf, holte noch einmal mit dem Beil aus und trieb die Klinge ungezielt in den Torso des Tieres, irgendwo hinter dem linken Schulterblatt.
Der Wolf fauchte – Lauchbjörn spürte, wie sein heißer Atem durch das Blut zwischen den in seinem Bein versenkten Reißzähnen hervorsprudelte. Dann ließ er von ihm ab, machte einen Satz außer Reichweite, und bei dem Versuch, die Bestie noch einmal zu treffen, gab Lauchbjörns Bein sofort unter ihm nach und er stürzte zu Boden.
Dieses Mal verlor er die Axt, als ihn die sengende Pein, die bis zur Hüfte ausstrahlte, kurzzeitig lähmte. Er schaffte es, sich auf ein Knie aufzurichten.
Etwas flog durch die Luft und prallte harmlos von der Flanke des Wolfs ab, so dass dieser ein beinahe harmloses, überraschtes Jaulen von sich gab und hektisch den Kopf zur Seite wandte, suchend, schnüffelnd, während seine blasse Zunge Lauchbjörns und Elfrics Blut von seinen Lefzen schlabberte. Der junge Fallensteller hatte es geschafft, mit einer ledernen Fangschlinge sein Bein abzubinden. Er hielt das lange Ende der Schnürung zwischen den Zähnen, um den Druck nicht zu mindern. Mit der freien Hand war es ihm offensichtlich gelungen, einen Zweig vom Baum zu brechen, den er nach dem Peitschenwolf geworfen hatte, und er suchte bereits nach dem nächsten. Das Raubtier knurrte missbilligend, wetzte hinüber zum Baum und stellte sich auf die Hinterläufe, richtete das kantige Maul nach oben und kratzte mit seinen scharfen Krallen tiefe Furchen in die Rinde. Elfric wimmerte, sichtlich von Angst erfüllt, aber er versuchte weiter, einen neuen Zweig abzubrechen.
„El... fric... nicht...“ Lauchbjörns Worte kamen als krächzendes Geflüster heraus. Distanziert nahm er wahr, dass sein Fuß im linken Stiefel in Flüssigkeit schwamm. Er biss die Zähne zusammen und richtete sich durch eine Welle aus Schmerz und Schwindel wieder auf. Sein einziger Gedanke war, den Wolf von Elfric weg zu bekommen.
„Hier... hier, du Bastard...“, versuchte er zu rufen, aber es klang wie das heisere Keuchen eines Trinkers nach einer durchzechten Nacht voller Flüche und Gesang. Er brachte kaum einen Ton heraus. Sein Blick tanzte in hektischen Sprüngen über den Waldboden, suchte nach seiner Handaxt. Fand sie nicht.
Der Wolf musste ihn doch gehört haben – oder gerochen. Das dünne Rinnsal aus seinem Bein war bei Weitem nicht so üppig wie bei Elfric, aber er war definitiv das leichtere Ziel. Mit einem plötzlichen, freudigen Hecheln reagierte der Peitschenwolf auf den neuen Impuls und wandte sich wieder Lauchbjörn zu. Sein Hinterlauf krallte sich in den Boden, warf einen Schwall kleiner Zweige und Erdbrocken auf. Bereit zum Ansturm.
Lauchbjörn tastete blind nach seinem Brustgurt. Zog das Kräutermesser heraus. Ein winziges Werkzeug mit einer kaum fingerlangen, gekrümmten Klinge.
„Komm doch...“, röchelte er. „Komm her...!“
Der Wolf täuschte an. Einmal. Zweimal.
Dann kam er heran.
Lauchbjörn presste einen verzerrten, kehligen Schrei hervor, schloss die Augen und hielt das Messer mit beiden Händen vor der Brust, betete, dass der Wolf wenigstens in die Klinge springen würde, wenn er diesmal mit ihm kollidierte...
Und dass er lang genug mit mir beschäftigt ist, damit Elfric verschwinden kann.
Ein leichtes Sirren in der warmen Waldluft. Der Wolf winselte empört und knurrte, aber der erwartete Zusammenstoß blieb aus.
Als Lauchbjörn die Augen öffnete, sah er noch, wie das Raubtier auf der Lichtung hin und her sprang, sich im Kreis drehte, um nach einer Bedrohung zu suchen, die es nicht orten konnte. Aus seinem hinteren linken Beinmuskel ragte der Schaft eines Pfeils mit sandfarbener Befiederung. Dann tauchte eine kleine, flinke Gestalt hinter dem Baum auf, in dem Elfric kauerte, und Lauchbjörn erkannte Famke Annadyr, die ihren Arm über den Kopf hob, etwas Glänzendes in der Hand. Sie riss es nach vorne, ein silberner Schimmer kreuzte den Raum zwischen ihr und dem Wolf, und mit einem satten Geräusch blieb ein Wurfmesser in der Flanke des Tieres stecken. Es heulte auf, der universelle, verängstigte Schmerzenslaut eines Wesens, das vom Jäger zum Gejagten geworden war.
Ein weiterer Pfeil verfehlte es nur knapp, bohrte sich zu seinen Füßen in den Sand, und mit einem Quieken sprang der Wolf in die Höhe, fuhr herum und raste davon. Seine gräuliche Silhouette verschwand knisternd und raschelnd im Unterholz.
Ulf Torfson, der Jäger, kam zwischen den Bäumen an Lauchbjörns Seite gelaufen, den Boden mit einem dritten Pfeil schussbereit gespannt. Er verharrte einen Moment. Dann ließ er die Sehne locker und kniete sich zu Lauchbjörn hinunter.
„Euch zwei kann man ja keinen Augenblick alleine lassen“, knurrte er mit einem Grinsen, das nicht ganz seine Besorgnis übertünchen konnte.
Lauchbjörn war nicht nach Grinsen zumute. Er ließ das Kräutermesser fallen und sackte mit dem Rücken an einem Baum zusammen. Er deutete auf sein Bein. „Hilfe, bitte“, murmelte er in einem matten Beschwerdeton.
„Ja, mach dir nicht ins Hemd“, erwiderte Torfson leichthin, während er den Bogen beiseite legte und in seiner Gürteltasche kramte.
„Elfric...?“, gab Lauchbjörn von sich.
„Dem geht’s gut“, rief Famke, ein paar Schritt entfernt. Lauchbjörn drehte unter einiger Anstrengung den Kopf und sah, dass die Kundschafterin Elfric offensichtlich irgendwie vom Baum hinab geholfen hatte und gerade dabei war, mithilfe eines Astes die Kaninchenschlinge in eine etwas festere Aderpresse umzubauen.
Dann nahm ihm eine erneute Welle des Schmerzes die Sicht – und auch alle anderen Sinneswahrnehmungen –, als Ulf Torfson mit ordentlich Kraft eine Leinenbinde um sein verletztes Bein wickelte.
„Das wird wieder“, brummte der alte Zwerg. „Sind nur zwei, drei Zähne durch die Haut gegangen. Das spülen wir mit Salz aus und packen Kapuzinerkresse und Salbei drauf, und in zwei, drei Tagen läufst du wieder durch den Wald wie ein Jungspund.“
Lauchbjörn lächelte matt.
„Danke, Ulf...“, krächzte er. „Danke.“
KAPITEL 2
Er hatte so lange gewartet, dass sich Raureif gebildet hatte. Die graue, mehrschichtige Kleidung aus unterschiedlichen Stoffen war nun an Schultern, Handrücken und Knien von einer dünnen silbrigen Schicht bedeckt, die das fahle Mondlicht als zahllose glitzernde Pünktchen reflektierte. Unter anderen Umständen hätte er die Position gewechselt, aber auf den Ziegeln unter seinen Stiefelsohlen war im vergangenen Docht ebenfalls eine dünne, frostige Schicht herangewachsen, die seinen dunkel gekleideten Körper nur noch mehr mit dem fast gleichfarbigen Untergrund verschmelzen ließ. Das grobe Gewebe der Maske schluckte sämtlichen Atem, bevor er als verräterischer weißer Dunst in die kalte Nachtluft entkommen konnte.
Wie man es ihm beigebracht hatte, überprüfte er regelmäßig die wichtigsten Elemente, von denen der erfolgreiche Abschluss seiner Mission abhängen würde. Seine eigene Tarnung: Intakt. Auf Höhe des zweiten Stockwerks, nahe an der Wand, unter der Dachschräge, wo ihn das Mondlicht kaum erreichte, war er praktisch unsichtbar. Sein Ziel: In greifbarer Nähe. Aus der Schänke, sechs Häuser weiter auf der anderen Seite der gefrorenen Hauptstraße, drang noch immer ausgelassenes Gelächter, Gesang und Musik. Das glutähnliche Licht, das aus den von Fett und Staub verschmierten Fenstern auf die Straße fiel, trennte das Gebäude so deutlich vom Rest der nachtschlafenden Häuser ab, dass jeder, der die Taverne verließ, unweigerlich dichte Schatten auf die umliegenden Mauern warf. Das hatte er bereits bei zahlreichen kommenden und gehenden Zechern in den letzten Dochten beobachten können.
Seine halb bandagierte Hand, deren Finger von einer dünnen Schicht schlammig grauer Schminke bedeckt waren, schlich sich zum dritten Element des Erfolgs: Seinem Dolch. Er war noch genau da, wo er sein sollte – an seinem Gürtel, dort, wo seine Hand selbst blind immer gelandet wäre, selbst wenn er nur im Reflex danach gegriffen hätte. Der kürzestmögliche Weg von Hand zu Waffe zu Ziel – eines der Prinzipien, die ihn zu mehr machten als einem simplen Halsabschneider. Er lächelte, schlechte Zähne, deren noch intakter Anteil im Dunkeln aufblitzte.
Der kalte Wind war stärker geworden. Die Wolken rasten förmlich über den Himmel, spielten Fangen miteinander. Er bewegte sich nicht. Ihm war kalt, aber der Gedanke an seine Bestimmung schob diese körperliche Unpässlichkeit in den Hintergrund. Wer konnte schon von sich behaupten, so direkt und unverfälscht einem höheren Zweck zu dienen? Er führte die Klinge des Schicksals – nein, er war gewissermaßen selbst diese Klinge. Eine Waffe, nicht nur metaphorisch, sondern auch faktisch, denn selbstverständlich hatte man ihn nebst dem Umgang mit seinem Dolch auch in allen möglichen anderen Künsten unterwiesen, die darauf abzielten, das Leben einer Kreatur zu beenden. Das Brauen von Giften und das Mischen von Sprengpulvern. Der Umgang mit dem Bogen. Die Fähigkeit, mit geworfenen Gegenständen spitzer und scharfer Natur die lebenswichtigen Punkte am Körper seines Ziels zu treffen. Und natürlich das Verständnis dafür, wie dieser Körper funktionierte, wo man drücken, ziehen und drehen musste, um notfalls auch ohne jede Waffe diese Funktionen gegen den Körper selbst zu richten. Wie man Schwäche ausnutzte.
Wie man am Ende aus zwei Leben eines machte. Als Sieger hervorging.
Wieder öffnete sich die Tür der Taverne. Dieses Mal taumelten zwei schlanke, fast hagere junge Männer heraus, offenkundig Brüder oder alte Freunde, so, wie sie die Arme um die Schulter des jeweils anderen gelegt hatten. Schwankend, die Luft mit laut gelallten Witzen füllend, die nur der jeweils andere kapierte, stolperten sie in die eisige Nacht davon.
Es konnte nicht schaden, ein wenig näher zu kommen, entschied er. Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich aus den Schatten, nahm Anlauf und flitzte über das abschüssige Dach. Seine Füße in den maßgeschneiderten Stiefeln erzeugten kaum ein Geräusch auf den Dachziegeln, noch ließ ihn die dünne Eisschicht ausgleiten. Lautlos und schnell wie eine Rauchwolke im Wind jagte er auf die seitliche Dachkante zu und sprang, sirrte durch die Luft und fand ebenso lautlos Halt auf dem Dach des nächsten Gebäudes. Hier an der Hauptstraße hatten sie alle Vordächer. Flach. Ideal, um jemandem aufzulauern. Wie für seinesgleichen gemacht.
Er überbrückte zwei weitere Dächer, schlitterte kontrolliert zurück in den Schatten unter dem Dachüberhang und regulierte seine Atmung. Die Taverne war jetzt ganz nahe, lag nur einen Steinwurf entfernt jenseits der Hauptstraße. Er konnte einen niedrigen, langgezogenen Schatten an der angrenzenden Hauswand sehen, und kurz darauf trottete ein streunender Hund, die Lefzen beinahe unkenntlich hinter den rhythmisch heraus stiebenden Atemwolken, hinter dem Gebäude hervor, kreuzte die menschenleere Straße und verschwand irgendwo unter ihm.
Mit einer Gründlichkeit, auf die er stolz war, überprüfte er seine zusätzlichen Waffen – selbstverständlich, ohne den Blick auch nur eine Sekunde von der Tür zu nehmen, aus der früher oder später sein Ziel treten musste. Sein zweiter Dolch im Stiefel. Die Garotte in seinem Gürtel. Zwei kurze, gewichtete Wurfklingen mit geschwärzten Schneiden, die hinten in seiner Kapuze versteckt waren – perfekt, um danach zu greifen, wenn man die Hände hob, um so zu tun, als ergäbe man sich. Er schmunzelte.
Dann sank er wieder in sich zusammen, reglos, lauernd, abwartend.
Er hatte seine Position noch nicht verändert, als über zwei Dochte später die Tür zum wiederholten Male aufschwang. Dieses Mal widmete er ihr nur einen beiläufigen Blick, der jedoch sofort schärfer und fokussierter wurde, als er die Gewänder erkannte – pflaumenfarben und senfgelb. Wertiger Stoff. Ein feingliedriger Körper mit aristokratischen Zügen, seinem eigenen nicht unähnlich. Und diese extravaganten Stiefel mit den glänzend polierten, vorne zugespitzten Stahlkappen hätte er selbst auf die doppelte Entfernung erkannt.
Er spürte, wie ihm warm wurde – Adrenalin, das seinen Kreislauf beschleunigte, die Muskeln zum Zittern brachte, kontrolliert, pragmatisch, auf den bevorstehenden Kraftakt wartend. Insgesamt waren drei Personen gemeinsam aus der Schänke getreten und bewegten sich nun die von zu Krusten gefrorenen Schlammrinnen gesäumte Hauptstraße entlang. Um die beiden Leibwächter machte er sich wenig Sorgen – ihre Rüstungen aus verblichenem, abgeschürftem Leder, die nachlässigen, kaum angedeuteten Blicke in die Umgebung, und allem voran die leicht tänzerisch anmutende, schwankende Bewegungsweise, die darauf hinwies, dass auch diese beiden Männer die Taverne nicht komplett nüchtern verließen, sagten ihm alles, was er wissen musste.
Wie vor jedem Attentat visualisierte er die kommenden Augenblicke, so, wie man es ihn gelehrt hatte. Wie er die tragende Säule des Daches rechts von ihm hinabgleiten würde, dabei die metallenen Sporen an der Innenseite seines linken Handschuhs und seine Stiefel nutzend, um sich vorsichtig abzubremsen. Wie er auf etwa halber Höhe den Sprung wagen würde, weg vom Haus, in die Mitte der Straße, bereits so nahe wie möglich an seiner Zielperson. Wie er eine der geheimen Techniken, die er so verehrte, nutzen würde, um seinen Aufprall und die folgende Rolle beinahe aller hörbaren Schwingungen zu berauben, um wie eine herabstoßende Eule bei seinem Opfer anzukommen. Wie der Dolch, gezogen im Sprung, eine kurze, effiziente Kurve beschreiben würde, während seine andere Hand das Haar der Zielperson griff und daran zog, um Luftröhre und Schlagadern für einen einzelnen tiefen Schnitt freizulegen. Wie er – sicherheitshalber – noch einmal seitlich in den Hals stechen würde, um sich dann von dem unweigerlich zusammenbrechenden Körper zurückzuziehen. Die Wachen waren ein Risiko, aber ein kalkulierbares. Entweder verstanden sie schnell genug, dass mit dem letzten Atemzug ihres ehemaligen Klienten auch dessen Zahlungsfähigkeit aus dieser Welt entschwunden war, und ließen ihn ziehen.
Oder sie griffen an, und starben auf dieser kalten, einsamen Straße, für ein Ideal, das weder so nobel, noch so groß war wie das seine. Ein Ideal, das ihm, wenn er in weniger als einem Augenblick wieder in den Schatten verschwinden würde, die Richtigkeit – ja, sogar die Unvermeidbarkeit – des eigenen Tuns so deutlich offenbaren würde, wie es bereits in zahllosen vergangenen Momenten, ob Tag oder Nacht, ob Schnee oder Sand, der Fall gewesen war. Er war wahrlich gesegnet, dachte er, als er die Finger um den mit einem feinen Lederriemen umwickelten Griff des Dolches schloss und sich geräuschlos aufrichtete.
Ein türkisgrüner Pfeil aus purem Licht bohrte sich durch seinen Hals. Kaum da, dann schon wieder verschwunden, hinterließ er ein schmurgelndes, zischendes Loch mit glühenden Rändern. Er versuchte zu sprechen, Worte der Verwunderung, aber es kam nur ein blubberndes Gurgeln heraus, als ihm dicke, salzige Flüssigkeit in die Lunge tropfte. Jemand bewegte sich rechts von ihm, und es waren keine lange eingeübten Verteidigungsreflexe, sondern lediglich eine seltsam träge, neblige Neugierde, die ihn dazu brachte, sich dorthin zu drehen. So erhaschte er einen letzten Blick auf eine schlanke, hochgewachsene Gestalt, die sich ihm über das gefrorene Vordach näherte, nicht schleichend, nicht rennend, sondern im resoluten Gangtempo einer Person, die noch eben schnell etwas zu erledigen hatte, bevor sie sich wichtigeren Dingen zuwandte.
Große, stechend blaue Augen blitzten unter ihrer Kapuze auf, und er stellte verwundert fest, dass sie graue Kleidung trug, die der seinen gar nicht unähnlich war.
Die Worte, die er vernahm, waren so wohlklingend wie genervt.
„Sechs Dochte, ich schwöre...“
Er schaffte es noch, einen fragenden Würgelaut aus seiner durchbohrten Kehle hervorzupressen, bevor der Dolch sein Ziel fand.
Hey, genau so hätte ich das auch...
KAPITEL 3
Die trägen Rauchschwaden verhüllten ihre Sicht bis auf wenige Handbreit. Die schweren Wände des kleinen Zeltes, Schichten aus rohem Leder und Tierfellen, fraßen jeden Laut, der von außen hätte hereindringen können. Im Innern war es düster, warm und still, bis auf das leise Knistern der verglühenden Kräuter, die in einer groben Tonschale vor sich hin glommen.
Rho'sha hob die Hände und begann mit einem getragenen, kehligen Gesang, der sich in dem beengten Raum dumpf und seltsam anhörte. Während sie die einfachen, sich wiederholenden Worte einer primitiven Sprache skandierte, tauchte sie die schwieligen Fingerspitzen von Zeige- und Mittelfinger in eine Schale mit teerartiger, pechschwarzer Schmiere. Die feuchte Substanz blieb an ihren Fingern haften, überdeckte das schlammige Olivgrün ihrer Haut mit einer Schicht glänzender Düsternis. Sie setzte zwei Finger unter ihrem hervorstehenden, breiten Kiefer an, die anderen über den deutlich sichtbaren Knochenwülsten ihrer Augenbrauen, und malte je einen breiten Streifen dunkler Farbe auf ihre Stirn und ihr Kinn. Dabei sang sie unablässig, und die harsch hervorgestoßenen Harmonien ließen dünne Speicheltropfen zwischen ihren Lippen und den beiden großen Hauerzähnen hervorsprühen.
Dann wandte sie sich dem Jungen vor ihr zu. Er stand inmitten eines Kreises von Verwandten und Freunden und trug nur einen einfachen Lendenschurz – gefertigt aus dem Fell des ersten Großwilds, das er erlegt hatte. Er war ziemlich kurz, was bedeutete, dass er sich den Sieg über die Beute entweder mit vielen seiner Altersgenossen geteilt oder sich für seine Initiation ein relativ kleines Exemplar des Tieres ausgesucht hatte.
Aber er stand hier, und das zählte als Erfolg, egal, wie groß die blutenden Kratzer und bläulichen Prellungen auf seinem nackten Oberkörper auch sein mochten und wie viele an der Zahl. Er blickte Rho'sha aus nur einem knappen Schritt Entfernung an, mit leuchtend gelben, animalischen Augen, genau wie ihre eigenen. Sein Atem ging stoßweise. Obgleich die Jagd schon lange zurücklag, inspirierten die Umstände des Rituals – der enge Raum, die schwer zu atmende Luft, die verhaltenen, erwartungsvollen Blicke der Umstehenden, der Geruch von Schweiß und Feuer, und nicht zuletzt Rho'shas aufpeitschender Gesang – ein Gefühl von Aktion, von Konflikt und Bedeutsamkeit. Der muskulöse Brustkorb des Initianten hob und senkte sich knurrend unter gesteigerter Atemfrequenz.
Sie führte die immer noch pechtriefenden Fingerspitzen an seine Brust, setzte sie auf seinen Schlüsselbeinen an und zog zwei knappe Bögen hinab zum Brustbein. Dann legte sie dem jungen Krieger eine Hand auf die kahlgeschorene Stirn und begann mit der nächsten Phase des Rituals.
„Kragh!“, rief sie, und sofort stampften alle Anwesenden, vielleicht zehn, fünfzehn Orks, Männer und Frauen, auf den trockenen Boden, dass die Haltestangen des Zelts erzitterten, und wiederholten im Chor: „Kragh!“ Stärke. Natürlich. Wie von einem alten Kriegervolk, das gerade erst der Primitivität entstiegen war und die Kunst des Überlebens und des Gewinnens als höchste Werte schätzte, nicht anders zu erwarten, war dies die erste Säule des Mantras. Stärke, sowohl des Körpers als auch des Geistes.
„Kuntor!“, schrie Rho'sha ungehemmt, und der Chor fiel ein. Stolz. Nicht nur die implizierte Bedeutung, stolz auf die eigenen Taten und Fähigkeiten sein zu können, sondern vor allem auf seine Herkunft. In einer Welt, die seit jeher das, was anders war, gehasst und verfolgt hatte, war es nie einfach gewesen, ein Ork zu sein – und dieses Ritual verfestigte nur, was ohnehin jeder von ihnen von Kindesbeinen an gelernt hatte: Es war hart, ein Ork zu sein, aber niemals falsch. Man hatte keine Wahl, aber man lernte auch, sich keine zu wünschen.
„Groth!“, brüllte die Schamanin das dritte und letzte Prinzip. „Groth“ bedeutete „Recht“, und es war wohl die am weitesten gefasste und persönlichste der drei Eigenschaften, die jedem Ork bei seinem Übergangsritus vom Kind zum Erwachsenen zugesprochen wurden. Ursprünglich war damit das Recht gemeint, alles zu besitzen, für dessen Beschaffung und Erhalt die eigene Kraft ausreichte – was man erlangen konnte, durfte man behalten. Aber diese Definition stammte aus Zeiten, in denen Rho'shas Artgenossen noch in winzigen, verstreuten Rudeln durch alle Gebiete des Landes gestreift waren, nackt, gerade einmal aufrecht gehend, und mit einer Sprache ausgestattet, deren gesamtes Vokabular neben „Kragh“, „Kuntor“ und „Groth“ vielleicht noch zwanzig weitere Worte umfasste.
Mittlerweile hatten die Orks allmählich begonnen, das zu entwickeln, was die Menschen und Elfen als „Zivilisation“ oder vielleicht „Kultur“ bezeichneten, und obgleich dieser Prozess quälend langsam und nur bis zu einem bestimmten Grenzpunkt ablaufen würde, so hatten seine ersten Anzeichen doch bereits Einzug in die Haltung, die Gedanken, die Selbstwahrnehmung ihrer Stammesmitglieder gehalten. Darum stand „Groth“ nicht länger nur für das Recht, sich zu nehmen, was man wollte, sondern hatte für jeden Initianten eine eigene Bedeutung. Für manche war es nur etwas so Simples und Bescheidenes wie das Recht, seine eigene Existenz und die seiner Familie zu beschützen. Für andere das Recht, unter dem Himmel dieser Welt leben und atmen zu dürfen, ihr Wasser zu trinken, ihr Fleisch zu essen, und ihre Geschenke zu tragen. Und für wieder andere – insbesondere jene, die noch eher den alten Traditionen verhaftet waren – steckte dahinter der Wunsch nach etwas größerem. Mochte es Ruhm sein, Reichtum, Macht oder, wie hätte es anders sein können, Liebe – für sie alle stand „Groth“ nach dem Recht, danach zu streben. Dafür zu kämpfen. Es sich zu verdienen.
Rho'sha zog den Finger ein zweites Mal über die Haut des jungen Kriegers und malte ihm einen groben, schwarzen Winkel über die Augenbrauenwülste.
Dann stieß sie erneut einen Schrei aus, diesmal ohne jede Artikulation, und die Anwesenden fielen mit ein – ebenso wie der muskulöse, aufgeregte Neuling vor ihr, der das hauerbewehrte Maul zu einem tiefen, grollenden Brüllen voller Zustimmung und Eifer öffnete.
Für einen Moment war das Innere des Zelts von diesem einen, vielstimmigen Schrei erfüllt, der immer lauter wurde. Ein rhythmischer Takt von stampfenden Füßen, klatschenden Händen und dem Aufprall von hölzernen Waffenschäften auf Erde und aufeinander schwoll an und nahm Geschwindigkeit auf. Rho'sha bückte sich und hob aus einer hölzernen Schale, die vor frischem Blut glänzte, ein rohes Stück Fleisch empor, das so unförmig und zerfetzt aussah, als hätte man es mit bloßen Händen brutal aus dem Körper eines Tieres gerissen. Sie reichte den triefenden Klumpen feierlich an den jungen Initianten weiter, und als dieser es entgegennahm und mit einem Fauchen seine Zähne im Fleisch seiner ersten Beute versenkte, kollabierte der Rhythmus der Umstehenden in eine ausgelassene Kakophonie aus brüllenden, lachenden, kreischenden Rufen der Freude und des Stolzes. Einzelne Orks traten an den Jungen heran und schlugen ihm auf die Schulter oder nahmen ihn in einen freundschaftlich verspielten Schwitzkasten, und als er das zeremonielle Stück Fleisch von seinem dunkelrot verschmierten Gesicht nahm, kam darunter ein verschämtes, aber ebenso stolzes Grinsen zum Vorschein. Auch Rho'sha grinste nun, drückte dem Jungen die Schulter und nickte ihm bekräftigend zu. Dann hob sie sie Hände und brummte einen unartikulierten Laut, den alle Gäste als das Zeichen zum Aufbruch verstanden. Die hinterste Reihe hielt die Aufschläge des Zelteingangs auf, und unter dem lauten Johlen und Lachen seiner Freunde und Familienmitglieder ging der letzte der frisch gebackenen Krieger hinaus ans Tageslicht. Kurz darauf war Rho'sha wieder alleine in ihrem Schamanenzelt.
Gut, ein bisschen frisches Blut im Lager zu haben, dachte sie, während sie das Räucherkraut mit einer Handvoll Sand zum Erlöschen brachte. Fähiges Blut. Können wir gut gebrauchen, bei den Göttern.