
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bloomoon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein magischer Wald, ein zahmer Wolf und ein wildes Mädchen: Der verschüchterte Junge Ned hätte nie zu träumen gewagt, dass ausgerechnet er es ist, der sein Dorf vor einem schlimmen Unglück bewahrt. Um zu verhindern, dass ein Banditenkönig den größten Schatz seiner Mutter raubt - einen Topf voller wilder, unzähmbarer Magie - muss sich Ned in den riesigen verzauberten Wäldern verstecken. Ohne die Hilfe der selbstbewussten Áine, die in den Wäldern aufgewachsen ist, wäre Ned verloren. Was er nicht weiß: Áine ist die Tochter des Banditenkönigs, die beim Anblick des Jungen an die letzten Worte ihrer Mutter denken muss: „Der falsche Junge wird dein Leben retten und du seines ...“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von André Mumot
Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe
bloomoon, München 2015
Copyright © 2014 by Kelly Barnhill
Published by Arrangement with Kelly Barnhill
Titel der Originalausgabe: The Witch’s Boy
Die Originalausgabe ist 2014 im Verlag
Algonquin Young Readers, Chapel Hill, North Carolina, erschienen.
© 2015 bloomoon, ein Imprint der arsEdition GmbH, Friedrichstraße 9, D-80801 München
Alle Rechte vorbehalten
Text: Kelly Barnhill
Übersetzung: André Mumot
Lektorat: Stefanie Zeller
Covergestaltung: Joëlle Tourlonias und Jann Kerntke
eBook Umsetzung: Zeilenwert GmbH
Das Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
ISBN eBook 978-3-8458-1117-8
ISBN Printausgabe 978-3-8458-0958-8
www.bloomoon-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Jake Sandberg –
meinem Cousin, Mit-Abenteurer, verbündeten Pläneschmieder
und ersten besten Freund –
ist dieses Buch in Liebe gewidmet
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
1. Die Zwillinge
2. Eine spitze Nadel und ein Stück Faden
3. Die Steine
4. Der falsche Junge
5. Áine
6. Ein Besuch von der Königin
7. Der Tontopf
8. Die Steine
9. Der Gebrauch hat Folgen
10. Die Tochter des Banditenkönigs
11. Behalte den Wald im Auge
12. Áines Plan
13. In der Falle
14. Neds Entscheidung
15. Neds Reise beginnt
16. Die Lichtung
17. Der Anhänger
18. Die Steine
19. Das Loch im Sack
20. Die Schlucht
21. Eine unglückliche Audienz bei der Königin
22. Der Wolf
23. Der Traum
24. Das Mädchen
25. Der König jenseits des Berges
26. Die Wahl
27. Der verirrte Bandit
28. Áine verlässt das Haus
29. Im Kerker
30. Rauch
31. Die Barke
32. Die Steine
33. Zurück im Dorf
34. Der Geröllabhang
35. Die Magie hört hauptsächlich zu
36. Die Hinrichtung von Schwester Hexe
37. Jetzt
38. Die Steine hören auf zu warten
39. Näher heran
40. Die Steine fällen eine Entscheidung
41. »Schlagt Alarm!«
42. König Ott
43. Der Anhänger
44. Die Toten nehmen Abschied
45. Ned hat einen Plan
46. König Otts Heer
47. Das letzte Gefecht der Sprechenden Steine
48. Áine und der Wolf
49. Auf den Schultern der Riesen
50. Fort
51. Áines Rückkehr
52. Das Meer! Das Meer!
1
Die Zwillinge
Es waren einmal zwei Brüder, die einander so ähnlich waren, wie man es nur dem eigenen Spiegelbild ist. Sie hatten die gleichen Augen, die gleichen Hände, die gleiche Stimme, die gleiche unstillbare Neugierde. Und wenn sich auch alle einig darüber waren, dass der eine von ihnen eine Spur gewandter, eine Spur klüger, eine Spur wunderbarer war als der andere, so konnte doch niemand die Jungen auseinanderhalten. Und wenn es trotzdem einmal jemand glaubte, so irrte er sich für gewöhnlich.
»Welcher von beiden hat die Narbe auf der Nase?«, fragten die Leute. »Welcher ist der mit dem frechen Grinsen? Ist Ned der Kluge oder ist es Tam?«
Ned, sagten die einen.
Tam, sagten die anderen. Sie konnten sich nicht entscheiden. Doch einer musste besser sein als der andere. Das sagte einem die Vernunft.
»Um Himmels willen, Jungs«, seufzten ihre Nachbarn dann und wann verdrießlich, »wollt ihr jetzt endlich stillhalten, damit wir euch ordentlich anschauen können?«
Doch die Jungen hielten nicht still. Immerfort lachten und juchzten sie und heckten Streiche aus. Sie waren wie ein Wirbelwind. Im Zaum halten ließen sie sich nicht. Und so blieb auch die Frage, wer von ihnen denn nun der Gewandtere, der Klügere, der Wunderbarere war, ungeklärt.
Eines Tages entschieden die Jungen, dass es höchste Zeit sei, ein Floß zu bauen. Ganz im Geheimen zimmerten sie es aus Ästen und abgeknickten Stämmen, aus Seilresten und fortgeworfenen, zerschlissenen Möbelstücken und Stöcken zusammen, immer darauf bedacht, ihr Werk vor den Augen ihrer Mutter zu verbergen. Als sie dachten, ihr Gefährt sei seetüchtig, ließen sie es im Großen Fluss zu Wasser und kletterten, in der Hoffnung, es bis aufs Meer hinaus zu schaffen, selbst an Bord.
Sie täuschten sich jedoch. Das Gefährt war nicht seetüchtig. Sehr bald schon riss die wilde Strömung das Floß auseinander und die Jungen stürzten ins Wasser und mussten um ihr Leben kämpfen.
Ihr Vater, ein breitschultriger, starker Mann, sprang ins Wasser, und obwohl er kaum schwimmen konnte, kämpfte er sich durch die Strömung auf seine Kinder zu.
Eine Menschenmenge versammelte sich am Ufer. Die Leute fürchteten sich vor dem Fluss – vor den Geistern, die im Wasser lebten und die Unachtsamen packen und zum dunklen Grund hinunterzogen. Deshalb sprangen sie dem Mann auch nicht hinterher, um ihm oder seinen ertrinkenden Kindern beizustehen. Stattdessen riefen sie dem Vater in seiner fürchterlichen Angst bloß ihre Ratschläge zu.
»Denk daran, dass ihre Köpfe immer über Wasser sind, wenn du sie zurückziehst«, schrie eine Frau.
»Und wenn du nur einen retten kannst«, fügte ein Mann hinzu, »dann rette nur ja den Richtigen.«
Die Strömung trennte die Jungen und der Vater konnte nicht beide retten. Er strampelte und fluchte, aber als er einen der Jungen erreicht hatte, war sein Zwilling bereits weit den Fluss hinuntergetrieben und längst nicht mehr zu sehen. Später am Tag wurde sein Leichnam, aufgequollen und mit entsetzten Augen, am Ufer angeschwemmt. Die Leute umringten das tote Kind und schüttelten den Kopf.
»Wir hätten uns ja denken können, dass er es vermasseln würde«, sagten sie.
»Er hat den Falschen gerettet. Es hat der falsche Junge überlebt.«
2
Eine spitze Nadel und ein Stück Faden
Der falsche Junge war kaum noch am Leben. Er hatte so viel von dem schmutzigen Flusswasser geschluckt, dass sein kleiner Bauch ganz geschwollen war. Seine Lungen sackten unter dem Gewicht des Wassers ein – sie gurgelten und röchelten und konnten die Luft nicht halten. Sein Vater legte den Jungen behutsam auf den Boden und bog ihm den Kopf nach hinten. Dann presste er die Lippen auf seine Lippen und blies ihm seinen Atem ein, wieder und wieder und wieder.
»Hab keine Angst«, flüsterte der Vater. »Hab keine Angst.« Aber ob er zu dem Jungen sprach oder zu sich selbst, vermochte niemand zu sagen.
Der Junge atmete nicht.
»Komm schon, Neddy«, sagte der Vater. »Mein lieber, kleiner Ned. Komm schon und wach auf für Papa. Mach die Augen auf.«
Doch der Junge machte seine Augen nicht auf. Erst nachdem einige weitere Atemstöße in seinen Mund gegangen waren, schnappte Ned schließlich nach Luft und begann zu husten, bis das Flusswasser in Strömen aus seinem Mund brach. Er atmete, doch es fiel ihm schwer. Seine Lippen waren blau und seine Haut so weiß wie Knochen. Der Vater zog sich die Jacke aus und wickelte seinen Sohn darin ein, dessen kleiner Körper noch immer von Kopf bis Fuß vom Husten geschüttelt wurde.
»Das Meer, Tam«, stöhnte er. »D-d-das M-m-meer …« Er schlotterte und seine Zähne klapperten. Sein Vater nahm ihn auf die Arme und trug ihn nach Hause.
Als sie dort ankamen, hatte Ned vor Fieber das Bewusstsein verloren, und sein Vater schaffte es nicht, ihn aufzuwecken.
Derweil zog eine Handvoll Männer und Frauen aus dem Dorf am langen, langen Ufer des Flusses entlang, um den Leichnam des ertrunkenen Zwillings nach Hause zu tragen. Die Mutter der Jungen wartete auf sie. Ganz aufrecht saß sie auf einem Felsen und krallte die Hand immer wieder in ihr Kleid, ballte sie zur Faust und öffnete sie, raffte den Stoff und ließ ihn los, wieder und wieder.
Ihr Blick ging ins Nichts. Sie hatte einen Namen, doch niemand sprach ihn aus. Ihre Kinder nannten sie Mutter, ihr Ehemann nannte sie Frau und alle anderen nannten sie Schwester Hexe. Sie war eine Frau, die Kräfte besaß und die man ebenso liebte, wie man sie verachtete, auf deren Rat man aber hörte – immer.
»All diese Magie«, raunten die Leute einander zu, während sie den toten Jungen nach Hause trugen, »für nichts und wieder nichts. Ihre eigenen Kinder kann sie nicht retten. Was um Himmels willen nützt sie ihr dann?«
Schwester Hexe war die Hüterin einer Magie, die so alt und machtvoll war, dass sie jeden, der Hand an sie legte, das Leben kosten konnte – doch sie selbst hatte nichts davon. Ihre Magie konnte nur im Dienste anderer genutzt werden. (Zumindest glaubten dies die Leute, und Schwester Hexe ließ sie in ihrem Glauben. In einem jedoch täuschten sie sich: Sie sollte nur für andere genutzt werden. Sie war gefährlich, ihre Magie. Und ihr Gebrauch hatte Folgen.)
»Wie dumm«, sagten die Leute. »Was für eine Vergeudung.«
Doch manche, die nicht vergessen hatten, wie die Zauberin ihnen geholfen hatte – als sie ihre Krankheit geheilt, das Korn gerettet, ihre verirrten Kinder wundersamerweise wiedergefunden hatte –, und ihr immer noch dankbar waren, pressten sich nun fest die Hände vor den Mund, um ihre Trauer zurückzuhalten. »Die arme Schwester Hexe«, sagten sie. »Das arme, arme Geschöpf.« Und ein ganz wenig brach ihnen das Herz dabei.
Die Mutter der Jungen hörte das Getuschel, doch sie sagte nichts. Die Leute mochten glauben, was sie wollten, vermutlich täuschten sie sich ohnehin. Das war nichts Neues.
Schließlich, als das Tageslicht sich neigte und schwach zu werden begann, wurde das tote Kind zu seiner Mutter gebracht. Sie sank auf die Knie.
»Schwester Hexe«, sagte eine ältere Frau. Sie hieß Madame Thuane und war das jüngste Mitglied im Rat der Ältesten. Für gewöhnlich trat sie gebieterisch und streng auf und sie misstraute der Hexe zutiefst, doch die Anwesenheit des toten Kindes schien sie zu erweichen. Ihre Augen wurden feucht und ihr stockte die Stimme. »Ich will Euch ein Tuch bringen, in das Ihr ihn wickeln könnt. Und wir werden ihn so behutsam wie nur möglich aufbahren.«
»Nein, habt Dank«, sagte Schwester Hexe. Niemand konnte ihr helfen. Diesmal nicht. Und so kümmerte sie sich auch nicht um die Blicke ihrer Nachbarn in ihrem Rücken, als sie sich den Kopf ihres Sohnes auf die Schulter legte, die Arme um seinen Körper schlang und ihn zum letzten Mal nach Hause trug.
Als sie das Haus betrat, war es still und traurig. Ihr Mann lag neben dem Bett auf dem Boden und schlief tief und fest, erschöpft von Sorge und Trauer.
Ned, ihr Kind, das noch am Leben war, kämpfte um Atem. In seiner Lunge war Wasser und Schlamm. Der Große Fluss kochte noch in ihm und forderte das Leben des Jungen, der eigentlich in ihm hätte ertrinken sollen, nun mit seinem Fieber. Die Chancen standen schlecht, dass der Junge die Nacht überlebte. Zumindest ohne Hilfe.
»Oh nein«, flüsterte Schwester Hexe. »So weit wird es nicht kommen. Mein kleiner Ned wird leben.«
Sie ging zu ihrem Nähkorb und zog eine Spule mit einem starken, schwarzen Faden daraus hervor. Dann zückte sie eine Nadel und ließ sie so lange über die Kante eines Schleifsteins fahren, bis die Spitze derartig scharf war, dass schon die zarteste Berührung an ihrem Finger eine winzige Blüte tiefroten Blutes hervortreten ließ.
Sie hielt inne, führte den verletzten Finger an ihre Lippen und saugte das Blut auf. Dann schloss sie die Augen, und einen Augenblick lang sah es so aus, als würde sie noch um eine Entscheidung ringen.
Magie sollte nur anderen nutzen. Nicht: konnte.
Das Gebälk des Hauses knarrte und die Dachsparren klapperten und aus den Bodendielen stieg ein übel riechender Rauch auf.
Das Haus stank nach Magie – erst nach Schwefel, dann nach Asche, dann nach blubbernder Süße.
Die Magie, das wusste sie, war aufgewacht, sie lauschte und war hungrig.
Sie wollte hinaus.
»Du bleibst, wo du bist«, fuhr Schwester Hexe sie an. »Dich werde ich nicht brauchen.«
Die Magie, uralt und übellaunig, wie sie war, blieb vorerst noch stumm. Sie war in ihrem Tontopf gefangen und sicher verstaut in der Werkstatt von Schwester Hexe – einem trockenen, sandigen Keller unter dem Haus, den man nur über die Falltür unter dem Teppich erreichen konnte. Doch sie ruckelte so heftig auf dem Regal hin und her, dass der Topf gegen die Wand stieß.
Ohne uns kannst du es nicht tun. Die Magie sagte es nicht laut, doch Schwester Hexe konnte die Worte spüren. Na komm schon, du herrische alte Vettel. Lass uns raus. Wir wollen dir doch bloß helfen.
»Ich meine es ernst«, sagte Schwester Hexe, doch ihre Stimme klang schon deutlich weniger überzeugt. »Ich schaffe das schon allein. Du machst mir nur alles zunichte.«
Die Magie stieß eine Grobheit aus, doch Schwester Hexe ging nicht darauf ein.
Schäumend vor Wut klapperte die Zauberkraft mit ihrem Topf und war dann still. Es war eine angespannte, trockene Stille, als hielte sie lauschend den Atem an.
»So ist es brav«, sagte Schwester Hexe laut, als lobe sie ein launisches Kind. Dann machte sie sich an die Arbeit.
Sie kramte in ihrer Wäschetruhe, bis sie ein Stück weißen Stoffes gefunden hatte. Es war nicht ganz so sauber, wie sie gehofft hatte, doch sauber genug.
Das wird nicht reichen, flüsterte die Magie.
»Ich höre dir nicht zu«, sagte Schwester Hexe, während sie versuchte, mit dem Daumennagel die Flecken abzukratzen.
Na, komm schon, drängte die Magie. Für die Mächtigen ist der Tod doch nicht das Richtige und für die Klugen erst recht nicht. Der Junge muss nicht sterben. Weißt du überhaupt, wohin die Toten gehen? Wir auch nicht und wir wollen es auch nicht wissen. Lass uns dir doch helfen, allerliebste Hexe. Bitte.
Sie würde die Magie nicht helfen lassen. Das sagte sie sich noch, während sie den Teppich über der Falltür beiseitetrat. Sie würde die Magie nicht für ihren persönlichen Vorteil nutzen. Das sagte sie sich, während sie die Leiter hinunterkletterte und vor den Tontopf auf dem Regal trat.
»Das ist keine Magie«, sagte sie, als sie den Faden auf den Deckel des Topfes legte. Der Tontopf erzitterte und rauchte. Der Faden glühte orange auf, dann gelb, dann blau, dann weiß. Er glitzerte.
Ah!, seufzte die Magie. Ah, ah! Wir haben es doch gewusst …
»SCHWEIG STILL!«
Die Magie gehorchte. Schwester Hexe wickelte den Faden in das Tuch und hastete anschließend so rasch die Leiter hinauf, als hätte sie sich verbrannt.
Der Faden war jetzt schrecklich schwer.
Ihn nur zu halten, schmerzte in ihren Händen.
»Das ist keine Magie«, sagte sie laut, als könne sie es dadurch wahr werden lassen.
Und es war ja auch keine Magie. Nicht wirklich. Der Faden hatte die Kraft im Inneren des Tontopfes ja nie wirklich berührt. Er war ihr nur nahe gekommen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen beinahe und tatsächlich. Genauso wie es ein Unterschied war, ob man etwas nicht tun sollte oder …
Sie schüttelte den Gedanken ab.
Tams Körper lag auf dem Küchentisch – kalt, aufgequollen und erschreckend regungslos. Schwester Hexe setzte sich neben ihn, strich ihm mit der Hand über Wangen und Stirn und fuhr mit den Fingern durch seine dunklen, feuchten Locken. So wartete sie darauf, dass die Sonne unterging.
Wenn jemand stirbt, bleibt seine Seele bis zum Sonnenuntergang in seinem Körper gefangen. Dann aber tritt sie aus ihm heraus und zieht … an einen anderen Ort. Niemand weiß, wohin. Schwester Hexe hatte es miterlebt, viele Male schon. Doch eingeschritten war sie nie.
Bis jetzt.
Die Sonne hing am Horizont, rot und prall wie ein überreifer Pfirsich, bis sie der Nacht entgegenfiel. Der Himmel leuchtete in schreiend bunten Farben; es war, als wollte er auf sich aufmerksam machen.
Ned hustete und stöhnte. »T-t-tam«, flüsterte er in seinen Träumen.
»Bald«, sagte sie zu ihrem noch lebenden Sohn am anderen Ende des Raumes. Dann beugte sie sich über den toten Zwilling und küsste ihn auf beide Augenlider. »Sehr bald.«
Die Sonne zog sich in die Breite, schlug Wellen und verschwand hinterm Horizont. Im selben Moment durchfuhr Tams Körper ein leichtes Zittern, und vor den Augen seiner Mutter begann sich seine Seele aus seinem Mund herauszuwinden, genau wie sie es vorausgesehen hatte. Und, oh, sie war wunderschön! Langsam spross die Seele, entfaltete sich Blatt für Blatt, bis sie sich wie eine Blüte vollständig geöffnet hatte und vor ihr schwebte. Schwester Hexe stockte der Atem. Mein Kind!, dachte sie. Mein geliebtes kleines Kind. Sie warf das weiße Tuch über die Seele und wickelte sie wie einen Säugling. Dann drückte sie sie leise summend an ihre Brust.
Die Seele flatterte und strampelte unter dem weißen Tuch, versuchte verzweifelt zu entkommen.
»Ich weiß, mein Schatz«, flüsterte sie der Seele zu. »Ich weiß, mein süßer kleiner Junge. Es tut mir leid. Aber ich kann nicht euch beide verlieren. Nicht auf einmal. Das ertrage ich nicht.«
Sie ließ ihre Stimme ruhig und unbeschwert klingen. Doch in ihrem Inneren brach ihr das Herz. In tausend Scherben zerfiel es ihr. Und heilen würde es nie. Sie hob die Seele an ihr Gesicht und küsste sie sanft.
»Bleib bei deinem Bruder«, sagte sie, während sie die Seele an die Brust des sterbenden Jungen presste. »Halte ihn am Leben«, sagte sie, während sie die Nadel zückte. »Beschütze ihn«, sagte sie, während sie den Faden entwirrte und mit den Zähnen ein Stück abbiss.
Und während sie beide durchstach, die Seele und den Jungen, während sie beide aneinandernähte, sagte sie noch:
»Mutter liebt euch. Vergesst das nicht.«
Und inmitten der Dunkelheit, in jenem Haus der Trauer, öffnete die Seele weit ihren Mund und schrie.
Und aus dem Schrei wurde ein Stöhnen.
Und aus dem Stöhnen wurde ein Husten.
Und Ned begann zu gesunden. Und er blieb am Leben.
3
Die Steine
Es war Abend und der Schatten der Bäume fiel über den kleinsten und jüngsten der Neun Steine.
Hätte er Augen gehabt, er hätte sie geöffnet.
Hätte er einen Mund gehabt, so hätte er gegähnt. Vielleicht sogar gelächelt.
»Ich bin wach«, sagt er verblüfft. Etwas hatte ihn geweckt, auch wenn er keine Ahnung hatte, was es gewesen sein mochte.
»Wir alle sind wach«, sagte ein anderer Stein. Es konnte durchaus der Sechste gewesen sein. Es war lange her, seit der Jüngste ihre Stimmen gehört hatte, so lange, dass er sie ganz vergessen hatte.
»Bedeutet das …« Er hielt inne. Er konnte es nicht einmal aussprechen.
»Womöglich«, sagte eine andere Stimme. Die, die vielleicht, vielleicht auch nicht dem Sechsten gehörte. »Wir können hoffen. Oder wir verzweifeln und schlafen wieder ein. So oder so spielt es keine Rolle.«
»Ich werde hoffen«, sagte der jüngste Stein. Seine Stimme war leise und dünn und knirschte am Ende jedes Wortes.
»Tu das nicht!« Das war der Älteste. Seine Stimme war unverkennbar. Sie rumorte unter der Erde und surrte bis zum Himmel hinauf. Sie brachte Felsen in Bewegung und ließ die Kiesel aus den Flussbetten springen. Es war eine Stimme von Gewicht. »Das letzte Mal, als wir uns Hoffnung gemacht haben, gab es Krieg. Und dann war da der Verlust. Und der Schmerz. Und mehr davon wird kommen. Ich kann es spüren.«
Eine lange Zeit lang blieb der älteste Stein stumm. Minuten. Stunden. Tage. Was bedeutet Zeit für einen Stein? Der Jüngste begann sich zu fragen, ob er das Gespräch inzwischen vergessen hatte.
Dann jedoch sagte er: »Warte. Hoffe nicht. Wünsche dir nichts. Verzweifle nicht. Warte nur. Unsere Gefangenschaft ist unsere eigene Schuld, und unsere Erlösung wird so plötzlich kommen wie ein Blitz – oder überhaupt nicht. Es liegt nicht an uns.«
Und so warteten sie. Die Neun Steine gemeinsam. Sie warteten und warteten und warteten.
4
Der falsche Junge
Neds Fieber ging schließlich zurück, doch er war nicht mehr der Alte. Sein Gang hatte sich verlangsamt, seine Augen leuchteten nicht mehr und sein Lachen hatte ihn vollständig verlassen. Wie benommen saß er in einer Ecke und bastelte kleine Puppen aus Stoffresten, die er dann an sich drückte. Seine Augen waren schmal wie Schlitze, sein Mund fest verschlossen. Sprechen wollte er überhaupt nicht mehr.
»Er wird sich wieder fangen«, sagte seine Mutter entschieden, als könnten ihre Worte allein dafür sorgen. »Warte nur ab.«
Aber nichts änderte sich. Eine Ewigkeit lang.
Die Fäden auf Neds Brust waren, so schrecklich sie auch ausgesehen hatten, nur Augenblicke, nachdem die Hexe sie eingenäht hatte, mit seiner Haut verschmolzen – gezogen werden konnten sie nicht mehr. Das war nicht absehbar gewesen. Wie so vieles. Wenn sie ihre Hand auf seine Brust legte, spürte sie das Klopfen seines Herzens – aber auch, wie noch etwas anderes darin flatterte. Sie schloss die Augen, stellte sich die wunderschöne Seele vor und redete sich ein, es sei so das Beste.
»Du bist einfach du selbst«, sagte sie zu Ned, auch wenn sie wusste, dass es eine Lüge war.
»Und du wirst geliebt«, fügte sie hinzu. Und das war wahr.
Doch glaubte er ihr? Schwester Hexe hatte keine Ahnung.
Ihr Mann verbrachte derweil den ganzen Tag und große Teile der Nacht im Sägewerk oder im Wald oder beim Holzhacken. Der Stapel hinter der Scheune war inzwischen hoch genug, um ein neues Haus damit zu bauen. Oder ein gigantisches Floß, um damit aufs Meer hinauszufahren oder einen Jungen vorm Ertrinken zu retten.
Es ist nicht deine Schuld, das sagte seine Frau ihm wieder und wieder. Doch es half nichts. Sie sah seine graue Haut, die bleischweren Augen, sah den kummervoll erstarrten Mund. Er war kein großer Mann, aber er hatte Schultern so breit wie ein Ochse und Arme und Beine so dick wie Baumstämme. Und doch ging er jeden Tag gebeugt unter dem Gewicht seiner Schuld und seiner Traurigkeit, als trüge er einen riesigen Mühlstein um den Hals. Ned konnte er nicht anschauen.
Was nicht verwunderte, denn Ned hatte das Gesicht seines Bruders.
(Und mehr als nur sein Gesicht, wie Schwester Hexe bitter dachte.)
Derweil sprach Ned noch immer kein einziges Wort. Es liegt am Fieber, beruhigte sich Schwester Hexe im Stillen. An der Trauer. Doch während die Jahre vergingen, wurde Neds Schweigen größer und größer. Es legte sich drückend auf sein Gesicht und seinen Körper, es breitete sich im Haus aus und drang bis auf den Hof hinaus. Sein Schweigen wog schwer. Es war greifbar, spürbar, machte sich bemerkbar. Und den Menschen fiel es auf.
Je länger er nichts sagte, desto häufiger flüsterten die Leute: der falsche Junge, und desto weniger Kraft hatte Schwester Hexe, um dagegen anzukämpfen. Es war längst zum geflügelten Wort geworden.
Und so wuchs Ned heran.
Der falsche Junge, sagte das Dorf.
Der falsche Junge, sagte die Welt. Jahr für Jahr für Jahr.
Und Ned glaubte es selbst.
5
Áine
Weit fort, am anderen Ende der Welt, lebte ein Mädchen namens Áine mit ihrer Mutter und ihrem Vater, die sie beide sehr lieb hatte. Als Áine noch ganz klein war, war ihre Mutter Fischerin gewesen – die geschickteste und am meisten bewunderte von allen Fischern entlang der Küste. Ihr Geschick im Navigieren war legendär, und es hieß, sie sei weiter in die unentdeckten Regionen des Meeres vorgestoßen als jeder andere vor ihr. Von ihrer Mutter lernte Áine, ein Schiff zu steuern, im Stand des Wassers zu lesen und einen Kurs abzustecken, den Kampf mit einem Fisch aufzunehmen und einem Sturm die Stirn zu bieten. Jedermann sagte, eines Tages würde sie ebenso gut sein wie ihre Mutter.
Doch dann verlor ihre Mutter ganz plötzlich ihr Augenlicht.
Und dann begann das Zittern. Und die Anfälle, die Stunden dauerten.
Bald schon musste das geliebte Fischerboot verkauft werden, weil sie Geld für Arznei brauchten. Auch die Seekarten wurden verkauft. Und die Werkzeuge. Erbstücke. Ringe. Winterstiefel. Ein Hochzeitskleid. Selbst das Fernglas ihrer Mutter. Alles, was sich in Münzen eintauschen ließ, wurde zum Marktplatz gebracht – alles, was zu ihrer Genesung beitragen konnte. Und die Arznei wirkte. Bis sie es nicht mehr tat.
Und als Áine erst zehn Jahre alt war, ging das Leben ihrer Mutter zu Ende.
Noch während dieser letzten Augenblicke saß Áine am Krankenbett und wollte die aufgesprungenen Lippen dazu bewegen, Brühe aufzunehmen, wollte mit einem kühlen, feuchten Tuch das Fieber vertreiben, versuchte noch immer, sie zu retten. Doch die Augen ihrer Mutter waren längst blutunterlaufen und erblindet und ein dicker, gelber Film hatte sich über das Weiße gelegt. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und rang nach Atem, während sie Áines Hand umklammerte.
»Der falsche Junge«, flüsterte ihre Mutter und ihre Stimme war so rau und trocken wie ein Mund voller Sand. Sie hustete. »Der falsche Junge wird dein Leben retten und du das seine. Und der Wolf …« Ihr blieb die Luft weg und sie erschauderte.
Doch was ein Wolf mit Jungen zu tun hatte (mit richtigen, falschen oder sonst welchen), das sagte Áines Mutter nicht. Stattdessen drückte sie ein letztes Mal die Hand an Áines Herz, bevor sie sie wieder aufs Bett hinabsinken ließ. Und bald schon setzte ihr schwacher Atem aus und sie war tot.
Da Áine ein praktisch veranlagtes Mädchen war, ein tüchtiges Mädchen, das nicht zur Rührseligkeit neigte, verschwendete sie keine Zeit mit Weinen. Sie liebte ihre Mutter und sie vermisste sie furchtbar, doch vom Weinen wurde die Wäsche nicht gewaschen und das Brot nicht gebacken und auch die Suppe nicht gekocht, und ganz gewiss würde es ihre Mutter nicht von den Toten zurückholen. Davon abgesehen weinte Áines Vater genug für sie beide zusammen.
Ihre Mutter hatte sie gut unterrichtet. Áine wusste, wie man ein Haus sauber und warm und sicher hielt. Sie wusste, wie man Netze knüpfte und mit ihnen Fische aus den Stadttümpeln fing und wie man diese mit Rauch und Salz haltbar machte. Sie konnte die Reste eines Bratens strecken, indem sie einen Eintopf daraus machte, der eine Woche oder länger vorhielt. Sie wusste, wie man auf dem Marktplatz feilschte. Und all das kam nun sehr gelegen, denn ihr Vater hatte sich mit einem Krug Wein und seiner schluchzenden Traurigkeit in seinem Zimmer eingeschlossen. Er ging nicht mehr in den Laden, in dem er arbeitete. Er redete nicht mehr mit ihr. Seine Tränen rannen wie aus überlaufenden Flüssen und drohten sie beide ertrinken zu lassen. Áine watete tief durch den Sumpf dieser Trauer.
Währenddessen wurden die Münzen in ihrem Einweckglas immer weniger, bis schließlich keine mehr übrig waren. Zugleich wurde das Ölfass leichter und die Speisekammer kahler und der Bohnenkrug so leer wie Áines Herz. Selbst die Fische gingen ihr aus.
Schließlich kam der Ladenbesitzer zu ihnen nach Hause und sagte, dass ihr Vater nicht zur Arbeit zurückkommen müsse. Kurz darauf ließ ihr Wirt sie wissen, dass sie ihre Sachen packen und einen anderen Ort zum Leben finden müssten. Und so war Áine schließlich doch noch am Ende ihrer Weisheit angelangt. Also ging sie ins Zimmer ihres Vaters und weckte ihn auf.
»Vater«, sagte sie. »Der Ladenbesitzer sagt, du musst nicht mehr zur Arbeit kommen, und der Wirt sagt, dass wir ausziehen müssen, und es sind keine Münzen mehr im Glas, sodass ich kein Mehl mehr kaufen und kein Brot mehr backen kann. Und es steht keine Suppe auf dem Feuer, weil uns das Fleisch ausgegangen ist.«
Die Kartoffeln auch, dachte Áine. Und die Linsen. Und der Fisch. Und das Salz. Und auch alles andere, das vielleicht in den Topf hätte geworfen werden können. Im Stillen rechnete sie aus, was nötig wäre, um sie eine Woche lang zu ernähren. Einen Monat lang. Ein Jahr. Woher sollte das Geld kommen? Sie hatte keine Vorstellung.
Ihr Vater trocknete seine Augen und setzte sich auf. Er war ein großer Mann. Ein Riese. Sein rotes Haar leuchtete, als stünde ihm der Kopf in Flammen, und auf sein Gesicht stahl sich der listige Ausdruck eines Banditen – denn das war er gewesen, bevor Áine auf die Welt gekommen war, wenn sie davon auch keine Ahnung hatte. Noch nicht.
Er fuhr sich mit der Hand über den roten Bart, strich ihn unter dem Kinn zu einer Spitze glatt und betrachtete seine Tochter mit zur Seite gelegtem Kopf. Seine Züge wurden weicher. Schließlich drückte er die Lippen aufeinander, als habe er sich zu einer Entscheidung durchgerungen. »Also, meine kleine Blume«, sagte er langsam, legte seine große breite Hand auf ihre Wange und beugte sich über sie, um ihre Stirn zu küssen. »Du sagst also, wir hätten nichts mehr?«
Im Nachhinein wünschte Áine, sie hätte dem seltsamen Leuchten, das bei der Erwähnung des Wortes nichts in den Augen ihres Vaters aufgetaucht war, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Als hafte dem Wort nichts oder dem, wofür es stand, etwas Magisches an. Als sei es ein Faustpfand der Macht oder des Verderbens.
»Überhaupt nichts?«, hakte er nach. Das Leuchten wurde stärker.
»Nein, Vater«, sagte sie zögerlich. »Ich würde nie behaupten, dass wir gar nichts mehr haben.«. (Schon wieder! Dieses Leuchten!) »Wir haben noch unsere Hände und unsere Köpfe und einen starken Rücken. Das ist doch immerhin etwas. Mutter hat immer gesagt, dass ein scharfer Verstand wertvoller ist als ein Schloss voller Gold.« Das Mädchen schluckte und schloss die Augen. Sie vermisste ihre Mutter so sehr, dass sie das Gefühl hatte, entzweigerissen zu werden. »Und sie hat immer recht gehabt.«
Die grünen Augen ihres Vaters zogen Falten an den Winkeln, und in jeder hielt sich die Spur einer Träne. Er legte seinen Kopf in den Nacken und stieß einen Schrei aus, der zuerst wie Wehklagen klang, sich dann aber in ein gewaltiges, dröhnendes Gelächter verwandelte. Seine Stimme war kühl und hell und klar, als wäre seine Traurigkeit plötzlich zerbrochen und in glitzernden Scherben auf den staubigen Boden herabgerieselt. Er stand auf, schnappte sich seine Tochter bei der Taille und schleuderte sie umher, als wöge sie nicht mehr als ein Maß Mehl. Dann setzte er sie sich auf die Schulter wie einen kleinen Vogel.
»Wahrlich, meine Tochter, mein Goldschatz, meine Hoffnung«, sang er. »Die Welt ist weit und reich und wandelt sich schnell! Dieses Dorf ist zu winzig für Menschen, die so klug sind wie wir. Pack unsere Sachen, mein Engel, und lass uns das Weite suchen!« Er setzte sie behutsam auf dem Boden ab, griff nach seinem Hut und seinen Stiefeln und einem leeren Ledersack und eilte in die Nacht hinaus. »Ich besorge uns noch Vorräte, meine kleine Blume!«, rief er von draußen. »Sammle alles zusammen, was dir gehört. Wir brechen auf, bevor der Mond am Himmel steht!«
Es gab nicht viel zu packen. So viel von dem, was sie besessen hatten, war bereits verkauft worden. Das wenige, das sie noch ihr Eigen nannten, passte leicht in einen kleinen Rucksack – und ließ noch Platz obendrein. Was von den Habseligkeiten ihrer Mutter übrig geblieben war – Papiere, zwei vernünftige Kleider, ein Bündel Haushaltshefte, und Áine wusste nicht, was sonst noch –, lag verschlossen in einer mit Leder ausgeschlagenen Kiste. Und die würde sie nicht zurücklassen. Also setzte sie sich auf die Kiste und wartete auf ihren Vater.
Sie wusste nicht, wie er das, was sie brauchen würden, ohne Geld erwerben wollte, doch ihr Vater erstaunte sie, indem er mit einer vollen Geldbörse am Gürtel heimkehrte und mit dem ehemals leeren Sack, der nun, sehr voll und sehr schwer, über seiner Schulter baumelte.
»Vater …«, begann sie.
»Keine Fragen«, sagte er. Seine Augen leuchteten und hatten einen wilden Ausdruck, seine Wangen waren gerötet. Sein Blick huschte hin und her, als seien ihnen bereits Feinde auf den Fersen. »Komm! Zu unseren Pferden!«
»Wir haben keine Pferde!«, wandte Áine ein.
»Jetzt haben wir welche«, sagte ihr Vater mit einem übermütigen Grinsen. Er packte ihren Arm mit der einen Hand und ihre Habseligkeiten mit der anderen und zog alles, was von ihrem Leben in diesem Haus übrig war, hinaus in die Dunkelheit.
Sie ritten nach Osten, über Grasland, durch die Sümpfe und durchs Gebirge, bis sie einen tiefen, düsteren Wald erreichten. Es war, wie die Leute sagten, der größte Wald der Welt.
Áine presste sich die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien. »Wir können dort nicht hinein«, stieß sie aus. Der Wald war ein Feind, erschaffen von der Magie der bösen Sprechenden Steine. Er hatte Städte und Bauerndörfer zerstört und unzählige Menschen umgebracht. Und auch jetzt noch war er verflucht: Seine Pfade blieben nicht an Ort und Stelle, und seine Bäume waren launisch und bösartig. Ein jeder wusste das. Áine kannte die Geschichte, solange sie denken konnte.
»Fürchte dich nicht, mein Liebes«, sagte ihr Vater. Er streckte die Hand aus und legte sie auf den nächsten Stamm. Voller Verblüffung sah Áine, wie der Baum sich daraufhin aufrichtete, nur ein wenig. Und vor ihren Augen tat sich ein Pfad auf, der unter ihrem Blick immer breiter wurde.
»Vater …«
»Nicht jede Geschichte ist wahr«, sagte ihr Vater. »Und manchmal rettet uns das, was Böse schien, und das Gute verurteilt uns zu Elend und Schmerz. Wir erheben unseren Blick zum Himmel, doch leben müssen wir auf dem Boden. Komm. Ich zeige es dir.«
Ihr Vater hatte keine Angst, also verspürte Áine ebenfalls keine und sie setzten ihren Weg auf dem düsteren Pfad fort.
Er war in diesem Wald aufgewachsen, erzählte er ihr, und wäre wohl für immer in ihm geblieben, wäre da nicht seine Liebe zu einer guten Frau gewesen, die ein einfaches, ehrliches Leben im Dorf hatte führen wollen. Er sagte ihr, dass der Wald ihr nichts tun, sondern ihnen ein gutes Leben ermöglichen würde.
Kein ehrliches Leben allerdings, das nicht. Das Leben der Banditen. Sie sprach das Wort nicht aus und ihr Vater ging auch nicht weiter darauf ein, doch das Wort hing zwischen ihnen in der Luft wie eine Wolke.
Ein Bandit war er gewesen. Früher. Nun verstand Áine .
Er fand das Haus, in dem er aufgewachsen war. Es war winzig, aus Steinen und Balken, mit einem moosbewachsenen Dach, versteckt in einem Dickicht aus Bäumen neben einem Wasserfall und einem tiefen Tümpel. (Keine Fische, das fiel Áine sofort auf. Sie befanden sich hier zu weit stromaufwärts. Schade.) Es gab sogar eine verfallene Scheune. Ihr Vater ließ sie draußen warten und stöberte eine Weile durch das Haus. Schließlich hörte sie, wie er einen Freudenschrei ausstieß, dann kam er zur Haustür herausgelaufen und sah irgendwie größer, stärker und wilder aus als vorher. Er trug etwas um den Hals – einen Stein, der aussah wie ein Auge, das an einem Lederband baumelte.
»Vater«, begann Áine, »was ist das da an deinem …«
»Keine Fragen«, herrschte ihr Vater sie wütend an und das Auge an seinem Hals leuchtete plötzlich hell auf. Áine schrak zurück, atmete aber auf, als der zornige Blick von einem Ausdruck derartiger Sanftheit und Freundlichkeit abgelöst wurde, dass sie dachte, sie hätte es sich bloß eingebildet. »Wir haben keine Zeit für Fragen, meine kleine Blume. Schau! Unser neues Zuhause!«
Es war in einem schrecklichen Zustand, doch Áine liebte das Haus. Innerhalb einer Woche war es nicht weniger ordentlich und sauber und heimelig als ein jedes Kaufmannshaus in ihrer alten Stadt. Áines Vater baute die Scheune wieder auf und brachte ihr bei, wie man mit Pfeil und Bogen jagte, wie man dem Waldboden Nahrung entlockte und welche Pilze und Beeren und Wurzeln man ohne Gefahr essen konnte. Er stahl Ziegen, die Milch gaben, und Hühner, die Eier legten, und dann und wann ein Fass Wein.
Vor den Wölfen aber warnte er sie. »Denk immer dran, sie zu erschießen, bevor sie dir die Kehle herausreißen«, sagte er finster. »Trau niemals einem Wolf.«
Jedes Mal, wenn er das sagte, spürte sie noch einmal die Hand ihrer Mutter, die auf ihr Herz drückte.
Seit jenem Tag hatten sie stets genug zu essen. Und Áine war glücklich. Meistens. Sie liebte den Wald und sie liebte ihren Vater, und beide erwiderten ihre Liebe. Und wenn auch der Wind in den Bäumen manches Mal, wenn sie im Bett lag, wie das Meer klang und ihr daraufhin ein Schluchzer durch die Brust fuhr wie ein Nadelstich, so wusste sie doch, dass es so am besten war.
Der Fluss neben ihrem Haus floss schließlich zum Meer. Und das musste eben genügen.
Und das tat es auch. Bis es nicht mehr genügte.
6
Ein Besuch von der Königin
Wie immer erwachte Ned, noch bevor die Sonne aufging. Er zog sich sein Hemd über und dann, als er die Kälte bemerkte, die in der Luft hing, gleich noch ein weiteres. Im Nebenraum schnarchte sein Vater so dröhnend, dass die Dielenbretter und die Fenster klapperten und das Geschirr im Schrank klirrte. Neds Eltern würden bald erwachen, und dann war es ihm lieber, außer Reichweite zu sein. Nachdem er in seine Schafsfellstiefel geschlüpft war, die beide so weich und abgenutzt waren wie oft getragene Hausschuhe, tapste er leise auf den Hof hinaus. Wie die meisten Häuser, die er in seinem Leben gesehen hatte, war es aus Flusssteinen und Mörtel und das Dach aus Holzschindeln. Es war eine reine Freude, daran hochzuklettern.
Ned begrüßte jeden Morgen vom Dachfirst aus, ganz gleich, wie das Wetter war. Er sah dem Tag gern dabei zu, wie er sich langsam in Bewegung setzte. Noch war der Himmel von einem tiefen Violett und zarten Grau. Nebel hing über den Feldern, verdeckte die Sicht und ließ die Welt verschwimmen.
Er griff in die Tasche seines Hemdes, zog ein Stück Holz und ein sehr scharfes Messer heraus und begann damit, eine Figur zu schnitzen. Auch dies tat er jeden Morgen. Es war die eine Sache, die er wirklich gut konnte – auch wenn kein Mensch davon eine Ahnung hatte. Wie auch? Jeden Abend trug er seine Schnitzereien zum Ufer des Großen Flusses, setzte sie in ein Papierschiffchen und übergab sie dem Strom. Seine Figuren zeigte er niemandem und er sah sie niemals wieder.
Er hoffte, sie würden es zum Meer schaffen.
Der Himmel hellte sich auf, während Ned rittlings auf dem moosigen Dachfirst arbeitete. Im Haus waren seine Mutter und sein Vater aufgewacht. Er hörte ihr gedämpftes Murmeln und ihre eiligen morgendlichen Verrichtungen. Wenn sie seinen Namen sagten, klangen sie so gedrückt, als sei er eine große Bürde. Sie machten sich bereit, um im Dorf das Jubiläum der Königin zu begehen – denn im ganzen Land wurden die neunzig Jahre ihrer weisen und friedvollen Regentschaft gefeiert. Aus diesem Anlass war die Königin die vergangenen Monate durchs ganze Land gereist, und nun, zum Abschluss, kam sie auch in ihr Dorf. Es war das am weitesten abgelegene und gewiss das rückständigste Dorf des ganzen Königreichs.
Hinter Neds Dorf begann der Wald.
In den Wald wagte sich niemand hinein. Keine Soldaten. Keine Krieger. Niemand. Nur Neds Vater, der Holzfäller. Nur er war mutig genug.
Doch heute würde es im Dorf einen Menschenauflauf geben und Speisen und Gesang und allerlei Vergnügungen. Die Leute würden sich herausputzen. Und Ned verstohlene Blicke zuwerfen, die ihm jedoch nicht entgingen. Er konnte sie im Nacken spüren. Seine Eltern wollten, dass er sie auf das Fest begleitete, daran hatten sie keine Zweifel gelassen.
Doch er würde nicht mitgehen, sagte er sich. Auf keinen Fall.
Er widmete sich wieder seiner Schnitzerei. Das Messer in seiner Hand war klein, aber mit seinem Knochengriff und der Klinge aus poliertem Stahl hervorragend zu gebrauchen. Es reagierte schon auf den leichtesten Druck. Ned versah seine Figur mit einem Anzug samt dreier Knöpfe und den hohen Stiefeln eines Holzfällers. Er schnitzte lockiges Haar, helle Augen und ein halbes Lächeln. Sie sah aus wie Ned, abgesehen von einem entscheidenden Unterschied: Ned lächelte nie.
Fast eine Stunde nachdem seine Eltern erwacht waren, traten sie auf den Hof hinaus. Sein Vater trug dieselbe Jacke und dieselben Stiefel wie immer, doch seine Mutter hatte ihr zweitbestes Kleid gewählt und ihren zweifach gefärbten violetten Umhang. Normalerweise ging sie nur in schlichten Brauntönen aus, doch heute war ein besonderer Tag. Offenbar genügte es nicht, eine Frau mit außergewöhnlichen Kräften zu sein, heute musste sie auch wie eine aussehen.
»Ned!« Vom Gemüsegarten aus rief seine Mutter zu ihm hinauf. »Es ist Zeit. Der Festzug wird bald hier sein. Komm jetzt herunter, bitte.«
Ned schüttelte den Kopf. Er antwortete seiner Mutter nicht, aber das erwartete sie auch nicht von ihm. Niemand erwartete von ihm auch nur ein einziges Wort. Er sprach so gut wie nie, und wenn, kam aus seinem Mund nur gestottertes Kauderwelsch. Dabei schwitzte er, zitterte und fühlte sich, als wäre ihm ein Mühlstein auf die Brust gebunden worden. Worte waren seine Feinde. Sie klapperten in seinem Mund wie abgebrochene Zähne oder tanzten von den Seiten der Bücher wie Staubkörner, die man mit einem Niesen in alle Winde verstreut.
In der Hoffnung, seine Eltern nicht begleiten zu müssen, wenn sie sahen, wie schrecklich beschäftigt er war, hielt er seine Schnitzerei hoch. Das gesamte Dorf würde sich versammeln, um den Tross der Königin zu empfangen – und auch noch viele Leute von außerhalb. Im Dorf fiel die Schule aus, und alle Läden würden schließen, sobald der Festzug angekommen war. Es handelte sich schließlich um die Königin. Jeder hatte schon seit Monaten Vorbereitungen getroffen.
Schwester Hexe verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte langsam den Kopf. Diese Auseinandersetzung würde er wohl kaum für sich entscheiden können. Sie wusste, wie sie ihren Willen durchsetzte.
»Hör auf deine Mutter«, sagte sein Vater mit ungeduldiger Stimme und ohne aufzuschauen. Er sah Ned nicht an.
Das tut er nie, dachte Ned.

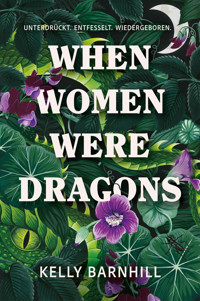













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













