
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Im Sternenlicht liegt natürlich Magie. Das ist allgemein bekannt. Aber Mondlicht: Das ist eine ganz andere Geschichte. Mondlicht ist pure Magie. Das weiß jeder. Diese Geschichte erzählt von einer Hexe, von der alle glauben, sie sei böse, einem kleinen Mädchen, das die Hexe bezaubert, einem Sumpfmonster, das Gedichte liebt, von einem wahrhaft winzigen Drachen und einem jungen Mann, der sich aufmacht, die Hexe zu töten. Jedes Jahr lassen die Bürger des Protektorats ihr jüngstes Kind im Wald zurück – als Opfergabe zum Schutz vor der bösen Hexe. Jedes Jahr rettet die Hexe die ausgesetzten Kinder, denn sie ist überhaupt nicht böse. Dieses Jahr jedoch ist alles anders: Die Hexe gibt dem ausgesetzten kleinen Mädchen aus Versehen Mondlicht zu trinken. Und Mondlicht ist pure Magie! Und so wächst in dem Mädchen große Macht heran … Wird Luna diese Macht für das Gute einsetzen und die Stadt, die sie einst opferte, von ihrem grausamen Schicksal befreien?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kelly Barnhill
Das Mädchen, das den Mond trank
Über dieses Buch
Im Sternenlicht liegt natürlich Magie. Das ist allgemein bekannt. Aber Mondlicht: Das ist eine ganz andere Geschichte. Mondlicht ist pure Magie. Das weiß jeder.
Diese Geschichte entspinnt sich um eine Hexe, von der alle glauben, sie sei böse, um ein kleines Mädchen, das die Hexe bezaubert, um ein sechsarmiges Sumpfmonster, das Gedichte schreibt, um einen Wahrhaft Winzigen Drachen und um einen jungen Mann, der sich aufmacht, die Hexe zu töten.
Jedes Jahr lassen die Bürger des Protektorats ihr jüngstes Kind im Wald zurück – als Opfergabe zum Schutz vor der bösen Hexe. Jedes Jahr rettet die Hexe Xan die ausgesetzten Kinder, denn sie ist gar nicht böse. Dieses Jahr jedoch ist alles anders. Xan gibt dem ausgesetzten kleinen Mädchen aus Versehen Mondlicht zu trinken. Doch Mondlicht, das weiß jeder, ist pure Magie! Und so wächst in dem Kind, genannt Luna, große Macht heran … Wird sie diese Macht für das Gute einsetzen und die Stadt, die sie einst opferte, von ihrem grausamen Schicksal zu befreien?
Diese mitreißende Geschichte voller Magie, Humor und märchenhafter Figuren stellt die Frage, was ist Wahrheit, was ist Lüge?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kelly Barnhill erhielt für ihre Kinderbücher bereits zahlreiche Auszeichnungen, für »Das Mädchen, das den Mond trank« neben vielen Leserpreisen auch die renommierte Newberry Medal. Sie lebt in Minnesota mit ihren drei Kindern, ihrem Ehemann, und einem etwas launischen Hund. Sie liebt es zu wandern, ist eine schnelle Läuferin und eine furchtbar schlechte Gärtnerin.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel ›The Girl who Drank the Moon‹ bei Algonquin Young Readers, an imprint of Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing, New York
Text © Kelly Barnhill
Published by Arrangement with Kelly Barnhill
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Norbert Blommel, MT-Vreden, nach einer Idee von Carla Weise
Coverillustration: Yuta Onoda
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5063-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Danksagung
Für Ted, in Liebe
Kapitel 1,… in dem eine Geschichte erzählt wird
Ja, die Hexe im Wald gibt es wirklich. Es hat sie immer gegeben.
Würdest du bitte endlich einmal aufhören zu zappeln? Herrje! Ich habe noch nie so ein zappeliges Kind erlebt.
Nein, mein Schatz, gesehen habe ich sie noch nie. Niemand hat das. Seit ewigen Zeiten nicht. Wir treffen Vorkehrungen, damit es nicht dazu kommt.
Schreckliche Vorkehrungen.
Zwing mich nicht, es auszusprechen. Du verstehst ganz genau, wovon ich rede.
Ach, das weiß ich nicht, Liebes. Niemand weiß, wofür sie all die Kinder braucht. Warum es immer unsere jüngsten sein müssen. Schließlich können wir sie schlecht danach fragen. Niemand hat sie je gesehen. Und wir sorgen dafür, dass es so bleibt.
Natürlich gibt es sie wirklich. Was für eine Frage! Sieh dich doch nur mal im Wald um! All die Gefahren! Giftiger Qualm und klaffende Krater und kochend heiße Geysire, wohin man sich wendet. Glaubst du etwa, das ist Zufall? Von wegen! Das war alles die Hexe, und wer weiß, was aus uns wird, wenn wir nicht tun, was sie verlangt?
Muss ich es dir wirklich erklären?
Das würde ich nämlich lieber nicht.
Na, na, nun wein doch nicht. Man könnte ja meinen, der Ältestenrat stünde vor der Tür, um dich zu holen. Aber dafür bist du schließlich viel zu alt.
Aus unserer Familie?
Ja, Liebes. Vor langer, langer Zeit. Bevor du auf der Welt warst. Er war so ein hübscher Junge.
Aber nun iss brav deinen Teller leer und mach dich an deine Aufgaben. Wir müssen morgen früh aufstehen. Nichts ist so sicher wie der Tag des Opfers, und wir sollten alle da sein, um dem Kind zu danken, das uns ein weiteres Jahr Frieden erkauft.
Dein Bruder? Wie hätte ich denn um ihn kämpfen sollen? Wenn ich das getan hätte, hätte die Hexe uns samt und sonders getötet, und wem wäre damit geholfen gewesen? Entweder man opfert einen, oder man opfert alle. So läuft es nun mal auf dieser Welt. Daran ist nichts zu ändern, selbst wenn wir es versuchen würden.
So, Schluss jetzt mit den Fragen. Und ab mit dir, du Naseweis.
Kapitel 2,… in dem eine unglückselige Frau den Verstand verliert
Ältestenratsvorsteher Gherland ließ sich Zeit an diesem Morgen. Schließlich war nur einmal im Jahr Tag des Opfers, und Gherland war stets darauf bedacht, für die feierliche Prozession zum Haus der betroffenen Familie wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Die anderen Ratsherren hielt er dazu an, es ihm gleichzutun. Es war wichtig, dem Volk etwas zu bieten.
Er tupfte sich sorgfältig Rouge auf die schlaffen Wangen und umrandete seine Augen dick mit schwarzem Puder. Dann überprüfte er seine Zähne im Spiegel auf etwaige Essensreste und sonstige Verunstaltungen. Er liebte seinen Spiegel. Es war der einzige im gesamten Protektorat. Nichts bereitete Gherland mehr Vergnügen, als etwas zu besitzen, das niemand sonst hatte. Er fühlte sich gern wie etwas Besonderes.
Der Ältestenratsvorsteher nannte einige solcher einzigartigen Dinge sein Eigen. Das war einer der Vorzüge seines Amts.
Das Protektorat – von manchen Schilf-Imperium genannt, von anderen Traurige Stadt – lag eingepfercht zwischen einem heimtückischen Wald auf der einen Seite und einem riesigen Sumpf auf der anderen. Die meisten Bewohner des Protektorats verdankten ihr Auskommen dem Sumpf. Sumpfkennern winke eine rosige Zukunft, predigten die Mütter ihren Kindern. Nun ja, oder zumindest überhaupt eine Zukunft, und das war besser als nichts. Im Frühling strotzte der Sumpf vor jungen Zirintrieben, im Sommer vor Zirinblüten und im Herbst vor Zirinknollen – ganz zu schweigen von einem großzügigen Angebot an Heil- und (mit etwas gutem Willen) magischen Pflanzen, die man erntete, trocknete, bündelte und an die Händler jenseits des Waldes verkaufte, bevor diese die Sumpfprodukte weiter in die Freien Städte transportierten. Der Wald selbst war lebensgefährlich und nur auf der sogenannten »Allee« zu durchqueren.
Die Allee gehörte dem Ältestenrat.
Oder anders ausgedrückt: Die Allee gehörte Ältestenratsvorsteher Gherland, und seine Kollegen durften auch daran teilhaben. Dem Ältestenrat gehörte auch der Sumpf. Und die Obstgärten. Und jedes Haus im Protektorat. Jeder Marktplatz. Bis hin zum letzten kleinen Gemüsebeet.
So kam es, dass die Familien im Protektorat ihre Schuhe aus Schilf fertigten. So kam es, dass sie in mageren Zeiten ihren Kindern zähen Sumpfbrei vorsetzten, in der Hoffnung, dass er sie stark machen würde.
So kam es, dass die Ratsherren und ihre Familien, die von Fleisch, Butter und Bier lebten, die Einzigen waren, die groß und stark und rotwangig wurden.
Es klopfte an der Tür.
»Herein«, murmelte Ältestenratsvorsteher Gherland, der gerade die Falten seiner Robe zurechtzupfte.
Es war Antain. Sein Neffe. Er war Ältestenratsanwärter, wenn auch nur wegen eines Versprechens, das Gherland in einem schwachen Moment der unmöglichen Mutter des beinahe ebenso unmöglichen Jungen gegeben hatte. Obwohl, das war nicht ganz fair. Antain war ein netter Bursche von knapp dreizehn Jahren. Er arbeitete hart und lernte schnell. Er konnte gut rechnen, hatte geschickte Hände und vermochte aus dem Stand, eine Bank für einen müden Ratsherrn zusammenzimmern. Ob Gherland wollte oder nicht, der Junge wuchs ihm immer mehr ans Herz.
Aber.
Antain hatte Flausen im Kopf. Die wildesten Ideen. Und Fragen. Gherland zog die Brauen zusammen. Der Junge war – nun, wie sollte er es ausdrücken? Übereifrig. Wenn das so weiterging, würde er der Sache ein Ende machen müssen, Verwandtschaft hin oder her. Bei dem Gedanken wurde ihm das Herz schwer.
»ONKEL GHERLAND!« In seinem unausstehlichen Enthusiasmus fegte Antain seinen Onkel beinahe von den Füßen.
»Nicht so stürmisch, Junge!«, fuhr der Ältestenratsvorsteher ihn an. »Das hier ist ein ernster Anlass!«
Der Junge riss sich augenscheinlich zusammen und wandte sein vor Eifer glühendes, welpenhaftes Gesicht zu Boden. Gherland widerstand dem Drang, ihm den Kopf zu tätscheln. »Man hat mich geschickt«, fuhr Antain nun mit halbwegs gedämpfter Stimme fort, »um dir zu sagen, dass die anderen Ratsherren bereit sind. Und dass das Volk am Straßenrand versammelt ist. Alle sind gekommen.«
»Alle? Keiner versucht, sich zu drücken?«
»Ich bezweifle, dass das nach letztem Jahr je wieder einer versuchen wird«, entgegnete Antain und erschauderte.
»Zu schade.« Gherland wandte sich wieder dem Spiegel zu und frischte ein letztes Mal das Rouge auf. Er genoss es, den Bürgern des Protektorats hin und wieder eine Lektion zu erteilen. Das schaffte klare Verhältnisse. Stirnrunzelnd betastete er die herabhängende Haut unter seinem Kinn. »Gut, Neffe«, sagte er dann und ließ im Umdrehen gekonnt seine Robe flattern – ein Kunststück, das zu beherrschen ihn mehr als ein Jahrzehnt Übung gekostet hatte. »Dann sollten wir uns sputen. So ein Baby opfert sich schließlich nicht von selbst.« Und schon schritt er würdevoll nach draußen auf die Straße, während Antain hinter ihm herstolperte.
Für gewöhnlich wurde der Tag des Opfers mit der gebotenen Würde und Feierlichkeit begangen. Die Kinder wurden widerstandlos ausgehändigt. Die gramgebeutelten Familien trauerten in aller Stille, während sich in ihren Küchen Eintöpfe und andere nahrhafte Speisen stapelten und die tröstenden Arme der Nachbarn ihr Bestes taten, um den Verlust zu lindern.
Normalerweise brach niemand diese Regeln.
Normalerweise.
Ältestenratsvorsteher Gherland presste die Lippen zusammen. Er hörte das Brüllen der Mutter schon, ehe die Prozession auch nur die betreffende Straße erreicht hatte. Die Bürger am Wegesrand waren unruhig.
Am Haus der Familie angekommen, bot sich dem Ältestenrat ein erstaunliches Bild. Ein Mann mit zerkratztem Gesicht, geschwollener Unterlippe und kahlen Stellen auf dem Kopf, wo ihm offensichtlich büschelweise die Haare ausgerissen worden waren, empfing sie an der Tür. Er versuchte zu lächeln, doch seine Zunge schnellte immer wieder reflexartig an die Stelle, wo bis vor kurzem noch ein Schneidezahn gesessen hatte. Der Mann sog die Lippen ein und vollführte eine kleine Verbeugung.
»Verzeihen Sie, meine Herren«, sagte der Mann, vermutlich der Vater. »Ich weiß gar nicht, was in sie gefahren ist. Es ist, als hätte sie den Verstand verloren.«
Als die Ratsherren das Haus betraten, sahen sie über sich in den Dachbalken eine Frau hocken, die aus voller Kehle heulte und kreischte. Ihr glänzend schwarzes Haar peitschte ihr ums Gesicht wie ein Nest sich windender Schlangen. Einem in die Enge getriebenen Tier gleich fauchte die Frau sie an. Während sie sich mit einem Arm an der Decke festhielt, drückte sie sich mit dem anderen ein Baby an die Brust.
»VERSCHWINDET!«, schrie sie. »Ihr bekommt sie nicht. Schande über eure Namen, soll der Teufel euch holen! Schert euch aus meinem Haus, oder ich reiße euch die Augen aus dem Kopf und werfe sie den Krähen zum Fraß vor!«
Die Ratsherren starrten mit offenen Mündern zu ihr hoch. Sie konnten es nicht glauben. Niemand kämpfte um ein todgeweihtes Kind. Das war einfach nicht üblich.
(Antain fing an zu weinen und gab sich die größte Mühe, es vor den Erwachsenen im Raum zu verbergen.)
Geistesgegenwärtig zwang Gherland einen verständnisvollen Ausdruck auf sein zerfurchtes Gesicht. An die Mutter gewandt hob er die Hände, um zu demonstrieren, dass er ihr nichts Böses wolle. Innerlich jedoch fletschte er die Zähne. All diese Freundlichkeit würde ihn noch ins Grab bringen.
»Armes verwirrtes Mädchen. Wir sind es doch nicht, die dir dein Kind nehmen«, sagte Gherland so geduldig, wie er nur konnte. »Sondern die Hexe. Wir tun bloß, was sie von uns verlangt.«
Die Mutter stieß einen drohenden Laut aus, der tief aus ihrer Brust zu kommen schien, wie das Knurren eines Bären.
Gherland legte dem fassungslosen Ehemann die Hand auf die Schulter und drückte sanft zu. »Mir scheint, du hast recht, mein Freund: Deine Frau hat tatsächlich den Verstand verloren.« Er bemühte sich, seine Wut unter vorgetäuschter Sorge zu verbergen. »Eine äußerst seltene Reaktion, keine Frage, aber nichts, was wir noch nicht gesehen hätten. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Was deine Frau braucht, sind tröstende Worte, keine Vorwürfe.«
»LÜGNER!«, kreischte die Frau. Das Baby begann zu weinen, und die Mutter kletterte noch höher, bis sie mit den Füßen auf zwei parallel verlaufenden Balken stand, den Rücken an die Dachschräge gepresst, um sich und das Kind außer Reichweite der Männer zu halten. Dann wiegte sie das Baby sanft hin und her. Das kleine Mädchen beruhigte sich sofort. »Wenn ihr sie mir wegnehmt«, knurrte sie, »werde ich sie finden. Ihr werdet schon sehen. Ich werde sie finden und sie zurückholen.«
»Und es mit der Hexe aufnehmen?«, lachte Gherland. »Ganz allein? Ach, du traurige verlorene Seele.« Seine Stimme klang honigsüß, sein Gesicht jedoch war rot wie ein glühendes Stück Kohle. »Dein Kummer hat dir den Verstand geraubt. Aber Kopf hoch. Wir werden alles tun, um dich davon zu kurieren. Wachen!«
Er schnippte mit den Fingern, und ein Trupp bewaffneter Wachen stürmte das Haus. Es war wie immer eine Spezialeinheit der Schwestern des Sterns. Jede von ihnen trug einen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken sowie ein kurzes, scharfes Schwert am Gürtel. Ihre langen geflochtenen Zöpfe waren straff um ihre Taillen geschlungen und festgesteckt – ein Symbol für die Jahre, die sie mit Meditation und Kampftraining im Turm verbracht hatten. Ihre Mienen waren so unnachgiebig wie Stein, und selbst die Ratsherren wichen, bei aller Autorität und Erhabenheit, vor ihnen zurück. Mit den Schwestern war nicht zu spaßen. Besser, man geriet ihnen nicht in die Quere.
»Nehmt dieser Verrückten das Baby ab und dann bringt die Ärmste in den Turm«, befahl Gherland. Mit finsterer Miene sah er hinauf zu der Mutter, die plötzlich leichenblass geworden war. »Die Schwestern des Sterns wissen, wie man einen kranken Geist heilt, meine Liebe. Ich bin sicher, es wird fast gar nicht weh tun.«
Die Wache ging besonnen, effizient und absolut unerbittlich vor. Die Mutter hatte keine Chance. Innerhalb von Sekunden hatten die Schwestern sie gefesselt, hochgehoben und davongetragen. Ihre Schreie hallten durch die totenstillen Straßen und brachen erst ab, als das mächtige hölzerne Tor des Turms hinter ihr zuschlug.
Das Baby dagegen, das dem Ältestenratsvorsteher übergeben worden war, wimmerte nur kurz, bevor es seine Aufmerksamkeit auf dessen Gesicht richtete und die schlaffe, von Falten und Furchen durchzogene Haut zu bestaunen schien. Das kleine Mädchen hatte etwas seltsam Ernsthaftes an sich, etwas Ruhiges, Skeptisches, Wissendes, und Gherland fiel es schwer, den Blick von ihm abzuwenden. Sie hatte schwarze Locken und schwarze Augen. Schimmernde Haut, wie polierter Bernstein. Und mitten auf der Stirn ein Muttermal in der Form eines Halbmonds. Genau wie ihre Mutter. Den Legenden zufolge waren solche Menschen etwas ganz Besonderes. Gherland hatte noch nie etwas für Legenden übriggehabt, und noch weniger konnte er es leiden, wenn Bürger des Protektorats sich für etwas Besseres hielten. Sein Stirnrunzeln vertiefte sich, und er beugte sich mit kritischem Blick über den Kopf des Kindes. Das Mädchen streckte ihm die Zunge heraus.
Grässliches Kind, dachte Gherland.
»Meine Herren«, sagte er dann mit aller Autorität, die er aufbringen konnte, »es wird Zeit.« Das Baby hielt ausgerechnet diesen Moment für angemessen, um einen großen, feuchtwarmen Fleck auf Gherlands Robe zu hinterlassen. Er tat so, als hätte er nichts bemerkt, innerlich jedoch schäumte er vor Wut.
Das war Absicht gewesen. Eindeutig. Was für ein abscheuliches Balg.
Die Prozession schob sich so langsam, gravitätisch und unerträglich schwerfällig dahin wie jedes Jahr. Gherland wurde beinahe verrückt vor Ungeduld. Doch sobald sich die Tore des Protektorats hinter ihnen geschlossen hatten und die Bürger mitsamt ihrer trübseligen Brut in ihre trostlosen kleinen Häuser zurückgekehrt waren, legten die Ratsherren einen Schritt zu.
»Warum rennen wir denn so, Onkel?«, fragte Antain.
»Pscht, Junge!«, zischte Gherland. »Und lauf gefälligst schneller!«
Niemand war gern im Wald abseits der Allee. Nicht einmal der Ältestenrat. Nicht einmal Gherland. Zwar galt das Gebiet nahe der Protektoratsmauern als einigermaßen sicher. Theoretisch. Aber jeder kannte schließlich irgendwen, der sich aus Versehen zu weit hinausgewagt hatte. Und in einen Krater gefallen war. Oder in ein Loch voller Schlamm getreten war, der ihm die Haut vom Körper gefressen hatte. Oder in eine Höhle geraten, in der es merkwürdig roch, und nie zurückgekehrt war. Der Wald barg tödliche Gefahren.
Sie folgten einem gewundenen Pfad bis zu einer kleinen Senke mit fünf uralten Bäumen, die als die Hexenmägde bekannt waren. Oder sechs. Waren das nicht immer fünf? Gherland starrte missmutig zu den Bäumen hoch, zählte noch einmal nach und schüttelte den Kopf. Also sechs. Sei’s drum. Das war der verfluchte Wald, der machte ihn schon ganz konfus. Und diese Bäume standen hier schließlich schon seit Anbeginn der Zeit.
Innerhalb des Baumkreises war der Boden mit weichem Moos überzogen, und die Ratsherren legten das Kind dort ab, wobei sie es sorgsam vermieden, ihm in die Augen zu sehen. Sie hatten sich kaum umgedreht, um sich eilig aus dem Staub zu machen, als ihr jüngstes Mitglied sich räusperte.
»Wir lassen sie einfach hier liegen?«, fragte Antain. »Das ist der Brauch?«
»Ja, Neffe«, antwortete Gherland. »Genau das ist der Brauch.« Mit einem Mal legte sich Erschöpfung auf ihn, schwer wie ein Ochsenjoch. Er spürte, wie seine Schultern sich unter der Last krümmten.
Antain kniff sich in den Hals – eine nervöse Angewohnheit, derer er einfach nicht Herr wurde. »Wollen wir nicht wenigstens warten, bis die Hexe kommt?«
Die anderen Männer verfielen in unbehagliches Schweigen.
»Was hast du gesagt?«, krächzte Ratsherr Raspin, der Klapprigste von allen.
»Na ja, wir sollten …« Antain zögerte kurz. »Wir sollten doch sicher auf die Hexe warten«, fuhr er dann leiser fort. »Es könnten schließlich irgendwelche wilden Tiere kommen und sich das Baby holen.«
Die anderen Ratsherren pressten die Lippen zusammen und starrten den Ältestenratsvorsteher an.
»Glücklicherweise, lieber Neffe«, sagte dieser rasch, während er den Jungen mit sich zog, »ist das noch nie vorgekommen.«
»Aber –«, begann Antain, der sich schon wieder in den Hals kniff, so fest, dass seine Haut sich rötete.
»Aber gar nichts«, schnitt ihm Gherland das Wort ab, der nun zügig, den Jungen entschieden vor sich herschiebend, den ausgetretenen Pfad zurückmarschierte.
Einer nach dem anderen wandten sich auch die restlichen Herren zum Gehen, und das Baby blieb allein auf der Lichtung zurück.
Sie alle (alle bis auf Antain) wussten, dass es gar keine Frage war, ob wilde Tiere das Kind fraßen – es würde ganz sicher so kommen.
Denn sie alle wussten, dass es keine Hexe gab. Es hatte nie eine gegeben. Alles, was es gab, war ein gefährlicher Wald mit einem einzigen Weg hindurch und ein Mindestmaß an Kontrolle über das bequeme Leben, das die Ratsherren sich vor vielen Generationen eingerichtet hatten. Die Hexe – beziehungsweise der Glaube an sie – bescherte ihnen ein verängstigtes und damit unterwürfiges Volk, ein fügsames Volk, das sein trübseliges Dasein unter einer Wolke aus Trauer fristete, die ihnen die Sinne vernebelte und den Verstand durchweichte. Was den Ratsherren nur allzu willkommen war, sicherte es ihnen doch die uneingeschränkte Herrschaft. Nun brachte diese natürlich auch Unannehmlichkeiten mit sich, aber dagegen ließ sich nichts machen.
Auf dem Weg zurück durch den Wald hörten sie hinter sich das Kind weinen, doch das Geräusch ging schon bald im Seufzen der Sumpflöcher, im Vogelgezwitscher und Ächzen der Bäume unter. Und jeder Ratsherr war überzeugt, dass das Mädchen den nächsten Morgen nicht erleben würde, dass sie es nie wieder hören, sehen oder auch nur an es denken würden.
Sie dachten, es wäre für immer fort.
Sie irrten sich.
Kapitel 3,… in dem eine Hexe versehentlich ein Kind magifiziert
Mitten im Wald gab es einen kleinen Sumpf, brodelnd, schweflig und üble Dämpfe verströmend, gespeist und gewärmt von einem unterirdischen, etwas unruhig vor sich hin schlummernden Vulkan und bedeckt von einer zähen Morastschicht, deren Farbe je nach Jahreszeit von Giftgrün über Kobaltblau bis hin zu Blutrot variierte. Heute, kurz vor dem Tag des Opfers – oder Tag der Sternenkinder, wie er überall sonst genannt wurde – begann das Grün, ein kleines bisschen ins Blaue hinüberzuspielen.
Am Ufer des Sumpfs, gleich neben einem Büschel blühenden Schilfgrases, das dort aus der trüben Suppe emporwuchs, stand eine sehr alte Frau auf einen knotigen Stock gestützt. Sie war klein und etwas rundlich um die Mitte. Ihr graues Haar war zu einem Knoten zurückgeflochten, aus dem winzige Blätter und Blümchen sprossen. Trotz ihrer offensichtlichen Missstimmung schienen ihre weisen alten Augen zu funkeln, und ein Lächeln umspielte den breiten Mund. Aus einem bestimmten Winkel hatte sie Ähnlichkeit mit einer großen, freundlichen Kröte.
Ihr Name war Xan. Und sie war die Hexe.
»Glaubst du im Ernst, du kannst dich vor mir verstecken, du einfältiges Monster?«, blaffte sie gerade über den Sumpf. »Ich weiß genau, wo du bist. Du kommst jetzt sofort rauf und entschuldigst dich!« Sie zog ein leidlich strenges Gesicht. »Oder muss ich dir erst Beine machen?« Wenn sie dem Monster auch keine direkten Befehle erteilen konnte – dazu war es viel zu alt –, vermochte sie doch zumindest, den Sumpf dazu zu bringen, es auszuhusten wie einen lästigen Schleimklumpen. Dazu brauchte sie lediglich mit der linken Hand zu wedeln und mit dem rechten Knie zu wackeln.
Sie versuchte sich abermals an ihrer strengen Miene.
»LASS ES LIEBER NICHT DRAUF ANKOMMEN«, donnerte sie.
Der Schlamm begann zu blubbern und zu strudeln, und einen Moment später brach der riesige Kopf des Sumpfmonsters durch das bläuliche Grün. Es blinzelte erst mit einem Auge, dann mit dem anderen, bevor es beide zum Himmel verdrehte.
»Werd nur nicht frech, junger Mann«, schalt die alte Frau.
»Hexe«, brummte das Monster, dessen Maul sich noch immer halb unter Wasser befand. »Ich bin um Jahrhunderte älter als du.« Eine Blase stieg von seinen dicken Lippen durch den Algenteppich nach oben. Eigentlich sogar Jahrtausende, dachte es bei sich. Aber wer wird schon so kleinlich sein?
»Dein Ton gefällt mir nicht.« Xans faltiger Mund kräuselte sich zu einem unwirschen Röschen.
Das Monster räusperte sich. »Um es mit den Worten unseres hochgeschätzten Poeten zu sagen, meine Teure: Wird die Dame barsch, geht mir’s vorbei am –«
»GLERK!«, rief die Hexe empört. »Ich muss doch sehr bitten!«
»Tut mir leid«, brummte Glerk versöhnlich, obwohl er es kein bisschen so meinte. Dann legte er alle vier Arme ans Ufer und stemmte die siebenfingrigen Hände in den Schlamm. Schnaufend hievte er sich an Land. Das war auch schon mal einfacher, dachte er. Obwohl er sich beim besten Willen nicht erinnern konnte, wann das gewesen sein sollte.
»Der arme Fyrian hockt da drüben bei den Schloten und weint sich die Augen aus«, schimpfte Xan. Glerk seufzte. Xan stieß nachdrücklich ihren Stab ins Gras, woraufhin zu ihrer beider Erstaunen Funken aus der Spitze stoben. Dann wandte sie sich mit finsterer Miene wieder dem Sumpfmonster zu. »Musst du denn immer so gemein zu ihm sein?« Sie schüttelte den Kopf. »Er ist doch noch ein Baby.«
»Meine liebe Xan«, erwiderte Glerk, der ein tiefes Rumpeln in seiner Brust spürte, von dem er nur hoffen konnte, dass es ihn imposant und furchterregend wirken ließ und nicht bloß, als hätte er Sodbrennen. »Fyrian ist ebenfalls älter als du. Und es wird höchste Zeit –«
»Ach, du weißt genau, was ich meine. Und was den Rest betrifft, habe ich es nun mal seiner Mutter versprochen.«
»Dieser Drachenzwerg lebt jetzt schon seit fünfhundert Jahren, plus/minus ein paar hundert, in völliger Verblendung – die du, meine Liebe, höchstpersönlich schürst und nährst. Wo genau soll das denn hinführen? Er ist nun mal kein Ganz Und Gar Gigantischer Drache. Und es deutet auch nichts darauf hin, dass er jemals zu einem werden wird. Was ist denn dabei, ein Wahrhaft Winziger Drache zu sein? Es kommt nämlich nicht nur auf die Größe an, weißt du? Er entstammt einem uralten, ehrwürdigen Geschlecht, das ein paar der größten Denker der Sieben Zeitalter hervorgebracht hat. Er hat so viel, worauf er stolz sein kann.«
»Seine Mutter hat mir damals deutlich zu verstehen gegeben –«, begann Xan, doch das Monster ließ sie nicht ausreden.
»Er hätte jedenfalls längst über seine Abstammung und seinen Platz in der Welt unterrichtet werden sollen. Ich habe schon viel länger zu dieser Lügengeschichte beigetragen, als mir lieb ist. Aber jetzt …« Glerk stemmte die Arme auf den Boden und schob sein gewaltiges Hinterteil unter sein gewölbtes Rückgrat, bevor er den schweren Schwanz um seinen Körper rollte wie ein riesiges, glänzendes Schneckenhaus. Sein dicker Bauch senkte sich über die eingezogenen Beine. »Ich weiß nicht, Xan. Irgendetwas hat sich verändert.« Seine feuchte Stirn umwölkte sich, aber Xan schüttelte den Kopf.
»Geht das schon wieder los«, seufzte sie.
»Der Poet sagt: O Welt, die du dich stetig wandelst –«
»Dein Poet kann mir gestohlen bleiben. Geh dich entschuldigen. Und zwar sofort. Er schaut doch zu dir auf.« Xan sah zum Himmel hoch. »So, ich muss mich beeilen, mein Guter. Ich bin jetzt schon spät dran. Bitte. Ich verlasse mich auf dich.«
Glerk wälzte sich auf die Hexe zu, die ihm die Hand auf die massige Wange legte. Er war zwar durchaus in der Lage, aufrecht zu gehen, bewegte sich jedoch gern auf allen sechsen fort – oder allen siebenen, wenn man den Schwanz als zusätzliche Gliedmaße mitzählte, oder allen fünfen, wenn gerade eine seiner Pfoten damit beschäftigt war, ein besonders wohlduftendes Blümchen an seine Nüstern zu heben oder Steine zu sammeln oder eine zu Tränen rührende Weise auf seiner handgeschnitzten Flöte zu spielen. Er drückte seine breite Stirn an Xans winzige.
»Bitte sei vorsichtig«, sagte er mit erstickter Stimme. »Seit einiger Zeit habe ich die schaurigsten Träume. Ich bin in ständiger Sorge um dich, wenn du nicht in der Nähe bist.« Xan hob erwartungsvoll die Augenbrauen, und Glerk ließ mit einem leisen Grollen von ihr ab. »Schon gut«, sagte er dann. »Ich werde weiter für unseren Freund Fyrian Theater spielen. Der Pfad zur Wahrheit windet sich durch das Herz des Träumers, sagt der Poet.«
»Das ist die richtige Einstellung!«, lobte Xan. Zufrieden schnalzte sie mit der Zunge und warf dem Monster einen Handkuss zu. Dann katapultierte sie sich mit ihrem Stab einmal um die eigene Achse und hastete los in den Wald.
Entgegen dem hartnäckigen Aberglauben der Protektoratsbewohner war der Wald keineswegs verflucht oder auch nur verzaubert. Aber gefährlich war er. Der Vulkan unter der Erde – der sich mit seinen flachen Hängen unvorstellbar weit erstreckte – war ein heimtückischer Geselle. Er grummelte im Schlaf, erhitzte das Grundwasser zu zischenden Geysiren und kratzte unablässig an winzigen Ritzen, bis sie zu bodenlosen Löchern wurden. Er brachte Flüsse zum Sieden, Schlamm zum Brodeln und ließ Wassermassen in tiefe Abgründe stürzen, nur um sie ein paar Meilen entfernt jäh wieder emporsprudeln zu lassen. Es gab Krater, die faulige Gerüche ausstießen, Krater, die Asche ausstießen, und Krater, die überhaupt nichts ausstießen – bis plötzlich jemand blaue Lippen bekam und nach Atem rang.
Für einen normalen Menschen war der einzig sichere Weg durch den Wald die Allee, die einem natürlichen, mit der Zeit etwas abgeflachten Felsgrat folgte. Die Allee blieb stets unverändert und zeigte keinerlei Launen. Allerdings wurde sie von einer Truppe Rüpel und Rabauken aus dem Protektorat verwaltet, die sich als ihre Besitzer erachteten. Darum nahm Xan nie die Allee. Sie konnte Rüpel nicht ausstehen. Und Rabauken auch nicht. Außerdem verlangten sie viel zu viel Wegzoll. Oder zumindest hatten sie das beim letzten Mal. Es war Jahre her, dass sie sich auch nur in die Nähe der Allee begeben hatte – fast zwei Jahrhunderte. Also suchte sie sich nun ihren eigenen Weg durch den Wald, indem sie sich auf eine Mischung aus Magie, Ortskenntnis und gesundem Menschenverstand verließ.
Diese Querfeldeinmärsche waren alles andere als leicht. Aber sie waren nun mal unumgänglich. Ein Kind wartete auf sie, nicht weit vor den Toren des Protektorats. Ein Kind, dessen Leben davon abhing, dass sie es holen kam. Sie durfte also nicht zu spät kommen.
Solange Xan zurückdenken konnte, setzte jedes Jahr genau zur selben Zeit eine Mutter aus dem Protektorat ihr Baby im Wald aus, vermutlich zum Sterben. Xan hatte keine Ahnung, warum. Aber sie wollte die armen Würmchen auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Und so wanderte sie jedes Jahr zu dem Ring aus Platanen, hob das verlassene Kind auf und trug es durch den Wald bis in eine der Freien Städte am anderen Ende der Allee. Dort lebten glückliche Menschen. Und die liebten Kinder.
Hinter einer Biegung kam nun die Mauer des Protektorats in Sicht. Xans zügige Schritte verlangsamten sich zu einem Schlurfen. Das Protektorat war ein trostloser Ort: schlechte Luft, schlechtes Wasser, und stets schien eine Wolke aus Trauer über den Dächern der Häuser zu dräuen. Die geballte Trübsal senkte sich auf Xans Schultern wie ein schwerer Mantel.
»Hol einfach das Baby und mach, dass du wieder wegkommst«, schärfte sie sich wie jedes Jahr ein.
Mit der Zeit hatte sie angefangen, allerlei nützliche Dinge mit auf ihre Märsche zu nehmen – eine Decke aus weichster Schafwolle, um das Kind darin einzuwickeln, damit es nicht fror, ein Bündel Leinen, um eine nasse Windel zu wechseln, ein oder zwei Flaschen Ziegenmilch, um ein leeres Bäuchlein zu füllen. Wenn ihr die Ziegenmilch ausging (was unweigerlich passierte, denn der Weg war lang, und Milch ist schwer), tat Xan das, was jede vernünftige Hexe in einer solchen Situation tun würde: Sobald es dunkel genug war, hob sie die Hand, um Sternenlicht zu sammeln, das wie seidene Spinnweben daran haften blieb, und ließ das Kind an ihren Fingern nuckeln. Denn Sternenlicht, das weiß jede Hexe, ist die beste Nahrung für ein Baby. Zwar erfordert das Einsammeln ein gewisses Maß an Geschicklichkeit und Begabung (magischer Begabung, um genau zu sein), aber die Kinder sind ganz verrückt danach. Das Licht macht sie zu zufriedenen, buchstäblich strahlenden Wonneproppen.
Es dauerte nicht lange, bis die Freien Städte das jährliche Erscheinen der Hexe wie einen Festtag zu feiern begannen. Für die Menschen dort war jedes von Xans Kindern, mit Wangen und Augen, die vor Sternenlicht leuchteten, ein Geschenk des Himmels. Xan nahm sich viel Zeit, um jedem Schützling, für den sie während ihrer langen Reise gesorgt hatte, je nach Charakter, Temperament und persönlichen Neigungen eine passende Familie zu suchen. Und die Sternenkinder, wie die Kleinen in den Städten genannt wurden, wuchsen von glücklichen Babys zu fröhlichen Kindern und liebenswerten Erwachsenen heran. Sie waren begabt und erfolgreich und unendlich großherzig. Und wenn sie im hohen Alter starben, blickten sie auf ein erfülltes Leben zurück.
Als Xan den Baumkreis erreichte, wartete dort kein Baby auf sie, es war noch zu früh. Und Xan war müde. Sie lehnte sich an den Stamm eines der knorrigen Bäume und ließ sich den lehmigen Geruch der Borke in die Hakennase steigen.
»Ein bisschen Schlaf wird mir guttun«, sagte sie zu sich selbst. Und sie hatte recht. Die Reise, die hinter ihr lag, war lang und kräftezehrend gewesen, und die Reise, die sie vor sich hatte, würde noch länger sein. Noch kräftezehrender. Da konnte ein kleines Nickerchen nicht schaden. Und wie so oft, wenn Xan sich unterwegs nach ein wenig Ruhe und Ungestörtheit sehnte, verwandelte sie sich in einen Baum – ein verhutzeltes Gewirr aus Blättern, Flechten und zerfurchter Borke, genau wie die uralten Platanen, die über die kleine Lichtung wachten. Und als Baum schlummerte sie schließlich ein.
Sie hörte die Gruppe nicht näher kommen.
Sie hörte weder Antains Protest noch das betretene Schweigen der Ratsherren noch die barschen Belehrungen von Ratsvorsteher Gherland.
Sie hörte nicht einmal das Baby, das gluckste. Das wimmerte. Das weinte.
Erst als das Kind aus voller Kehle zu schreien begann, schreckte Xan aus dem Schlaf hoch.
»Herrjemine!«, sagte sie mit ihrer knorrigen, borkigen, laubigen Stimme, denn sie hatte sich noch nicht wieder zurückverwandelt. »Ich habe dich gar nicht gesehen!«
Das kleine Mädchen zeigte sich unbeeindruckt. Es strampelte und heulte und jammerte ungerührt weiter. Sein Gesicht war rot und wutverzerrt, die winzigen Hände zu Fäusten geballt. Das Muttermal auf seiner Stirn lief bedrohlich dunkel an.
»Momentchen, mein Schatz. Tante Xan macht so schnell, wie sie kann.«
Und das tat sie wirklich. Verwandlungszauber sind eine komplizierte Angelegenheit, selbst für eine so erfahrene Hexe wie Xan. Langsam zog sich ein Ast nach dem anderen in ihre Wirbelsäule zurück, während gleichzeitig ihre zerfurchte Borke Stück für Stück zu zerfurchter Haut wurde.
Xan stützte sich auf ihren Stab und ließ ein paarmal die Schultern kreisen, um das Ziepen in ihrem Nacken zu lindern, erst die eine Seite, dann die andere. Sie sah auf das Kind hinunter, das sich inzwischen ein wenig beruhigt hatte und nun die Hexe mit demselben Blick maß wie zuvor den Ältestenratsvorsteher – unverwandt, kritisch und irgendwie verstörend. Es war ein Blick, der direkt nach den Saiten der Seele griff und daran zupfte wie an denen einer Harfe. Die Hexe schnappte nach Luft.
»Fläschchen«, entschied Xan, ohne auf die sphärischen Klänge zu achten, die ihre Knochen zum Schwingen brachten. »Du brauchst ein Fläschchen.« Sie durchwühlte ihre diversen Taschen nach einer der Flaschen mit Ziegenmilch, die nur darauf warteten, ihrem Zweck zugeführt zu werden.
Mit einem raschen Wackeln ihres Fußknöchels ließ Xan einen Pilz zu einem bequemen Hocker anwachsen. Im Sitzen bettete sie das warme Gewicht des Babys auf die Wölbung ihres Kugelbauchs und ließ es trinken. Nach einer Weile verblich die kleine Mondsichel auf der Stirn des Mädchens wieder zu einem hübschen Zartrosa, und ihre dunklen Locken umrahmten die noch dunkleren Augen. Ihr Gesicht leuchtete wie ein Edelstein. Die Milch machte sie ruhig und zufrieden, ihr Blick jedoch war noch immer fest auf Xan gerichtet – wie Baumwurzeln, die sich tief in die Erde bohrten. Xan räusperte sich.
»Du brauchst mich gar nicht so anzustarren«, sagte sie. »Ich kann dich nicht dorthin zurückbringen, wo du herkommst. Dieses Kapitel deines Lebens ist abgeschlossen, also vergiss es lieber. Na, na.« Das Baby hatte angefangen zu wimmern. »Kein Grund zum Weinen. Es wird dir gefallen dort, wo ich dich hinbringe. Sobald ich mich für eine Stadt entschieden habe. Sie sind alle unglaublich schön. Und deine neue Familie wirst du auch mögen. Dafür werde ich schon sorgen.«
Doch beim Klang ihrer Worte wurde Xan das alte Herz schwer. Mit einem Mal war sie völlig grundlos traurig. Das Kind hörte auf, an der Flasche zu nuckeln, und musterte sie aufmerksam. Die Hexe zuckte mit den Schultern.
»Tja, frag mich nicht«, sagte sie. »Ich weiß nicht, warum man dich im Wald ausgesetzt hat. Ich verstehe nicht mal die Hälfte von dem, was diese Menschen tun, und über die andere Hälfte kann ich nur den Kopf schütteln. Aber ich habe nicht vor, dich hier auf dem Boden liegen zu lassen, bis dich irgendein dahergelaufenes Wiesel frisst. Dir steht eine größere Zukunft bevor, mein Liebling.«
Das Wort Liebling hinterließ ein seltsames Gefühl auf ihrer Zunge. Xan verstand die Welt nicht mehr. Sie räusperte sich die betagte Kehle frei und lächelte das kleine Mädchen an. Dann beugte sie sich vor und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Sie gab jedem Kind einen Kuss. Oder zumindest war sie sich einigermaßen sicher, dass sie das tat. Die Haut des Babys roch nach Brotteig und gestockter Milch. Xan schloss einen Moment die Augen und schüttelte den Kopf. »Na komm«, sagte sie schließlich mit leicht belegter Stimme. »Dann wollen wir mal, was?«
Xan schnürte sich das Baby mit einem Tuch vor die Brust und machte sich, fröhlich vor sich hin pfeifend, auf den Weg durch den Wald.
Sie wäre geradewegs in Richtung der Freien Städte gegangen. Denn das war ja der Plan.
Doch dann war da dieser Wasserfall, der dem Baby gefallen könnte. Und der Felsvorsprung, von dem aus man eine besonders reizvolle Aussicht hatte. Sie merkte, dass sie dem Baby Geschichten erzählen wollte. Ihm vorsingen. Also fing sie an zu erzählen und zu singen, und ihre Schritte wurden langsamer und langsamer und langsamer. Xan schob es auf ihr Alter und den schlimmen Rücken und die Bedürfnisse des Babys, aber nichts davon traf zu.
Immer wieder blieb sie stehen, um das Tragetuch zu lösen und in die unglaublich dunklen Augen des Babys zu blicken.
Jeden Tag lockte Xans Weg sie ein bisschen weiter fort von ihrem Ziel. Mal führte er sie im Kreis herum, mal in die entgegengesetzte Richtung, mal verlief er im Zickzack. Ihre Reise durch den Wald, die normalerweise so schnurgerade verlief wie die Allee selbst, war ein einziges Gewirr aus Sackgassen und Kurven. Nachts, nachdem die Ziegenmilchvorräte erschöpft waren, sammelte Xan seidig schimmerndes Sternenlicht, und das Baby verschlang es gierig. Mit jedem Schluck wurden die Augen des Mädchens dunkler. Verborgene Welten schienen hinter diesen Augen zu lauern – Galaxien um Galaxien.
Nach zehn Nächten war von der Reise, die für gewöhnlich dreieinhalb Tage dauerte, nicht einmal ein Viertel geschafft. Der zunehmende Mond ging jede Nacht früher auf, doch Xan achtete nicht darauf. Sie griff einfach weiter nach dem Sternenlicht, ohne die stetig runder werdende Scheibe am Himmel zu bemerken.
Nun liefert Sternenlicht ein gewisses Maß an Magie. Das ist bekannt. Doch weil dieses Licht eine so lange Reise zurücklegen muss, ist die Magie schwach und diffus und zu feinsten Strähnen zerfasert. Sternenlicht liefert genug Magie, um ein Baby sattzumachen, und kann, in ausreichender Menge verabreicht, das Beste in seinem Herzen, seiner Seele und seinem Geist erwecken. Es vermag, das Kind zu verbessern, aber nicht, es zu magifizieren.
Mit Mondlicht dagegen verhält es sich vollkommen anders.
Mondlicht ist Magie. Da kann man fragen, wen man will.
Xan konnte den Blick nicht von den Augen des Babys wenden. Sonnen, Sterne, Meteore. Bunte Nebel. Urknalle, schwarze Löcher und unendliche, unendliche Weiten. Der Mond stieg höher, dick und rund und leuchtend.
Xan griff nach oben. Sie sah nicht einmal zum Himmel hoch. Sie bemerkte den Mond nicht.
(Spürte sie, dass das Licht an ihren Fingern seltsam schwer war? Seltsam klebrig? Seltsam süß?)
Sie schwenkte die Hand über ihrem Kopf. Senkte sie, als sie den Arm nicht mehr oben halten konnte.
(Merkte sie, wie die Magie an ihrem Handgelenk zerrte? Nein, sagte sie sich. Sie sagte es wieder und wieder, bis sie es irgendwann selbst glaubte.)
Das Baby trank. Und trank. Und trank. Und plötzlich erschauderte es und wand sich in Xans Armen. Es schrie auf – nur ein einziges Mal. Aber laut. Gleich darauf stieß es einen wohligen Seufzer aus und schlummerte ein, das Köpfchen an den weichen Bauch der Hexe geschmiegt.
Xan blickte nach oben und spürte den Mondschein im Gesicht. »Ach herrje«, flüsterte sie. Der Mond war voll geworden, ohne dass sie es bemerkt hatte. Sein Licht war pure Magie. Ein einziges Schlückchen hätte genügt – und das Baby hatte, nun ja … mehr als ein Schlückchen getrunken.
Dieser kleine Nimmersatt.
Was passiert war, lag auf der Hand, so klar, wie der Mond über den Baumwipfeln hing. Das Kind war magifiziert worden. Und das machte die Sache komplizierter, als sie ohnehin schon war.
Xan setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und legte das schlafende Baby in ihre Kniebeuge. Niemand würde es jetzt aufwecken können. Nicht für die nächsten paar Stunden. Xan strich dem Mädchen über die schwarzen Locken. Sie konnte bereits das Pochen der Magie unter der Haut ertasten, spüren, wie die Fasern sich zwischen den Zellen einnisteten, das Gewebe durchdrangen, jeden Knochen erfüllten. Irgendwann würde die Kraft unberechenbar werden. Nicht für immer natürlich – aber Xan konnte sich gut genug an die Worte der Zauberer erinnern, bei denen sie aufgewachsen war, um zu wissen, dass ein magisches Kind großzuziehen keine leichte Aufgabe war. Das hatten ihre Lehrer nur zu gern betont. Und ihr Ziehvater, Zosimos, hatte sich endlos darüber ausgelassen. »Ein Baby mit Magie zu versehen, das ist, wie einem Kleinkind ein Schwert in die Hand zu drücken – zu viel Kraft kombiniert mit zu wenig Vernunft«, sagte er wieder und wieder. »Siehst du denn nicht, wie du mich altern lässt, Kind?«
Und er hatte recht gehabt. Magische Kinder waren gefährlich. Dieses Mädchen konnte sie unmöglich in die Obhut von jemand anderem geben.
»Tja, Liebes«, sagte sie. »Du bist eine wahre kleine Unruhestifterin.«
Das Baby atmete tief ein. Ein winziges Lächeln umspielte seinen rosigen Mund. Xan spürte, wie ihr Herz einen Hüpfer machte, und drückte das Kind an sich.
»Luna«, sagte sie. »Dein Name soll Luna sein. Und ich werde deine Großmutter. Wir werden eine richtige Familie.«
Und noch während sie es aussprach, wusste Xan, dass es die Wahrheit war. Die Worte brachten die Luft zwischen ihnen zum Vibrieren, stärker als jede Magie.
Sie stand auf, schob das Baby zurück in sein Tragetuch und machte sich auf den Heimweg, während sie bereits darüber nachgrübelte, wie um alles in der Welt sie das Glerk erklären sollte.
Kapitel 4,… in dem das alles nur ein Traum war
Du stellst zu viele Fragen.
Niemand weiß, was die Hexe mit den Kindern macht, die sie mitnimmt. Niemand fragt sie danach. Wir können sie nicht fragen – verstehst du denn nicht? Es tut einfach zu weh.
Na schön. Sie verschlingt sie. Bist du jetzt zufrieden?
Nein. Das glaube ich nicht im Ernst.
Meine Mutter hat mir immer erzählt, die Hexe würde die Seelen der Kinder fressen, und ihre Körper müssten bis in alle Ewigkeit über die Erde wandeln. Nicht tot und nicht lebendig. Mit leeren Augen und leeren Gesichtern würden sie dahinstolpern. Aber das glaube ich nicht. Dann hätten wir doch sicher schon mal welche gesehen, meinst du nicht? Zumindest eins wäre doch sicher mal vorbeigespukt. In all den Jahren.
Meine Großmutter hat mir erzählt, die Hexe würde die Kinder als Sklaven halten. Dass sie in finsteren Katakomben unter ihrem Schloss im Wald schuften müssten, um all die schauerlichen Maschinen instandzuhalten, all die riesigen Kessel umzurühren und von morgens bis abends den Befehlen der Hexe zu gehorchen. Aber das glaube ich auch nicht. Wenn das stimmen würde, wäre doch sicher irgendwann einem der Kinder die Flucht gelungen. In all der Zeit wäre es doch wohl wenigstens einem von ihnen gelungen, sich zu befreien und zurück nach Hause zu kommen. Also nein. Ich glaube nicht, dass sie sie als Sklaven hält.
Ich glaube gar nichts. Weil es nichts zu glauben gibt.
Manchmal. Manchmal träume ich. Von deinem Bruder. Er wäre heute achtzehn Jahre alt. Nein. Neunzehn. In meinem Traum hat er dunkle Haare und strahlende Haut und Sterne in den Augen. In meinem Traum leuchtet sein Lächeln so hell, dass es meilenweit sichtbar ist. Gestern Nacht habe ich geträumt, dass er an einem Baum auf ein Mädchen gewartet hat. Er hat ihren Namen gerufen und ihre Hand genommen. Und sein Herz hat geklopft, als er sie geküsst hat.
Was? Nein. Ich weine nicht. Warum sollte ich denn weinen?
Und sowieso: Das war alles nur ein Traum.
Kapitel 5,… in dem ein Sumpfmonster sich versehentlich verliebt
Glerk war dagegen und sagte das auch gleich am ersten Tag, als die Hexe das Baby mit nach Hause brachte.
Am nächsten Tag sagte er es wieder.
Und am nächsten.
Und am nächsten.
Aber Xan hörte nicht hin.
»Babys, Babys, Babys«, trällerte Fyrian. Der winzige Drache war entzückt. Er hockte auf einem Zweig über der Tür von Xans Hütte, spreizte seine bunten Flügel, so weit er konnte, und reckte den Hals zum Himmel. Sein Gesang war laut, schrill und entsetzlich schief. Glerk hielt sich die Ohren zu. »Babys, Babys, Babys, BABYS!«, jubilierte Fyrian weiter. »Ach, wie ich Babys liiiebe!« Er war noch nie zuvor einem Baby begegnet oder konnte sich zumindest nicht daran erinnern, aber das hielt ihn keineswegs davon ab, von nun an alle Babys dieser Welt zu lieben.
Von morgens bis abends war Fyrian mit Singen und Xan mit dem Baby beschäftigt und keiner von beiden, so schien es Glerk, auch nur im Geringsten empfänglich für die Stimme der Vernunft.
Nach zwei Wochen schon war das Haus nicht mehr wiederzuerkennen: An einer neu gespannten Wäscheleine hingen Windeln, Babykleidung und Mützchen; auf einem kürzlich errichteten Gestell neben einem nagelneuen Waschbottich trockneten frisch geblasene Glasfläschchen; eine zusätzliche Ziege war herbeigeschafft worden (Glerk hatte keine Ahnung, woher), und Xan verwaltete plötzlich verschiedene Milchkrüge – einen zum Trinken, einen zum Käse- und einen zum Buttermachen. Der Boden lag von einem Moment zum anderen voller Spielzeug. Glerk war schon mehrere Male auf eine besonders scharfkantige Holzrassel getreten und hatte gebrüllt vor Schmerzen, nur um augenblicklich unter strengem »Pssst«-Gezischel und Handgewedel aus dem Zimmer gescheucht zu werden. Damit er das Baby nicht weckte, das Baby nicht erschreckte, das Baby nicht mit seinen Gedichten zu Tode langweilte.
Nach drei Wochen hatte Glerk die Nase voll.
»Xan«, sagte er. »Ich muss darauf bestehen, dass du dich nicht in dieses Baby verliebst.«
Die alte Frau schnaubte, aber eine Antwort blieb sie ihm schuldig.
Glerk zog streng die Augenbrauen zusammen. »Im Ernst. Ich verbiete es dir.«
Die Hexe brach in schallendes Gelächter aus. Das Baby fiel mit ein. Die beiden waren bereits eine eingeschworene kleine Gemeinschaft, und das machte Glerk wahnsinnig.
»Luna!«, schmetterte Fyrian, der zur offenen Tür hereingeflogen kam. Er schwirrte durchs Zimmer wie ein musikalisch minderbemittelter Singvogel. »Luna, Luna, Luna, LUNA!«
»Es wird nicht mehr gesungen!«, bellte Glerk.
»Hör nicht auf ihn, Fyrian«, tröstete Xan. »Babys lieben es, wenn man ihnen vorsingt. Das weiß doch jeder.« Das Baby strampelte und gluckste. Fyrian ließ sich auf Xans Schulter nieder und gab ein unmelodisches Summen zum Besten. Was besser war als vorher, aber nicht viel.
Glerk stieß ein frustriertes Grunzen aus. »Weißt du, was der Poet über Hexen sagt, die Kinder großziehen?«, fragte er.
»Ich kann mir nicht vorstellen, was ein Poet über Babys oder Hexen zu sagen haben sollte, aber ich bin mir sicher, dass es höchst erhellend sein wird, wie immer.« Sie drehte sich um. »Glerk, würdest du mir einmal die Flasche da reichen?«
Xan ließ sich auf den blanken Holzboden sinken und legte sich das Baby auf den Schoß.
Glerk ging zu ihr, beugte sich über das Baby und musterte es skeptisch. Die Kleine nuckelte an ihrer Faust; Spucke lief ihr über die Finger. Mit der anderen Hand winkte sie dem Monster zu. Ihr rosa Mund verzog sich um die nasse Faust zu einem breiten Lächeln.
Das macht sie mit Absicht, dachte Glerk, der versuchte, seine eigenen sumpffeuchten Lippen vom Grinsen abzuhalten. Sie ist absichtlich niedlich, um mich zu ärgern, um mir eins auszuwischen. Was für ein gemeines Baby!
Luna stieß ein quäkendes Kichern aus und strampelte mit den Beinchen. Ihr Blick fing den des Sumpfmonster auf, und ihre Augen funkelten wie Sterne.
Verlieb dich ja nicht in das Baby, befahl er nun im Stillen sich selbst und versuchte, standhaft zu bleiben.
Er räusperte sich.
»Der Poet«, fuhr er dann gedehnt fort, während er das Baby aus schmalen Augen betrachtete, »sagt überhaupt nichts über Babys und Hexen.«
»Na also«, entgegnete Xan, die ihre Nase gegen die des Babys stieß und es damit zum Lachen brachte. Sie machte es noch einmal. Und noch einmal. »Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Gar keine Sorgen!« Ihre Stimme ging in einen albernen Singsang über, und Glerk verdrehte seine riesigen Augen.
»Meine liebe Xan, der tiefere Sinn meiner Worte ist offenbar vollkommen an dir vorbeigegangen.«
»Und an dir geht noch viel mehr vorbei, wenn du weiter so viel nörgelst und moserst und dich nicht an diesem Baby erfreust. Sie bleibt bei uns, keine Widerrede. Menschenkinder sind nur für kurze Zeit so winzig – sie werden schneller erwachsen, als ein Kolibri mit den Flügeln schlägt. Genieß es, Glerk! Genieß es oder geh.« Die Hexe sah ihn nicht an, während sie das sagte, aber Glerk spürte eine abweisende Kälte von ihr ausgehen, die ihm beinahe das Herz brach.
»Also«, verkündete Fyrian, der auf Xans Schulter hockte und interessiert zusah, wie das Baby strampelte und krähte. »Ich mag sie.«
Dennoch durfte er ihr nicht zu nahe kommen. Das, hatte Xan erklärt, sei zu ihrer beider Sicherheit. Das Baby, vollgestopft mit Magie, sei ein bisschen wie ein schlummernder Vulkan – dessen innere Hitze und Energie sich mit der Zeit aufstauten, bis es womöglich irgendwann ohne Vorwarnung zur Eruption kam. Xan und Glerk waren weitgehend immun gegen jegliche Kapriolen der Magie (Xan, weil sie eine Hexe war, und Glerk, weil er älter als die Magie selbst war und sich mit solcherlei Unfug gar nicht erst abgab) und hatten daher nicht viel zu befürchten, Fyrian dagegen war empfindlicher. Hinzu kam, dass der kleine Drache zu Schluckauf neigte. Und seine Hickser waren für gewöhnlich ziemlich feurig.
»Nicht zu nah ran, Fyrian, Schatz. Bleib schön hinter Tante Xan.«
Fyrian verbarg sich hinter Xans krausem Haarvorhang und starrte das Baby mit einer Mischung aus Angst, Eifersucht und Neugier an. »Ich will aber mit ihr spielen«, jammerte er.
»Das kannst du auch bald«, sagte Xan beschwichtigend, während sie das Baby in Position brachte, um ihm das Fläschchen zu geben. »Ich will nur sichergehen, dass ihr zwei einander nicht weh tut.«
»Das würde ich nie«, beteuerte Fyrian. Dann schniefte er. »Ich glaube, ich bin allergisch gegen das Baby.«
»Du bist nicht allergisch gegen das Baby«, sagte Glerk just in dem Moment, als Fyrian Xan eine Feuerwolke in den Nacken nieste. Die Hexe zuckte nicht einmal zusammen. Sie zwinkerte lediglich mit einem Auge, woraufhin sich die Flammen in Dampf verwandelten, der sich um ihre Schultern legte und im Auflösen mehrere getrocknete Milchflecken aus ihrem Kleid entfernte.
»Gesundheit, mein Schatz«, sagte Xan. »Glerk, warum nimmst du Fyrian nicht mit auf einen kleinen Spaziergang?«
»Ich mag keine Spaziergänge«, grollte Glerk, trottete aber gehorsam mit Fyrian nach draußen. Oder vielmehr: Glerk trottete, und Fyrian flatterte hinterdrein, von rechts nach links, vor und zurück, wie ein zu groß geratener, übermütiger Schmetterling. Fyrian beschloss, für das Baby Blumen zu pflücken – ein Unterfangen, das durch Schluckauf und Niesen und die dazugehörigen Feuerwolken erschwert wurde, die seine Ausbeute immer wieder in schwarz verkohlte Skelette verwandelten. Aber er schien es kaum zu bemerken. Stattdessen sprudelte er über vor Fragen.
»Ist das Baby irgendwann auch mal so ein Riese wie du und Xan?«, wollte er wissen. »Es muss doch noch viel mehr Riesen geben. Ich meine, auf der ganzen Welt. Auf der Welt, die nicht hier ist. Ich würde so gerne mal die Welt sehen, die nicht hier ist, Glerk. Ich will alle Riesen auf der ganzen Welt sehen und alle, die größer sind als ich!«
Fyrian lebte nach wie vor in vollkommener Unwissenheit, sosehr das Glerk auch missfiel. Obwohl sein Körperumfang in etwa dem einer Taube entsprach, hielt der kleine Drache sich für größer als die durchschnittliche menschliche Bevölkerung und war überzeugt, dass man ihn nur von ihr fernhielt, damit er nicht die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzte.

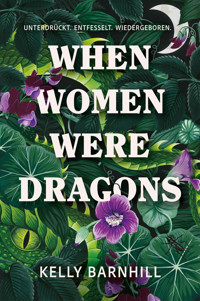
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










