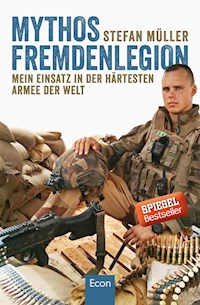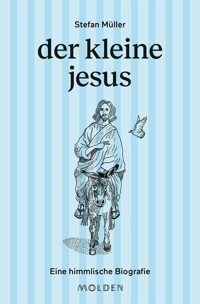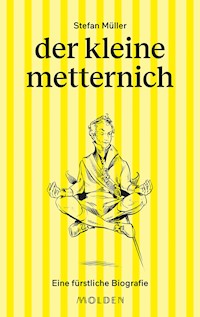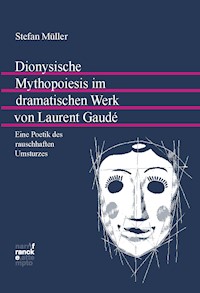9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bücher faszinieren die Menschen seit jeher. Waren sie vor Gutenbergs Buchdruck noch kostbare und nur von wenigen Menschen gelesene oder auch nur gesehene Einzelexemplare, die sorgsam und unter großem künstlerischen Einsatz per Hand kopiert wurden, haben Bücher in den folgenden Jahrhunderten die ganze Welt erobert Sie sind Teil des kulturellen Gedächtnisses der Menschheit, weil sie die Gedanken und das Wissen ungezählter Generationen in sich aufnehmen. Sie sind das Medium, das dauerhaft Vergangenheit, Gegenwart und bisweilen auch die Zukunft transportiert. Bücher sind aber auch - und das ist das Faszinierende - ein Ticket für eine Reise in die Fantasie, in der der Prinz die Prinzessin bekommt, das Gute über das Böse siegt und Leser für ein paar Stunden jemand sein oder an etwas teilhaben können, was sie nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Über Bücher zu schreiben ist eine Mammutaufgabe. Von A wie Antiquariat bis Z wie Zeilenumbruch scheint die Themenvielfalt unerschöpflich. Und wie soll man einen gemeinsamen Nenner für den Geschmack aller Leser finden? Stefan Müller hat 111 gute Gründe zusammengetragen, Bücher zu lieben. Er ist Literaturwissenschaftler und hat sich mit seinen 33 Lenzen schon eine ansehnliche Wohnzimmerbibliothek geschaffen. Doch hier einfach nur auf und ab zu gehen und Lieblingsbücher herauszugreifen - das reicht natürlich nicht! Also hat er sich auf eine literarische Reise durch die Epochen begeben und die Knüller, Überraschungshits und Dauerbrenner ausgewählt, die seiner Meinung nach auf eine Unbedingt-lesen-Liste gehören. Aber auch ein Plausch mit der Postfrau, unbarmherzige Kritiker, individuelle Lesezeichen, nette Buchhändlerinnen und Reisen mit leichtem Gepäck spielen eine große Rolle, wenn es um die Anziehungskraft von Büchern geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Stefan Müller
111 Gründe, Bücher zu lieben
Eine Liebeserklärung an das Lesen
Für Julia und die Erdmanns
Das Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn ich nicht regelmäßig arbeiten müsste, würde ich wahrscheinlich zwei Drittel meines Lebens auf meiner Couch verbringen und lesen. Nun habe ich das Glück, dass ich als Literaturwissenschaftler so tun kann, als wäre das Arbeit. Sollte mich also jemand fragen, was ich den ganzen Tag gemacht hätte, und ich wüsste nur etwas beschämt »lesen« zu antworten, könnte ich das problemlos auch durch »arbeiten« ersetzen. So wie andere Leute Squash mögen, Fußball, Formel 1, Eisenbahnen oder Elefantenfiguren, mag ich Bücher. Ich lese und besitze gern so viele wie möglich von ihnen und mag den Anblick meiner Bücherwand, die ich in regelmäßigen Abständen erweitern muss. Dass ich ein Buch übers Lesen schreibe, liegt also ziemlich nahe.
Über Bücher zu schreiben, ist eine Mammutaufgabe. Es ist im weitesten Sinne sogar gefährlich! Denn man wagt sich auf das weltenumspannende Terrain der – Gott sei Dank! – niemals vom Aussterben bedrohten verschiedenen Arten der Bücherwürmer und Leseratten vor. Über Bücher zu schreiben, ist deswegen so schwierig, weil sie zwar einen im Grunde simplen Aufbau haben (Papier, Druckertinte, Leim), dafür aber oft mit explosivem Inhalt daherkommen. Und sie sind eine Sache des Geschmacks und daher so schwer zu beurteilen oder gar zu empfehlen wie die neueste Oberbekleidung vom Catwalk in Paris oder Ferienhotels am bulgarischen Goldstrand.
111 Gründe, Bücher zu lieben ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eine Reise durch die mannigfaltigen Epochen der Literatur. Gemeinsam schauen wir hinter die Kulissen des Büchermarktes und nehmen die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Büchern unter die Lupe. Vor allem aber ist 111 Gründe, Bücher zu lieben eine literarische Schatzsuche nach den beliebtesten Romanen, nach den mutigsten Heldinnen, den empfindsamsten Helden, nach Klassikern, Dauerbrennern und Neuerscheinungen, die das Zeug haben, uns ganz lang im Gedächtnis zu bleiben.
Gespickt mit unzähligen Leseempfehlungen, ist dieses Buch für alle, die Bücher lieben.
Stefan Müller
1. Kapitel
Jenseits des Klappentextes
1.
Weil Bücher von der Schriftrolle bis zum Taschenbuch ihre eigene Geschichte haben
Mit Geschichtlichem wollen wir uns nicht lange aufhalten, denn wir lieben Bücher ja nicht, weil sie sich irgendwann mal aus einer Papyrusrolle im alten Ägypten über den Kodex aus Pergament im antiken Rom zu einem neuzeitlichen Papier-Wälzer wie Uwe Tellkamps Der Turm entwickelt haben (der aufgrund seiner Dicke und Schwere schon fast als Wurfwaffe bezeichnet werden könnte), sondern weil sie einfach da sind und uns erfreuen, informieren, unterhalten, erschrecken, faszinieren und noch weitere etwa 300 Tätigkeiten ausüben.
Allen Spitzfindigen sei an dieser Stelle gesagt: Natürlich, Bücher können selbst keine Tätigkeiten ausüben, sondern sind nur Produkte, die eine bestimmte Wirkung erzielen. Aber da wir hier unter uns sind, kann man die gebundenen Papierberge als ein wenig selbstständiger betrachten. Wer von uns wurde nicht von einem Buch seit seiner Jugend begleitet, wer hat nicht in einem Buch einen Seelentröster gefunden, wer hat nicht schon mal auf die Hilfe eines Buches gesetzt (frage ich jetzt mal die Verzweifelten in der Küche)?
Laut UNESCO ist ein Buch ein nicht periodisches Werk und hat übrigens mindestens 49 Seiten. Was ein wenig seltsam klingt, denn wo ist bitte schön die Rückseite der 49. Seite geblieben? Dass der Begriff »Buch« tatsächlich von der Baumart Buche abgeleitet ist, ist so naheliegend, dass man gar nicht drauf kommt. Im Germanien anno dazumal hatte man auf die Rinde der Buche geschrieben.
So, ich stelle mal den Zeitraffer an und vereinfache die Historie ein bisschen: Bevor der Mainzer Johannes Gutenberg in Europa den Druck mit beweglichen Lettern erfand, waren traditionelle Bücher sowas wie kostbare Mangelware. Sie wurden von Hand geschaffen und beschrieben, oftmals reich verziert und verschwanden dann in einer Klosterbibliothek oder in einem Präsentationsraum in irgendeinem Schloss, wo sie dann kaum jemand mehr zu Gesicht bekam. Da half auch Anstellen nichts, sofern man das damals überhaupt schon erfunden hatte. Dann kam Gutenberg und schuf die Möglichkeit der Vervielfältigung von Schriften. Diese frühen Bücher, heute Inkunabeln oder Wiegendrucke genannt, sind dieser Tage sehr kostbar und waren der Startschuss für den modernen Buchhandel. Bücher sind das gedruckte Gedächtnis der Menschheit und funktionieren auch bei Stromausfall. Das Gute ist, sie können beides: bilden und unterhalten.
Bei Philosophen aller Couleur stellt sich seit Menschengedenken die Frage, was nun zuerst da war, die Henne oder das Ei. Bei dem Buch und der Schrift haben wir dieses Problem nicht, denn die Entwicklung von der Erfindung der Schrift bis hin zu Bestsellern anno 2013 lässt sich historisch ja belegen. Und es würde auch wenig Sinn ergeben, hätte man ein Buch erfunden und wüsste nicht, wie man es füllen sollte.
Je mehr Bücher produziert wurden, umso größer war ihre Verbreitung, desto besser wurde die Bildung der Menschen, was wiederum dazu führte, dass noch mehr Bücher gedruckt wurden. Durch die Verbesserung des Buchdrucks und die Schöpfung von preiswerterem Papier verbreiteten sich die papiernen Wissensträger, die dazumal nur gebildeten Leute vorbehalten waren, in ganz Europa. Dann kamen – im Schnelldurchlauf – die Reformation (alle wollten jetzt die Bibel auf Deutsch lesen), etwas später Goethe, dann die Manns und kurz darauf Shades of Grey. Was würde wohl der alte Gutenberg dazu sagen?
2.
Weil jeder doch gern mal einen Literaturpreis gewinnen möchte
»Richtige Schriftsteller« behaupten von sich ja immer, dass sie nicht leben könnten, wenn sie nicht jeden Tag mindestens eine Seite Text schrieben. Eine Art innerer Zwang treibe sie dazu an, sei ihnen wie die Luft zum Atmen, sie würden verkümmern, wenn ihre Fingerspitzen nicht auf dem Wellental einer Tastatur herumklimpern könnten. Zunächst ist ihnen auch gar nicht wichtig für wen, sondern nur dass sie schreiben. Und ärgern sich am Ende doch, wenn es keiner liest. Doch mal ehrlich, Quantität allein bringt ja nun nicht den Lesefrieden auf die Welt; bei manchen Autoren wäre es doch günstiger, sie würden weniger, dafür aber bessere Sachen schreiben. Und überhaupt: Niemand kann mir erzählen, dass er frohen Herzens für die Schublade schriebe, denn jeder Schreiberling sehnt sich doch nach Anerkennung durch seine Leserschaft, wie ein Schauspieler auf der Bühne nach dem Applaus der Zuschauer lechzt und ein Fernsehmoderator am nächsten Tag einen ernsten Blick auf die Einschaltquoten seiner Sendung wirft.
Jeder, der sich viele Wochen und Monate an seine Schreibmaschine oder seinen Computer setzt und durchaus auch mal ganze Nächte hindurch an seinen Texten arbeitet, dabei zu essen und zu schlafen vergisst und nicht mehr fähig ist, die Einladungen von Freunden zu einem gemütlichen abendlichen Beisammensein anzunehmen, möchte doch wenigstens ein bisschen Anerkennung einheimsen. Am besten natürlich auch etwas weiter über die Grenzen der Familie und der lokalen Zeitungen hinaus. Was dem Ingenieur seine Brücke, ist dem Schriftsteller sein Buch – und bitte jeder sollte doch ein bisschen Staunen dafür übrig haben. Größter Lohn sind freilich gute Verkaufszahlen und das Auftauchen auf diversen Bestsellerlisten, denn hat man es dorthin erst geschafft, ist der eigene Name schnell im Munde vieler anderer, dann klettert man nicht mehr mühselig auf der Karriereleiter, sondern nimmt einfach den Lift.
Doch erst, wenn die eigenen Bücher mit einem leicht ablösbaren Aufkleber mit dem charmanten Aufdruck »Ausgezeichnet mit …« verziert werden, hat man sich in die endlos lange Reihe von Preisträgern eingereiht und kann nun stolz behaupten, es zu etwas gebracht zu haben. Billy Wilder prägte mal einen scherzhaften Ausspruch über Auszeichnungen und Preise, die früher oder später jedes Ar… bekomme, und wenn man bedenkt, dass es allein in Deutschland weit über 300 Bücherpreise gibt, könnte er damit durchaus Recht haben. Die Mehrzahl der Preise trägt Namen berühmter Autoren, ob die allerdings über die Auswahl der Gewinner immer so glücklich wären, sei mal dahingestellt.
Preise gibt es ja nicht nur für die pädagogisch wertvollsten Bücher, oft werden auch Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Kunstform Buch geehrt. Städte schreiben Literaturpreise aus, um ihren kulturpolitischen Ansatz zu unterstreichen, die Frankfurter Buchmesse prämierte sogar das Buch mit dem irrwitzigsten Titel. Früher hat man solche Bücher gar nicht erst gekauft, jetzt bekommen sie sogar Preise!
Die Formalitäten sind jeweils verschieden: Mal bewirbt sich ein Verlag mit einem Buch, manchmal schlägt sich der Autor selbst vor, es gibt Preise für Übersetzer, Buchgestalter, Jugendbücher, Krimis, mal wird einfach mit ausgestreckter Hand in die Fülle der Schriftsteller gegriffen und schon – die Vielfalt macht’s möglich – hat man seinen Preisträger. Dem Otto Normalverbraucher völlig unbekannte Autoren werden mit gutdotierten Preisen überhäuft und vielgelesene Schriftsteller werden einfach Jahr für Jahr ignoriert, bis man ihnen am Ende der Karriere, also quasi kurz bevor der Stift endgültig aus der Hand gleitet, nur trostweise irgendeinen Preis fürs Lebenswerk überreicht.
Am besten ist, man schreibt gar keine Bücher, dann muss man sich auch nicht ärgern, wenn man keinen Preis bekommt, ja wenn man es nicht mal auf eine sogenannte Longlist, geschweige denn auf eine Shortlist schafft. Ich habe noch keinen Literaturpreis erhalten. Aber ich will auch gar keinen. Ganz ehrlich.
3.
Weil Literaturwissenschaftler einfach ihr Hobby zum Beruf machen können
Ich bin ja selbst so einer. Und fühle mich gut dabei. Man muss nur aufpassen, dass man in der Routine der Arbeit nicht die Faszination für das Objekt selbst verliert, Bücher also nicht mehr zur eigenen Unterhaltung konsumieren kann, sondern immer nur nach wissenschaftlich verwertbaren Aspekten Ausschau hält. Danach, wie sich Silben zu Wörtern und Wörter zu Sätzen formen und in ihrer Summe einen zufälligen oder genauestens geplanten Sinn ergeben.
Wer einmal hinter die Kulissen einer Fernsehserie geschaut hat oder sogar dort arbeitet, der sieht das Produkt mit anderen Augen: Die Wände sind aus Pappe und davon hat das vermeintliche Zimmer auch nur drei (und eine Decke schon mal gar nicht), die Aussicht nach draußen ist nur ein Plakat, der Straßenlärm kommt künstlich vom Band, und die Darsteller können sich nicht leiden, obwohl sie in der Serie ein ach so verliebtes Paar spielen.
Nicht anders ist das ja bei Sängern. Die machen zwar auf der Bühne eine tolle Figur und lächeln auch immer so herzlich in die Kamera, aber wehe das Playback geht aus! Und dass manche Sänger nur eine Arbeitsberechtigung haben, damit sich der Techniker im Studio nicht arbeitslos melden muss, ist auch so eine Geschichte, der man besser nicht auf den Grund geht.
Alle Literaturwissenschaftler eint die Liebe zu Büchern und zum Lesen. Was den Wissenschaftler vom Normalo-Leser unterscheidet, ist, dass die eigentliche Arbeit des Profis während des Lesens beginnt und nach der letzten Seite in eine neue Ebene aufsteigt. Dann geht es ans Analysieren, Auszählen und Anstreichen, ans In-Verbindung- und In-Kontrast-Setzen, es geht darum, Sekundärliteratur auszuwerten und nicht selten sogar Tertiärliteratur, es werden Thesen und Antithesen aufgestellt, es wird interpretiert und verworfen, niedergeschrieben und wegradiert, mit Kollegen im Büro oder im stillen Kämmerlein mit sich selbst diskutiert, die Lebensbedingungen des Autors werden hinterfragt, der Erzähler vom Autor losgelöst.
Man muss aufmerksam sein und sehr akribisch, man ist quasi ein Sherlock Holmes beim Lesen, achtet auf jede Kleinigkeit (und sei es auch nur ein mysteriöser Gedankenstrich! – zu dem kommen wir später noch), schenkt dem Beachtung, was eigentlich überlesen wird. Der Literaturwissenschaftler deutet und erklärt und muss aufpassen, dass er nur das aus einem Text herausholt, was drin ist, und nicht auch das, von dem er gerne wollte, dass man es herauslesen könnte. Schon anhand dieser Satzkonstruktion wird erkenntlich, wie schwer dieser Job ist!
Nun wird jeder Arbeiter auf einer Baustelle sagen, dass sein Job viel schwerer ist. Denn was ist das Schippen von Sand und Kies und das Tragen gewichtiger Metallträger gegen einen Job im Lesesessel und am Schreibtisch, bei dem man sich nicht mit mehr beschäftigt als mit Buchstaben, Büchern und Schreibpapier? Aber das wäre ja im Grunde so, als würde man Hausarzt Dr. Bolliger – Sein Leben, seine Liebe, seine Patienten von Patrick C. Frey mit Dr. Faustus von Thomas Mann vergleichen. Das geht irgendwie nicht.
Beide Berufe bringen ihre Schwierigkeiten und ihre schönen Seiten mit sich. Hier wie da müssen sich die Erfahrenen mit Anfängern rumärgern und deren Fehler korrigieren. Hier wie da steht man am Ende des Arbeitstages vor einem mal mehr, mal weniger befriedigenden Ergebnis. Während der Bauarbeiter aber zum Feierabend mit den Kollegen eine kühle Flasche Bier hebt (Sie merken schon, die Klischeekiste ist gerade aufgesprungen), bleibt der Literaturwissenschaftler allein zurück – nur umgeben von seinen Büchern, seinen Ideen und der Angst vor den Kollegen in aller Welt, die nur darauf brennen, seine neuen Erkenntnisse zu widerlegen. Also mal ehrlich, wer ist jetzt hier im Vorteil?
4.
Weil Kritiker Schmeichler oder Barbaren sein können
Wenn Marcel Reich-Ranicki in seinem Literarischen Quartett mit der Faust auf den Tisch haute und ein Buch nach Strich und Faden verriss, wusste man als Zuschauer gar nicht, was man davon halten sollte. Einerseits faszinierte seine Redegewandtheit, die über den bissigen Ton hinwegzutäuschen vermochte, andererseits empfand man Mitgefühl mit den betroffenen Autoren, deren Karriereende – obwohl sie vielgelesene und bekannte Leute waren – man nun gekommen sah. Wer seine Fernsehbeiträge verpasst hat, kann ja mal auf YouTube nachschauen oder kauft sich einfach seinen Band Lauter Verrisse, der auch einen guten Eindruck vom Ton seiner Kritiken vermittelt. Wie mühten sich Sigrid Löffler, Hellmuth Karasek und später auch Iris Radisch zu schlichten und von Reich-Ranicki offenbar überlesene Vorzüge eines Buches zu betonen.
Marcel Reich-Ranicki war zwar Deutschlands Literaturkritikpapst, aber bei weitem nicht der Einzige, der seine Meinung über Bücher kundtut. In Literaturzeitschriften, Tageszeitungen und Sammelbänden werden die geistigen Ergüsse von Kritikern abgedruckt. Das Rezensionsexemplar eines Romans – vom Verlag hoffnungsvoll an die lesenden und schreibenden Kollegen in den Redaktionen verschickt – wird zur Grundlage einer thematischen, stilistischen und an den persönlichen Bedürfnissen des Kritikers ausgerichteten Auseinandersetzung mit dem Werk.
Und da im Internetzeitalter nicht nur altgediente Literaturwissenschaftler und Buchmarkt-Insider Rezensionen verfassen, sondern heute jede und jeder auf den Seiten von Onlinekaufhäusern, in Blogs und auf Homepages seine Meinung vervielfältigen darf, gibt es mittlerweile eine Fülle von mehr oder minder kritischen Auseinandersetzungen. Das freie Internet lädt jedermann ein, seine Meinung kundzutun, auch wenn sie eigentlich keiner wissen möchte und vor allem auch wenn sie unangemessen ist. Sollte man nicht nur Dinge beurteilen, die man zu beurteilen objektiv in der Lage ist? »Schlagt ihn tot, den Hund. Es ist ein Rezensent!«, hat schon der alte Goethe in einem Gedicht geschrieben. Man müsste daher eine mathematische Gleichung erfinden, durch die die Glaubwürdigkeit einer Rezension zu berechnen ist, indem man den Stil des Romanautors proportional dem des Rezensenten gegenüberstellt. Besteht eine Diskrepanz von mindestens 15 Einheiten (wovon auch immer), hat der Kritiker das Buch einfach nicht verstanden und sollte sein Geschriebenes am besten wieder entfernen oder als untauglich kennzeichnen.
Kritiker sind keine Götter, sondern Menschen wie du und ich. Sie haben ihren eigenen guten oder schlechten Geschmack. An einem Tag schreiben sie etwas Gemeines, weil sie schlechte Laune haben und sich drin suhlen wollen, an einem anderen schreiben sie etwas Gutes, weil sie schlechte Laune haben und das ändern wollen. Einige Leser lassen sich durch eine schlechte Kritik abschrecken und verzichten auf den Erwerb des Buches, andere fühlen sich durch einen Verriss geradezu animiert, es zu kaufen, um zu prüfen, was wirklich dahintersteckt. Kritiken sind Orientierungshilfen und im Grunde so etwas wie Kalorien-, Fett- und Zuckerangaben auf Lebensmittelverpackungen. Sie zeigen dem geneigten Leser an, was alles drin ist – ob und wie’s am Ende schmeckt, muss aber jeder selbst herausfinden.
5.
Weil uns ein Buchcover magisch anziehen kann
Zufallskäufe im Buchsegment gibt es eigentlich gar nicht, denn irgendein Detail wurde exakt so gesetzt, dass es uns als Käufer auffallen und zum Erwerb animieren soll. Selbst wenn man weiß, was man kaufen will, ist man trotzdem nicht vor äußeren Einflüssen gefeit. Und das geht beispielsweise so: Es gibt immer wieder Klassiker, die ihr Dasein mehr oder weniger unbeachtet in Buchhandlungen verbringen. Ihre Aufmachung ist schlicht, der Titel ist sowieso geläufig. Nehmen wir als Beispiel mal Anna Karenina. An dem Regal »Romane von A bis Z« gehen wir ständig daran vorbei und denken bei uns, dass man das auch mal lesen müsste. Ist schließlich Weltliteratur, und was wäre das für ein Angeberfaktum, wenn man von sich sagen könnte, es gelesen zu haben. Aber die Arbeit kommt dazwischen, der Haushalt, Freunde, die besucht und empfangen werden wollen. Man verschiebt den Kauf auf später, denn dieses Buch – so ganz schlicht mit seinem weißen Schutzumschlag und der Pastellzeichnung einer schönen Frau vorn drauf – wird immer da sein.
Große Literaturklassiker eignen sich ja seit Filmurzeiten dazu, in prächtige Hollywoodschinken verwandelt zu werden. Jedes Vierteljahrhundert hat seine eigene Verfilmung, auf Anna Karenina trifft das ganz gut zu. Man denkt sofort an die göttliche Greta Garbo, Scarlett O’Hara, ach nein, Vivien Leigh und Sophie Marceau, bis dann die Ankündigung aus den Journalen bricht, dass die bezaubernde Keira Knightley die Rolle der unglücklich verliebten, ehebrecherischen Russin spielen wird. Lew Tolstois Erben (oder aber auch der Buchhandel) wittern ein gutes Geschäft. Die dicken Schinken werden wieder gut sichtbar hingelegt, und nun sieht man zum ersten Mal, dass es neben dem schlichten weißen Einband mit Pastellfrau auch eine ebensolche Ausgabe mit dem Konterfei der Garbo gibt, und wenig später wird der Fokus auf eine ganz neue Zielgruppe gesetzt: Fans von Keira Knightley und diejenigen, die von Tolstoi noch nie was gehört haben und den Wälzer für das »Buch zum Film« halten.
Das Cover zeigt eine Aufnahme aus dem neuen Film, Keira Knightley in einem überwältigenden ausladenden roten Kleid, das jede Möchtegernprinzessin einmal tragen möchte und dem vielleicht ein Stückchen näher kommt, wenn sie das Buch liest. Das Cover springt einem direkt ins Auge, es fesselt den Käufer, noch bevor er weiß, dass er mit dem Akt des Berührens sich schon von einem bloßen Interessenten zu einem Käufer entwickelt hat. Gut, dass sich Umschläge recht schnell wechseln lassen, während der Inhalt bleibt.
Buchcover sind aufregend wie Kunstwerke. Sie machen neugierig auf den Inhalt eines Buches, sie locken mit hübschen Menschen in ungewöhnlichen Situationen, sie sind Ergänzung zum Titel des Buches, sie fangen die Stimmung des Romans mit ihrer Farbgestaltung ein, als buntes stechen sie aus einem Meer von weißen Covern heraus. Man stelle sich ein Backbuch vor, auf dem kein leckerer Kuchen vorn drauf wäre! Sie sind manchmal ein Indiz für die Zielgruppe (zum Beispiel durch verwendete Schriftarten oder Bilder), manchmal ein Hinweis darauf, ein zeitloses Produkt zu sein, das immer aktuell und beliebt sein wird und daher keinen aufwendig gestalteten Umschlag benötigt. Wie oft haben wir schon ein Buch gekauft, weil uns die Frau oder der Mann (oder beide zusammen) auf dem Cover gefallen haben, wie oft fühlten wir uns an etwas erinnert, was wir durch das Buch noch vertiefen zu können hofften?!
Ich mag Buchcover und lese mir in den Verlagsangaben auch durch, wer es entworfen hat oder von wem die Bilder stammen. Die Coverdesigner bleiben zu Unrecht so oft unbeachtet. Man sollte ihre Namen mal bei Facebook eingeben und dort ein Lob hinterlassen. Ja, das sollte man mal machen.
6.
Weil wir auf der Buchmesse einfach »unter uns« sind
Auf einer Buchmesse zu sein, fühlt sich fast so exklusiv an, wie in einem klassischen Konzert im Opernhaus zu sitzen. Wenn ich auf das Opernhaus zuschreite, langsam mein Ticket aus der Jackettasche ziehe und nach dem Abriss zu meinem Stammplatz gehe, macht sich in mir ein wohliges Gefühl breit, was in etwa dem Nach-Hause-kommen-Gefühl gleicht, nur dass es hier mit deutlich mehr Spannung geladen ist. Gleich wird das Ensemble auf der Bühne Geigenbögen schwingen, Luft in Blasinstrumente pusten und zärtlich an der Harfe zupfen. Das alles passiert im Beisein mehrerer Hundert Menschen, die das Wissen eint, einen der Ihren neben sich zu haben, einen Liebhaber klassischer Musik, der für zwei Stunden den Alltag hinter sich lässt und sich mal nicht über irgendwelche Rabauken in der Straßenbahn oder laut grölende Typen spätabends auf der Straße aufregt.
Buchmessen sind seit jeher ein Ort des Austausches, der vor allem in Zeiten von Eisernen Vorhängen und anderen Grenzen einen wichtigen Treffpunkt darstellte. Leipzig im Osten Deutschlands und Frankfurt am Main im Westen sind die beiden großen Buchmesse-Städte der Republik und ziehen jedes Jahr im Frühling und im Herbst Zehntausende, ja Hunderttausende Besucher aus der ganzen Welt an. Kaum vorstellbar, dass in Frankfurt auf eine mehr als 500-jährige Messetradition zurückgeblickt wird! Denn recht schnell nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg im wenige Kilometer entfernten Mainz wurde Frankfurt zum zentralen Umschlagplatz des sich kontinuierlich entwickelnden Buchhandels. Für ein paar Jahrhunderte verschob sich das Messezentrum für Bücher dann nach Leipzig, bis nach dem Zweiten Weltkrieg Frankfurt wieder aus seinem Messe-Dornröschenschlaf erwachte und seither die Führungsposition innehat.
Ob aber nun in Leipzig oder Frankfurt oder sonst wo auf der Welt: Wo immer Menschen wegen Büchern zusammenkommen, kann man sich wohlfühlen. Der Traditionsbesucher, der noch mit Mann, Musil, Schröder und Wolff aufgewachsen ist, wird sich am heutigen Antlitz der Buchmesse vielleicht ein bisschen stören. Die Moderne hat natürlich auch hier Einzug gehalten. Das Buch als solches (also aus Papier und Pappe und Druckerfarbe) wird natürlich (Gott bewahre!) niemals aus der Mode kommen. Aber dennoch haben sich einige Neuerungen auf dem Markt etabliert, mit denen der Traditionalist leben lernen muss. Das mediale Zeitalter hat seine Fangarme ausgebreitet, und so mancher, der sich beim Stöbern in seiner ihm eigenen Ruhe gestört fühlt, freut sich am Ende doch, wenn im Radio oder im Fernsehen ausführlich von der Messe berichtet wird und zahlreiche Neuerscheinungen vorgestellt werden.
Dass in den letzten Jahren zunehmend extravagante Themengebiete Fuß gefasst haben und – sagen wir mal schwungvoll – gänzlich andere Zielgruppen (Stichworte: Anime, Hörbuch, E-Book) auf die Buchmessen gelockt werden, ist ja reine Gewöhnungssache und gibt dem Ganzen vielleicht sogar den nötigen Pep. Die vielen Begleitveranstaltungen aus Lesungen, literarischen Konzerten und Vorträgen tragen ihr Übriges zum Gelingen einer Messe bei.
Es ist doch herrlich zu sehen, wenn Promis ihre Bücher vorstellen und es einen Massenauflauf von Autogrammjägern gibt! Es ist doch faszinierend, die großen Schriftsteller mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen und festzustellen, dass sie auch nur Menschen wie du und ich sind, einziger Unterschied: Ihre Worte haben Hunderttausende auf der Welt in gedruckter Form gelesen, während der eigene Wortradius nur bis zu den Glückwunschkarten reicht, die man zu Weihnachten an Familie und Freunde verschickt.
»Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein«, soll der alte Goethe jedes Jahr beim (freien) Eintritt in die Leipziger Buchmesse gesagt haben. Und auch wenn dieses Zitat natürlich zweckentfremdet ist (ja, es ist in Wahrheit aus dem Faust’schen Osterspaziergang, aber immerhin von Goethe, also schon ganz nah dran an der Wirklichkeit), ist die Vorstellung, dass auch er einer von den Bücherverrückten war, irgendwie schick. Und ich stell mir vor, wie ich auf ihn zugehe und sage: »Herr Goethe, schön, Sie wieder hier zu treffen, die Welt draußen ist gar zu laut, und hier sind wir endlich unter uns!«
7.
Weil man beim Büchereinsortieren so herrlich kreativ sein kann
Ich glaube, es gibt auf der Welt niemanden, der nicht auch ein bisschen spleenig ist, wenn es um sein Hobby geht. Wie oft sieht man erwachsene Männer, gestandene Kerls, sich in den Armen liegen und hemmungslos weinen, wenn die Lieblingsmannschaft vor den eigenen Augen das Heimspiel verloren hat. Oder umgekehrt: Mit vereinten Kräften überdimensional große Fahnen zum Wallen bringen, Fanschals schwenken, Trikots und am besten noch phantasievolle Hüte tragen, wenn das Glück auf Seiten der eigenen elf Freunde war. Zuhause wird dann noch nachgefeiert, im ehemaligen Kinderzimmer der Tochter, das vor langer Zeit schon zum Fanraum umgewandelt wurde – mitsamt signierten Postern an der Wand (wie damals bei der Tochter, nur mit anderen Motiven, abgesehen auch davon, dass der Papa dieses Anhimmeln von irgendwelchen Hollywoodtypen gar nicht nachvollziehen konnte), getragenen Turnschuhen und ehemals schweißnassen Trikots, die gerahmt unter Glas aufbewahrt werden.
Sammlerinnen von Teddybären, Elefanten, Kühen, Spielzeug und Souvenirlöffeln mit besonderer Prägung, Sammler von Wanderstöcken, Pilzfiguren und Schauspieler-Memorabilien sowie Joghurtbechern (was es nicht alle gibt!) – sie alle eint der für einen Außenstehenden nicht zu begreifende Reiz, solche Dinge anzuhäufen, die ganze Wohnung damit vollzustellen und sich am Ende auch noch wohlzufühlen. »Mich wohlfühlen in einem Haus ohne meine Kuhtapete, ohne meine Couch in Kuhform, ohne meine Porzellan- und Stoffkühe, ohne Hella hinten auf der Wiese und meinem höchsteigenen Ochsen, der in der Werkstatt an einer neuen Lampe in Kuhform bastelt – unmöglich!«, würde ihnen Heide S. entgegnen, wenn man sie auf alternative Wohnformen anspräche.
So, wie schlägt man nun die Brücke von einer Kuhinteressierten zu einem Büchernarren? Vielleicht so: Früher waren Bucheinbände ja noch aus Leder. Hm, aber das könnte ein bisschen schwierig sein, wegen der Tierschützer. Da gibt es nur eine Lösung: Es muss ohne Überleitung gehen.
Hobby hat auch immer etwas mit Systematik zu tun. Da ist man einem Bibliothekar durchaus ähnlich, der mit drei Ausfallschritten und einem Griff das gesuchte Buch aus einem der vielen Regale zieht. Sammler wissen, wo etwas zu finden ist, sie katalogisieren, sie sortieren, sie kleben ein und nummerieren, sie signieren und meist auch phantasieren sie, wie es wohl wäre, wenn man … Bei Bücherfreunden gibt es verschiedene Spezies, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Man respektiert sich zwar gegenseitig und wirft gern einen prüfenden Blick auf die in Regalen und Schränken verstauten Bücher, muss sich aber doch manchmal anstrengen, kritische Kommentare zu unterlassen. Diese Kommentare bezögen sich freilich nicht nur auf die belletristische Güte der Bücher, sondern vor allem auf deren Unterbringung. Schließlich kann ja keiner etwas für seinen schlechten Lesegeschmack. Wohl aber kann man etwas gegen schlechten Sortiergeschmack tun!
Jeder wie er will, sage ich mir immer, wenn ich eine Wohnung verlassen habe, in der die Bücher kreuz und quer auf Regalen lagerten, als wären sie zufällig übereinandergekippte Holzscheite. Grüne, gelbe, beige Taschenbücher neben voluminösen Bildbänden, Thomas Mann neben einer alten Schwulenzeitschrift (oder war das gewollt?), Kochbücher neben den reizenden Gedichten von Mascha Kaléko. Ja, auch in meinem Freundeskreis gibt es solche Leute! Lesen wie die Teufel, aber von Sortierstil keine Ahnung. Einen Vorteil haben sie jedoch auf ihrer Seite, dazu aber später.
Es stehen einem doch alle Möglichkeiten offen. Man kann so richtig kreativ werden. Nach der Farbe eines Covers zu ordnen, hat sich für viele bewährt. Manche lieben einfach den Anblick eines riesigen vielfarbigen Regenbogens. Andere ordnen nach dem Alphabet und bringen ihre Bücher so in eine leicht auffindbare Position. Dabei kann man sich nach dem Buchtitel oder dem Verfassernamen richten. Ganz Ordentliche sortieren nach dem Namen des Autors und als Unterordnung noch nach dem Namen des Buches. Wenn die könnten, würden sie ihre Bücher am liebsten noch lochen und abheften!
Ich bin Verfechter des Wir-ordnen-Bücher-nach-ihrer-Größe-Prinzips. Ganz links oben fangen die großen Bücher an und wie der Körper einer sich endlos langziehenden, sich zum Ende hin verjüngenden Schlange stehen ganz rechts unten die kleinen gelben Reclamhefte. Dieses Prinzip verursacht regelmäßig ein Staunen bei Besuchern, die ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, wie die Bücher scheinbar alle auf einer Höhe enden, obwohl es im Grunde abwärts geht wie auf einer sich gen Tal neigenden Gebirgsstraße.
Was den Wildaufbewahrern zum Vorteil geneigt, wird den Sortierern regelmäßig zum Verhängnis. Denn während die einen ihr eben ausgelesenes Buch einfach auf den bestehenden Haufen legen oder ans offene Ende ihrer Bücherkette stellen, stehen die disziplinierten Sortierer erster und zweiter Ordnung vor einer großen Herausforderung: Sie müssen, um neue Bücher einzusortieren, die ganze Bücherschlange zum Leben erwecken und verschieben, um Lücken für die Neuankömmlinge zu schaffen. Wer schon mal einen Nachmittag damit verbracht hat, 1500 oder mehr Bücher zu bewegen (und nebenbei abzustauben), der weiß, wovon ich rede. Aber das gehört einfach dazu, und irgendwie klappt es immer, dass einem ein Buch in die Hand fällt, das man schon fast vergessen hatte. Nun weiß man wieder, wo’s steht. Prima!
8.
Weil Lesezeichen nicht nur Platzhalter sind, sondern auch etwas über den Leser aussagen
Wann immer man an der Kasse einer Buchhandlung steht, wird einem ein kostenloses Lesezeichen in die Tüte gesteckt. Darauf zu sehen ist dann meist Verlagswerbung für Neuerscheinungen oder es ist eine etwas in die Höhe verlängerte Visitenkarte des Ladens (nein, ich meine nicht Strittmatters!). So leid es mir tut: Diese Lesezeichen wandern regelmäßig in den Papiermüll, denn als Bücher-Altmeister hat man natürlich längst sein System perfektioniert, wie man sich die zuletzt gelesene Seite merkt.
Als Jugendlicher malte ich mit einem mehrfarbigen Buntstift kleine Sterne an den ersten zu lesenden Absatz, bis ich das albern fand und auf einen Einleger wechselte. Das war lange Zeit – es liegt irgendwie nah – mein Bibliotheksausweis aus dünner Pappe; als es den jedoch nicht mehr gab, kaufte ich mir ein Lesezeichen mit einem schönen Spruch von Hermann Hesse hinten drauf. Vorn war das Konterfei des Meisters selbst abgebildet, das mich immer so eindringlich anschaute, dass ich meist das Gedicht nach oben legte.
Kann man Rückschlüsse auf Menschen ziehen, wenn man ihr Lesezeichen begutachtet, so wie beispielsweise Schreibutensilien (man denke an den klassischen Federhalter, an einen teuren Kugelschreiber, an einen Werbegeschenk-Kuli, einen Bleistift oder einen bunten Fasermaler) oder Kalender (literarischer Katzenkalender, berühmte Gemälde, Manga-Motive) vermutlich etwas über ihren Besitzer aussagen?
Lesezeichen gibt es ja in allen Formen und Farben: Es gibt überdimensional große Büroklammern, plattgewalzte und bedruckte Metallblättchen, Lesezeichen mit Pferde-, Katzen- und Schriftstellermotiven, manche verwenden eine Haarnadel, wiederum andere machen einfach ein Eselsohr oder knicken gleich die ganze Seite ein und lassen einen Papierzipfel herausgucken. Leute mit gutem Gedächtnis merken sich die Seitenzahl, und die ganz Schnellen brauchen gar kein Lesezeichen, weil sie ein Buch in einem Rutsch durchzulesen pflegen.
Meine Single-Freundin Anita ist eine von denjenigen, die sich ihre Lesezeichen noch selber basteln. Und das geht so: Sie findet im Internet einen süßen Typen (es ist meist ein Model oder ein Schauspieler), kullert zweimal mit den Augen und denkt: Ach, der würde mir auch gefallen. Dann speichert sie das Bild ab, druckt es an ihrem Schreibtisch in besonders hoher Qualität aus und lässt das Ganze trocknen, bis die frische Farbe gut vom Papier aufgenommen wurde und der Typ sie sehnsuchtsvoll oder freundlich lächelnd von dem circa fünf mal acht Zentimeter großen Ausdruck anschaut.
Erst dann schneidet sie das Bild aus und steckt den Typen ins nächste Buch, das sie liest. »Ist er nicht süß?«, fragt sie mich manchmal, und ich sage nur »Ja, ja«, weil die Bilder von Woche zu Woche wechseln und man was anderes ja in dem Moment eh nicht entgegnen kann. Wenn Anita nach einer Leseeinheit ihr Buch zuklappt, dann zeichnet sich auf ihrem Gesicht ein Lächeln ab, als hätte sie eben in ihrem dystopischen Roman eine irre romantische Szene gelesen und würde noch immer darin schwelgen. Dabei hat sie aber gerade verliebte Blicke mit ihrem heimlichen Schatz getauscht, der ihr zuzuflüstern schien: Ich bin immer da, du musst nur das Buch aufklappen. Dann und wann frage ich sie: »Was ist denn mit Jimmy (oder Johnny oder Justin oder Danny) passiert?« Da zuckt sie dann mit den Schultern und sagt lapidar: »Verlorengegangen.« Das kann dann nur eines bedeuten: Sie hat eine echte kleine Liebschaft gefunden (von der ich doch aber wissen würde!) oder einfach – ein neues Schnuckelchen für ein weiteres Lesezeichen.
9.
Weil man mit Büchern ungeahnte Rekorde aufstellen kann
Man muss schon schmunzeln, wenn man liest, dass ausgerechnet das Guinnessbuch der Rekorde in sich selbst verzeichnet ist. Das regelmäßig erweiterte Werk sammelt die unterschiedlichsten Weltrekorde, darunter viele skurrile Ereignisse, Geschichten und Menschen. Unter anderem finden sich darin Auskünfte über den ältesten Menschen der Welt, über die größte Autorenlesung oder die meisten in einer Minute aus der Luft gefangenen Popcorn-Wölkchen. Das Guinnessbuch der Rekorde ist nicht nur eines der meistverkauften Bücher der Welt, sondern auch noch das am häufigsten aus einer Bibliothek gestohlene! Ein zweifelhafter Rekord zwar, aber – wenn man es mal positiv betrachten will – immerhin ein Zeichen dafür, dass es sehr beliebt ist.
Wer selbst nicht über 50 Autos springen, 35 Äpfel in einer Minute essen oder gleichzeitig mit 124 Frauen tanzen kann (dies sind übrigens Rekorde, die es noch nicht gibt, also ran!), der könnte mit einem seiner Bücher einen Rekord aufstellen. Dafür braucht man entweder viel Geld und gute Beziehungen oder Glück und Geduld. Das größte von Menschenhand geschriebene Buch und damit ein Unikat ist der Codex Gigas aus dem 13. Jahrhundert, der auch Teufelsbibel genannt wird. Das Mammutwerk ist 92 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter breit und 22 Zentimeter dick. Es wiegt stolze 75 Kilogramm und wurde – nach dem heutigen Stand der Wissenschaft – von nur einer Person, einem Mönch, niedergeschrieben. Dass der Teufel höchstpersönlich bei der Niederschrift geholfen haben soll, ist allerdings nur eine Legende.
Das größte maschinell gefertigte Buch ist momentan ein Bildband des Autoherstellers Mazda. Es misst 3,07 mal 3,42 Meter! Ist es aufgeklappt, könnte sich so mancher Kleinwagen dahinter verstecken. Da Größe aber in allen Bereichen des Lebens nur relativ ist, könnte diese natürlich noch übertroffen werden. Wie wäre es also mit einem begehbaren Aufklapp-Märchen-Bilderbuch, in dem man selbst zur Märchenfigur werden könnte?
Das kleinste Buch der Welt dürfte wohl das japanische Werk Shiki no Kusabana (auf Deutsch: Blumen der Jahreszeiten) sein, das mit bloßem Auge gar nicht zu lesen ist. Es ist so klein, dass es durch die Öse einer Nähnadel passt. Die Buchstaben und Schriftzeichen haben eine Größe (oder besser: Kleinheit) von gerade mal 0,01 Millimeter. Damit man es doch entziffern kann, wird vom Hersteller die dazu passende Lupe gleich mitgeliefert.
Wer über viel Geld verfügt, könnte sich (wohl aussichtslos) um den Erwerb jener Bücher bemühen, die das Bankkonto stark belasten würden: Darunter zählen beispielsweise John James Audubons The Birds of America, der rund tausend Jahre alte und mit Edelsteinen, Gold, Elfenbein und Perlen geschmückte Codex Aureus (der heutige Wert des Evangelienbandes liegt wohl bei etwa 80 Millionen Euro) und der Codex Manesse, die Heidelberger Liederhandschrift, die in mitteldeutscher Sprache abgefasst wurde.
Kurios ist der Fall des wohl am längsten ausgeliehenen Buches: 1998 fand Eve Lettice aus Victoria in Kanada das Buch Sunshine Sketches of a Little Town (1912) von Stephen Leacock, einen der kanadischen Klassiker der Unterhaltungsliteratur, auf ihrem Dachboden. Wie sich herausstellte, hatte ein früherer Mieter sich das Buch im Jahre 1916 in der örtlichen Bibliothek ausgeliehen und nicht zurückgebracht. 82 Jahre später konnte es endlich aus der Liste der nicht zurückgegebenen Bücher ausgetragen werden. Die Strafgebühr von 7200 Kanadischen Dollar wurde erlassen.
Wen es einmal nach Portland im US-Bundesstaat Oregon verschlägt, der sollte sich einen Besuch der weltgrößten Buchhandlung nicht verwehren. Bei Powell’s Books lagern rund eine Million neue und gebrauchte Bücher und warten auf interessierte Leserinnen und Leser. Das Übernachten in Schlafsäcken, Einmannzelten und auf Lesesofas ist vor Ort leider nicht möglich, in nahegelegenen Hotels kann man aber die Zeit bis zu den Öffnungszeiten totschlagen …
10.
Weil es oftmals die Werbung macht
Man kann davon ausgehen, dass in Buchhandlungen und Antiquariaten einige literarische Perlen liegen, von denen kaum ein Mensch je gehört hat. In kleinen Auflagen produziert, fristen sie ihr Dasein und hatten nur die Chance, in wenige Hände und heimische Buchsammlungen zu gelangen, denn Geld für umfassende Werbung war nicht vorhanden.
Heute mehr denn je ist Lesen ja zu einem Massenevent geworden. Was nicht bedeuten soll, dass heute mehr Menschen lesen als früher, sondern dass Menschen heute verstärkt auf das Lesen bestimmter Bücher gelenkt werden. Manche literarischen Erzeugnisse »muss« man heute gelesen haben, um überhaupt noch »up to date« zu sein und mitreden zu können. Wer nicht bei einem, nein, dem sozialen Netzwerk mindestens ein Profil hat, der ist schon mal ganz raus – denn woher soll der bitte wissen, was derzeit »in« ist?
Literatur ist zu einem Hype-Phänomen geworden: Bücher starten ganz klein in einem Independentverlag oder im Internet, durch Hörensagen werden sie weitervermittelt und schließlich durch die alten und neuen Medien aufgegriffen und weltweit verbreitet. Qualität spielt da zunächst eine untergeordnete Rolle, und es ist doch wirklich spannend, erstmal Teil von etwas (diesem Hype) zu sein und mitzumachen. Was das wirklich ist, wird sich später schon herausstellen. Okay, Vampire. Okay, Sadomasosex. Gibt doch Schlimmeres.
Haben Verlage früher in Zeitungen und Zeitschriften Anzeigen geschaltet, wollten sie auf bestimmte lesenswerte Bücher hinweisen. Heute werden Anzeigen geschaltet, damit auch der Letzte noch mitbekommt, dass das bereits millionenfach verkaufte Buch, der Brüller der Saison bitte schön immer noch zu haben ist. Stand früher der Name einer Autorin oder eines Autors für die Qualität eines Werkes, sind es heute die Auflagenzahlen. Je kleiner die Auflage, desto kleiner die Aussicht auf Erfolg. Und welches Buch wird wohl eher verkauft – eines, von dem 100 griffbereit auf dem zentralen Präsentierteller einer Buchhandlung lagern, oder das einzelne Exemplar, das unter dem Buchstaben M im Regal »Romane von A bis Z« versteckt steht? Schlägt man den Katalog eines Buchversands auf, sind darin oft nur die Bücher, die sowieso schon erfolgreich sind. Das Konzept der Werbung – also Neues, Unbekanntes und vielleicht auch Gehaltvolles anzupreisen – folgt hier keiner wirklichen Logik mehr. Da muss man als Verbraucher dann wieder selbst etwas aktiver werden und in Buchhandlungen und Antiquariaten schmökern, was das Zeug hält. Das hat ja auch was für sich.
2. Kapitel
Bücher sind Menschen und Menschen sind Bücher
11.
Weil ich mit meiner Postfrau gern mal ein Schwätzchen halte
Ich liebe ja Buchhandlungen und Antiquariate, und ich hätte – das muss ich ehrlich zugeben! – niemals gedacht, dass ich mal ein Interneteinkäufer werde. Ich dachte immer: Der persönliche Kontakt zur Verkäuferin oder zum Verkäufer gehört einfach dazu, man wird beraten, man kann sich umschauen und die Bücher schon mal prüfend in die Hand nehmen.
Dass nicht nur die Bücher selbst mit mir kommunizieren, sondern auch allerhand Kommunikation mit anderen Menschen stiften, die im Grunde mit den Büchern nur indirekt zu tun haben und sie als solche gar nicht zu Gesicht bekommen, verblüfft mich immer wieder. Wenn man wie ich gern Bücher liest, die zwar nicht inhaltlich, dafür aber im wahrsten Sinne des Wortes bereits Staub angesetzt haben, kommt man nicht umhin, entweder in eine Bibliothek zu gehen und sie auszuleihen oder ein Antiquariat aufzusuchen, um sie zu kaufen. Ich bin seit jeher der Käufertyp. Ich mag »mein« Antiquariat, verstehe mich prima mit dessen Besitzerin (sie würde sich jetzt an lange Gespräche über Hermann Hesse und Magdeburger Inkunabeln erinnern) und wandele mit Erstaunen und Begeisterung durch den kleinen Laden, der über und über mit Büchern aller Epochen und Stilrichtungen versehen ist. Aber selbst mein Antiquariat kann nicht alle Bücher vorrätig haben, die ich gern lesen möchte. Das Internet, die Fundgrube für so wahrscheinlich alles, was man sich denken kann, ist natürlich auch in Sachen alte Bücher kaum zu schlagen. Anstatt also an echten Regalen entlangzugehen und die Buchrücken der Bücher abzutasten, macht man das jetzt virtuell. Und hier beginnt das Unheil!
Ein wirkliches Unheil ist es aber auch nicht, wenn ich – mal wieder – ehrlich mit mir selbst bin. Denn man ist nur einen Mausklick von einem Buch entfernt, und des Öfteren scheint mein rechter Zeigefinger ein Eigenleben zu entwickeln und, bevor ich richtig darüber nachgedacht habe, zu bestellen.
Und nun beginnt das freudige Warten, das Warten auf die Ware und das Warten auf eine Begegnung – mit meiner Postfrau. Die kennt mich mittlerweile schon persönlich, weil sie ungefähr jeden zweiten Tag bei mir klingeln muss. »Ich verstehe nicht, warum Sie nur so einen kleinen Briefkasten haben«, sagt sie den einen Morgen, da hat sie mich gerade aus dem Schlaf geklingelt und steht ein bisschen aufgeregt vor mir. Sie überreicht mir drei unheimlich dicke Umschläge, auf denen jeweils in gestempelten Lettern das Wort »Buchsendung« steht. »Ja«, sage ich, »da muss ich wohl mal mit dem Vermieter sprechen.« Wir haben Einheitsbriefkästen, ich fürchte, er wird für mich keine Ausnahme machen.
An einem anderen Tag im zurückliegenden Winter komme ich nach Hause und finde einen Abholschein in meinem Briefkasten. Natürlich wieder Büchersendungen. Den gelben Schein mit dem angekreuzten Vermerk »2 Büchersendung(en)« lege ich gut sichtbar in den Wohnungsflur.
Vormittags um zehn stehe ich dann weiß bepudert vom Schnee und mit kalten Füßen, aber in freudiger Erwartung am Schalter, und auch diese Dame auf der anderen Schalterseite kennt mich mittlerweile – schließlich kann man nicht immer zuhause sein und seine Bücher persönlich in Empfang nehmen. Und nachdem sie mir zum wiederholten Male vorgeschlagen hat, ein neues Tagesgeldkonto zu eröffnen, und wir übers miese Wetter draußen gesprochen haben, macht sie mir einen weiteren, diesmal unerwarteten Vorschlag:
»Ich habe heute ein neues Angebot für Sie«, sagt sie lächelnd, und ich weiß, sie meint es nur gut. »Sie können Ihre Buchsendungen auch bequem an eine Packstation senden lassen, dann müssen Sie nicht immer bei Wind und Wetter herkommen.« Ich müsse nur ein Formular ausfüllen und dann ginge alles seinen Gang.
»Aber ich möchte eigentlich nicht schon wieder irgendwem meine Daten aushändigen«, erwidere ich und versuche, Zeit zu gewinnen. Das scheint sie allerdings nicht zu überzeugen: