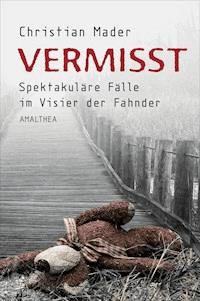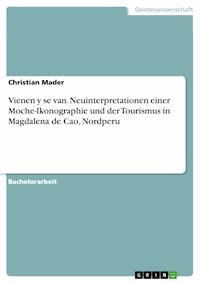6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Einen Verein zu lieben, der es als einziger vollbracht hat, eine Saison ohne Niederlage zu absolvieren, sollte nicht schwer sein. An einem Verein, der Spieler wie Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Tony Adams hervorgebracht hat, führt einfach kein Weg vorbei. Arsenal gelang es als erstem englischen Team, Real Madrid im Bernabéu-Stadion zu bezwingen. Ohne Arsenal gäbe es den Strafraum-Halbkreis und den zweiten Schiedsrichter nicht. Arsène Wengers One-Touch-Fußball ist besser als Tiki-Taka. Wer sich in London einmal verloren fühlt, der schaut einfach auf die Tube Map und steigt dort aus, wo er hingehört, an der gleichnamigen Arsenal-Station. Arsenal ist nicht durch Scheich-Geld künstlich geschaffen. Arsenal ist Tradition pur. Hier trinkt der Richter neben dem Bauarbeiter sein Pint, hier lebt und leidet man mit, hier teilt man die Leidenschaft für den Verein mit royaler Prominenz, und zwar Queen Elizabeth persönlich. Arsenal gewinnt Meisterschaften auch einmal mit einer Tordifferenz von 0,099. EINIGE GRÜNDEWeil Arsenal eine Saison ungeschlagen blieb. Weil Arsenal eine gleichnamige U-Bahn-Station hat. Weil Thierry Henry Rekordtorschütze ist. Weil man 1989 mit genau zwei Toren Differenz gewann. Weil man den Heimrekord gegen Tottenham hält. Weil Arsène Wenger der beste Trainer der Welt ist. Weil Dennis Bergkamp ein Fußballgott ist. Weil Arsenal es schaffte, eine 4:0-Halbzeitführung zu verspielen. Weil die Away Boyz die coolste Pub-Band sind. Weil die Queen Arsenal-Fan ist. Weil es nirgends bessere Pubs gibt. Weil man bei Arsenal Burger im Vorgarten verkauft. Weil London die geilste Stadt der Welt ist. Weil man bei Arsenal auch an Weihnachten spielt. Weil man bei Arsenal die deutsche Revolution angestoßen hat. Weil Jens Lehmann den einen Elfmeter in Villarreal hielt. Weil Arsenal seine Legenden in Bronze gießt. Weil Arsenal auch mal 8:2 in Manchester verliert. Weil Arsenal als erstes englisches Team im Bernabéu-Stadion gewann. Weil Herbert Chapman den modernen Fußball prägte. Weil Arsenal einmal quer durch die Stadt umzog. Weil Highbury Kult ist. Weil Arsenal einmal Dial Square hieß. Weil man Arsenal auch in Vietnam schaut. Weil Arsenal einmal 5:1 bei Inter Mailand gewann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
Christian Mader
111 GRÜNDE, FC ARSENAL ZU LIEBEN
Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt
INHALT
WIR SIND DER ZWÖLFTE MANN,
FUSSBALL IST UNSERE LIEBE!
VORWORT
MIND THE GAP
Ich kann schon nicht mehr zählen, wie oft ich gefragt worden bin: »Warum Arsenal? Warum ein Verein aus England?« Fragen, die ich bisher nicht wirklich prägnant zu beantworten vermochte. Es gibt nicht den einen Grund, einen Verein wie den FC Arsenal zu lieben. Es gibt auch keine rationale Erklärung dafür, warum man am Samstagmorgen direkt nach dem Aufstehen schon nervös ist und nur noch auf eines, die drei Punkte, hofft. Klar kann man sagen: »Weil wir eine Saison ungeschlagen geblieben sind, die Queen Arsenal-Fan ist und Dennis Bergkamp der wahre Fußballgott ist.« Aber erfassen diese Antworten allein wirklich all das, was Arsenal so besonders macht? Wahrscheinlich nicht. Deshalb bin ich glücklich, dass dieses Buch mir nach Jahren gescheiterter Erklärungsansätze nun endlich die Möglichkeit gibt, in aller Ausführlichkeit auf diese so häufig gestellten Fragen zu antworten. 111 Einblicke in das seelische Innenleben eines positiv Fußballverrückten, der dem besten Verein der Welt verfallen ist.
Wenn ich mit meinem Vater aus der Arsenal tube station steige und den Weg über die Gillespie Road hin zum Stadion beschreite, ist das immer ein erhabenes Gefühl. Teil einer Gemeinschaft zu sein, die von derselben Sache angetrieben wird, gekleidet in das berühmte Red and White, die Kanone auf der Brust. Endlich normale Leute, pflege ich dann immer zu sagen. Man macht sich jedoch kaum Gedanken darüber, wie groß der Verein wirklich ist. Wie viel er für so viele Menschen auf der Welt bedeutet und wie er es immer wieder schafft, sie alle in einer Leidenschaft zu verbinden. Vieles davon ist in jeden einzelnen der 111 Gründe eingeflossen. Vieles hat sich mir in seiner Gesamtheit auch erst während des Schreibens erschlossen. Jeder Leser wird seine eigenen Erfahrungen und Geschichten mit diesem wundervollen Verein verbinden. Doch ich glaube, wiederfinden kann und wird sich in den 111 Gründen jeder an der einen oder anderen Stelle.
Arsenal ist mehr als nur Fußball. Es ist eben nicht nur ein Verein, es ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich die Kanone auf der Brust trage, gebe ich damit ein Statement ab, das über das letzte Ergebnis hinausgeht. Ich trage eine gewisse Philosophie nach außen, die diesen Verein seit über einem Jahrhundert prägt und so besonders macht. Eine Tatsache, über die man sich immer im Klaren sein muss.
Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger Sky-Abos und endloser Stunden puren Fußballkonsums. Das Resultat langer Diskussionen, warum auch dieses Spiel noch geguckt werden muss und ob man nicht etwas früher umschalten könne. Aber auch eines unerschöpflichen Verständnisses meiner Familie und Freunde dafür, dass ich den Kopf oft ganz woanders habe. Danke an meine Eltern, dass sie mir die Arsenal-Karten zahlten, als ich noch kein eigenes Geld verdiente, und mir auch heute noch das ein oder andere Pint im Pub spendieren. Danke an meinen Vater, der vor lauter Vorfreude den Check-in bei easyJet am liebsten selbst vornehmen würde, um endlich wieder in den Flieger nach London zu kommen. Danke an meine Verlobte Marion, die das alles jedes Wochenende (manchmal auch unter der Woche) so tapfer erträgt. Ohne euch wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Danke auch an Andreas, der durch die technische Unterstützung mit dem Blog dies alles erst entstehen ließ. Wer nach diesem Buch von Arsenal noch nicht genug hat, schaue einfach bei mir vorbei: germangunners.wordpress.com.
Nun aber hinein in 111 Mal Arsenal pur. Come on you Gunners!
Christian Mader
1. KAPITEL
VON DER FABRIK ZUR CHAMPIONS LEAGUE
1. GRUND
Weil Arsenal das beste Vereinsemblem hat
Vereinsembleme sind oft langweilig und nichtssagend. Aneinandergereihte Buchstaben ohne Aussage. Dabei liegt es doch so nahe, seine Herkunft im Vereinsemblem widerzuspiegeln und damit einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Unser Wappen, »The Arsenal Crest«, wie es im englischen Sprachgebrauch genannt wird, war schon immer durch ein Element geprägt: die Kanone. Auch wenn sich das crest über die Jahre den grafischen Gegebenheiten angepasst hat, ist sich Arsenal bei seiner Gestaltung immer treu geblieben. Dabei hatte man nicht gleich die Idee gehabt, überhaupt ein Emblem zu entwerfen.
Die Vermarktung eines Vereins war damals noch kein großes Thema und man benötigte nicht zwingend ein Wappen. Ohnehin befanden sich in den ersten 80 Jahren der Vereinsgeschichte auf den Trikots keine Embleme. Lediglich für Finalspiele beispielsweise des FA Cups wurden extra Aufnäher gefertigt. Die Selbstverständlichkeit, mit der Vereinswappen im modernen Fußball verwendet werden, gab es damals noch nicht. Erst im Jahre 1888, also zwei Jahre nach der Gründung von Arsenal, wurde das erste crest des Vereins eingeführt. Damals bediente man sich zunächst an dem Wappen des Stadtgebiets, welches damals noch Woolwich war, und den darin enthaltenen, länglich nebeneinander formierten drei Kanonen, die den Ursprung des Vereins wie den Nagel auf den Kopf trafen. Spöttische Stimmen (wahrscheinlich aus Tottenham) behaupten, sie hätten eher wie Schornsteine ausgesehen. Bei genauer Betrachtung wird man jedoch nicht umhinkönnen, sie als Kanonen zu erkennen.
Die Jahre vergingen und Arsenal entschied sich – aus wirtschaftlichen Gründen und weil keine geeignete Spielstätte ausfindig zu machen war –, in den Norden Londons zu ziehen, was bei den dortigen Nachbarn nicht gerade gut ankam. Wer möchte schon einen erfolgreichen Konkurrenten in direkter Nachbarschaft haben. Die Idee des Vereinswappens geriet über den Umzug aus der ursprünglichen Heimat und den andauernden Weltkrieg ein wenig in Vergessenheit. Erst im Jahre 1922 wurde das Wappen wieder zum Thema, als ein neues Design den Weg in die Stadionhefte fand. Das Motiv, so wie wir es heute auf den Trikots sehen, nahm zum ersten Mal seine grundsätzliche Ausrichtung, eine Kanone aus seitlicher Perspektive, an. Man munkelt, dass das Wappen des Royal-Arsenal-Torhauses als Vorlage für dieses bis heute aktuelle Design diente. Interessierte können gerne den Weg in den Süden Londons machen und selbst vergleichen.1 Die Ähnlichkeit ist schon frappierend. Wie gut, dass es damals noch keine Patentanwälte gab. Das wäre wohl ein gefundenes Fressen gewesen.
Es ist aber nicht nur die Kanone gewesen, welche das crest einzigartig machte. Es war ebenso der lateinische Zusatz »Victoria Concordia Crescit«, was so viel heißt wie »Erfolg durch Eintracht«. Da behaupte noch einmal jemand, Latein wäre eine tote Sprache. Da hat der Nachhilfeunterricht ja doch etwas für sich gehabt. Auch wenn der Zusatz das heutige crest nicht mehr schmückt, findet er sich doch als Aufdruck auf der Trikotinnenseite wieder. Das Emblem veränderte sich über die Jahre stets ein wenig, so ist die aktuelle Version erst seit 2002 in Gebrauch. Dies ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass der Verein seine Identität auch markenrechtlich schützen lassen wollte. Da das in der bis dato geltenden Fassung nicht möglich war, entwarf man ein Makeover.
Dieses basiert auf der markante Kanone, um welche herum das Wappen, bestehend aus den prägenden Vereinsfarben, gestaltet wurde. Anders als zuvor zeigt die jetzige Kanone jedoch nicht mehr nach Westen, sondern nach Osten. Um die Frage, welche Himmelsrichtung nun die richtige ist, zurückgehend auf das »erste« Kanonensymbol nach dem Vorbild des Stadtwappens von Woolwich, ranken sich viele Diskussionen. Mir persönlich ist es nicht wichtig, in welche Richtung die Kanone zeigt. Wichtig ist, dass sie der prägende Teil des Wappens ist und der Verein seine Tradition damit auch im modernen Design fortgeführt hat. Denn fragt man Menschen auf der ganzen Welt, was sie mit Arsenal verbinden, so werden sie immer als eine der ersten Antworten zurückgeben: »Eine Kanone.«
2. GRUND
Weil Arsenal nicht immer nur Arsenal war
Der Name eines Vereins, gleich welcher Sportart, ist sein Kapital, sein Erkennungszeichen nach außen. In Zeiten ausländischer Investoren geht man leider immer mehr dazu über, Firmennamen zu integrieren und mit langjährigen Traditionen zu brechen. Seien es diverse Red-Bull-Teams oder der drohende Zusatz »Tigers« bei Hull City oder die Frage, ob Cardiff City in Zukunft weiter blau oder doch lieber rot sein soll – die Identität eine Vereins ist immer enger gekoppelt an seine Investoren.
Aber auch in den Anfängen des FC Arsenal war man mit Namensänderungen nicht gerade sparsam. Selbstverständlich waren die Beweggründe damals andere. Einen Einblick in die Namensgebung sollten wir jedoch werfen, um die Entwicklung zu dem heute auf dem Trikot abgedruckten Namenszug nachvollziehen zu können.
Im Oktober 1886 wurde die Grundlage für den heutigen FC Arsenal gelegt. Nach der Gründung des Vereins blieb man jedoch kurze Zeit ratlos, was die Namensgebung betraf. Nach einem Fabrikbereich wurde man nur »Dial Square« genannt. Ein Name, der jedoch nicht der eigenen Wahl, sondern vielmehr der simplen Zuordnung zur Fabrik entsprang. Am Weihnachtsabend im Jahre 1886 fand man sich nach einem Spiel gegen die Eastern Wanderers im Royal Oak Pub nahe der Woolwich Station ein. Es war Zeit für einen richtigen, eigenen Namen. Einen Namen, den man sich selbst gab und der einem nicht aufgedrückt wurde. Was lag also näher, als die beiden prägenden Dinge im Leben eines englischen Fabrikarbeiters zu verbinden? Aus Arbeit und Bier wurde »Royal Arsenal«. Eine Verbindung des Pub-Namens und der Arbeitsstätte. Eigentlich praktisch, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt.
Die nächste Station auf dem Weg zur heutigen Namensgebung ist, zumindest was ihre zeitliche Verortung angeht, ein wenig strittig. Aus »Royal Arsenal« wurde »Woolwich Arsenal«. Man entledigte sich also des »Pub-Zusatzes« und stellte den unmissverständlichen Ortsbezug her. Wann genau das geschah, wird in der Arsenal-Historie heiß diskutiert. Manche gehen vom Jahre 1891 aus, als man zu einem professionellen Status wechselte.2 Anderer Ansicht sind einige sehr geschätzte Arsenal-Historiker, die die Namensänderung erst zwei Jahre später, sprich 1893, im Zuge einer Rechtsformänderung verorten.3 Wie man sehen kann, ist aus dem Verein so oder so etwas geworden, wir müssen diesen historischen Streit also hier nicht entscheiden und können uns stattdessen der nächsten Namensänderung zuwenden.
Im Jahre 1914 änderte man den Vereinsnamen nämlich erneut ein wenig ab. Weg vom Ortsbezug Woolwich hin zu »The Arsenal Football And Athletic Limited Company«. Im gleichen Jahr noch entledigte man sich des Athletic-Teils und wurde zu »The Arsenal Football Club Limited«.
Damit war man schon nah dran an dem Namen, den wir heute kennen. Im Jahre 1919 entledigte man sich dann schlussendlich des »The« und hieß fortan »Arsenal Football Club Limited«. Diese Namensgebung ist auch heute noch geläufig. Nur warum kein »The« mehr? Darum ranken sich natürlich auch diverse Mythen. Einer der wohl bekanntesten geht, wie so viele, auf den legendären Trainer Herbert Chapman zurück. Demnach soll es Chapman missfallen haben, dass der Verein nicht an oberster Stelle erschien, wenn die Tabellenergebnisse veröffentlicht wurden. Deshalb habe er den Artikel »The« gestrichen, sodass Arsenal in der alphabetischen Auflistung der Vereine ganz nach oben rückte. Klingt erst mal einleuchtend, ist historisch gesehen aber eher fragwürdig. Betrachtet man historische Spielprogramme, so wird man sehen, dass sich der Verein bereits vor dem ersten Ligaspiel unter Chapmans Ägide nicht mehr als »The« Arsenal bezeichnete.4
Ob es nun Herbert Chapman war, der die finale Namensänderung durchführte, oder ob das ein Mythos ist, der sich über die Jahrzehnte entwickelte, werden wir mit Sicherheit wohl nie sagen können. Fakt aber ist: Wenn der neue Spielplan samt Tabelle veröffentlicht wird, steht Arsenal stets auf Platz eins. Genau da also, wo der Verein auch hingehört.
3. GRUND
Weil Arsenal das berühmte Red and White trägt
Für viele Fans ist das Trikot der eigenen Mannschaft ein Erkennungszeichen. Etwas, was man mit Stolz trägt, womit man ein Statement abgibt. Man trägt es im Stadion, zu Hause oder beim Sport. Auch bei Arsenal ist das nicht anders. Das Trikot hat eine reiche Geschichte zu bieten und auch andere Mannschaften in ihrer Trikotwahl inspiriert. Einer neuen Studie zufolge spielen Mannschaften in roten Trikots erfolgreicher als jene in andersfarbigen. (Das würde zumindest den Erfolg von Bayern München erklären.)Wissenschaftler der englischen Universität Durham haben dies auf der Basis ausgewerteter Heimspiele feststellen wollen. Rot sei ein »vom Testosteron bestimmtes Signal für Männlichkeit«.5 Na dann ist ja schon alles gesagt, oder?
Als man sich bei Arsenal um das Jahr 1886 herum Gedanken über die Trikotfarbe machte, hatte man diesen Effekt wohl kaum im Hinterkopf. Es waren vielmehr praktische und wirtschaftliche Gründe, die zu der Trikotfarbe, wie wir sie heute kennen, führten. Arsenal stand kurz davor, ein professioneller Fußballverein zu werden, und konnte schon damals talentierte Spieler aus dem ganzen Königreich für sich gewinnen. Es waren Spieler von Nottingham Forest. Da Adidas, Nike und Co bei der Trikotherstellung noch ein wenig Vorlauf (von beinahe einem Jahrhundert) benötigten, war Eigeninitiative gefragt. Und wenn ein Teil der Mannschaft doch schon Trikots hat, warum sich dann nicht einfach an deren Farbgestaltung orientieren? Gesagt, getan! Die Trikots der ehemaligen Nottingham-Forest-Spieler hatten einen dunkelroten Farbton. Vergleichbar übrigens mit den heutigen Trikots von Sparta Prag. Ein Zufall? Keineswegs! Der damalige Präsident von Sparta Prag war bei einem Besuch in Nottingham im Jahre 1906 so begeistert von den Trikots der Mannschaft, dass er die Farbauswahl für seinen eigenen Verein übernahm. (Dies nur am Rande für alle, die beim nächsten Stammtisch mit neuem Wissen glänzen wollen.)
Das damalige Trikotdesign umfasste jedoch noch nicht die heute so bekannten weißen Ärmel und den weißen Kragen. Wo kamen die nun wieder her und wer hat sich das nur ausgedacht? Auch hierzu gibt es diverse mehr oder weniger glaubhafte Geschichten. Sicher ist, dass es wieder einmal Herbert Chapman war, der den Anstoß zum legendären Design gab. Der einflussreiche Trainer, der so viel veränderte, nahm sich auch des Trikotdesigns an. Der am weitesten verbreiteten Überlieferung zufolge wurde Chapman durch das Outfit eines Arsenal-Fans inspiriert, der unter seinem roten Sweater ein weißes T-Shirt trug. Andere behaupten, er hätte sich zu viel auf dem Golfplatz umgesehen und sich das Design dort abgeschaut. Wie auch immer Chapman auf die Idee gekommen ist, im Jahre 1925 wurde sie zum ersten Mal umgesetzt. Arsenal trägt seitdem rote Trikots mit weißen Ärmeln. Zudem verabschiedete man sich damals von dem dunklen Rotton – zugunsten des heute bekannten hellen, aggressiveren Rots.
4. GRUND
Weil »Good old Arsenal« das beste Stadionlied ist
Das Schöne an einem Stadionbesuch am Wochenende ist ja bekanntlich neben dem Spiel an sich auch immer die Atmosphäre. Und wer sich in den Stadien dieser Welt schon ein wenig herumgetrieben hat, der wird wissen, dass jeder Verein gewisse Lieder bevorzugt, die den perfekten Rahmen schaffen sollen. Das viel zitierte Wir-Gefühl soll gestärkt werden.
In Barcelona ist es der Cant del Barça, der die heißblütigen Spanier noch mehr in Wallung bringt. Liverpool hat sein You Never Walk Alone, das in Deutschland ja gerne von sämtlichen Vereinen adaptiert wird. Übrigens ein absolutes No-Go in England. Beim BVB ist es das klassische Heja BVB und beim FC Schalke einfach nur Blau und Weiß, wie lieb ich dich. Wenn die Teams auf das Feld kommen, dann gibt das zumeist den letzten Kick.
Natürlich gibt es auch bei einem so traditionsreichen Verein wie dem FC Arsenal ein passendes Pendant. Stimmt man Good Old Arsenal an, fällt jeder in den Gesang ein. Good Old Arsenal ist eines der klassischen Fußballlieder, wie man sie früher kannte. Heute werden solche Lieder kaum noch hervorgebracht. Zur Melodie von Thomas Augustine Arnes Rule, Britannia! schmettert man: »Good old Arsenal, we’re proud to say that name. And while we sing this song, we’ll win the game.« In der nicht gerade melodischen deutschen Sprache würde man diese Zeilen mit den Worten »Gutes altes Arsenal, wir sind stolz, deinen Namen zu rufen, und während wir singen, gewinnen wir das Spiel« übersetzen.
Zugegeben, der Text ist nicht gerade abendfüllend, deshalb hat man sich bei Arsenal immer wieder darangemacht, das musikalische Programm etwas zu erweitern. Eine Zeit lang versuchte man es mit dem King persönlich. Ja genau: Elvis in the house. Mit The Wonder of You stieß man jedoch nicht auf wirklichen Zuspruch bei den Fans, die das Lied zwar vom Text her ganz ansprechend fanden, sich aber mit der langsamen melodischen Restkonzeption nicht so richtig anfreunden konnten. Nach ein paar Spielzeiten verschwand der Klassiker und Elvis had left the Emirates.
Norman Cook aka Fatboy Slim hingegen hat sich mit seinem Song Right Here, Right Now in Sachen Anheizen sehr hervorgetan. In Highbury war der Track über Jahre das Lied kurz vor dem Anpfiff und auch im Emirates-Stadion kommt man um den einprägsamen Text nicht oft herum. Wenn die Spieler den Tunnel verlassen, bringt Cooks raviger Big Beat die Stimmung zum Überkochen.
Besonders passend finde ich jedoch den Klassiker, der seit Neustem im Emirates-Stadion vor Anpfiff erschallt. London Calling von The Clash ist einer Mannschaft aus London buchstäblich auf den Leib geschneidert. Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen von Arsenal und haben das Lied wieder zurück in die »Spielvorbereitung« genommen. Bei dem Beat kann dann wirklich keiner mehr still sitzen.
5. GRUND
Weil Arsenal die Rückennummern einführte
Dass Arsenal ein ganz besonderer Verein ist, ist dem ein oder anderen Leser bestimmt nicht entgangen. Dass Arsenal neben den vielen Erfolgen und grandiosen Spielern aber auch mehr ist, kann man an den Innovationen sehen, die ein gewisser Herr Herbert Chapman vorangetrieben hat. Er führte das Flutlicht in Stadien ein und benannte die tube station Gillespie Road in Arsenal Station um. Doch eines darf nicht vergessen werden, wenn man über den Einfluss von Arsenal auf den modernen Fußball spricht: die Rückennummern auf den Trikots der Spieler.
Trikotnummern wie Henrys Nummer 14 oder Bergkamps Nummer 10 wären wohl kaum zum Kassenschlager geworden, hätte es die Chapman-Ära nicht gegeben. Früher, sprich vor dem Jahre 1928, war es nicht vorgesehen, dass die Spieler Nummern auf den Trikots trugen. Hauptsächlich stand das im Zusammenhang damit, dass man überhaupt erst mal elf gleichfarbige Trikots auftreiben musste. Es war nicht möglich, einfach so einen Satz Trikots von Nike und Co zu ordern, wie es heute der Fall ist.
So war es ein absolutes Novum in der Fußballgeschichte, als Arsenal am 25. August 1928 im Spiel gegen Sheffield Wednesday mit durchnummerierten Trikots auflief. Zu einem Sieg reichte es deshalb zwar nicht, aber so etwas hatte es es zuvor nicht gegeben, Arsenal war mal wieder dabei, Fußballgeschichte zu schreiben. Die Idee hinter den nummerierten Trikots war simpel. Herbert Chapman war einer der ersten Trainer, die von einer Taktiktafel Gebrauch machten. Seine WM-Formation prägte das Spiel der nächsten Jahre. So war es wichtig, dass die Spieler sich auf dem Feld orientieren und besser einschätzen konnten, wo ihr »taktischer« Platz war. Die Rückennummern halfen dabei natürlich enorm, zumal es damals keine freie Nummernwahl gab, sondern eine Beschränkung auf die Nummern 1 bis 11, wobei jeder Nummer eine feste Funktion zugeordnet war. Die Nummer 10 zum Beispiel stand für den Spielmacher, die Nummer 4 für den Innenverteidiger. Man munkelt übrigens, auch Chelsea sei an diesem Spieltag mit Nummern aufgelaufen.6 Im Unterschied zu Arsenal – und zur heutigen Konvention – soll aber der Torwart keine Nummer getragen haben.
Wie dem auch sein, der Fußballverband war von den Rückennummern überhaupt nicht angetan und untersagte ihre Verwendung. Eine wirkliche Begründung dafür ist nicht überliefert. Wahrscheinlich gab es schon damals verbandsinterne Machtkämpfe und irgendeinem einflussreichen Mitglied passte die Idee nicht.
Es sollte bis zum 4. Dezember 1933 dauern, bis Arsenal erneut einen Versuch startete. In einem Testspiel gegen den FC Wien in Highbury trug man erneut die untersagten Rückennummern. Auch durch das neuerliche Experiment ließ sich der Verband nicht überzeugen. Vielmehr ließ er sich noch bis ins Jahr 1939 bitten, bevor er der Verwendung von Rückennummern endgültig zustimmte. Die Nummernvergabe 1 bis 11 für beide Teams war nun auch offiziell geboren. Zunächst hatte man alternativ angedacht, ein Team mit den Nummern 1 bis 11 und das andere mit den Nummern 12 bis 22 auszustatten. Gut, dass es dazu nicht gekommen ist, denn das hätte doch für arge Verwirrung gesorgt.
Am 30. August 1939 absolvierte Arsenal nun auch offiziell sein erstes Heimspiel mit Rückennummern auf den Trikots.7 Aufgrund des Krieges wurde der Siegeszug der Rückennummern für ein paar weitere Jahre ausgebremst. Nach Kriegsende konnte jedoch jedes Team Rückennummern verwenden. In den 90er-Jahren ging man dann schließlich auf die freie Nummernwahl über und führte zudem den Spielernamen auf dem Trikot ein.
Wenn ihr euch also demnächst nicht für eine Rückennummer entscheiden könnt, denkt daran, dass es ohne Arsenal vielleicht überhaupt keine Rückennummern gäbe.
6. GRUND
Weil Arsenal einmal quer durch die Stadt zog
Arsenal und der Londoner Stadtteil Islington sind untrennbar miteinander verbunden. Aber das war nicht immer so. Der Verein wurde nämlich nicht im Norden Londons gegründet, sondern ganz tief im Süden, in Woolwich. Wie und, viel entscheidender, weshalb kam es also zum Umzug quer durch die Stadt in die heutige Heimat Islington? Werfen wir einen kurzen Blick zurück. Schlappe 100 Jahre zurück in etwa. Die Erinnerung sollte also noch taufrisch sein.
Im Oktober 1886 beschloss eine Gruppe von Arbeitern der Woolwich Arsenal Armament Factory, ihrem Hobby zu frönen und eine Fußballmannschaft zu gründen. Ein Schritt, der mit Blick auf die Gegenwart eine einschneidende Bedeutung für die Fußballwelt haben sollte. Damals hieß man noch Dial Square, aber über die diversen Namensgebungen seid ihr ja bereits im Bilde.
Nachdem sich das Vorhaben der Arsenal-Arbeiter, einen Fußballverein zu gründen, herumgesprochen hatte, meldeten auch Spieler des ein paar Jahre zuvor gegründeten Vereins Nottingham Forest Interesse an, an dem neuen Projekt in der Hauptstadt teilzunehmen, man warf das nötige Geld zusammen, um den ersten Fußball zu kaufen. Wenn also von den berühmten Sixpence die Rede ist, dann spricht der Arsenal-Fan von der unmittelbaren Gründung seines Vereins.
Die Zeit verging, man spielte nicht ohne Erfolg in diversen Wettbewerben und residierte in verschiedenen mehr oder weniger geeigneten Spielstätten, zum Beispiel Invicta Ground und Manor Ground. So richtig glücklich war man aber mit keiner von ihnen. Finanziell war es um Arsenal damals nicht gerade gut bestellt. Die Verkehrsanbindung in Woolwich war schlecht, die Arbeitslosenzahlen in der Region stiegen und die Zuschauerzahlen ließen zu wünschen übrig (im Schnitt unter 10.000 pro Spiel). Angesichts dieser Umstände wurde es notwendig zu handeln.
Der damalige Präsident des FC Fulham, Sir Henry Norris, nahm sich Arsenals an. Sein ursprünglicher Plan war, die beiden Vereine zusammenzuführen. Wer den langen Weg zum Fulham-Stadion Craven Cottage kennt, der wird drei Kreuze machen, dass der Fußballbund diesen Plan durchkreuzte, indem er Veto einlegte. Eine altertümliche Kartellbehörde eben. So musste sich Norris also zwischen Fulham und Arsenal entscheiden und tat dies in weiser Voraussicht zugunsten von Arsenal.
Norris erkannte gleich, dass eine Veränderung hermusste. Sein erklärtes Ziel war es, den Verein umzusiedeln. Nachdem er sich unter anderem in Battersea (wo Chelsea heute gerne sein neues Stadion errichten möchte) umgeschaut hatte, stieß er auf den heute berühmten Sportplatz in Highbury. Die Anbindung an die tube (die Station hieß damals noch Gillespie Road) war perfekt.
Doch so einfach, wie es klingt, war es dann doch nicht. Auch nicht für einen Mann wie Norris. Das Areal, auf dem er das Stadion bauen wollte, befand sich in einem Wohngebiet und gehörte zum Teil der Kirche, die gern verhindert hätte, dass sich dort ein Fußballverein ansiedelte. Aber Norris wäre nicht Norris gewesen, wenn er nicht auch dieses Hindernis galant umschifft hätte. Sein Erfolg gründete jedoch nicht nur auf Verhandlungstaktik, sondern in erster Linie auf einem Vorfall, der sich ein paar Jahre zuvor ereignet hatte. Norris war nämlich auch Bürgermeister von Fulham. Im September 1909 hatte der Londoner Rat der Mineralölgesellschaft BP eine Genehmigung erteilt, in Fulham Öltanks zu errichten, und zwar auf dem Gelände der Kirche, die gerne bereit war, ihre Ländereien zu Geld zu machen.
Da sich der geplante Bauplatz aber in einem Wohngebiet befand, war die Aufregung groß, als die lokale Presse von dem Vorhaben Wind bekam. Es wurde die Frage gestellt, warum der Bürgermeister (zur Erinnerung: Herr Norris) nicht eingegriffen habe. Aus Angst, sein Amt zu verlieren, quatschte Norris die Kirche förmlich aus dem Verkauf des Landes heraus. Gegen ein paar kostenlose Renovierungsarbeiten von Norris’ Baufirma an der Residenz des Bischofs von London, versteht sich.8
Als es nun um den Highbury-Deal ging, konnte Norris die alte Geschichte wieder hervorkramen und bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass er damals auch das Ansehen der Kirche geschützt hatte. Wie gut, wenn man noch ein Ass im Ärmel hat. Der Weg war frei und Arsenal konnte umsiedeln. Eine neue Heimat und eine neue Ära waren geboren. Und das Ganze auf der anderen Seite Londons.
7. GRUND
Weil Arsenal von Umzügen nicht genug bekommt
Jeder, der privat schon einmal einen Umzug organisiert hat, weiß, dass es schönere Dinge gibt, seine Freizeit zu verbringen. Hat man es einmal geschafft, möchte man es so schnell nicht erneut machen müssen. Arsenal war es aus seiner Gründungszeit bereits gewohnt, nach geeigneten Stadien beziehungsweise früher noch Sportplätzen zu suchen. In der Woolwich-Umgebung war man bekanntlich nicht fündig geworden, sodass es 1913 in die jetzige Heimat, den Norden von London, ging. Das Kapitel Highbury war dabei ein durchaus bewegendes und erfolgreiches, gespeist von Titeln – inklusive einer Saison ohne Niederlage – und verbunden mit Legenden wie Henry oder Adams. Aber Arsenal wäre nicht Arsenal, wenn man es nicht ein weiteres Mal vollbracht hätte, in ein neues Stadion umzuziehen. Um die Umzugskartons nicht so weit schleppen zu müssen, zog man dieses Mal nicht quer durch London, sondern nur wenige Meter die Straße runter auf ein leer stehendes Gelände namens Ashburton Grove, heute bekannt als Emirates-Stadion.
Der Entschluss zum Umzug nach Ashburton Grove und zur damit einhergehenden Beendigung einer 93 Jahre alten Tradition in Highbury wurde bereits im November 1999 gefasst. Bekanntlich ist ein solches Projekt nicht von heute auf morgen zu planen oder gar zu verwirklichen. Folglich konnte mit den Arbeiten erst im Februar 2004 begonnen werden. Das erste Spiel im neuen Stadion fand am 22. Mai 2006 statt. Und womit hätte es besser eingeweiht werden können als mit dem Abschiedsspiel für Dennis Bergkamp?
Mit Arsenals FA-Cup-Sieg 2014 ist das Emirates-Stadion nun auch Kulisse eines Titelgewinns geworden. Theorien bezüglich eines Titelfluchs, der seit dem Umzug auf dem Verein laste, dürften hiermit wohl endlich begraben sein. Trotz des modernen Stadions und der damit verbundenen Annehmlichkeiten war es nämlich nicht für alle Arsenal-Fans Liebe auf den ersten Blick. Man musste sich erst mal herantasten, sich aneinander gewöhnen.
Doch ließen sich auch die Zweifler am Projekt Emirates-Stadion schnell überzeugen. Arsenal hatte nicht aus dem hohlen Bauch heraus den Entschluss gefasst, Highbury zu verlassen. Es waren bei genauer Betrachtung vielmehr die identischen Motive, die Henry Norris 1913 zum Bau eines neuen Stadions in Highbury bewogen hatten. Kurz nach Arsenals Gründungszeit war es darum gegangen, den Verein bekannt zu machen, ihm eine breite Fanbasis zu verschaffen und die Anbindung für die Fans so leicht wie möglich zu gestalten. Sämtliche Voraussetzungen haben Nord-London und Highbury ohne Einschränkung erfüllt.
Beinahe ein Jahrhundert später ging es nun erneut darum, den nächsten Schritt machen. Um in Europa mit den großen Vereinen mithalten zu können, war es notwendig, mehr Einnahmen zu generieren. Es musste mehr Fans die Gelegenheit gegeben werden, ihren Verein spielen zu sehen. Ein neues Stadion mit der zweitgrößten Kapazität in England bot dies alles. Man war plötzlich, auch was die Spielstätte angeht, auf einem Level mit Real Madrid, dem FC Barcelona und dem AC Mailand. Eine neue Heimat war geschaffen.
Gehe ich heute ins Emirates-Stadion, werfe ich zwar noch immer einen Blick hinüber zur alten Liebe Highbury. Doch warm geworden bin ich mit der neuen Heimat schon lange.
2. KAPITEL
EIN ARSENAL AN WELTKLASSE-SPIELERN UND -TRAINERN
8. GRUND
Weil Herbert Chapman bei Arsenal Trainer war
In der heutigen schnelllebigen Fußballwelt gibt es viele Trainer. Sie kommen und gehen, manchmal sogar mehrfach in einer Saison. Bis auf ein paar Ausnahmen sind sie austauschbar und zumeist nur eine Marionette der Vereinsführung. Als der Fußball noch Fußball und kein Geschäft war, war das anders. Die meisten Leser, mich eingeschlossen, werden einen der Innovatoren der Fußballgeschichte, Herrn Herbert Chapman, sicher nur aus Erzählungen kennen. Aber die Errungenschaften, die wir diesem charismatischen Trainer zu verdanken haben, sind bahnbrechend.
In der Saison 1925 (ja, so lange ist das schon her) wurde Herbert Chapman als neuer Arsenal-Trainer verpflichtet. Im Gepäck hatte er Erfolge mit Huddersfield Town und die Idee, den FC Arsenal vollständig umzukrempeln. Immer ein schweres Unterfangen, alte Strukturen aufzubrechen, aber Chapman war ein Mann der Tat. In seiner ersten Saison führte er Arsenal in das FA-Cup-Viertelfinale und bescherte dem Verein mit dem zweiten Tabellenplatz seine bis dato höchste Platzierung im Profifußball. Kurz darauf folgte ein FA-Cup-Finale gegen Cardiff City, welches leider verloren ging. Drei Jahre später stand man erneut im Finale, und diesmal fand der Wettbewerb mit einem Triumph in Wembley ein gutes Ende. Meisterschaften folgten und aus der grauen Maus Arsenal war eine erfolgreiche und ambitionierte Mannschaft geworden.
Aber was war es, was Herbert Chapman so erfolgreich machte? Wie so häufig im Fußball war es die Formation, die Chapman gewählt hatte. Er führte die sogenannte WM-Formation ein. Wer jetzt an die vierjährlichen Turniere denkt, ist jedoch auf dem falschen Dampfer. Das WM spiegelt vielmehr die von Chapman gewählte 3-2-2-3-Formation grafisch wider. Wenn ihr den Begriff mal googelt, werdet ihr sehen, was ich meine. Sie war innovativ und stellte eine Herausforderung dar, welcher die meisten Mannschaften der damaligen Zeit nicht gewachsen waren. Für die junge Generation unter den Lesern kann man den Einfluss dieser Formation vielleicht am ehesten mit dem heutigen Tiki-Taka-Fußball der spanischen Nationalmannschaft vergleichen. Obwohl dieser Vergleich sicher der Innovationsstufe des Herbert Chapman nicht im Ansatz gerecht wird.
Chapman war jedoch nicht nur in seinem ursprünglichen Ressort als Fußballtrainer aktiv. Es war Herbert Chapman, der den ersten Anstoß für die Einführung des Elfmeterhalbkreises, eines zweiten Schiedsrichters, von Linienrichtern und Flutlichtern gab. Zudem ließ er eine Stadionsprechanlage sowie eine Anzeigetafel im Stadion installieren.9 Für heutige Fußballfans eine Selbstverständlichkeit. Damals eine Errungenschaft. Natürlich war es auch Chapmans Verdienst, dass Arsenal heute der einzige Verein in London ist, nach dem eine eigene tube station benannt ist. Ach ja, das berühmte Clock End und die berühmten Arsenal-Trikots sind auch auf Herbert Chapman zurückzuführen. Dazu jedoch an anderer Stelle mehr.
Leider war es Herbert Chapman nicht vergönnt, seine Neuerungen auch über die weiteren Jahre zu begleiten. Nachdem er sich ein Spiel der dritten Mannschaft angeschaut hatte, erlitt er eine schwere Erkältung, die sich im weiteren Verlauf zu einer schweren Lungenentzündung ausweitete. Herbert Chapman starb im Jahr 1934 im Alter von nur 55 Jahren. Seine beinahe zehn Jahre im Verein waren jedoch genug, um die Grundlage für das Arsenal zu schaffen, das wir heute kennen. Und wenn ihr demnächst am alten Highbury-Stadion vorbeigeht oder die Herbert-Chapman-Statue vor dem Emirates-Stadion passiert, widmet ihm einen kurzen Gedanken. Er hat das ermöglicht, was Arsenal heute ist. Ein fortschrittlich denkender Verein.
9. GRUND
Weil Arsène Wenger der beste Trainer der Welt ist
Als der Franzose im September 1996 das Zepter in Nord-London übernahm, fragten sich nicht nur die Fans, wen Arsenal dort wohl verpflichtet hatte. »Arsène who?« war schneller in aller Munde als die beans auf dem Frühstücksteller der Engländer. Aber wer war dieser Mann, der mit seiner Professoren-Brille so gebildet rüberkam? Arsène Wenger hatte eine relativ unspektakuläre Spielerkarriere hinter sich und war nicht gerade das, was man einen europaweit bekannten Trainer nennen würde. Mit seinen Stationen in Monaco und später in Japan hatte er sich jedoch zumindest in kleinem Kreis bereits einen Namen gemacht. Auf der Insel war diese Info jedoch noch lange nicht angekommen, sodass sich Fans und Journaille ihm nur mit großer Skepsis annäherten. Arsène Wenger verkörperte einen neuen, einen anderen Trainertypus, wie er bisher in England nicht Usus gewesen war. Es ging schon lange nicht mehr um Kick and Rush. Die feine Klinge war nun angesagt. Ausgefeilte Taktik, immer ein Ass im Ärmel, eben der sogenannte magic hat, das war es, womit Wenger immer wieder zuschlug.
All die, die Arsène Wenger nach seiner Verpflichtung mit Argwohn beobachtet hatten, mussten schnell feststellen, dass sie zu früh geurteilt hatten. Bereits in seiner ersten vollständigen Saison als Trainer (1997/98) gelang es ihm, das Double nach Nord-London zu holen. Ein Erfolg, den es zuvor längere Zeit nicht mehr gegeben hatte. Wenger hatte seine Kritiker bereits in seiner ersten Saison als Trainer Lügen gestraft. Eine Tatsache, die nicht nur ihm, sondern auch der Vereinsführung Genugtuung verschaffte. Das risikobehaftete Projekt Arsène Wenger war von Erfolg gekrönt. Weitere Highlights wie das Double in der Saison 2001/02, eine Saison ohne einzige Niederlage, ein Champions-League-Finale und weitere FA-Cup-Triumphe folgten.
Wenn man Fans und Wegbegleiter Wengers über seine Triumphe befragt, so bekommt man sehr oft zu hören, dass Wenger für Arsenal mehr sei als nur ein Trainer, den man an Titeln messen kann oder soll. Arsène Wenger verköpert die Arsenal-Philosophie. Er steht für eine stringente Vereinsführung auf der Grundlage von moralischen Werten. Er steht für eine wirtschaftliche Führung des Vereins, die nicht mit verschwenderischen Transfersummen um sich wirft. Sicherlich hat ihm dies über die titellosen Jahre oft Kritik eingebracht. Dass es der richtige Weg war und ist, wird man jedoch nicht abstreiten können. Dass Wenger eine Leitfigur des Vereins ist, zeigte sich auch während der Umsiedelung von Highbury ins heutige Emirates-Stadion. Wenger reichte es nicht, in der Phase nur Trainer zu sein. Der Umzug war, getreu dem Motto einer bekannten Baumarktkette, auch sein Projekt. Er hatte sich mit der Vereinsführung unter der Prämisse finanzieller und somit sportlicher Einschränkungen gezielt für dieses Projekt entschieden und stark gemacht. Was er daraus machte, ist nicht hoch genug zu bewerten. Er schaffte es, den Verein konstant in der Champions League zu halten und damit wichtige Einnahmen zu sichern. Das alles mit limitierten Transferressourcen und einer aufstrebenden und gesponserten Konkurrenz aus Chelsea und Manchester.
Diese Fähigkeit spiegelte sich über die Jahre nur allzu oft in seinem Blick für junge Talente wider. Viele heute bekannte Spieler verdanken ihren Weg in die Stadien dieser Welt einem Mann, Arsène Wenger. Sei es ein Anelka, ein Henry, ein Bergkamp, ein Fàbregas oder ein Vieira. Hört man die vielen Spieler, die unter Arsène Wenger gespielt haben, heute über ihren ehemaligen Trainer reden, so fällt auf, dass Arsène Wenger mehr für sie war als nur ein Trainer. Das Wort »Vaterfigur« fällt in diesem Zusammenhang sehr häufig. Und ich denke, Wenger selbst hat den Anspruch an sich, seine Spieler zu führen und ihnen den Weg auf und abseits des Spielfeldes zu weisen. Er wird sich dabei immer vor seine Spieler stellen. Sei es nach einer Niederlage oder nach Verfehlungen neben dem Platz. Wie ein Vater eben.
Unerwähnt dürfen an dieser Stelle natürlich auch nicht Wengers langjährige Scharmützel mit Trainerkollege Alex Ferguson bleiben. Eine Rivalität zweier Urgesteine, die durch hohen Respekt und langjährige Eiszeit geprägt war. Highlight dieser Saga war sicherlich das legendäre »Battle of the Buffet« 2004. Nach dem Spiel im Old Trafford, welches Arsenals Serie von 49 Spielen ohne Niederlage beendet hatte, kam es während einer hitzigen Diskussion beider Trainer im Kabinengang zu einem angeblichen Pizzawurf ins Gesicht des United-Trainers. Auch nach Veröffentlichung von Fergusons Autobiografie konnte kein Licht ins Dunkel gebracht werden, wer den ersten Stein, äähhh, die erste Pizza, geworfen hatte.10
Im März 2014 absolvierte Arsène Wenger sein 1.000. Spiel als Trainer des FC Arsenal Leider fiel die anschließende Party nach einem 0:6 gegen Chelsea ins Wasser. Aber das ist ein anderes Thema. Arsène Wenger beendete seine Jubiläumssaison dafür mit dem Gewinn des FA Cups im Mai und krönte den Sieg mit der Unterschrift unter einen neuen Vertrag mit dem Verein.
10. GRUND
Weil George Graham Arsenal Leben einhauchte
Für die »etwas jüngere« Generation der Arsenal-Fans (mich eingeschlossen) hat es auf der Trainerbank von Arsenal keinen anderen Trainer als Arsène Wenger gegeben. Sicherlich ist Wenger einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Trainer, die wir bei Arsenal jemals hatten. Kurz dahinter rangiert jedoch bereits der Mann, der Arsenal nach langer Durststrecke wieder in die Erfolgsspur zurückgeführt hatte, George Graham. Betrachtet man die Statistik, so findet man den Schotten sogar auf Platz zwei der meistgewonnenen Titel (darunterallein sechs major trophies, wie man auf Englisch so schön sagt) hinter besagtem Arsène Wenger.11
Graham war bei Arsenal kein Unbekannter, als er das Traineramt im Mai 1986 von Don Howe übernahm. Eigentlich hatte man damals, zumindest in der Presse, einen anderen Schotten im Blick gehabt. Viele hatten mit einer Verpflichtung von Sir Alex Ferguson gerechnet, der damals bei Aberdeen und der schottischen Nationalmannschaft sehr erfolgreich war. Bei Arsenal entschied man sich jedoch für den beim FC Millwall emporschreitenden Graham.
Und warum war der neue Trainer kein Unbekannter? Ganz einfach: Er war bereits als Spieler beim Verein und Mitglied der Mannschaft, die in der Saison 1970/71 das Double gewonnen hatte. Sei es Zufall oder Vorsehung, genau dieser Titel, der bereits 15 Jahre zurücklag, war der letzte Ligagewinn gewesen, den Arsenal verzeichnen konnte. Graham trat also in einer Phase ein, die nicht gerade von Erfolgserlebnissen geprägt war.