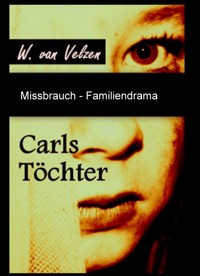1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
13 Tödliche Flügelschläge
1- Gefangen - Eine Frau wird in eine Zelle gesperrt. Um sie herum, die absolute Dunkelheit.
2- Verschwunden - Ein altes Kino, eine Filmrolle ohne Titel.
3- Nika, die Stalkerin - Eine Lehrerin verliebt sich, sie verfolgt den Mann, dringt in sein Haus ein.
4- Die Aktentasche - Wenn Liebe blind macht und das Geld lockt.
5- Nebel - Marina läuft nachts im Nebel durch den Park, die Angst ist bei ihr.
6- Bronzefiguren - Ein verrückter Millionär hat eine Vision, die er mörderisch umsetzt.
7- Absinth - Die grüne Fee hat dich im Griff. Was ist Wirklichkeit, was nicht?
8- Der Jadekiller - Ein Mörder ritzt seinen Opfern eine Rune in die Haut.
9- Damals - Brief an meine Tochter
10- Kendra - Karneval in Venedig. Die Vampirin hat ihr Opfer bereits gewählt.
11- Reise ohne Wiederkehr - Sie fliegt nach Paris, will einen Job annehmen und stirbt.
12- Codex Gigas - Die Teufelsbibel. War der Teufel mit dem Mönch in einer Zelle? Schrieben sie gemeinsam das Buch?
13- Malan, der Nachtmahr - Malan stiehlt das Leben und die Seele der Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
13 Tödliche Flügelschläge
Kurzgeschichten Thriller & Fantsy
Für meine Leser/innenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRechte
Impressum
Texte: © Copyright Wine van Velzen Umschlag: © Copyright Nico Kay / Pixabay
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch Übersetzungsrechte, vorbehalten.
Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mithilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt.
März 2018
Impressum:
Text und Layout: ©
Korrektur:
Lektorat:
Bildvorlage:
Covergestaltung: ©
van Velzen
Duden Korrektor
Weberwww.pixabay.de
Nico Kay
Gefangen
Gefangen
Ich saß in einer Zelle, in der ich seit Tagen, oder waren es nur Stunden, gefangen gehalten wurde. Ich fror erbärmlich. Es war eiskalt und feucht, ich zitterte und hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Mühsam setzte ich mich auf der stinkenden Federkernmatratze auf. Mein Kopf tat mir weh, der Nacken und der Rücken ebenso. Mein Entführer hatte mir dreimal Essen und Wasser gebracht. Jedes Mal habe ich mit dem Fingernagel eine Kerbe in die feuchte Mauer gekratzt. Am Kopfende der alten Matratze waren noch andere Einkerbungen, die ich beim Abtasten gespürt habe. Ich legte meine Hand darauf, fuhr mit den Fingerspitzen darüber, doch in der ewigwährenden Dunkelheit konnte ich nicht feststellen, was sie bedeuten. Wann war das? Wann habe ich die Mauern abgetastet? Heute? Gestern? Vor einer Woche? Ich wusste es nicht. Meine Hände und Finger wurden zu meinen Augen.
-
Ich hörte ihn kommen. Seine Schritte hallten in dem schwarzen Gang laut und drohend. Das Licht der Taschenlampe zuckte über die Mauern, wurde größer. Ich presste mein Gesicht gegen die Gitterstäbe, versuchte, mehr zu erkennen. Er kam näher, hinter dem Licht nur die rabenschwarze Finsternis.
Ohne ein Wort zu sagen, leuchtete er mir in die Augen. Das Licht stach, schmerzte, die Pupillen zogen sich zusammen. Mein Entführer griff nach meinem Arm, schupste mich grob von den Gitterstäben weg. Ich ging rückwärts, bis ich die Wand hinter mir spürte. Er brachte Essen. Auf dem Pappteller lag immer dasselbe. Ein Stück trockenes Brot, Käse und ein runzeliger Apfel. Zwei große Plastikflaschen mit Wasser warf er stumm durch die Zellenstäbe und sie rollten in die Dunkelheit. Er bückte sich hinunter, legte den Teller in der Zelle auf den Betonboden und verließ mich wortlos wieder.
Sobald seine Schritte verhalten, begann ich mit der Suche. Verzweifelt kroch ich im Dunkeln auf dem kalten Steinboden umher. Meine Finger tasteten sich zitternd und suchend vorwärts. Meine gepflegten, manikürten Fingernägel schon längst abgebrochen, hatten Risse und die Fingerspitzen waren aufgescheuert und blutig. Wo ist das Wasser? Hektisch suchte ich in der Dunkelheit den Boden ab. Wo lagen die Flaschen? Wie von Sinnen kroch ich in der Finsternis umher, tastete den rauen Boden ab. Dann, endlich, fand ich eine von ihnen. Ich berührte mit der Spitze des Zeigefingers, den Verschluss. Fest umgriff ich das Plastik. Erleichtert setzte ich mich auf den kalten Boden und trank gierig das lauwarme Wasser. Das Zittern ließ nach, Wärme breitete sich in meinem Magen aus.
-
Krampfhaft hielt ich die Flasche an mich gepresst und versuchte mich zu orientieren. Wo genau, in meinem Gefängnis, befand ich mich? Auf welcher Seite war die Matratze, wo die Zellentür? Denn dort stand mein Essen! Ich musste es vor der Ratte finden. Das Essen unter meinen Pullover verstecken, sonst wäre der Käse weg, das Brot angeknabbert und nass vom Speichel des Tieres und der Apfel angefressen oder nicht mehr auffindbar. Diese Ratte war schlau. Sehr schlau. Sie schaffte alles hinaus in den finsteren Gang. Irgendwo dort hatte sie ihr Lager und bunkerte die Speisen. Mein Essen! Diesmal nicht! Ich würde den Pappteller finden, bevor sie es stehlen konnte. Meine Arme ausgestreckt, die Hände tastend und suchend, rutschte ich auf dem Hintern umher, in der Hoffnung auf eine Mauer zu stoßen. Ich stand auf. Blind ging ich zaghaft einige Schritte, drehte mich um, ging langsam weiter. Ich stieß mit der Schulter an die feuchte Mauer. Erleichtert fuhren meine Hände an ihr entlang. Ich spürte die Nässe und Kälte, doch auf welcher Seite in meiner Zelle ich mich befand, wusste ich nicht. Auf den Knien kroch ich an der Wand entlang. Spitze Steinchen stachen durch den verdreckten Jeansstoff. Ich spürte jede einzelne Verletzung, die mein Entführer mir zugefügt hatte. Zweimal kam er in die Zelle und prügelte mit seinen Fäusten auf meinen geschwächten Körper ein. Büschel von langen blonden Haaren, riss er mir aus und ich konnte seine Schweißperlen spüren, die auf mein Gesicht tropften. Die Schmerzen, die er mir zufügte, waren kaum auszuhalten und ich schrie bei jedem Schlag wie eine Wahnsinnige. Ich krallte meine Finger in seine Kleidung, spürte den rauen Stoff, riss an den Knöpfen seines Hemdes, um meine Nägel in seine Haut bohren zu können.
-
Laut schepperte es und ich erschrak bis ins Mark. Die Ratte stieß einen schrillen Pfiff aus und ich hörte sie davonrennen. Ich bin mit dem Ellenbogen an den Eimer für meine Notdurft gestoßen. Ich tastete in der Finsternis nach dem Blechdeckel und bemerkte, dass die Papierrolle nicht mehr drauf lag. Wann würde mein Peiniger den Eimer holen und leeren? Er war ungefähr zu einem Drittel gefüllt. Trotz der beißenden Kälte, stank es bestialisch in meinem Gefängnis. Würde dieser Tyrann überhaupt noch einmal kommen? Nicht daran denken! Nein, nein! Er wird wiederkommen. Ganz sicher! Und irgendwann würde er mich frei lassen.
-
Der Raum war groß, ich bin ihn viermal, mit ausgestreckten Armen, an den Wänden abgelaufen. Meine Schulter streife dabei, das Gemäuer, um nicht die Orientierung zu verlieren. Ungefähr fünf Meter waren es von den Gitterstäben bis zur gegenüberliegenden Wand, breit war die Zelle circa acht Meter. Mit nach oben gestreckten Armen und auf Zehenspitzen, reichte ich nicht an die Decke über mir. Es gab kein Fenster, nicht mal ein kleines Luftloch, nur das feuchte Mauerwerk und die Gitterstäbe, die mich gefangen hielten. Es gab nur die feuchte Federkernmatratze und den Eimer in meinem Gefängnis. Keine Schüssel mit Wasser, keine Seife, um mich zu waschen. Kein Stuhl, auf dem ich mich setzen konnte, keine Decke, die mich wärmte. Und keinen verdammten Lichtschalter! Ich bin jeden Zentimeter in der Zelle abgelaufen, kroch über jedes noch so kleine Steinchen, das auf dem kalten Beton lag. Meine Hände und Finger strichen über die nackten Mauern, fuhren über jede Kerbe, jeden Spalt. Jeden einzelnen Gitterstab habe ich angefasst, bin sie mit den Händen auf- und abgefahren. Die Farbe war zum größten Teil abgeblättert und brach ab, als ich darüberstrich. Die scharfen Kanten schnitten in meine Haut, schoben sich unter meine Nägel. Ich fühlte den Schmerz, der stechend und grell war. Das Schloss an der Gittertür war verrostet. Ich rüttelte und schlug mit den Füßen dagegen, ohne Erfolg. Zigmal, habe ich meine Finger darüberstreichen lassen, bemerkte den Rost, der sich auf meine Kuppen legte.
Dank dem übel riechenden Eimer, wusste ich endlich, wo ich mich befand. Ich musste mich beeilen. Die Ratte ist aus der Zelle geflohen und hatte sich noch nicht über mein Essen hergemacht. Doch sie würde bald zurückkommen. Schnell kroch ich an der linken Wand meiner Zelle entlang, streifte sie bei jeder Bewegung mit dem Arm und Schenkel, um die Richtung nicht zu verlieren. Plötzlich schlug mein Kopf heftig gegen eine Eisenstange. Der Schmerz, trieb mir die Tränen in die Augen und ich setzte mich benommen hin. Ich stellte die Flasche ab und wartete, bis die leichte Übelkeit verging. Ich konnte die Beule spüren, die mit Sicherheit größer werden würde.
Hier irgendwo musste der Pappteller sein. Mit den Händen suchte ich hektisch den Boden ab. Immer nervöser kroch ich in der Dunkelheit umher, entfernte mich von den Eisenstäben, verzweifelt suchte ich mit ausgestreckten Armen die Mauer, die Stäbe. Verdammt! Ich musste mich beruhigen, die Panik niederkämpfen. So aufgeregt und fahrig, würde ich das Essen nicht finden. Ich musste bedachter, langsamer vorgehen. Tief atmete ich durch, schloss die Augen, bis mein Herz gleichmäßig schlug. Vorsichtige tastete ich wieder den Boden ab. Kniete mich hin und streckte die Arme erneut aus. Da! Da war die Mauer. Ich spürte die feuchten Steine und den nassen Mörtel, kroch zu ihr. Jetzt musste ich nur noch in die richtige Richtung kriechen. Eng drückte ich mich gegen die Wand, die Feuchtigkeit drang in meine verdreckte Kleidung und die Kälte fraß sich in mein Fleisch. Nach einer Ewigkeit war ich wieder an den Gitterstäben angelangt. Ich lehnte mich gegen sie und tastete erneut den Boden ab. Diesmal fand ich den Teller sofort. Ich berührte den Plastikrand und griff gierig ich nach dem Essen darauf. Ausgehungert, biss ich in den Käse und riss ein Stück von dem trockenen, harten Brot ab. Das Tippeln von kleinen Füßen, in dem pechschwarzen Gang, ließ mich innehalten. Die Ratte kam zurück, um sich ihren Anteil zu holen. Schnell schob ich das Essen unter meinen Pullover, griff die Wasserflasche und kroch eilig zurück auf die stinkende Matratze. Ich rollte mich zusammen und verschränkte die Arme vor meiner Brust. Diesmal sollte das Essen nur mir alleine gehören.
-
Eine warme, zärtliche Berührung an meinem Hals, ließ mich erwachen. Mit geschlossenen Augen genoss ich das zarte Streicheln auf meiner Haut. Es prickelte angenehm und ein Schauer lief mir den Rücken hinab. Wie zarte Federn fühlte es sich an, die sich weich an mich schmiegten. Dann kam schlagartig die Erinnerung zurück und ich wusste, wo ich mich befand und wer bei mir ist. Hektisch setzte ich mich auf und stieß einen Schrei des Ekels und der Angst aus. Blut tropfte von meinem Hals und der Schmerz riss mich vollends aus dem Halbschlaf. Warm lief das Blut über das rechte Schlüsselbein hinunter zu meiner Brust. Die verdammte Ratte hatte mich gebissen. Scharf und spitz haben sich ihre Zähne direkt unter meinem Ohr in den Hals gebohrt. Voller Angst zerrte ich an meinem Unterhemd. Der zarte Stoff riss und ich drückte den abgerissenen Fetzen an die Wunde, um die Blutung zu stillen. Fieberhaft überlegte ich, wann ich die letzte Tetanus Impfung bekommen habe. Der Biss war nicht sehr tief, nahm ich an, und schon bald blutete er nicht mehr. Irgendwann später, empfand ich einen ziehenden Schmerz am Hals und Nacken. Zaghaft fuhr ich mit dem Finger über die Schwellung. Die Haut um die Wunde war kochend heiß geworden und noch stärker angeschwollen. Ich begann zu weinen.
Ich weinte, weil ich eingesperrt war. Ich weinte, weil diese ständige Dunkelheit an meinen Nerven zerrte. Ich weinte, weil ich bitterlich fror und ich weinte, weil ich diese verdammte Ratte und meinen Entführer verabscheute. Ich hasste sie beide abgrundtief. Die Ratte, weil sie mir das wenige Essen stahl und mich gebissen hatte. Den Kidnapper, weil er mich entführt, geschlagen und mich in diese Zelle gesteckt hatte, in der es nicht den kleinsten Lichtschimmer gab. Nur Schwärze, Rabenschwärze um mich herum. Die Kälte kroch unter meine Haut, verharrte dort. Der Hunger nagte und der Durst war unerträglich. Nur meine Hände halfen mir, mich zurechtzufinden.
-
Ich lag auf der alten Federkernmatratze und starrte in die Finsternis. Ich zitterte, mir war kalt. Bitterkalt. Wie viel Zeit war vergangen, seit ich hier eingesperrt worden bin? Wurde ich vermisst, suchte man bereits nach mir? Eine der Federspiralen drang durch den Stoff, bohrte sich in meinen Rücken. Ich rutschte mit meinem geschwächten Körper auf der widerlichen Matratze herum, um eine bequemere Stelle zu finden, auf die ich mich legen konnte. Doch es half alles nichts. Sie war vollkommen durchgelegen, Feuchtigkeit hatte sie aufgeweicht und die Enden der angerosteten Federn, drückten sich aus dem Inneren heraus. Ich döste vor mich hin, wälzte mich von rechts nach links, ignorierte den Gestank, bis ich schmerzhaft aufschrie. Voller Wut sprang ich auf, als eine Feder sich stechend und schmerzhaft in meinen Rücken gebohrt hatte. Ich hob die vermaledeite Matratze von dem eiskalten Steinboden hoch. Mit aller Kraft warf ich sie gegen die Wand.
Was hatte so laut geklirrt? Unsicher kroch ich auf die Matratze zu, tastete sie ab. Da! Meine Finger spürten die Windungen der Eisenfeder. Meine Hand schloss sich um die Spirale und zog daran. Stoff riss. Meine Finger tasteten sich tief in das Inlett, rissen und zerrten in dem feuchten Stoff. Die Spiralen waren miteinander verbunden, doch eine von ihnen war gebrochen. Hin und her bog ich die Feder, bis sie sich von den anderen löste. Mein freudiger Aufschrei hallte durch die Zelle, hinaus in den pechschwarzen Gang.
Ich rappelte mich auf, die Feder hielt ich fest in der Hand. Mit ausgestreckten Armen ging ich Schritt für Schritt in der Dunkelheit, auf die Gitterstäbe zu. Bebend berührten meine Finger das Schlüsselloch an der Tür. Zitternd und mit angespannten Nerven, schob ich die Eisenfeder ein Stück hinein. Vorsichtig drehte ich sie, schob sie tiefer, bog sie hin und her.
Ich weiß nicht, wie lange ich versucht habe, das Schloss zu knacken. Minuten? Stunden? Der Schweiß lief mir in Bächen den Rücken herab. Das Haar war nass, ich strich es aus der feuchten Stirn. Der Rattenbiss schmerzte, als ob tausend Nadeln in der Wunde wüteten. Mein Arm wurde schwer und schwerer. Die Finger verkrampften sich. »Nicht aufgeben! Ich muss es schaffen! Langsam, vorsichtig, ich darf nicht ungeduldig werden«, murmelte ich und sprach mir Mut zu. Wieder und wieder bog und drehte ich die Feder in dem rostigen Schloss, wollte nicht aufgeben. Sie rieb mir die Haut von den Fingern, Blasen entstanden, füllten sich mit Wasser, doch ich drehte und rotierte die Feder verbissen weiter in dem Schlüsselloch herum.
Klack, klack. Der Riegel schnappte zurück und quietschend öffnete sich einen spaltbreit die Tür.
Wie angewurzelt stand ich davor, konnte es nicht fassen. Nur langsam drang das Unbegreifliche in meinen Kopf. Frei! Ich bin frei!
Zaghaft schlich ich in der Finsternis, an der Wand den Gang entlang, in die Richtung, aus der mein Entführer immer kam. Ich war auf meine Hände, meine Finger angewiesen, die mir den Weg nach draußen zeigen sollten. Ich spürte die Steine unter meinen Fingern. Kalt, rau und feucht fühlten sie sich an, genau wie in meiner Zelle. Leise zählte ich jeden meiner Schritte mit. Bei dreiundfünfzig stieß ich an eine Mauer, die sich direkt vor mir befand. Nein! Das darf nicht wahr sein! Frustriert stand ich in dem stockdunkeln Gang. Was nun? Zurück zu meiner Zelle oder blind den Ausgang suchen? Vorsichtig tastete ich die Mauer vor mir ab, lief an ihr entlang. Jeden Stein berührte ich, strich über ihn. Ich spürte die Feuchtigkeit, den Mörtel, der sich anfühlte, als ob er in meine Haut biss. Dann plötzlich ein Durchgang. »Weiter! Geh weiter!«, spornte ich mich an. Und ich ging in dieser absoluten Finsternis weiter. Schritt für Schritt lief ich vorsichtig tastend, in den anderen Gang hinein.
Ich weiß nicht, wie oft ich abgebogen bin. Es war ein Labyrinth aus dunklen Gängen und ich irrte ihn ihnen umher. Hatte keine Ahnung, wo ich bin. Wusste nicht, wo der Ausgang war. Wie eine Schlafwandlerin lief ich weiter, immer weiter. Meine Finger strichen über die Wände, suchten nach dem Ausgang. Meine Hände waren aufgerissen. Ich spürte, wie sich der salzige Mörtel durch meine Haut fraß. »Weiter! Geh weiter!«, schrie ich mich selbst an. Plötzlich stolperte ich über etwas und fiel auf den harten Boden. Ein jäher Schmerz jagte durch mein Bein, schoss in mein Gehirn. Mit den blutig aufgeschürften Händen fasste ich an mein Wadenbein. Blut lief mir in den Turnschuh und sickerte durch meine Jeans. Ich schob sie nach oben. Vorsichtig tastete ich die Wunde ab. Es fühlte sich wie ein Schnitt an, der auseinanderklaffte. Er war ungefähr drei Zentimeter lang und knapp unter meinem Knie. Ich wusste nicht, gegen was ich gestoßen bin und tastete frustriert den Boden ab. Irgendein kniehohes Gerät oder Gestell stand in dem Gang. Es war aus harten, eiskalten Stahl. Fieberhaft glitten meine Finger über das Teil, doch mein Tastsinn ließ mich nicht erkennen, was es war. Ich umklammerte es, versuchte es anzuheben, es gelang mir nicht. Ich kroch um das stählende Ding herum, fuhr mit den Händen die Rohre hinauf und ab. Der Stahl war eiskalt, kühlte meine Blessuren. Die Finsternis machte mir mehr zu schaffen, als ich wahrhaben wollte. Ich hasste sie. Nur auf meine Hände und Finger angewiesen zu sein, die mir einen Eindruck verschaffen sollten, wo ich mich befand und was da mitten in dem Gang stand, zerrte an meinen Nerven. Ich tastete den Boden unter dem Teil ab, bemerkte eine Stahlplatte, auf der das Ding angeschweißt oder verschraubt war. So sehr ich mich anstrengte, um zu erkennen, was es darstellte, es gelang es mir nicht. Der Schmerz am Bein beendete das Betasten und Berühren. Der Schmerz ließ mich tief ein und ausatmen, ich musste mich um die Wunde kümmern. Umständlich zog ich das zerrissene Unterhemd aus und band es um die Verletzung. Danach hielt ich mich an dem nackten Stahl fest, zog mich hoch. Wieder spürte ich die wohltuende Kälte an den Fingern. Humpelnd ging ich weiter, biss die Zähne zusammen, um nicht laut zu heulen. Es tat weh. Der Schnitt tat verdammt weh und der Schmerz wurde nicht weniger, sondern bei jedem Schritt mehr.
-
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich in den nachtschwarzen Gängen, umhergeirrt bin. Die Orientierung hatte ich schon längst verloren. Durst plagte mich, der Rattenbiss am Hals stach und pochte. Der Schnitt an meinem Bein, pulsierte schmerzhaft bei jeder Bewegung. Der Kopf tat mir weh, ich spürte jeden blauen Fleck an meinem Körper. Ich fühlte mich fiebrig und krank, war erschöpft, müde und hatte keine Kraft mehr.
Tapp, tapp, tapp. Ich saß in irgendeinem Gang an der Wand gelehnt, die Augen geschlossen. Spürte den feuchten Schweiß auf meiner Haut und begann vor Kälte und Erschöpfung zu zittern. Die Ratte kam näher, sie kam sehr schnell näher. Sie rannte und ich hörte ihr durchdringendes Piepsen. Wollte sie mich angreifen? Erfasste ihr kleines Hirn, das ich mich nicht mehr wehren würde? Freute sie sich darauf, ihre scharfen Zähne in mein Fleisch zu treiben? Still blieb ich sitzen. Lauschte. Meine Finger krallten sich in meinen Pullover, der sich klamm und kalt anfühlte.
Die Ratte beachtete mich nicht, als sie an mir vorbeihuschte. Nur langsam begriff ich, ich war nicht ihr Ziel gewesen. Das Tier wollte woanders hin. Ich hörte ihr schrilles Pfeifen und dann ein weiteres und noch eins. Dort wo sie hinrannte, gab es mehr von ihrer Rasse. Mühsam stand ich auf. Versuchte, das verletzte Bein nicht zu belasten. Ich folgte humpelnd und mich an der Wand haltend, den hohen Pfeiftönen.
-
Mittlerweile torkelte und stürzte ich nur noch durch die nachtschwarzen Gänge. Ich spürte den nassen Mörtel und den feuchten Dreck auf meinem Gesicht und Händen, versuchte, mit dem Ärmel des Pullovers, ihn wegzuwischen. Ich fühlte die Risse und Schnitte, jede Wunde an meinem Körper. Meine Finger strichen über meine abgebrochenen Nägel, bemerkten angetrocknete Klümpchen aus Mörtel, Stein und Schmutz, der sich in meine Haut fraß. Verzweifelt schlug ich mit den Fäusten gegen die Wand, neben mir. Rau, kalt und hart, war sie. Tief atmete ich durch, musste mich beruhigen. Ich durfte nicht den Verstand verlieren. Meine Hände tasteten sich wieder suchend vorwärts, glitten an ihnen entlang. Jede Berührung mit meinen Fingerspitzen und Händen, nahm ich intensiv wahr. Ich konnte unterscheiden, wie nass oder feucht die Mauern waren. Ziegel und Steine fühlten sich anders an. Ich bemerkte Erhebungen, Löcher, Risse, an ihnen. In Bodennähe, bis zu meinen Hüften, waren die Mauern feuchter, über mir beinahe trocken. Das Abtasten und untersuchen der Wände, raubte mir viel Kraft und Zeit. Doch es musste sein. Nichts durfte mir verborgen bleiben, jede Lücke, jeder Riss, jeden neuen Gang musste ich wahrnehmen, erkennen, ertasten und absuchen. Ich war alleine auf meine Hände und Finger angewiesen, ohne sie hätte ich nicht annähernd begreifen können, was sich um mich herum befand.
Wieder stieß ich an eine Mauer, die mir den Weg versperrte. Verzweifelt schrie ich auf, fasste sie an, schlug mit geballten Fäusten auf sie ein. Nachdem ich den Frust runtergeschluckt habe, ließ ich meine Hände über die Wand gleiten, meine Finger betasteten sie vorsichtig. Mein Kopf pochte schmerzhaft. Ich untersuchte und prüfte die Mauer, mit den Fingern, so wie die vielen anderen davor. Etwas hatte sich verändert. Ich kniete mich hin, meine Hände blieben an der Wand. Ungläubig erkannte ich den Unterschied. Die Mauer war trocken! Ich rieb meine Fingerspitzen an ihr, dann aneinander, berührte wieder und wieder die Wand. Waren die Mauern noch vor Minuten, oder Stunden, bis zu meiner Hüfte hinauf nass gewesen, war sie jetzt von Boden ab trocken. Das war gut, das war sogar sehr gut, erkannte ich und lachte hysterisch auf. Obwohl ich es nicht bemerkt hatte, muss ich nach oben gelaufen sein. Es war keine erkennbare Steigung gewesen und bemerkte endlich, dass die Luft nicht mehr so feucht und modrig um mich herum war. Hoffnung stieg in mir auf.
Links an der Wand fand ich den nächsten Gang. Eine Hand ließ ich an der Wand, die andere streckte ich nach vorn. Vorsichtig ging ich hinein. Aufgeregt tastete ich mich nervös vorwärts. Nach einigen Metern machte der Gang eine Biegung und meine Finger bemerkten die nächste Veränderung. Putz! Die Wand war verputzt! Ich spürte unter meinen Fingern die raue, körnige Beschichtung. Taumelnd lehnte ich mich an die Wand. Ich presste mein Gesicht dagegen und der Putz rieb kühl über meine Haut. Tränen liefen mir die Wangen hinab. Ich lehnte mich mit den Rücken an die Mauer, streckte die Arme aus und lief zu gegenüberliegenden Wand. Sobald ich sie berührte, erkannte ich, dass auch sie nicht nass oder feucht war. Meine Hände strichen über den Putz, als ob ich ihn großflächig mit einem Lappen reinigen würde. Trocken! Das muss ein gutes Zeichen sein. Voller Zuversicht ging ich weiter, die eine Hand immer an der Mauer. Und dann sah ich in der Ferne das kleine, schimmernde Licht.
Ich rannte los. Schrie vor Schmerzen gepeinigt auf. Die Wunde unter dem Knie blutete wieder, ich spürte die Feuchtigkeit, die sich in die Jeans saugte und am Bein hinunterlief. Ich fiel hin, schlug hart auf dem Boden auf. Benommen blieb ich liegen, schloss die Augen und spürte den harten Boden unter mir. Ich breitete meine Arme aus, und als der Schmerz verebbte, ließ ich sie wie Flügel auf dem Beton nach oben und unten gleiten. So wie ich es im Winter tat, wenn ich im Schnee lag und mit meinem Abdruck einen Engel machen wollte. Ich spürte, wie sich Fäden an den Ärmeln lösten, die an dem rauen Boden haften blieben. Mühsam setzte ich mich auf, robbte und kroch auf allen vieren weiter, dem Licht entgegen. Ich schrie, ich weinte und schluchzte. Ich wankte vor Erschöpfung, stieß hart gegen die Mauern, spürte den Aufprall, fiel auf die Knie, kroch weiter. Meine Hände tasteten dabei hektisch den Boden ab. Ich hatte Angst, dass wieder etwas im Wege stand und ich mich daran verletzen könnte. Meine Finger strichen bebend über den Beton. Ich spürte feinen Sand, kleine Steinkörnchen und Staubflusen auf dem kühlen Beton. Ich musste weiter! Auf Knien, eine Hand an der Wand, die andere ausgestreckt nach vorn, tastete ich mich weiter. Dann stand ich schwankend auf. Meine Hände griffen an die Mauer, suchten Halt. Sofort bemerkte ich, dass der Putz noch glatter und feiner aufgezogen war. Ich fuhr mit den aufgerissenen Fingern an ihm entlang, spürte kleine Unebenheiten, tastete sie behutsam ab. Ich humpelte und hastete weiter. Das kleine Licht wurde größer, heller. Dann, eine gefühlte Ewigkeit später, erreichte ich den Aufstieg. Unten an der Treppe ließ ich mich auf die Stufe fallen und spürte eine Gummimatte unter mir. Ich berührte sie, versuchte sie anzuheben, zog an ihr, doch sie war an der Stufe festgeklebt. Verschwommen sah ich nach oben, erkannte, dass alle Stufen diesen Belag hatten. »Wegen der Rutschgefahr«, flüsterte ich. »Eine Sicherheitsmaßnahme!« Mit letzter Kraft, rappelte ich mich auf, zog mich am Geländer hoch. Mein Atem rasselte und ich hustete, würgte und erbrach mich. Raus! Du musst hier raus, schrie es in mir. Die abgeblätterte Farbe und der Rost am Geländer, stachen und schnitten in die Innenflächen meiner Hände. Trotz der Schmerzen, griff ich immer wieder zu, zog mich mit aller Kraft hinauf, sobald ein Fuß die nächste Stufe berührte.
-
Ich stand in einer großen, leeren Halle. Die Fenster waren zum größten Teil eingeschlagen und die Sonne schien herein. Ich kniff die Augen zu, verdrängte den stechenden Schmerz in meinen Augen und wankte mit ausgestreckten Armen durch das offene Tor.
Der Schlag auf meinen Hinterkopf raubte mir die Sinne und ich fiel in eine erbarmungslose Ohnmacht.
-
Rabenschwarze Finsternis! Eine Ratte piepste aufgeregt und sprang davon. Ich lag auf einer feuchten Matratze, um mich die feuchte Dunkelheit. Ich schrie, bis kein Ton mehr über meine aufgesprungenen Lippen kam. Gefangen!
*
Verschwunden
Verschwunden
Lachend und gut gelaunt liefen die drei attraktiven Mädchen auf die jungen Männer zu, die am Eingangstor des Parks auf sie gewartet haben.
»Habt ihr keine Uhr?«, fuhr John seine Freundin Mia an.
»Wir stehen seit einer halben Stunde hier.«
Mia lächelte und gab ihm einen Kuss.
»Jetzt sind wir ja da«, flüsterte sie in sein Ohr.
Ihr blumiger Duft stieg in Johns Nase und er atmete ihn tief ein. Er drückte das schlanke Mädchen mit dem langen blonden Haar fest an sich. Zuerst schrie Mia spitz und grell auf, dann schmiegte sie sich laut lachend an ihn. Julia verdrehte die Augen. Dieses affektierte Getue von Mia ging ihr manchmal ganz gewaltig auf die Nerven. David grinste und umfasste ihre schmale Hüfte.
»Hallo, meine Schöne«, raunte er Julia zu und strich ihr eine dunkle Locke aus dem herzförmigen Gesicht. Laura beobachtete die beiden Paare und biss sich auf die Unterlippe.
Abwartend und verärgert blickte sie ihren Freund Nico an, der in den Park hineinsah und anscheinend die Menschen darin beobachtete. Wie so oft, hielt er nicht viel von Begrüßungsküsschen und innigen Umarmungen. »Können wir nach diesem honigsüßen Empfang endlich gehen?«, erkundigte sich Laura unfreundlich bei ihren Freunden und sah Nico böse an. Der schien nicht bemerkt zu haben, dass Lauras Laune gesunken war. Der gut aussehende Sohn einer Italienerin legte Laura den Arm um die Schulter und zog sie eng an seine Seite. Er spürte ihre Rundungen, die üppig und weich waren. Nico liebte Laura seit er sie, als Drittklässler alleine auf dem Schulhof stehen sah. Ihr rotes Haar funkelte in der Sonne wie loderndes Feuer. Das kleine Mädchen hatte den Kopf gesenkt und starrte auf ihre Schuhe. Wie gebannt stand Nico nur einige Meter von ihr entfernt und konnte den Blick nicht von ihr lassen. Erst als er bemerkte, dass Laura still und leise weinte, hörte er, wie einige Schüler über ihr rotes Haar spotteten. Beschützend stellte sich Nico zu ihr, legte den Arm um sie und sah die Kinder herausfordernd an. Seitdem waren Nico und Laura unzertrennlich.
»Habt ihr den Alkohol besorgt?«, erkundigte sich John und sah Mia erwartungsvoll an. Die nahm ihren Rucksack von den Schultern und setzte ihn ab. Als sie ihn geöffnet hatte, zog sie ein Stück weit eine volle Flasche Whiskey heraus.
»Cola und Plastikbecher hat Laura gekauft und Julia hat Chips, Tortilla und Dips besorgt«, erklärte sie stolz und strahlte ihren Freund an.
John und die beiden anderen jungen Männer grinsten zufrieden. »Ok, dann lasst uns eine heiße Kinonacht erleben«, rief John und fischte einen Schlüssel aus der Hosentasche, den er triumphierend hochhielt.
-