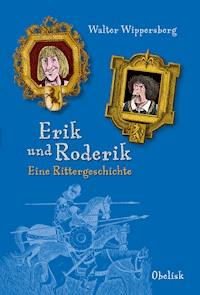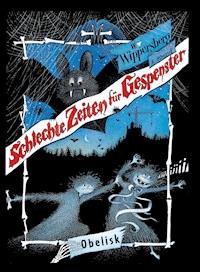Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das eigene Leben als Reportage, die eigenen Gedanken und Gefühle als Objekt der Betrachtung. Innerhalb von 14 Jahren in der Literaturzeitschrift "99" veröffentlicht, bieten diese Aufzeichnungen einen Querschnitt durch das Denken und Handeln des österreichischen Autors und Filmemachers Walter Wippersberg. Ob persönliche Einträge, Notizen oder Betrachtungen über die aktuelle Politik und Kulturszene - Wippersberg schreibt mit Humor und dem Abstand eines Dokumentarfilmers. Wie ein cineastischer Short Cut eröffnen sich dem Leser kurze Einblicke in das Leben eines Allroundtalents. Denn gerade weil 11 Monate jedes Jahres im Dunkeln liegen, zeigt sich am Ende ein Gesamtbild dessen, wie schöpferisches Werden und Sein den Alltag und die Gedanken eines Künstlers bestimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter WippersbergVierzehn Monate. Vierzehn Jahre.Aufschreibungen.
Walter Wippersberg
Vierzehn Monate.Vierzehn Jahre.
Aufschreibungen.
O T T O M Ü L L E R V E R L A G
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1179-8eISBN 978-3-7013-6179-3
© 2010 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at, Salzburg Druck und Bindung: CPI Moravia Books GmbH. Korneuburg
Inhalt
Vorwort
Oktober 1997
August 1998
Mai 1999
Juni 2000
Jänner 2001
April 2002
Februar 2003
März 2004
Juli 2005
September 2006
Dezember 2007
November 2008
Juli 2009
Jänner 2010
Vorwort
Dies ist eine recht fragmentarische Art, ein Tagebuch zu führen: über Jahre hin zwar, aber jeweils nur einen Monat lang, in dieser Zeit aber sehr konsequent, (fast) jeden Tag.
Diese besondere, seltsame Form des Tagebuchschreibens hängt zusammen mit einer kleinen Zeitschrift, die ich seit 1992 mit einigen befreundeten Autoren herausbringe (derzeit sind das Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter und Margit Schreiner). Dieses Periodikum heißt »99« – so benannt, weil es in (angeblich) nur 99 Exemplaren erscheint. Auch sonst unterscheidet es sich von anderen Literaturzeitschriften: Man kann »99« weder kaufen noch irgendwo bestellen, man bekommt »99« zugeschickt – oder nicht. Das heißt, wir suchen uns selber aus, von wem wir gelesen werden wollen. Es ist ein radikal subjektives Projekt, darum hat es auch keinen Sinn, uns Manuskripte zur Veröffentlichung anzubieten. Wen wir in »99« veröffentlicht sehen wollen, den oder die laden wir von uns aus zur Mitarbeit ein. Nie gab es ein formales oder inhaltliches Konzept – es sei denn, man wollte das ein Konzept nennen: Wir machen, was wir wollen, was uns gerade wirklich interessiert. Wir planen nicht lange voraus, was sich entwickeln will, soll sich entwickeln.
Manchmal benützen wir unsere kleine, feine Zeitschrift, um eine kulturpolitische Diskussion vom Zaun zu brechen oder in eine schon laufende einzugreifen. Gelegentlich widmen wir eine Nummer einer Autorin oder einem Autor, die oder der unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdiente. Hin und wieder erinnern wir in eigenen Heften an einen Klassiker der Aufklärung, dessen Namen fast jeder kennt, dessen Werke aber nicht jeder liest. Dann und wann gibt es auch eine Nummer einfach nur mit neuen literarischen Texten.
Vor vierzehn Jahren tauchte die Idee auf, wir könnten einmal für eine »99«-Ausgabe einen Monat lang Tagebuch schreiben. Die Texte wurden dann so ineinander verschränkt, daß man Tag für Tag quasi parallel nachvollziehen konnte, wie fünf schreibende Menschen ihre Zeit verbringen, worüber sie grad nachdenken, was ihnen auf- und einfällt.
Das hat unseren Lesern gut gefallen – und uns selber auch, deshalb machen wir seither Jahr für Jahr weiter. Und als wir vor zwei Jahren alle Monate (in unordentlicher Reihenfolge) durch hatten, haben wir uns entschlossen, noch einmal eine Runde anzufangen.
Man hat mich hin und wieder gefragt, ob ich denn meine Beiträge zu diesem Gemeinschaftsprojekt nicht sammeln und als Buch herausgeben wolle, und meine Antwort war immer, daß ich das gewiß einmal tun würde, irgendwann halt. Und dann hab ich mich selbst einmal gefragt: Wann, wenn nicht jetzt? Worauf eigentlich warten?
Das mag damit zusammenhängen, daß ich demnächst 65 werde, aber mehr noch damit, daß mein bisher letztes Buch »Eine Rückkehr wider Willen. Zwei Berichte über mich« mein erstes autobiografisches Buch ist, und das hier vorgelegte scheint mir eine nicht unlogische Ergänzung – mit dem ersten in mehrfacher Hinsicht verbunden und verflochten.
Der Reiz dieser Sammlung könnte im oben angesprochenen Fragmentarischen liegen. Einmal im Jahr wird ein Monat protokolliert, aber elf Monate jeden Jahres bleiben ausgespart.
Geschichten – auch solche, die, wie man so sagt, das Leben schreibt – fangen einmal an, entwickeln sich da- und dorthin und enden einmal, aber nie fängt eine Geschichte am Ersten eines Monats an und endet am Letzten. So ist zum Beispiel hier – vor allem in den ersten Jahren – oft von Film- oder Fernsehprojekten die Rede. So etwas zieht sich immer über Jahre hin, deshalb wird hier kaum einmal (oder allenfalls indirekt) vom Anfang eines solchen Unterfangens erzählt und auch nicht davon, wohin es geführt hat, zu einem Film oder – in diesem »Geschäft« nicht unüblich – eben doch zu keinem. Hier wird nur berichtet, was einmal (oder auch ein zweites Mal) vier Wochen lang geschah, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen und zu befördern. Ganz ähnlich verhält es sich auch bei Geschehnissen, die viel tiefer in den Lebenslauf einschneiden, Krankheiten etwa, die einen an den Rand des Lebens führen.
Das – hier, weil oft dem Zufall geschuldet, so radikal praktizierte – Fragmentarische gehört freilich ohnehin zur Kunst – und zur Literatur erst recht. Alles bis ins letzte auszuschreiben, das kann – viele dickleibige Romane beweisen es – tödlich langweilig sein. Oft, fast immer ist das Nicht-Gesagte, Nicht-Hingeschriebene so wichtig wie der formulierte Text. Es muß, das ist jedenfalls meine Meinung, in literarischen Werken Freiflächen geben, die jede Leserin, jeder Leser selbst füllen kann.
Durchaus nicht alle, aber viele der Freiflächen in dieser Sammlung sind durch die beschriebene besondere Entstehungsgeschichte, also auf aleatorischer Basis entstanden. Doch ist die Aleatorik ja längst als kompositorisches Prinzip anerkannt und kanonisiert, und das ist – soferne es nicht das einzige ist oder als das allein Seligmachende gepriesen wird – auch gut und richtig so.
WW., März 2010
Oktober 1997
Mittwoch, 1. Oktober 1997
In der Nacht die ersten Herbststürme.
Ausnahmsweise hab ich heuer nicht das Gefühl, den Sommer einfach versäumt zu haben.
Den Tag über herumgekramt, ein paar längst überfällige Briefe geschrieben, ein paar Leute angerufen, bei denen ich mich schon vor Wochen hätte melden sollen.
Wolfgang Glücks erster Tag als Abteilungsleiter: Ich überlege noch, ob ich ihm ein Fax mit meinen guten Wünschen schicken soll, da ruft er schon an, und ich kann ihm, was ich ihm wünsche, gleich sagen.
Erleichtert und erschöpft wie immer, wenn die Aufnahmsprüfungen vorbei sind. Auch diesmal hatte ich mir vorgenommen, neben den Prüfungen, die für uns (natürlich nicht ganz, aber doch fast) so anstrengend sind wie für die Kandidaten, nur das Allernotwendigste zu erledigen. Wie immer ist es anders gekommen. Da ist plötzlich ein Regisseur für meinen »Phönix«-Film im Gespräch, der einen Schwank daraus machen wird, wenn man ihn nur läßt. Dann die geplante Reform der Kunsthochschulen, zu der wir im Rahmen des Begutachtungsverfahrens Stellung nehmen müssen. Und dann noch, dies wenigstens vergnüglich, ein paar (vorläufig letzte) Besprechungen mit Wulf Flemming und Andreas Gruber über unser gemeinsames Kinoprojekt.
Nach ein paar Wochen aus 12- und 14-Stunden-Tagen kein Termin heute, so krabble ich durchs Haus und überlege, wem ich wirklich heute schreiben und wen ich wirklich heute anrufen muß. Das Allermeiste, was fällig wäre, verschiebe ich auf morgen oder irgendwann.
Donnerstag, 2. Oktober 1997
Ein paar Notizen zum Kino-Drehbuch. Zweieinhalb Szenen, hab ich vorgestern mit Flemming und Gruber vereinbart, kommen noch rein, dann ist Schluß. Amüsant ist, daß immer, wenn ich die beiden treffe, einer von ihnen, meist beide, mit Vorschlägen kommen, was noch rein müßte, dabei wissen wir, daß wir schon viel zu lang sind. Wir halten bei etwa 130 Minuten, aber länger als hundert Minuten, darin sind wir uns einig, soll das Ding nicht werden. Komplexität, das ist es, was wir uns wünschen – und was die normierten Filmlängen nur sehr beschränkt zulassen. Einfache Geschichten müssen’s sein fürs Kino, aber nicht immer lassen sich die Geschichten einfach erzählen, wenn man nicht unzulässig vereinfachen will. Das gilt zumal dann, wenn man politische Geschichten erzählen will.
Mir fällt ein, wie ich am liebsten leben möchte, nämlich parallel. Frühstücken in Wien im Café Landtmann oder vielleicht noch lieber, wegen der Aussicht von meinem Frühstücksplatz aus, in Losenstein. Dann arbeiten, am besten auch in Losenstein, unterm Dach. Irgendwann am Vormittag wäre un café auf einer italienischen Piazza angenehm. Den Nachmittag schließlich würde ich zum Beispiel gern in der judäischen Wüste verbringen. Das eine oder andere abendliche Bier könnte man dann in einem Pub in Dublin trinken oder in New York in jener irischen Bar in der 45. Straße, wo Barry mit zartem Guinness-Strahl so schöne Kleeblätter in den cremigen Schaum zeichnet. Auf dem Heimweg dann, von wo auch immer, noch ein letztes Bier bei Rudi im sogenannten Wein- und Bierhaus in der Josefstädter Straße (wo Oskar Werner selig einen Teil seines Verstandes und seines Talentes versoffen hat) oder im Verdi in der Lange Gasse. Schlafen dann in Wien, aber frühstücken wieder in Losenstein. Oder aber in einem sehr guten Hotel irgendwo; das Wohnen im Hotel mag ich selten, das Frühstücken oft.
Eine Art bescheidenen Parallel-Lebens führe ich ja durch das ständige Pendeln zwischen Wien und Losenstein. Oft habe ich, wenn ich von einem Ort zum anderen wechsle, das Gefühl, als ginge ich nur in ein anderes Zimmer einer einzigen Wohnung, bloß daß der Weg ins andere Zimmer eben seltsamerweise zwei Stunden dauert. Wenn ich in der Nacht aufwache und nicht gleich weiß, wo ich bin, muß ich nur nach der Bettkante tasten: In Wien steige ich links aus dem Bett, in Losenstein rechts.
Ich bin – wer hat das zuerst gesagt? – überall ein bißchen ungern, und es braucht nicht viel, daß ich mich augenblicklich irgendwo anders hin wünsche. Ein paar New-York-Bilder im Fernsehen, und ich möcht für zwei Tage nach New York. Was etwa Paris angeht, so sind es die Pariser Dächer mit diesen besonderen Mansardenfenstern, die den Reflex auslösen, augenblicklich in Paris sein zu wollen.
Freitag, 3. Oktober 1997
In Salzburg, höre ich, haben F-ler in den Computer eines SPÖ-Landesrates eingebrochen. Erst streiten sie’s ab, dann lügen sie es sich zur Robin-Hood-Tat zurecht. Auch wenn man schon darüber prospektiv geschrieben hat, erschrickt man, wenn’s tatsächlich geschehen ist.
Als sich bei unserem Gespräch am Dienstag herausstellte, daß Gruber und ich potentielle politische Entwicklungen pessimistischer sehen als er, da sagte Wulf Flemming den schönen Satz: »Keine Angst, ich fürcht mich auch.«
Samstag, 4. Oktober 1997
NFL-Treffen in Losenstein: Alle haben, scheint es, mit dem Tagebuchschreiben begonnen. Wir vereinbaren, nichts über die Art des Schreibens oder über die Inhalte zu erzählen. Man würde es aber doch gerne tun. Zu wissen, daß alles, was man jetzt schreibt, schon im November oder Dezember in »99« veröffentlicht wird, hat natürlich einen gravierenden Nachteil: Man spart (wenig schmeichelhafte) Kommentare über Leute aus, die das lesen werden oder könnten. So bleibt u.U. genau das, was einen im Augenblick wirklich beschäftigt, ärgert etc., unbeschrieben und unkommentiert.
Sonntag, 5. Oktober 1997
Um 16 Uhr im Fernsehen die erste Hochrechnung auf die Ergebnisse der oö. Landtagswahl. Für die FPÖ werden weniger als zwanzig Prozent prognostiziert. Wenn vorn der Einser bleibt, sag ich zu Tonja, dann gehen wir feiern. Er bleibt nicht. Es wäre ein nettes optisches Signal gewesen.
Montag, 6. Oktober 1997
Die Medienhysterie um den angeblichen Bombenbastler ist zum Kotzen. Und der ORF scheißt wieder einmal auf öffentlich-rechtliche Seriosität, geriert sich als Boulevardmedium der schlimmsten Sorte und betet ungeprüft nach, was die Polizei uns glauben machen möchte: »Das ist der, der die Oberwarter Rohrbombe und all die Briefbomben zu verantworten hat«. Dabei deutet alles, was bisher bekannt ist, viel eher auf einen Trittbrettfahrer hin.
Aber: »Die Preußen hängen keinen, sie hätten ihn denn.« Vielleicht denkt man: Die wirklich Verantwortlichen finden wir eh nie, aber den einen haben wir. Und der ist es jetzt. Basta.
Und keiner redet davon, daß das schon einmal so war, bei den Herren Nazi-Buben Radl (oder wie der geheißen hat) und Binder, von deren Täterschaft die Polizei auch schon felsenfest überzeugt war.
Dienstag, 7. Oktober 1997
Ehe ich wegfahre, ruft mich Julia an, sie hat im Radio von einem Stau zwischen Amstetten West und Amstetten Ost gehört. Ich weiche über die Bundesstraße 1 aus. Nebel. Ich möcht nicht wohnen, wo viel Nebel ist. (Seit wir ernsthaft über eine Alternative zu Losenstein nachdenken, prüfe ich Gegenden unter dem Blickwinkel, ob ich hier wohnen möchte oder nicht.)
In meinem Zimmer im Studio Schönbrunn ist es saukalt. Geheizt darf, sagt der Schulwart, erst ab 15. Oktober werden. Die beiden Martins (jetzt schon fast die Senioren in der Klasse) sind in diesem Semester wieder da, und ich freu mich drüber. Martin Betz hat seinen Zivildienst absolviert, Martin Leidenfrost hat im letzten Jahr in Berlin ein Faible fürs Theater in sich entdeckt. Nach dem Unterricht sitze ich (auf dem Stammplatz Hans Mosers) mit Evelyn Itkin im Maxingstüberl. Der Gedanke, daß das »Phönix«-Drehbuch tatsächlich von diesem einen Regisseur realisiert und damit zu etwas werden könnte, was ich bestimmt nicht schreiben wollte, macht mich krank. Und Evelyn kann nicht helfen; so lange Werner im Spital ist, wird eh nichts entschieden. Immer wieder umkreisen wir die Frage, die mir diese Tage nicht eben verschönt: Wer könnte den »Phönix« wirklich inszenieren? Und dahinter die Frage: Wie überlebt mein Text das, was da auf ihn zukommt.
Um halb acht kommt der Schulwart ins Maxingstüberl. Mein Auto steht noch hinterm Studio, um halb neun, er muß es mir nicht sagen, werden die Tore geschlossen. Damit ihm die letzte Stunde Dienst nicht gar zu lang wird, fordere ich ihn auf, ein Bier auf meine Rechnung zu trinken. Da er sieht, daß er an unserem Tisch nicht wirklich willkommen wäre, setzt er sich zu einer etwas schrillen älteren Dame: »Is’ es gestattet?«
Im siebten Bezirk ist um halb neun nicht einmal mehr in den Halteverbotszonen ein Platz frei. Ich steh auf der Lerchenfelderstraße mit der vorderen Autohälfte in der Kurzparkzone, mit der hinteren auf einem Zebrastreifen. (So weit identifiziert man sich, scheint’s, mit dem Auto, daß man sagt »Ich stehe …«, wenn man meint »Das Auto steht …«) Morgen um halb neun muß ich eh wieder weg, die Sheriffs sind hoffentlich erst ab neun unterwegs, wenn die Lerchenfelderstraße wieder Kurzparkzone ist.
Dann mit Julia im Verdi zum Abendessen. Ich rede weiter von den Leiden der Drehbuchautoren.
Mittwoch, 8. Oktober 1997
Die Sheriffs waren doch schon vor neun unterwegs. Wieder einmal eine Anzeige.
Von neun bis kurz vor zehn ein paar erste Diplomprüfungen, beginnend mit »meinen« beiden Leuten, auf die ich große Hoffnungen setze. Dann die erste Vorlesung für den neuen Jahrgang (das Spiegelzimmer wird zu klein werden, der Jahrgang ist größer diesmal, dazu die Studenten von der Medienkomposition und vom Tonmeisterlehrgang). Wer in der neuen Gruppe das Sagen haben und das große Wort führen wird, zeigt sich auch diesmal schon in der ersten Woche.
Dann noch eine Kameraprüfung, der gezeigte Film ist jämmerlich, wir raten zum freiwilligen Rücktritt.
Als ich mit Wolfgang Glück zum Mittagessen und einer Besprechung ins Galerie-Café komme, sitzt der gesamte zweite Jahrgang da, bereitet sich auf die schriftliche Prüfung bei mir vor. »Zu spät«, sage ich, »ich werd euch alle durchfallen lassen.« »Wir wiederholen nur«, sagen sie.
Vor der Prüfung dann fragt mich Barbara G., ob das stimme, was alle ihr heute sagten, daß sie nämlich so gut aussehe. Ich sage ihr, daß ich mich grundsätzlich jeder Äußerung über das Aussehen von Studentinnen enthalte.
Anja S. will am Ende der Prüfung (zu der als Pflichtlektüre auch Freuds »Traumdeutung« gehört) von mir wissen, was ich denn persönlich von Freud halte.
Rudi, der Kellner im Wein- und Bierhaus in der Josefstädterstraße, die Stimme des Volkes: »Na, was sagst denn zum Bombenhirn?« Er zeigt mir, was in der Kronenzeitung darüber zu lesen steht. Übrigens hat er neue Zähne, mit raschen Lippenbewegungen versichert er sich ihres Sitzes.
Donnerstag, 9. Oktober 1997
Am Vormittag fahre ich auf Parkplatzsuche eine Dreiviertelstunde durch den siebenten Bezirk, dann stelle ich das Auto doch wieder in die Kurzparkzone in der Lerchenfelderstraße. Zu Mittag noch einmal ein Versuch, als ich die Runde Lerchenfelderstraße, Museumstraße, Neustiftgasse, Kellermanngasse zum vierten Mal drehe, finde ich einen Platz in der Neustiftgasse, viel zu eng eigentlich, irgendwie komm ich rein. Am Abend sitzen Tonja und ich – am 9. Oktober! – im Schanigarten vor dem Wegenstein und reden über den fünften Akt vom »Erben«-Drehbuch.
Vor dem Schlafengehen noch rasch die neuesten Fernsehmeldungen über das »Bombenhirn«. Die Polizei spricht in hohen Tönen von seiner Intelligenz, fast schwärmen sie von seiner Genialität, und ich kann nicht erkennen, worauf genau sich diese hohe Meinung gründet. Gut, er war Vorzugsschüler. Aber aus dem, was er angeblich zuletzt gesagt oder getan hat, kann ich diese »überdurchschnittliche Begabung« nicht erkennen. Wenn er sie hat, dann wohl nur im Vergleich zu den Polizisten, die ihn verhören. Er sei übrigens, höre ich, heute »schärfer« verhört worden als bisher. Wie das? Hat man ihm bildlich gesprochen – ein paar auf die nicht mehr vorhandenen Finger gegeben? Hat man ihn an den Ohren gezogen? Hat man ihm, wie das in Wachstuben nicht selten vorkommen soll, ein Plastiksackel über den Kopf gestülpt? Aber nein, man habe ihn, höre ich, mit Widersprüchen in seinen bisherigen Aussagen konfrontiert. Das nenn ich Härte. Und Amnesty schreitet gegen solche Brutalität nicht ein.
Mich würde interessieren, was unter Fuchsens Aussage zu verstehen ist, er sei im Auftrag der Bajuwaren im Auto als »Provokateur« herumgefahren, »damit die Polizei abgelenkt ist und die BBA unbehelligt ihrer Tätigkeit nachgehen kann«. Was genau soll man sich darunter vorstellen? Ist er durch die Steiermark und benachbarte Landstriche gefahren und hat vorbeifahrenden Gendarmeriebeamten die Zunge oder den Vogel oder den Stinkefinger gezeigt, um sie zu provozieren?
Die Einzeltäter-Hypothese, höre ich, bestätige sich immer mehr. Das ist schön für die Polizei und wundert mich auch nicht. Man findet, wonach man sucht. Man will einen Einzeltäter, weil man immer schon daran geglaubt hat. Und vor allem auch, weil man sonst weitersuchen müßte, worin man bisher ja nicht sehr erfolgreich war. Wenn das ein Einzeltäter ist, kann man den Fall abschließen, dann war man erfolgreich. Also ist er ein Einzeltäter. Schluß der Debatte!
Dabei könnte, was man weiß, viel plausibler auch so interpretiert werden: Eine arme, vereinsamte Sau, die irgendwo dazugehören wollte und sich in eine Nähe zur BBA phantasiert hat…
Freitag, 10. Oktober 1997
Beim Frühstück erzählt Julia, die Eltern des Bombenbastlers seien bei Vera im Fernsehen gewesen. Auch der Mann aus der Cola-light-Werbung, nach dem (bzw. dessen knackigen Hintern) angeblich alle Frauen schmachten, sei in der Sendung gewesen. Alles wird, das Fernsehen macht’s möglich, kaum noch unterscheidbares Entertainment: Werbung und Fernseh-Show und Berichterstattung über Verbrechen. Alles eins, und d’Leut unterhalt’s.
Mit Sabine Derflinger im Galerie-Café. Wir reden über das Drehbuch, zu dem sie meine Meinung hören will, und wir reden über ihre Erfahrungen, die sie gemacht hat, seit sie mit dem Studium fertig ist. Wieder einmal frage ich mich, ob mein Unterricht, in dem viel von Kunst die Rede ist, wirklich angemessen ist dieser Branche, in die die Absolventen hineinwachsen sollen und in der künstlerische Ambition allenfalls noch belächelt wird.
Danach eine Sitzung des Abteilungskollegiums, über die man in einem zum baldigen Verzehr bestimmten Tagebuch nichts schreiben kann.
Bei der abendlichen Fahrt nach Losenstein: Der erste Regen nach langer Zeit. Die ersten Laubteppiche dieses Herbstes auf den Straßen.
Samstag, 11. Oktober 1997
Ich hab, wie schon manchmal, geträumt: Ich liege – im Traum – wach, aber mit geschlossenen Augen im Bett, und kann, so sehr ich mich auch anstrenge, die Augen nicht öffnen.
Sonntag, 12. Oktober 1997
Andreas Gruber hat gestern die Kürzungsvorschläge für das Kino-Drehbuch gefaxt. Die meisten kann ich guten Gewissens übernehmen, aber das Ergebnis heißt: gerade zweieinhalb Seiten weniger. Dazu kommen jetzt die zweieinhalb besprochenen Szenen. Ich finde hier und dort noch was, was man verknappen kann, aber am Ende sind wir immer noch viel zu lang. Wie auch immer, das ist jetzt die Buchfassung, die kalkuliert und eingereicht wird. Bis zur Realisierung, falls es zu einer kommt, vergehen noch etliche Monate, vielleicht fällt uns bis dahin ein, wo man noch straffen könnte.
Die Sehnsucht danach, wieder einmal Prosa zu schreiben. Vor die Erfüllung dieses Wunsches hat das Schicksal aber die Fertigstellung des »Erben«-Drehbuchs gesetzt, was in Altaussee geschehen soll, in der Wohnung der Literar Mechana, in einer Arbeitsklausur, die möglich wird, weil Peter Mayer die halbe Schule zu einer Exkursion nach China führt.
Apropos Prosa: Mein Roman »Die Irren und die Mörder« ist, ohne daß das hätte geplant sein können, zu einer Gegenthese zu all dem geworden, was die Polizei der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Franz Fuchs auf die Nase binden möchte. Der Roman sollte also endlich erscheinen.
Montag, 13. Oktober 1997
Altaussee. Was sofort für die Wohnung spricht, ist die Veranda überm See. Und: In einem Schrank steht Grimms Wörterbuch in 33 Bänden.
Dies ist nicht der erste Arbeitsurlaub, aber der erste in Österreich. Die Fremdsprachigkeit rundum fehlt mir.
Altaussee wirkt ausgestorben, verschlossen, zugesperrt.
Dienstag, 14. Oktober 1997
Gasthaus zur Mühle. Der Wirt ist ein Eisenbahn-Fan, überall kleben Pickerl, die man sonst in Waggons und auf Bahnhöfen findet. Der kleine Raum, wo die Schank und drei Tische stehen, hat den herben Charme der Bahnhofsrestaurationen der 50er-Jahre. Die Einheimischen sitzen in der Gaststube, in der wir keinen Platz gefunden haben. Ein paar von den Männern sitzen mit den Hüten auf den Köpfen am Tisch.
Wir improvisieren Dialoge für die »Erben«. Ich notiere wenigstens Stichworte.
Mittwoch, 15. Oktober 1997
Wir schreiben zum ersten Mal gemeinsam, und das geht recht gut.
Am Abend beim Schneiderwirt entwickeln wir Szenen weiter, improvisieren wieder Dialoge.
Donnerstag, 16. Oktober 1997
Herr Haider will, höre ich, schon wieder das Volk abstimmen lassen. Nach dem Veto der Gewerkschaften zur Pensionsreform schlägt Haider vor, das Volk möge doch selbst darüber entscheiden. So kann man Populismus auch verstehen, daß man Entscheidungen einfach verweigert und abschiebt.
Freitag, 17. Oktober 1997
Die wenigen Fremden, die jetzt in Altaussee sind, laufen einander ständig über den Weg. Gestern beim Abendessen im Gasthaus zur Mühle sehen wir ein Paar, das wir bisher noch an jedem Abend in irgendeinem Gasthaus gesehen haben. Weil’s nach einem Ruhetag kalt ist in der Mühle, übersiedeln wir in ein Lokal, das als eine Art Heuriger geführt wird, und nach einer halben Stunde ist auch jenes Paar dort. Man lacht, man wechselt ein paar Worte, später kommt die Frau an unseren Tisch und fragt, ob wir denn nicht an den ihren kommen möchten.
Die beiden stammen aus Wuppertal, sie hat hier an einem Seminar über Gruppenanalyse teilgenommen, jetzt haben sie noch eine Woche Urlaub drangehängt. Ich erfahre, was ich mir unter Gruppenanalyse vorzustellen habe: Psychoanalyse der eher klassischen Art, aber eben in der Gruppe. Meine Skepsis gegenüber der Psychoanalyse überhaupt wird eher bestätigt, teilweise auch geteilt. Bei den von ihr praktizierten Verfahren, sagt die Frau, könne man bei etwa sieben Prozent der Patienten von Heilerfolgen sprechen. Ein berauschendes Ergebnis ist das nicht. Was unter Heilung denn recht eigentlich zu verstehen sei? Nur die Anpassung an die jeweils gerade als solche definierte Normalität? Oder ob es nicht eher Aufgabe der professionellen Helfer sein müßte, ihre Klienten derart zu stärken, daß sie mit ihren je eigenen psychischen Besonderheiten leben könnten? Diese Fragen scheinen die Dame nicht wirklich zu interessieren.
Der Mann, der sie begleitet, arbeitet in einem großen Betrieb und leitet dort, wie ich aus seinen etwas kryptischen Aussagen schließe, das Rechnungswesen. Vielleicht ist er aber auch ein simpler Buchhalter. Er kennt sich in österreichischer Geschichte aus und kann allerlei Jahreszahlen hersagen.
Der Heurige sperrt bald zu. Als ich versuche, die Wirtin zu überreden, noch eine letzte Runde herauszurücken, erfahre ich, jene deutsche Dame habe schon eine Flasche Rot und eine Flasche Weiß zum Mitnehmen bestellt und bezahlt. Wir sind eingeladen, noch was in der Ferienwohnung der Wuppertaler zu trinken. Wir sind ja leicht zu überreden.
Das Auto steht vor dem Heurigen, stehen will ich’s hier nicht lassen, aber Tonja will zu Fuß gehen. Schließlich fahren die Analytikerin und ich im Auto, Tonja und der Rechnungsverweser gehen zu Fuß.
Als die Gruppenanalytikerin und ich vor dem Häuschen ankommen, darin sie mit ihrem Lebensabschnittspartner Wohnung genommen hat, fragt sie mich: »Sind Sie jüdisch?«
»Leider nein«, sage ich. »Und Sie?«
Sie ist Jüdin. Das bestimmt die weitere Abendunterhaltung in der Ferienwohnung unterm Dach des kleinen Ausseer Häusls. Ich sondere in meiner nun rasch zunehmenden Trunkenheit philosemitische Bekenntnisse ab. Ich rede, was ich wie das übrige auch ernst meine, darüber, wie sehr die jüdischen Autoren der österreichischen Literatur fehlten. Ich frage die Analytikerin, die vierzig ist, danach, wie ihre Eltern überlebt hätten, und sie weiß es nicht, was mich doch ein wenig wundert. Ob sie sowas wie Antisemitismus spüre in Deutschland? Sie bejaht, ohne es näher erklären zu können. Sie meint, jüdisch auszusehen. Sie habe einmal als Tropenmedizinerin inmitten von Semiten gearbeitet, und überall sei sie als Semitin durchgegangen. Was bedeute das schon, frage ich, sie habe mich unten auf der Straße für einen Juden gehalten. Und sie sieht, das sage ich nicht so direkt, wie irgendeine deutsche Lehrerin aus, zum Beispiel aus Wuppertal. Oder aus Castrop-Rauxel oder aus Wanne-Eickel.
Er könne nichts dafür, sagt der Mann dazwischen immer wieder, er sei nun mal rein arisch, und er verwendet dabei, anscheinend ohne es zu bemerken, das Nazi-Vokabular. Und, ach!, diese Neigung so vieler Deutscher, sich im Ausland als Repräsentanten ihres Landes zu sehen: »Ich bin nun mal ein richtiger Deutscher«, sagt er. Und ich denke nach, was mich wohl dazu verleiten könnte, mich irgendwo einmal als richtigen Österreicher zu bezeichnen.
Und ich vergegenwärtige mir, betrunken oder nicht, immer wieder, wo dieses merkwürdige Gespräch stattfindet, im Ausseer Land nämlich, wo Herr Doktor Wilhelm Höttl immer noch lebt, hochgeachtet, pensionierter Direktor eines Privatgymnasiums heute, SS-Obersturmbannführer seinerzeit, den man in Nürnberg nicht aufgehängt hat, weil er rechtzeitig in CIC-Dienste getreten war. Ein in die geheimsten Geheimnisse der Nazis Eingeweihter. Von ihm hat die Welt erfahren, daß es etwa sechs Millionen Juden waren, die von den Nazis umgebracht wurden.
Auf der Veranda nebenan am späten Nachmittag ein Mann, der mit einer Fliegenklatsche umgeht. Drei Fliegen schlägt er tot, mit großer Akribie, und wirft sie aus dem Fenster.
Kurz vor Mitternacht noch einmal draußen auf der Veranda. Leichter Nebel liegt überm See. Ein fast noch voller Mond hinter einem dünnen Schleier. Ein Stück Seeufer ist zu sehen, nicht mehr. Die Berge ringsum sind verschwunden. Ich denke mir ein Ausseer Land ohne Berge zurecht. Ein Österreich am Meer. Ein Deutschland mit einer riesengroßen Wüste mittendrin.
Samstag, 18. Oktober 1997
Am Abend im Gasthaus zur Mühle.
Arbeit wie gewohnt. Wir sitzen nun im Gastzimmer unter den Eingeborenen.
Am Stammtisch gleich nebenan fragt einer, was wohl besser sei, Alzheimer oder Parkinson. Die Antwort lautet: Alzheimer. Denn besser sei es zu vergessen, eine Halbe zu bezahlen, statt ein Viertel zu verschütten.
Tonja und ich überlegen, was wohl der dümmste Wirt sei, den wir je kennengelernt haben (und wir haben in reichlich dreißig Jahren viele kennengelernt). Der hier, darin sind wir einig, hätte gute Chancen auf einen vorderen Platz in den Charts.
Sonntag, 19. Oktober 1997
Gestern in Bad Aussee beim Einkaufen erfahre ich aus einer »Die ganze Woche«-Schlagzeile, daß Franz Fuchs seine Handprothesen selbst wird zahlen müssen. Da schau ich aber!
Immer klarer wird, wieso man den Herrn aus Gralla so verbissen als verrückten Einzeltäter hinstellen möchte. Wenn’s wirklich so wäre, müßten wir nicht beunruhigt sein. Verrückte gibt’s halt immer und zu allen Zeiten, da kann man nichts machen. Die andere, für mich viel wahrscheinlichere Variante hingegen, daß nämlich Politik bei all dem sehr wohl eine Rolle spielt und daß Herr Fuchs eben kein Einzeltäter ist und mit den wirklichen Bomben-Terroristen vielleicht nicht einmal Verbindung hat, diese Variante müßte uns sehr beunruhigen. Also versucht man uns die Einzeltäter-Theorie einzureden.
Am Abend auf Arte ein langes Lino-Ventura-Portrait. Einer sagt, wenn Lino zur Tür hereingekommen sei, sei das Zimmer möbliert gewesen. Wie uns hierzulande Schauspieler dieser Art fehlen! Bei manchem der unsrigen wirkt das Zimmer, das sie eben betreten haben, noch leerer als zuvor.
Montag, 20. Oktober 1997
Oben auf dem Loser in der Sonne. Die Dohlen kommen an die Tische, wollen gefüttert werden, holen sich notfalls selbst von den Tellern, was sie wollen. Mächtig viel Gebirge ringsum. Ich kann die sogenannten majestätischen Landschaften (Wüsten ausgenommen) nicht leiden. Die hohen Berge bedrücken mich nicht, ich komm mir auch nicht klein vor daneben, ich kann sie bloß nicht leiden.
Dienstag, 21. Oktober 1997
Am Abend im Gasthaus zur Mühle (die meisten anderen Gasthäuser sind die halbe Woche lang zu) »dichten« wir das Geburtstagspoem, das wir für den Anfang der »Erben« noch brauchen. Tonja lacht Tränen.
Mittwoch, 22. Oktober 1997
Um dreiviertel sechs aufgestanden, weil das Gehirn schon angefangen hat auszuprobieren, ob das im fünften Akt praktisch gehen könnte, wie wir es gestern so lang beredet haben. Von sieben weg dann am Computer, und – siehe! – es geht genau so, wie wir uns das gedacht haben.
Nachmittag am Grundlsee. Tonja geht, weil sie halt immer gehen muß, zum Toplitzsee, ich sitze beim »Veit« und notiere ins Tagebuch. Ein älteres Ehepaar kommt in die Gaststube, die Frau murmelt was von einem Dichter da drüben und sagt dann »Der schreibt jetzt vielleicht über uns«. Mein klares »Nein!« beleidigt sie, glaube ich.
Interessant wäre es herauszufinden, was dieser merkwürdige Menschenschlag, der mir geistig autark in diesem Kessel zu leben scheint, wirklich von den Schriftstellern hält, die sich, wenn sie tot sind, ebenso trefflich ins Fremdenverkehrsmarketing integrieren lassen wie all die Schauspieler, die hier einmal Sommerfrische genossen haben. Im Falle jenes Mimen, der hier geboren ward, scheut man sich nicht, auch schon einen Lebenden zu ehren: Es gibt eine Klaus-Maria-Brandauer-Promenade, die, wenn ich es richtig sehe, von Altaussee nach Bad Aussee führt und, wenn der Blick von der Bundesstraße aus nicht täuscht, an einer Stelle abgerutscht zu sein scheint, woraus sich (zu) billig zu bröckelndem Ruhm assoziieren ließe. Übrigens wäre es mir, wenn fragwürdige Ehrungen dieser Art schon sein müssen, adäquater erschienen, an Karin Brandauer zu erinnern.
Spät in der Nacht auf 3sat zum hundertsten Geburtstag von Lernet-Holenia ein Film, der zu seinem 75. gedreht wurde. Axel Corti interviewt den Jubilar und mir fällt wieder einmal ein, wie sehr er mir immer noch in den Klassenleiter-Sitzungen fehlt. Hans W. Polak, der einmal auch mein Verleger war, hat für Lernet-Holenia ein Geburtstagsfest ausgerichtet, und ich sehe, daß damals Schriftsteller noch Anzug und Krawatte trugen.
Donnerstag, 23. Oktober 1997
Am Morgen zum ersten Mal ein bißchen Wind. Zum ersten Mal plätschert der See.
So still wie in diesem Haus am See hab ich, glaub ich, noch nie gewohnt. Ich erinnere mich, daß die Analytikerin aus Wuppertal erzählt hat, mehrere Teilnehmer ihres Seminars hätten noch ein paar Tage hier bleiben wollen, seien dann aber vorzeitig abgereist, weil sie diese Stille nicht ertragen hätten.
Im Zusammenhang mit dem Hörspiel, das ich von übernächster Woche an in München produzieren werde, hab ich neulich mit Marcus und Gicko überlegt, wie »Nacht« denn eigentlich klinge, und wir sind darauf gekommen, daß weit entfernte Geräusche, die man nur hört, wenn es in der Nähe ganz still ist, am ehesten einen akustischen Nacht-Eindruck suggerieren.
Akustisch ist es hier, wenigstens zu dieser touristenarmen Jahreszeit, Nacht auch am hellen Tag.
Am letzten Abend in Altaussee (wir sind mit der Arbeit fertiggeworden) beim Schneiderwirt. Wir reden nicht mehr über die »Erben«, wir reden nicht mehr übers Ausseer Land, sondern über Dinge draußen in der Welt jenseits von Pötschen, Koppen und Loser. Es gibt sie ja, diese Welt, wenn man es hier manchmal auch nicht glauben mag.
Draußen in bitterer Kälte ist eine Meisterschaft im »Taubenschießen« im Gange. Ein hölzerner, eisenbeschlagener Vogel mit Stahlschnabelspitze, der an einem langen Seil hängt, ist auf eine Zielschiebe hin loszulassen. Wir dürfen’s probieren, und weil wir uns weniger patschert als offenbar erwartet anstellen, kriegen wir einen Marillenschnaps.
Freitag, 24. Oktober 1997
Beim Heimfahren sehen wir: Die ersten Schneestangen werden aufgestellt.
Kaum in Losenstein möchte ich auf eine Veranda hinaustreten und auf den Altausseer See blicken.
Samstag, 25. Oktober 1997
Utopien basieren auf dem Wunsch, daß diese Welt menschenfreundlicher sein könnte. Wer keine Utopien entwickelt, der hat sich abgefunden.
Bei exponentiellen Entwicklungen geschieht alles am Schluß. Ein Seerosenteich: Jede Nacht teilen und verdoppeln sich die Seerosen, am vorletzten ist der Teich halbvoll, in der letzten Nacht ist er dann ganz voll. Die Hälfte der ganzen Entwicklung geschieht in der letzten Nacht, drei Viertel der Entwicklung geschehen in zwei Nächten, ganz egal, ob die Entwicklung vorher eine Woche, ein Jahr oder eine Million Jahre gedauert hat.
Sonntag, 26. Oktober 1997
Julia ist – beeindruckt und jetlag-müde – aus China zurück.
Montag, 27. Oktober 1997
Der erste Schnee. Und die Nachricht, Franz Kain ist gestorben. Wer sich jetzt wohl aller, auf ihn nachrufend, neben ihn hinstellen wird. Die »99«-Nummer 28 ist fertig, aber noch nicht in der Druckerei. Ich möchte nicht in Versuchung kommen, nach seinem Tod etwas über ihn sagen, was ich nicht auch schon vorher gesagt hab, also schieb ich – auch weil ich weiß, daß sie ihm gefallen hat – die Laudatio, die ich zur Verleihung des Adalbert-Stifter-Preises auf ihn gehalten hab, noch rasch ins Heft hinein.
Dienstag, 28. Oktober 1997
Julia fährt mit mir nach Wien, erzählt weiter von China, dann hat mich die Schule wieder.
Mittwoch, 29. Oktober 1997
Nach der Vorlesung für den ersten Jahrgang eine Studienkommissionssitzung, in der ich meine Stellungnahme zum neuen UniStG zur Beschlußfassung vorlege. Was man uns dabei zumutet, ist ärgerlich. Ein paar Beamte (es fällt schwer, in diesem Zusammenhang nicht von ahnungslosen Sesselfurzern zu reden) haben sich eine Reform ausgedacht, weil das halt immer gut klingt, wenn man reformieren will. Fachleute hat man bewußt nicht beigezogen. Und so sehen die Reformvorschläge denn auch aus.
(Wie geht’s? fragt der Blinde den Lahmen. Wie Sie sehen, antwortet der Lahme.)
Die Mindeststudiendauer soll von zehn auf acht Semester verkürzt werden, das klingt gut (kürzer ist besser, oder nein?), aber es bedeutet, daß wir die Absolventen schlechter ausgebildet in eine Branche hinausschicken werden, die nicht eben einfacher wird. Aus den fünf Studienrichtungen unserer Abteilung Film und Fernsehen soll eine einzige mit fünf Studienzweigen werden. Das heißt, man will kleine, flexible und autonome Einheiten zerschlagen und durch eine große, viel bürokratischere ersetzen. Erspart wird dadurch kein Groschen.
Mit einem Wort: Das Studium wird fürs gleiche Geld schlechter und komplizierter werden.
Ziel der Reform sei, habe ich irgendwo in den Papieren gelesen, eine Vereinheitlichung der Ausbildung. Als ob das ein Wert für sich wäre und als ob gerade in der künstlerischen Ausbildung nicht Vielfalt und Differenzierung mindestens ebenso hohe Werte wären!
Donnerstag, 30. Oktober 1997
»Die Irren und die Mörder«: Ich unterschreib den Vertrag, der Roman wird also im Frühjahr im Otto Müller Verlag Salzburg erscheinen.
Freitag, 31. Oktober 1997
Spät am Abend, ich will schon schlafen gehen, zappe ich noch rasch durch die Programme und sehe auf einmal zwei mir wohlbekannte Gesichter: Rolf Boysen als Lear und Thomas Holtzmann als Gloster (in Dieter Dorns Münchner Inszenierung). Ich war fünfzehn oder sechzehn, fing an, an einen Beruf zu denken, der mit Literatur, Theater und Film zu tun haben könnte, da sah ich im Fernsehen Boysen und Holtzmann in Kortners »Clavigo«-Inszenierung und dachte (wahrlich) sehnsuchtsvoll: Mit solchen Leuten müßte man einmal arbeiten dürfen!
Ich wurde zwar fast fünfzig, aber immerhin, dann durfte ich. Und mit Rolf Boysen darf ich im Jänner wieder.
Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung.
Die »Lear«-Aufzeichnung dauert, sehe ich im Programmheft, bis drei in der Früh, so lange schaffe ich’s gewiß nicht, wach zu bleiben. Neben den beiden Granden kann, was schwer ist, der Darsteller des Kent wunderbar bestehen, ein hinreißender Schauspieler, den ich noch nie gesehen hab; ich muß nächste Woche in München seinen Namen erfragen.
1. November, 2 Uhr 15: Schluß. Die feste Absicht, dieses Tagebuch privat weiterzuführen, und das sichere Wissen, daß ich die dafür notwendige Disziplin nicht aufbringen werde.
August 1998
Samstag, 1. August 1998, Gabicce Mare
Caro diario, derTag begann so, daß Tonja um etwa ein Uhr »Aiuto!« schrie, was Hilfe heißt. Ich saß schon eine Weile auf dem Balkon des Hotelzimmers, auch Tonja wollte noch auf eine Zigarettenlänge herauskommen, sie schloß, auf daß keine lästigen Mücken ins Zimmer kämen, die Balkontür, und dann waren wir ausgesperrt, weil die Tür sich von außen nicht öffnen läßt.
Unten auf der Piazza alles ruhig, Gabicce Mare ist ein ruhiger Ferienort, um Mitternacht schließen die Bars; kein Mensch zu sehen, wir überlegen schon einmal, ob wir uns darauf einrichten müssen, die Nacht auf dem Balkon statt gleich nebenan im Bett zu verbringen, aber da kommt unten doch noch ein Auto an, Menschen steigen aus, die Hilfe schaffen könnten, und da schreit Tonja, der Landessprache ein wenig mächtig, »Aiuto!«, erregt Aufmerksamkeit damit und kann denen da unten irgendwie verständlich machen, worum es geht.
Ein paar Minuten später erlöst uns dann der Nachtportier.
Zu Mittag kommt eine junge Dame an unseren Tisch und stellt sich als unsere Animateurin vor. Ich sage, daß wir nicht animiert zu werden wünschen. Ich für meinen Teil, füge ich hinzu, möchte im Falle des Falles nicht einmal re-animiert werden. Unbeeindruckt davon sagt sie, daß wir am Nachmittag um halb vier am Swimmingpool gemeinsam spielen würden. Ich antworte ihr, daß ich schon als Kind von meiner Mutter davor gewarnt worden sei, mit wildfremden Menschen zu spielen, ich lozelach mir einen Wolf, bis ich merke, daß die junge Dame, falls überhaupt etwas, grad die paar Sätze auf deutsch versteht, die sie selber sagt.
Am Abend dann auf einer Piazza hinterm Rathaus zerren Animateure alle Damen unter 45, die nicht bucklig sind und weniger als hundert Kilo wiegen, zur Wahl der Miss Gabicce 98 auf eine kleine Bühne. Ein Hauch von Mallorca weht uns an, der Ballermann läßt grüßen. Und wir wissen immerhin, welche Ortsteile wir künftig meiden müssen.
Wir sind am Freitag von Losenstein weggefahren, wollten irgendwo unterwegs übernachten, sind dann so schnell vorangekommen, daß wir im Hotel angerufen haben, ob das Zimmer auch schon eine Nacht früher als reserviert frei wäre, und siehe, es war frei. Also ist das schon der erste ganze Urlaubstag, aber der Kopf ist noch zu Hause.
Noch denke ich an Thomas W.s Drehbuch, mit dem er zum ersten Diplom antreten will, und ob das auch richtig ist, was ich ihm dazu geschrieben hab.
Noch denke ich an die Jurysitzung für den Landeskulturpreis, die am Donnerstag stattgefunden hat, wo der Preis einstimmig Thomas Baum zuerkannt wurde, der noch nichts weiß davon.
Am Mittwoch hab ich den neuen Roman an den Verlag geschickt, und mir drängt sich diese viel zu pathetische Formulierung auf: Die Wunden, die er gerissen hat, sind noch nicht geschlossen. So stimmt das natürlich nicht, aber irgendwas ist tatsächlich noch offen. Jener große Topf, darin das Unbewußte vor sich hin köchelt und blubbert und aus dem, wenn wir schreiben, all das kommt, worüber wir uns, wenn’s erst da ist, selber wundern. Zuerst läßt sich der Deckel gar nicht so heben, aber noch schwerer ist es, ihn wieder auf den Topf zu setzen, wenn man, was daraus aufsteigt, nicht mehr braucht, weil (wie in diesem Fall) der Roman fertiggeschrieben ist. So wird noch ein Weile ins Bewußtsein treten, was ich jetzt dort gar nicht mehr haben will, und ein paar Nächte mit höchst seltsamen Träumen stehen mir noch bevor.
Auch sonst läuft der Motor (das Hirn) immer noch auf hohen Touren, aber im Leerlauf. Stoppen kann man ihn nicht, er muß langsam auslaufen.
Das mit den Wunden, vorhin schnell hingeschrieben, stimmt wenigstens zum Teil. Zwei Jahre, genau zwei Romane und ein Drehbuch lang, hab ich mich jetzt mit Figuren von höchst unappetitlich rechtsextremer, wenigstens autoritärer Gesinnung schreibend abgegeben und insofern auch eingelassen, als man, wenn man sie beschreiben und glaubwürdig handeln lassen will, versuchen muß, in ihre (kranken?) Gehirne hineinzukriechen. Sowas hinterläßt tatsächlich Spuren, Wunden merkwürdiger Art, in der eigenen Psyche.
Sonntag, 2. August 1998, Gabicce Mare
Aufstehen. Frühstücken. Die kleine Treppe zum Strand hinuntergehen. Herumliegen. Eine halbe Stunde im Wasser, schwimmen kann man das bei mir nicht nennen, bei Tonja schon, aber ich steh nach Art der Einheimischen die meiste Zeit nur bis zum Hals im Wasser herum. Dann, nachdem Tonja sich umgezogen hat, die seit Jahrzehnten zum Urlaubsritual gehörende Feststellung »Die Bar ist geöffnet.« Un café. Ist es noch zu früh für einen Gin Tonic? Aber nein. Dann ist es eh Zeit zum Mittagessen. Siesta im angenehm klimatisierten Zimmer. Wieder Strand, wieder herumliegen, Robert Gernhardt »Die Blusen des Böhmen« fertiggelesen (ein paar Dinge drin sind schon ganz hübsch, aber genau genommen ist der Titel das Beste). Im Wasser herumstehen, und die Strandbar ist immer noch geöffnet. Abendessen. Dann, Tonja läßt es sich nicht ausreden, ein bissel spazierengehen. Schließlich eine Bar fünfzig Meter überm nächtlichen Meer. Die Kellnerin hat so enge Hosen an, daß sie sich nicht bücken kann. Immer noch 38 Grad Celsius. Die Sehnsucht nach ein bißchen Wind. Das Hotelzimmer, wie gesagt, hat erfreulicherweise eine Klimanlage.
Montag, 3. August 1998, Gabicce Mare
Normalität stellt sich ein, man ist die zwei Hauptstraßen des kleinen Ortes schon rauf- und runtergegangen, man weiß, wo die Animateure toben, und die Kellnerinnen und Kellner in den Bars wissen schon, was man trinkt.
Dreimal am Tag im Hotel ein paar Sätze über dies und das mit dem Oberkellner, den wir, wiewohl er auch zu Mittag und am Abend die übrigen Kellner und Serviererinnen kommandiert, den Frühstücksdirektor nennen. Stets ist er, der Hitze nicht achtend, sehr elegant und der jeweiligen Tageszeit entsprechend gekleidet, dies hier nennt sich immerhin Grand Hotel. Sein ziemlich perfektes Deutsch hat er als Gastarbeiter in Aachen gelernt, und er hat prachtvolle Zahnlücken, die unübersehbar sind, wenn er lacht, und er lacht gerne.
Am Strand fange ich an, »Ins unentdeckte Österreich« von Karl-Markus Gauß zu lesen.
Starker Wind am Abend. Wie wird das Meer morgen sein? Im Urlaub ist man (wieder) wetterabhängig.
In der Bar hoch überm Meer am Nebentisch ein Mann mit einem Mädchen von – was weiß ich – sieben oder acht Jahren. Er geht sehr zärtlich mit ihm um. Ein wenig zu zärtlich vielleicht? Die Hand des Mannes auf dem kleinen Hintern des Mädchens, eigentlich fast schon zwischen ihren Beinen. Tonja und ich sehen uns an und wissen nicht, ist das ein Kinderschänder – oder ist man selber durch all das, was man gehört hat in letzter Zeit, sozusagen übersensibilisiert? Daß der Mann, was er tut, ganz öffentlich tut, könnte ein Hinweis darauf sein, daß es ganz harmlos gemeint ist. Aber wer sagt uns, daß wir nicht einfach neben einem besonders ungenierten Kinderschänder sitzen?
Dienstag, 4. Oktober 1998, Gabicce Mare
Der Ort hat zwei Teile: Gabicce Mare unten am Meer, Gabicce Monte, wie auch hier der Name nahelegt, oben auf einem Berg. Dort hinauf kann man mit einer Art Liliputbahn fahren, was Tonja, die ja auch das Karussellfahren liebt, unbedingt tun muß. Also tun wir’s, und des Blickes wegen von da oben aufs Meer hinaus lohnt es sich allemal: Der gekrümmte Horizont legt die Vermutung nahe, die Erde sei, wie es so viele behaupten, eine Kugel.
Was den Aufenthalt hier – neben anderem – sehr angenehm macht: Keine Gelsen, keine Mücken, keine Moskitos. Wo sind die Viecher hingekommen, die einen vor Jahrzehnten, auch vor ein paar Jahren noch, in diesen Gegenden oft im Wortsinn bis aufs Blut gequält haben? Der Oberkellner im Hotel weiß nur, daß irgendwer irgendwas dagegen unternommen hat, was genau, weiß er nicht.
Gestern, fällt mir noch ein, im Fernsehen, das wir laufen haben, wenn wir uns zum Abendessen anziehen, ein RTL-Bericht über das Nitsch-Spektakel in Prinzendorf. Brigitte Bardot, so erfuhren wir, sei extra nach Wien gekommen, um die Ochsen vor Nitschens Schlachtern zu schützen. Eine Wiener Rechtsanwältin, Nitsch-Adorantin der verzücktesten Art, verteidigt, was sie meint, verteidigen zu müssen, und beantwortet die Frage, ob nicht auch Menschenopfer rituellkünstlerische Qualitäten haben könnten, mit dem Hinweis, daß sie sich das wohl vorstellen könne und sie wahrscheinlich einem solchen Akt auch beiwohnen würde. Man kann in der Tat manchmal gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Nicht nur, weil ich mich immer noch wundere, daß sich die Erde nicht blitzschnell auftut und jemanden, der so deppert ist, einfach verschlingt. Diese blöde, blutverzückte Kuh hat in der Tat einfach nicht kapiert, daß die Prinzendorfer Großheurigen-Besucher auf eine Stufe mit Mördern gestellt werden sollten. Vor allem aber dies: Als ob öffentliche Menschenschlachtungen und Hinrichtungen nicht über Jahrhunderte hinweg Volksbelustigungen allerersten Ranges gewesen wären! Und als ob nicht RTL heute, falls Hinrichtungen im Fernsehen übertragen werden dürften, Millionen und Abermillionen für die Übertragungsrechte zahlen würde.
Mittwoch, 5. August 1998, Gabicce Mare
Das Tagebuchschreiben widerspricht dem Sinn solcher Urlaube gründlich, der eben darin besteht, nicht zu schreiben, nicht alles, was man hört oder sieht, daraufhin zu überprüfen, ob man es sich für die spätere literarische Verwendung nicht aufschreiben sollte. Man kriegt das, ist man erst einmal professionell deformiert, ja eh nicht raus; ich sehe, höre und denke, das könnte man vielleicht brauchen, aber in dieser einen Woche im Jahr schreib ich’s nicht auf, verzichte einfach drauf, und das ist Luxus pur für mich.
Die andere Art des Reisens, wo man etwas sehen will, ist, seit unsere Kinder erwachsen sind, weniger heißen Jahreszeiten vorbehalten. So etwas wie hier hat mit Verreisen nichts zu tun für mich. Vom Hirnauslüften als dem einzigen Sinn eines solchen Aufenthalts rede ich manchmal. Dafür ist eine Woche natürlich viel zu kurz. Tonja würde gern drei Wochen lang bleiben, aber ich halte kaum diese eine Woche lang aus, am vierten oder fünften Tag werde ich unruhig, will wieder weg, obwohl ich weiß, daß ich nach drei Tagen zu Hause gern wieder am Meer wäre.
Das Meer muß schon sein für diese eine Woche, und, nachdem wir dies und das ausprobiert haben, muß es seit vielen Jahren schon Italien sein. Warum, darüber ließe sich ausführlich schreiben, und eben das werde ich jetzt nicht tun.
Auch nicht darüber, auf welche Art jeweils irgendwer in einem Hotel schon am ersten, zweiten Tag zu einer Art Bezugsperson wird. Diesmal unser Frühstücksdirektor. Letztes Jahr in San Mauro al Mare, dreißig Kilometer weiter nördlich, der Koch, der sich, wie wir zufällig herausfanden, täglich um Mitternacht an der Hotelbar einfand, um dort bei einer Flasche Sekt dem Nachtportier das Menu für den nächsten Tag zu diktieren. Kaum waren wir ins Gespräch gekommen, durften wir unsere Wünsche für den Speiseplan des nächsten Tages äußern. Manchmal waren unsere Wünsche seiner Meinung nach für ein Vier-Stern-Hotel zu bescheiden, zu wenig pompös, dann hat er für uns separat gekocht. Am Ende der Woche durften wir vom Sekt jener nur ihm reservierten Marke trinken.
Stürmischer Wind am Nachmittag.
Das Gauß-Buch, jetzt ausgelesen, gefällt mir gut. Vieles kannte ich freilich schon, aus früheren Gauß-Essays, auch aus eigenen. Echte Lese- und Denkfreude kommt auf, wo er über Dinge schreibt, über die ich nur oberflächlich informiert war, Doderers Obsessionen etwa, von denen ich vorher gar nichts wußte. Beim Kapitel über den Verleger Wucherer etwa oder natürlich bei dem über den wunderbaren Michael Guttenbrunner, der, seit Gauß ihn uns empfohlen hat, zu den »99«-Lesern gehört und, worauf wir stolz sind, manch eine Nummer zustimmend kommentiert.
Mutmaßungen über andere Hotelgäste, um sich die Zeit zwischen den einzelnen Gängen der Mahlzeiten zu vertreiben.
Ein Paar, das sich pro Stunde sechs- bis siebenmal zuprostet. Ihn halte ich für einen Rundfunkredakteur aus Deutschland, sie, etliches jünger als er und sehr schlank, hat ihn, behaupte ich, kennengelernt, als sie ihm eine Sendung vorgeschlagen hat, die dann, denke ich mir aus, nie produziert worden ist.
Eine Dame mittleren Alters allein an einem Tisch. Tagsüber oder auch nach dem Abendessen draußen auf der Hotelterrasse sieht man sie manchmal mit einem Herrn im vertrauten Gespräch, der im Speisesaal seinerseits allein an einem Tisch sitzt. Warum, fragen wir uns, sitzen sie beim Essen nicht zusammen?
Eine Familie mit drei Kindern: Die müssen mit gewaltigem Gepäck angereist sein, denn nie sieht man sie ein zweites Mal in der gleichen Kleidung, und alles sieht ganz neu aus, wie eben erst eingekauft. Die jüngste Tochter trägt spitzenbesetzte Söckchen. Die Mutter scheint großen Wert darauf zu legen, daß ihr Schuhwerk zum Kleid paßt. Sie trägt, behauptet Tonja, ein Mieder, und ich frage mich, an wen mich ihre Art sich zu schminken erinnert, bis ich auf die Hexe Gundel Gaukeley aus der Micky Maus komme. Am zweiten oder dritten Tag nehmen auf einmal die beiden älteren Kinder nicht mehr an den Mahlzeiten teil. Sind sie krank? Aber nein, sie sind draußen in der Hotelhalle, sausen auch schon einmal durch den Speisesaal. Haben sie sich etwa schlecht benommen und bei Tisch gerülpst oder gefurzt? Fragen über Fragen.
Wenige Fragen nur wirft eine nicht mehr ganz jugendliche Dame auf, die ihr sonnengeschundenes Dekolleté in immer neuen, noch tieferen Ausschnitten zu Schau stellt. Wenn sie einmal nicht beim Essen erscheint, mutmaßen wir, daß ihr Zielen und Trachten erfolgreich war; wir gönnen es ihr.
Ein Kapitel für sich wären die Russen, die ein Drittel des Speisesaales besetzen. Ohne sie, meint der Frühstücksdirektor, wäre der Fremdenverkehr in Italien schon zusammengebrochen.
Donnerstag, 6. August 1998, Gabicce Mare
Die ganze Nacht über stürmischer Wind, das Meer ist jetzt grau und schwappt weit ins Land hinein, an Baden ist nicht zu denken. Tonja will zum Friseur gehen. Soll ich auch? Zeit dafür wär’s schon lange. Ich zögere, aber: Was bleibt denn eigentlich einem Mann in dieser durchorganisierten, wohlverwalteten Welt als letztes Abenteuer? Na eben, ein Friseurbesuch. Immer ist die Gefahr einer Art von Persönlichkeitsverlust damit verbunden. Der Abenteuercharakter solcher Unternehmungen wächst in fremdsprachigen Landen. Allein, es ist eh wurscht. Egal, was man den Friseuren und Friseusen dieser Welt sagt oder nicht sagen kann, sie schneiden ja doch, wie sie wollen, und scheinen ihre eigene Maßeinheit zu haben, wenn ich zwei Zentimeter sage, schnippeln sie zwei Zoll ab. Ich riskiere es, und Tonja findet das Ergebnis gar nicht so schlimm.
Zu Mittag sehen wir, auch der Frühstücksdirektor war beim Friseur, ihn hat’s schlimm erwischt, er ist für Wochen arg entstellt. Ich freue mich, ich hab Glück gehabt, bin wieder einmal davongekommen.
Am Nachmittag beruhigt sich das Meer, und am Abend fällt mir der Plot einer Geschichte (eines kleinen Romans, eines Drehbuchs) ein, der Titel könnte sein »Die Tragödie eines lächerlichen Mannes«.
Freitag, 7. August 1998, Gabicce Mare
Ein wunderbarer träger Badetag, der letzte hier, und ich will – seltsam genug! – noch gar nicht weg. Ich kenne mich kaum wieder. Die ganze Woche lang kein Fluchtreflex, der mich veranlaßt hätte, wenigstens für ein paar Stunden irgendwohin, zum Beispiel ins Landesinnere, zu fahren.
Samstag, 8. August 1998, Cavriglia (Chianti)
Von der mittleren Adria über den Apennin hinüber in die Toskana.
Ein kleines Stück Autobahn am Anfang, ein kleines Stück am Ende, dazwischen Landstraßen durchs Wald- und Macchia-Italien. In einem Dorf auf neunhundert Meter Höhe steigen wir aus, um in einer Bar einen Kaffee und Mineralwasser zu trinken. Ob man auch eine Kleinigkeit essen könnte? Die Greisin, der die Bar offenbar gehört, kommt hinter der Theke hervor, geht hinaus, holt aus dem Laden nebenan, der ihr offenbar auch gehört, prosciutto crudo. Dann sitzen wir draußen inmitten der Männer des Dorfes, ein Kunstschmied macht Mittagspause, ohne seine Werkstatt abzuschließen. Die alte Frau läuft hin und her, um herüben Kaffee zu machen, ein Glas einzuschenken und drüben alimentari zu verkaufen.
Eine hochbeinige vielfarbige Katze, ein alter Mann, der Wirt, wie es scheint, packt sie am Schwanz, hebt sie hoch, läßt sie aufs Pflaster hinunterfallen, die anderen Männer lachen. Zwei cacciatori, auf italienische Art weidmännisch gekleidet, kommen im offenen Jeep, wirken geschäftig, gar hektisch, fahren gleich wieder ab. Eine Frau kommt zum Einkaufen, in einem BMW mit Mailänder Kennzeichen (noch sieht man die alten Nummernschilder, an denen man die Herkunft erkennen kann), offenbar gibt es Ferienhäuser in der Gegend.
Cavriglia, wohin Mary Jacobson uns eingeladen hat, liegt auf halbem Weg zwischen Florenz und Siena, mitten im Chianti-Land.
Mary J. hat Tonja in München einen genauen Plan gezeichnet, wie man zu ihrem Haus kommt, wir finden es auf Anhieb, und es ist nicht eigentlich ein Haus, eher ein Anwesen. Etliche Hektar Weinberge und Olivenhaine rundherum. Ein sorgfältig renoviertes Herrenhaus, zwei kleinere Häuser daneben, in einem wohnt Tarek, der polnische Chauffeur und Gärtner, das andere, casetta genannt, kriegen wir: Ein Wohnzimmer mit einer kleinen Küchenecke, ein Schlafzimmer, ein Bad.
Es sei jetzt ruhig hier geworden, hören wir. Den Juli über seien die Häuser voll gewesen. Jetzt ist nur Pavel da, über den wir Mary J. kennengelernt haben, und Raoul, den Pavel stets mit »mon général« anredet, Tunesier, french educated, wie er sagt, jetzt amerikanischer Staatsbürger.
Wir werden mit der Hausordnung bekannt gemacht: Den Tag über tut jeder, was er will, kein gemeinsames Frühstück, aber für den, der Lust hat, gibt’s zu Mittag eine Kleinigkeit im Haus, Pflichttermin ist nur das gemeinsame Abendessen in einem Restaurant in der Umgebung. Dabei gilt es die »eiserne Regel« zu beachten, daß im Umkreis von vierzig Kilometern niemand bezahlt außer Mary J.
Sie ist an die siebzig, immer noch schön, sehr klein, sehr zerbrechlich wirkend, die Witwe eines höchst erfolgreichen Schlagertexters. Sie haben dieses Anwesen vor fünfundzwanzig Jahren gemeinsam gefunden, das Haus sei, sie zeigt uns Fotos, desolat gewesen, aber ein Architekt habe sie darauf hingewiesen, daß man wohl ein Haus, nicht aber eine Aussicht umbauen könne. Von Anfang an sei das Haus den Sommer über voll mit Freunden gewesen, und so macht Mary auch weiter, seit ihr Mann tot ist, sie will nichts verändern, das Leben soll weitergehen wie zuvor.
Pavel ist gestern erst aus Wien gekommen, zwar schon seit Ende Juni in Cavriglia, aber er unterbricht den Aufenthalt für die Zwei-Wochen-pro-Monat-Konsulententätigkeit beim ORF. Wir spekulieren über mögliche Veränderungen im ORF nach der fälligen Generalintendanten-Wahl, wir reden über die Hochschule, wo er in meiner Klasse einen Lehrauftrag hat. Es geht ihm, scheint es, gesundheitlich ganz gut, mit eiserner Disziplin, die ich von einem ehemaligen deutschen Leistungssportler wie ihm auch erwarte, absolviert er sein Trainingsprogramm, allerhand Längen im Swimmingpool, eine Viertelstunde Strampeln auf einem Zimmerfahrrad. Lange, sagt er, habe er sich gegen dieses Training gewehrt, von dem in seinem Alter, er ist 79, kein Leistungszuwachs mehr zu erwarten sei, nur mehr die Erhaltung des Ist-Zustandes auf unbestimmte Zeit.
Raoul, der manchmal wie ein melancholischer Frosch aussieht, sitzt allein an einem Tisch und legt Patiencen.
Für den Abend ist ein Tisch bei Gianetto reserviert, man fährt fünfzehn oder zwanzig Minuten, Pavel sitzt neben mir im Auto und warnt mich davor, daß mir gleich nach der nächsten Kurve die tiefstehende Sonne genau in die Augen scheinen werde.
Nach dem Essen, für das das Lokal – zu Recht übrigens – weithin berühmt zu sein scheint, holt Gianetto, der Wirt, auf Pavels Wunsch die Ziehharmonika, Gesang ist angesagt. Gianetto spielt und singt, was gut und populär ist, nichts ist ihm heilig. Pavel singt, wo er den Text weiß, mit, sonst übernimmt er lautmalerisch den Part, den in Arrangements für Blasmusik die Tuba zu spielen hätte. Auch Tonja singt schließlich, Gianetto will mit ihr und Pavel, zu dritt also, das Capriccio italien von Tschaikowsky vierstimmig singen.
Den Reaktionen der anderen Gäste nach zu schließen ist es ein seltenes, nur engen Freunden vorbehaltenes Ereignis, wenn Gianetto singt. Meinem Wunsch, die guten alten italienischen Partisanenlieder zu singen, verweigert er sich – mit dem Hinweis auf die vermutlich unterschiedlichen politischen Ausrichtungen seiner Klientel. So wollen ihn denn Tonja und Pavel mit österreichischem Liedgut vertraut machen und proben mit ihm »Mariandl-andl-andl«, Pavel singt dabei stets »Mari-Antel-Antel-Antel«, was die anderen Gäste, mit österreichischer Filmkunst nicht vertraut, kaum zu würdigen wissen.
Sonntag, 9. August 1998, Cavriglia
In »unserer« casetta wüchsen, hinderte sie nicht ein Fliegengitter, zum Wohnzimmerfenster, von dem aus man das Tal überblickt, die Zweige eines Mandelbaumes herein. Vielleicht, überlege ich mir, sollte ich die ersten paar Zeilen jener neuen Geschichte, die mir vor ein paar Tagen eingefallen ist, an diesem kleinen Tisch schreiben, der unterm Fenster steht. Die ersten Sätze zu schreiben, hat immer etwas Zeremonielles, dies wäre ein guter Platz dafür.
Da wir nur drei Tage bleiben wollen, verzichten wir auf das Angebot, uns tagsüber zurückzuziehen, aber die Unterhaltung ist schwierig. Wenn wir deutsch reden, ist Raoul immer ein wenig beleidigt und zieht sich zu seiner Patience zurück. Reden wir aber, damit er uns versteht und mitreden kann, englisch, so leiden wir – Mary J. ausgenommen, die seit Jahrzehnten winters in New York lebt – unter der furchtbaren Primitivität unserer Sätze, die eine differenzierte Behandlung welchen Themas auch immer einfach nicht zuläßt.
Raoul, ursprünglich wohl ein Bekannter von Mary’s Sohn, verbringt schon viele Sommer im Jacobs’schen Haus, jetzt ist er seit vier Wochen hier, wird wohl noch ein Weilchen bleiben. Er geht, scheint es, auch bald auf die siebzig zu, und was er in seinem Leben getan hat, weiß man nicht so recht. Über den amerikanischen Film der 40er-Jahre weiß er wirklich gut Bescheid, und einmal erzählt er mir von einem selbstverfaßten Aufsatz über die großen Philosophen des 17. Jahrhunderts, aber wenn ich ihn recht verstehe, ist das auch schon ein paar Jahre her, daß er den geschrieben hat.
Mary J. erzählt von ihrem Zahnarzt unten in Montevarchi, sie vertraut ihm schon seit vielen Jahren und notfalls sucht sie ihn auch im Winter von New York aus auf.
Ich teile Pavel meine Beobachtung mit, daß italienische Männer sich öfter als die Männer aller anderen Völker, die ich kenne, am Sack kratzen. Woran mag das nur liegen? Waschen sie sich so wenig, daß es ständig juckt da unten? Oder wollen sie sich nur immer wieder rasch versichern, ob alles noch dran ist? Ich berichte von einem am Strand von Gabicce Mare, der diesen italienischen Volkssport mit solcher Hingabe betrieb, daß ich ihn zum italienischen Meister im Sackkratzen habe ernennen wollen. Da erzählt Pavel von seiner Offiziersausbildung in der deutschen Wehrmacht, zu der auch Benimm-Unterricht gehörte. Hätte ein deutscher Offizier der unguten Empfindung, die entsteht, wenn in der engen Uniformhose der Hodensack am Oberschenkel klebt (ganz offiziell Klebesack genannt), durch einen raschen Griff in den Schritt abzuhelfen versucht, in Gesellschaft anderer nämlich, womöglich gar in Damengesellschaft, so wäre dies, sagt Pavel, zu den ganz und gar unverzeihlichen Verstößen gegen Anstand und gute Sitte gezählt worden. Das als solches durchaus erkannte und anerkannte Problem des Klebesackes habe vielmehr diskret auf der Toilette behoben werden müssen.
Montag, 10. August 1998, Cavriglia