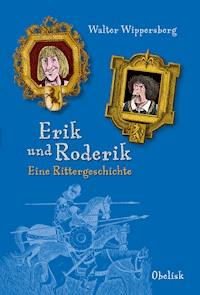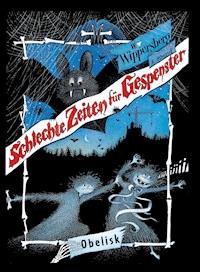Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Walter Wippersberg, bekannt als genauer Beobachter politischer Entwicklungen und als profunder Religionskritiker, erzählt diesmal über sich selbst. Er ist über sechzig, als er in die oberösterreichische Kleinstadt zurückkehrt, in der er aufgewachsen ist und die er neunzehnjährig verlassen hat. Er wird in jenes Krankenhaus eingeliefert, in dem er auch geboren wurde, und für eine Weile sieht es so aus, als würde er hier vielleicht auch sterben. Wippersberg erzählt von einer Nachkriegskindheit und von ein paar Monaten im Jahr 2006, die von lebensbedrohenden Krankheiten bestimmt sind. Auffallend genau, sehr eindringlich, ganz unsentimental und gerade deshalb berührend. Die beiden ineinander verschränkten Berichte lassen einen Sog entstehen, dem man sich kaum entziehen kann. Wie nebenbei öffnet das Buch Einblicke in die großen Fragen nach dem Leben und dem Tod und schlägt neben beklemmenden auch hoffnungsvolle Töne an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Wippersberg
Eine Rückkehr wider Willen
Walter Wippersberg
Eine Rückkehr
wider Willen
Zwei Berichte über mich
O T T O M Ü L L E R V E R L A G
www.omvs.at
ISBN: 978-3-7013-1152-1eISBN: 978-3-7013-6152-6© 2008 Otto Müller Verlag Salzburg/WienAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgUmschlaggestaltung: Ulli LeikermoserDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH., A-9431 St. Stefan
für Tonja, Marcus und Julia
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
1
VOM ANFANG ERZÄHLE ICH und von einer Zeit, die das Ende hätte sein können. Eine Art Vorspiel zum Leben das eine, eine Art Vorgeschmack aufs Sterben das andere. Zunächst erzähle ich für eine kleine Weile vom Anfang.
DAS KIND, ES MAG DREI oder dreieinhalb Jahre alt sein, sitzt unter einem schweren Holztisch. Ganz unten sind die Beine des Tisches durch starke Holzleisten miteinander verbunden, man kann, wenn man am Tisch sitzt, die Füße darauf stellen. Die nach außen weisenden oberen Kanten sind abgetreten, schon ganz rund, nur direkt an den Tischbeinen nicht. Jetzt sitzt niemand am Tisch. Aber das Kind kann die Füße eines noch jungen, doch schon erwachsenen Mannes sehen. Der heißt Hans und liegt auf einem Sofa, gleich neben dem Tisch. »Der Hans ist mein Freund«, sagt das Kind manchmal. Jetzt sitzt es unterm Tisch und singt. Einen von den Schlagern, die es alle Tage im Radio hört. Dann sagt das Kind: »Und jetzt der Wasserstandsbericht des hydrographischen Dienstes.« Das sind ein paar schwierige Wörter, aber das Kind hat sie oft gehört und merkt sich leicht, was es ein paarmal hört. »Engelhartszell vier Meter fünfzig, Linz drei Meter neunzig, Grein sieben Meter sechzig.« Dann sagt das Kind noch: »Wie immer sind alle Angaben ohne Gewehr. – Wieso ohne Gewehr?«
Der Hans lacht, gibt aber keine Antwort. Das Kind hat die Frage schon oft gestellt und noch nie eine Antwort bekommen, also sagt es: »Jetzt noch der Vermißtensuchdienst des Roten Kreuzes …« Der Hans aber sagt: »Ah, ich schalt das Radio jetzt aus.« Da sagt das Kind nichts mehr und kommt unterm Tisch hervor.
Ein halbes oder ganzes Jahr später meint die Mutter, das Kind dürfe zum Hans nicht mehr Hans und auch nicht mehr du sagen, das gehöre sich nicht. »Aber der Hans ist doch mein Freund!« Es hilft nichts, Kinder haben, wenn sie keine ganz kleinen Kinder mehr sind, zu den Erwachsenen nicht du zu sagen. So wird für das Kind der Hans zum Herrn Heigl. Manchmal in der warmen Jahreszeit, wenn am Abend alle im Garten sitzen, weiß das Kind, daß der Herr Heigl immer noch sein Freund Hans ist. Aber er ist jetzt nicht mehr oft da. Er hat viel zu tun, sagen die Erwachsenen. Fürs Radio-Spielen hätte er jetzt eh keine Zeit mehr. Und das Kind sagt sich, es wolle sowieso nimmer Radio spielen, schon lange nicht mehr, weil das Radio-Spielen nämlich ziemlich kindisch sei.
IN DEN ERSTEN FÜNFZEHN JAHREN wohnte ich mit meiner Mutter und meinem Bruder im Haus Schlüsselhofgasse 34. Man lebte damals viel enger beieinander als heute. Gleich nach dem Krieg, also in den Jahren nach meiner Geburt, fanden ganze fünf Familien Platz in dem zwar langgestreckten, aber nur zimmerbreiten Gebäude. In der Zeit, die ich erinnere, waren es immerhin noch drei Familien. (Heute ist das Haus mehrfach erweitert und vergrößert, aber es leben jetzt, so viel ich weiß, nur zwei oder drei Menschen darin.)
Einen ausgedehnten Gemüsegarten gab es und einen kleinen Blumengarten, den betrat man durch einen hölzernen Torbogen, der im Sommer voll blauer Clematisblüten war. Eine Wiese mit Apfelbäumen. Ribisel- und Stachelbeerhecken. Ein steiler Hang zum Turnplatz hinunter. Und direkt vorm Haus eine Reihe sehr alter Birnbäume. Von einem unserer Fenster aus waren im Herbst die Birnen zum Pflücken nah.
So lange wir – meine Mutter, mein Bruder und ich – dort wohnten, gab es noch einen rechtwinkelig ans gemauerte Haus gefügten Trakt, eine Art Scheune, fast ganz aus Holz. Früher dürften darin Ställe gewesen sein, wahrscheinlich hatte man ein paar Ziegen gehalten, Hühner vermutlich auch. Nach dem Krieg wurde dort Brennholz und mancherlei Gerümpel gelagert. Dieser Teil mußte weggerissen werden, als um 1960 herum die Schlüsselhofgasse verbreitert werden sollte.
Das Hausbesitzerpaar, von uns »der Hausherr« und »die Hausfrau« genannt, war schon alt, bei ihnen lebte eine erwachsene Tochter, eine unverheiratete Lehrerin, die für uns »Fräulein Käthe« hieß. Der Sohn des Hauses, Hans Heigl, hatte schon seine eigene Familie. Er war mit einer Pharmazeutin verheiratet, die in der Löwen-Apotheke arbeitete, und bald war er Vater zweier Töchter. Mit denen wuchsen mein Bruder und ich wie mit Schwestern auf. Sie waren in unserer kleinen Wohnung im ersten Stock so zu Hause wie wir unten im Erdgeschoß in ihrer, die auch kaum größer war. Die Christl und ich sind fast gleich alt, mein Bruder Hans ist drei Jahre älter als wir, die Annemarie drei Jahre jünger. Später hat sie sich darüber beklagt, sie sei nie ernstgenommen worden von uns, oft habe sie sich – da wir behauptet hätten, sie sei für dies oder das noch viel zu klein – von unseren Spielen ausgeschlossen gefühlt. Wahrscheinlich hat sie recht. Sicher ist, daß die Christl und ich sie beim Doktorspielen nicht dabei haben wollten, aber davon wußte ja auch mein Bruder nichts.
In den Kindergarten gingen die Christl und ich gemeinsam, höchst ungern zumeist. Oft und oft stapften wir den Posthofberg hinauf, Hand in Hand und beide heulend, weil wir es wieder einmal nicht geschafft hatten – »Nur heute, ausnahmsweise!« – zu Hause bleiben zu dürfen. Mein Bruder hatte den Kindergarten leidenschaftlich gern besucht, er wollte auch im Volksschulalter noch hin, die Tante Inge wolle er besuchen, sagte er und durfte es auch.
In den Jahren, von denen ich hier erzähle, fing Hans Heigl an, politische Karriere zu machen. Er war zu den Roten gegangen. Einmal durften wir Kinder ihm helfen, rote und weiße Bänder aus Kreppapier in die Speichen seines Fahrrades zu flechten, damit fuhr er dann zum Aufmarsch am 1. Mai. Ich traf ihn auch später noch gelegentlich, kannte ihn also recht gut, weiß aber bis heute nicht, wie er politisch dachte, und halte es für denkbar, daß er sich selbst diese Frage nie gestellt hat; er wollte etwas werden, also ging er zu den Roten. Wer nach dem Krieg in Steyr Karriere machen wollte, der hatte (wie vor dem Jahr 1934) gar keine andere Wahl. Hans Heigl wurde Betriebsrat in den Steyr-Werken, dann Zentralbetriebsratsobmann, später – da wohnten wir schon nicht mehr in der Schlüsselhofgasse – Landtagsabgeordneter, noch viel später Abgeordneter zum Nationalrat.
Christls und Annemaries Großeltern waren ein bißchen auch die meinen. Die »Hausfrau« mochte mich sehr. Sie war stocktaub und sehr mißtrauisch, immer meinte sie, es würde, wenn geredet wurde, Böses über sie geredet. Meine Mutter ging fast jeden Sonntagnachmittag mit ihr spazieren, wenn das Wetter, wie die Hausfrau es ausdrückte, nicht allzu »grob« war. Ziel war immer ein Ausflugsgasthaus in der Umgebung von Steyr, oft der Sandmayer unten an der Enns, dort gab es die »Überfuhr«, ein an einem Drahtseil laufendes Wasserfahrzeug, auf dem man sich über den Fluß nach Münichholz hinüberbringen lassen konnte. Manchmal gingen sie auch nach Gleink oder – noch weiter – nach Sankt Ulrich oder nach Christkindl. Bis ich dreizehn oder vierzehn Jahre alt war, ging ich mit, und die Christl und die Annemarie waren meistens auch dabei.
Der »Hausherr« ertrug sein oft zänkisches Weib mit stoischer Gelassenheit. Er wurde von ihr nur »Mann« gerufen. »Mann, geh her da!« Und wenn sie in den Garten rief »Wo bist’nn, Mann?«, dann blieb er, wo er war, und rührte sich nicht. »Gegen die Dummheit ist halt kein Kräutl gewachsen«, murmelte er manchmal, wenn sie ihn gar zu arg drangsalierte. Mit achtzig stieg er noch auf hohe Leitern, um die Birnen zu ernten. Dann standen wir alle vorm Haus und zitterten um ihn. Gelegentlich, etwa an den langen Sommerabenden im Garten, redete er davon, daß die Pfarrer uns nicht die ganze Wahrheit sagten. Er hatte in seinen jungen Jahren als Gärtner für den Grafen Lamberg gearbeitet und sei, so erzählte er, einmal auch in die Bibliothek im Schloß gekommen, habe dort eine alte Bibel aufgeschlagen – und darin seien viele Sätze durchgestrichen gewesen, all das nämlich, davon war er fest überzeugt, was das einfache Volk nicht wissen sollte. Er meinte, die Welt müsse von diesem Schwindel erfahren, darum schrieb er hin und wieder Briefe an hohe Regierungsstellen. Sein Sohn gab dann vor, diese Briefe zum Postkasten zu bringen, und ließ sie rasch verschwinden.
Ich war fünfzehn, als wir das Haus Schlüsselhofgasse 34 verließen, damit – spätestens – war meine Kindheit zu Ende.
2
WAS DAS ENDE HÄTTE werden können, geschieht im Jahr 2006, beginnt in der Woche nach Ostern. Am Freitagmorgen wache ich mit Bauchschmerzen auf. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Abend zuvor. Arno Kleibel, mein Verleger, und ich saßen bis nach Mitternacht in einem Lokal am Naschmarkt. »Einiges über den lieben Gott« soll im Herbst erscheinen; die Fassung, über die wir gestern sprachen, ist gewiß noch nicht die letzte. Ich hörte mir Arnos Vorschläge und Einwände an und versprach, dies und das noch zu berücksichtigen. Ich verschwieg, daß ich, die vorlesungsfreie Zeit der Osterferien nutzend, schon vor zwei Tagen eine neue Textfassung abgeschlossen habe. Ich werde sie Arno in zwei Wochen schicken, und er wird etliche seiner Anregungen darin verwirklicht sehen. Wir hätten bei unserem durchaus vergnügten Gespräch vielleicht ein bißchen weniger trinken sollen, denke ich am Morgen danach. Obwohl: Gar so viel war’s ja nicht, und noch nie im Leben hat Bier mir Bauchschmerzen bereitet. Allerlei Beschwerden sonst, aber Bauchschmerzen noch nie.
Im Auto dann, auf der Fahrt nach Losenstein, öffne ich den Gürtel und den Knopf am Hosenbund. Viel hilft das nicht. Was mir genau weh tut, kann ich nicht sagen, der Bauch halt. Es wird vergehen, vielleicht nach dem Mittagsschlaf, den ich mir gönne. So lange ich liege, hält sich der Schmerz in erträglichen Grenzen, für eine halbe Stunde schlafe ich sogar ein. Als ich aufstehe, ist alles wieder wie zuvor. Wo genau es denn weh tue, will Tonja wissen, und was für eine Art von Schmerz es denn sei. Ich kann’s nicht sagen, ich kann ihn weder wirklich lokalisieren, noch definieren.
Am späten Nachmittag mein derzeit wöchentlicher Termin bei der Physiotherapeutin. Sie bearbeitet meine wieder einmal sehr verspannte Rückenmuskulatur, danach scheint auch der Bauchschmerz ein wenig gelindert. Aber das hält nicht lange an.
Am Samstag ist der Bauch stark aufgebläht, die straff gespannte Bauchdecke hart wie ein Brett. Tonja besteht darauf, einen Arzt zu konsultieren. Wer hat denn Wochenenddienst? Dr. Rosenleitner aus Ternberg kommt. Akutes Abdomen. Ich müsse sofort ins Krankenhaus, er schreibt die Überweisung. Nein, ins Krankenhaus will ich auf gar keinen Fall. Was von selber gekommen sei, das könne, das solle gefälligst von selber auch wieder verschwinden, sage ich. Einer von meinen alten Sprüchen. Dr. Rosenleitner zuckt die Achseln. Zwingen könne er mich nicht. Er gibt mir die Einweisung, ob ich sie verwende oder nicht, müsse er mir überlassen. Er rate mir freilich dringend, es zu tun.
Ich bleibe den Samstag über im Bett. Ich habe in meinem Leben nicht viele Tage im Bett verbracht. An ein paar wenige erinnere ich mich, da war ich noch ein Kind und hatte Fieber. Aus Decken und Polstern hatte ich gewaltige Gebirge um mich herum aufgeschichtet, die irgendetwas darstellen sollten. Mittendrin lag ich dann und las den ganzen Tag. Jetzt lese ich nicht, liege nur da und habe Angst vorm Krankenhaus, ich geb’s zu, was wäre da zu leugnen. Die Hoffnung, die Schmerzen würden von selbst vergehen oder vorläufig wenigstens schwächer werden, verschwindet allmählich.
Am Sonntag, es ist der 23. April 2006, bin ich bereit. Eine lange scheußliche Nacht hat mich weich gemacht. Na gut, was sein muß, muß halt sein. Tonja möge mich, bittesehr, nach Steyr ins Krankenhaus fahren. Sie ruft lieber die Rettung, sie wird mit ihrem Auto hinter dem Rot-Kreuz-Wagen herfahren.
Was muß man mitnehmen ins Krankenhaus? Die Zigaretten darf ich nicht vergessen.
Ob ich im Krankenwagen lieber sitzen oder liegen wolle, fragt einer der freundlichen jungen Männer, die eine Viertelstunde später vorm Haus stehen. Ich könnte ganz gut auch sitzen, entscheide mich aber fürs Liegen. Wenn schon, denn schon.
Formulare sind auszufüllen auf der Fahrt. Wer sind die nächsten Angehörigen?
Die hinteren Fenster des Rettungswagens sind undurchsichtig, bis auf schmale Schlitze ganz oben. Von meiner Bahre aus kann ich allenfalls Baumkronen sehen, aber immer weiß ich, wo wir grad sind. Die Strecke von Losenstein nach Steyr bin ich ein paar tausendmal gefahren, ich kenne jede Kurve, jede Steigung, und wenn ich einmal Bäume sehe, weiß ich, wo die stehen.
Im Krankenhaus angekommen, finde ich es auf einmal übertrieben, auf der Bahre zur Aufnahme gebracht zu werden. Man lädt mich in einen Rollstuhl um. Ich könnte, meine ich, auch selber gehen. Aber was soll ich lange diskutieren, ich lasse mich schieben.
Tonja ist an meiner Seite. Der Aufnahmearzt stellt Fragen. Blutdruckmessen. EKG. Dr. Rosenleitner hat mich auf die Chirurgie eingewiesen, stellt sich nun heraus. Dorthin will ich auf gar keinen Fall. Die Chirurgen wollen schneiden, das ist klar, das Schneiden ist ihr Beruf. Wen sie in die Hände kriegen, den schneiden sie auch auf. Man widerspricht mir: Auf die Chirurgie eingeliefert zu werden, heiße durchaus nicht, daß man auch operiert werde. Ich glaub denen kein Wort und will in eine interne Abteilung eingeliefert werden. Tonja unterstützt mich, sie argumentiert klug, und das hilft, man findet auf der Internen einen Platz für mich. Sie brauche ein »Männerbett«, hat die Schwester am Telefon gesagt. Das alles ist sehr neu für mich. Ich habe – nun fast schon einundsechzig – noch keinen Tag in einem Krankenhaus verbracht. Nur einmal eine Nacht, als Siebenjähriger, als ich mir das Schlüsselbein gebrochen hatte.
Dritter Stock. Ein Zweibettzimmer. In dem einen Bett liegt ein Greis, regungslos, er hat die Augen offen, aber er reagiert nicht, als Tonja und ich, von einer Krankenschwester begleitet, ins Zimmer kommen. Das kann ja heiter werden. Gibt es kein anderes Zimmer? Leider nein, alles belegt. Die Krankenschwester läßt uns allein, ich setze mich auf die Kante des freien Betts, Tonja fängt an, mein mitgebrachtes Zeug in einen Schrank zu räumen.
Ein Arzt kommt, ein ernster junger Mann, durchaus vertrauenerweckend, kein Turnusarzt mehr, offenbar ein Assistenzarzt, ein Namensschild weist ihn als Dr. Fimberger aus. Er müsse mir Blut abnehmen. Naja, dann soll er halt. Ich sage ihm noch, daß ich panische Angst vor Nadeln aller Art hätte. Er lacht und tut, was zu tun ist.
Die Schwester kommt zurück. Man hat plötzlich doch ein anderes Zimmer für mich. Sogar ein Einzelzimmer. Die Schwester redet mich jetzt mit »Herr Professor« an. Sie bindet mir ein Plastikarmband um, darauf steht: Wippersberg, Walter, Univ. Prof.
Das neue Zimmer ist winzig, eine Kammer nur, grad daß das Bett und ein Nachttisch darin Platz haben, aber immerhin werde ich allein hier liegen. Ich frage die Schwester, ob irgendetwas – vom strengen Rauchverbot im ganzen Haus einmal abgesehen – dagegen spreche, daß ich im Bad die eine oder andere Zigarette rauche. Sie öffnet die Schiebetür, blickt hinein, blickt nach oben und meint: Rauchmelder könne sie jedenfalls keinen entdecken.
Der Chef der Internen kommt, Dr. Haidinger. Der Primar ist am Sonntagvormittag im Haus, erstaunlich. Ein kompakter Mann, rotblond, in meinem Alter ungefähr, oder nein, ein paar Jahre jünger vielleicht. Sein Bauch ist ungefähr so groß wie meiner, wenn er nicht gerade so aufgebläht ist wie jetzt; kein Asket also, das läßt hoffen. Über meinen Zustand weiß er schon Bescheid, wir plaudern ein bißchen, auch übers gute Essen und Trinken. Man werde, sagt er dann, jetzt die nötigen Untersuchungen durchführen, eine Computertomographie zuerst, das Blut sei schon im Labor. Bald würden wir wissen, was los und was zu tun ist, er werde sich wieder melden bei mir.
Tonja sitzt noch eine Weile neben mir auf der Bettkante, dann verabschiedet sie sich, sie kann im Augenblick nichts mehr für mich tun. Ich verspreche ihr tapfer zu sein, aber ja, ganz ganz tapfer. Und so bald ich etwas weiß, werde ich natürlich anrufen, eh klar.
Eine erste Zigarette im Bad. Die Angst ist jetzt weg. Die Leute hier werden schon wissen, was zu tun ist, das ist ihr Geschäft. Ich bin vermutlich in guten oder wenigstens kompetenten Händen. Auch die Bauchschmerzen sind jetzt weg, nicht ganz, aber fast. Der Versuchung mir einzureden, daß wahrscheinlich eh alles ganz harmlos ist, widerstehe ich. Man wird sehen. Vor allem: Erst kratzen, wenn’s wirklich juckt. Ich werde einfach nur warten, nichts hoffen und mich auch vor nichts fürchten. Und, verwunderlich eigentlich, das gelingt mir ein paar Minuten lang ganz gut.
3
DIE SCHLÜSSELHOFGASSE VERBINDET zwei für meine Kindheit sehr wichtige Plätze. Sie beginnt am Michaelerplatz, wo ich zwölf Jahre lang die Schule besuchte und wo ich, in der Michaelerkirche nämlich, Ministrant war, und sie endet am Ennsufer, in der Innenseite einer Flußbiegung, das war unser Badeplatz, und der angrenzende Auwald gehörte, kommt mir vor, uns Kindern ganz allein.
Der Stadtteil heißt Ort, doch erinnere ich mich nicht, daß jemand diesen Namen je verwendet hätte. Auf einem Merian-Stich von 1649 ist der Stadtteil Ort schon zu sehen, am linken Ennsufer gelegen, damals von der Steyrbrücke bis etwa zur heutigen Rederinsel reichend: Zwei Häuserzeilen zunächst nur, die eine unten am Fluß, der Ortskai, und die Schlüsselhofgasse auf halber Höhe zwischen dem Ennsufer und dem Tabor.
Steyr ist eine auf Terrassen angelegte Stadt. Von den ältesten Vierteln unten an den Flüssen Enns und Steyr hat sie sich immer weiter nach oben hin entwickelt und im 20. Jahrhundert die beiden höchsten Terrassen, Ennsleiten und Tabor, erreicht und verbaut. Viele Punkte der Stadt kann man auf unterschiedlich hoch gelegenen Wegen erreichen.
Drei Möglichkeiten gab es, wenn wir vom Michaelerplatz zu »unserem« Haus gelangen wollten. Der mittlere Weg, die auf dieser Strecke von alten Villen gesäumte Schlüsselhofgasse selbst, war der kürzeste. Ihn nahm ich, wenn ich es eilig hatte, in der Früh zum Beispiel.
Von der Schule nach Hause ging ich lieber auf dem Ortskai, also direkt die Enns entlang. Hier habe ich, das weiß ich noch, meine erste Zigarette geraucht. Beim Sägewerk Weidinger kam man dann durch einen schmalen, steilen Hohlweg wieder auf die Schlüsselhofgasse hinauf: Eine im Winter beliebte Rodelstrecke. Der Ehrgeiz aller war es, so knapp wie nur möglich vor dem Ennsufer abzubremsen, drei oder vier pro Saison schafften es nicht, sie landeten im Wasser und wurden für ihren Mut viel bewundert. Oben an der Straße stand ein ebenerdiges Haus, drinnen auf dem Fensterbrett schlief dort stets, wie in einer Auslage, ein kleiner häßlicher Hund, auf einen dicken Polster gebettet. Nie konnte ich an diesem Haus vorbeigehen, ohne an die Fensterscheibe zu klopfen, den Hund damit aufzuschrecken, der dann erbärmlich kläffte, woraufhin fast augenblicklich sein sehr altes Frauerl in der Haustür erschien und hinter mir herschrie, sie werde mich schon noch erwischen. Vieles drohte sie mir an für diesen Fall, allein er trat nie ein, sie erwischte mich nicht. Auch andere Kinder klopften natürlich im Vorbeigehen ans Fenster, die alte Frau hatte es nicht leicht. (Das Häusl wurde dann in den sechziger Jahren abgerissen, um Platz zu schaffen für die neue Rederbrücke, die inzwischen schon durch eine noch neuere ersetzt wurde.)
Der dritte Weg verlief eine Etage höher. Vom Michaelerplatz stieg man – was für manchen Erwachsenen mühsam, für uns Kinder leicht war – die damals ziemlich neue Taborstiege hinauf und ging zuerst am Krematorium vorbei, dann auf einem Fußweg entlang der Kante der höchstgelegenen Steyrer Terrasse, die ihren Namen Tabor trägt, seit im späten fünfzehnten Jahrhundert böhmische Söldner von hier aus die Stadt belagert hatten. Man kam – dieser Teil des Tabors war noch unverbaut – an Schrebergärten vorbei und gelangte schließlich über steile Wegstücke und provisorische Treppen wiederum fast genau dort, wo ich wohnte, auf die Schlüsselhofgasse. Dieser Hang, dem Haus gegenüber, war verwildert, viele alte Bäume gab es und viel Haselnußgesträuch, darin man ganz, ganz geheime Lager errichten konnte.
Unterm Hang stand und steht ein vermutlich aus dem Mittelalter stammendes Haus mit einem sehr hohen, sehr steilen Dach. Eine Greißlerei befand sich darin, eine Fleischhauerei und das Wirtshaus Koblmüller. Vom Greißler Laber, der sein winziges, enges Geschäft gemeinsam mit seiner Schwester führte, erzählte man sich, er besäße eine umfangreiche Sammlung höchst unanständiger Fotografien. Vom Fleischhauer weiß ich noch, daß er einmal einen seiner Gesellen gerügt haben soll, weil der zu wenig Mehl in die Würste getan hätte. Der Geselle hat daraufhin gekündigt: Er sei kein Bäcker, sondern Fleischhauer.
Beim Koblmüller, im Wirtshaus, gab es den ersten Fernseher in der Gegend. Manchmal gingen wir an einem Samstagabend hin. Meine Mutter mochte den Heinz Conrads sehr und den Lou van Burg auch.
Oft wurden wir Kinder über die Straße zum Einkaufen geschickt. Nicht gar so oft zum Fleischhauer, aber manchmal zwei-, dreimal am Tag zum Greißler. Dort, beim Laber, hatten wir meist lange zu warten, weil die Erwachsenen, auch wenn sie erst nach uns gekommen waren, immer zuerst bedient wurden. Nicht selten traf ich dort die Frau Sperk, eine Zahnarztgattin, die in der Blümelhuberstraße wohnte, und immer wurde ich von ihr gefragt: »Na, kannst net grüßen?« Ich konnte es nicht. Ich grüßte alle Erwachsenen in der Gegend, nur die Frau Sperk nicht. Da half es auch nicht, wenn sie mir Süßigkeiten versprach, sogar kleine Geldbeträge, wenn ich sie nur ordentlich grüßen wollte. Sie – ein hageres Geschöpf übrigens – beschwerte sich auch bei meiner Mutter, und der versprach ich, aber ja, ich würde die blöde alte Kuh das nächste Mal schon grüßen. Doch tat ich es nicht. Vermutlich nur, weil ihr gar so viel daran lag. Alle anderen ja, sie nicht. Um keinen Preis. Um nichts auf der Welt. Nicht für einen Wald voll Affen. Sonst war ich, glaube ich mich zu erinnern, kein unfreundliches Kind, die Leute – Frau Sperk ausgenommen – mochten mich ganz gern. Einmal in der Volksschule trug man uns auf, Lose für die Erhaltung (oder, was weiß ich, den Ausbau) des Sonnblick-Observatoriums zu verkaufen. Ich ging in der Schlüsselhofgasse von Haus zu Haus, trug beredt mein Anliegen vor und wurde nirgends abgewiesen, schnell hatte ich mein Loskontingent verkauft. Bei dieser Gelegenheit kam ich auch in die Steinparz-Villa, und der Hausherr, ein ausgewiesener Vogelkundler, zeigte mir seine Sammlung ausgestopfter Vögel. Hunderte von den Viechern muß es gegeben haben im Haus, kein freies Stück Wand, alles – es war ein wenig unheimlich – voll von präparierten Vogelleichen mit glasstarren Augen.
Von dort weg, wo wir wohnten, gab es keine Villen mehr in der Schlüsselhofgasse. Gleich neben uns stand ein ganz und gar unansehnliches, windschiefes, ebenerdiges Häusl, von dessen Besitzerin dies erzählt wurde: Als die amerikanischen Soldaten nach Steyr kamen, da hatten ein paar von ihnen an ihre Tür geklopft, ob sie sich hier nicht rasch waschen könnten. Ein »Neger« darunter. Dem habe sie kein Handtuch geben wollen, weil sie fürchtete, seine Haut würde abfärben und ihr Tuch versauen.
Ein Mann wohnte bei ihr, viel jünger als sie, er war bei Kriegsende irgendwie hier hängengeblieben. Ich besuchte ihn manchmal, wenn er im Garten war. Einmal grub er mit nacktem Oberkörper ein Fleckchen Gemüsegarten um, da zeigte er mir eine Tätowierung an der Innenseite seines linken Oberarms, ein Buchstabe nur, keinen Zentimeter groß, ein A. Er tat geheimnisvoll. Ob ich wisse, was das bedeute, fragte er mich. Ich wußte es nicht. Auch meine Mutter, später von mir befragt, wußte es nicht. Aber Hans Heigl konnte mir Auskunft geben: Das A bedeute Blutgruppe A, die Tätowierung weise den Nachbarn als einen SS-Mann aus. Er sagte das mit Respekt, fast mit Hochachtung. Den Begriff SS-Mann hatte ich schon gehört, vorstellen konnte ich mir noch nichts darunter.
Übers Kriegsende und alles, was zuvor geschehen war, redete man nicht viel. Manche Folgen waren nicht zu übersehen. Die Stadt war, als ein Zentrum der Rüstungsindustrie, heftig bombardiert worden, ich erinnere mich an Bombentrichter auf dem Turnplatz gleich hinterm Haus. Für die vielen Flüchtlinge, »Volksdeutsche« vor allem, hatte man oben auf dem Tabor, auf dem Kasernengelände, ein Barackenlager errichtet, vom Kindergarten aus konnte man es sehen. Man war von fremden Truppen besetzt, na gut, aber wenigstens von Amerikanern, es hätte schlimmer kommen können. Und beinahe wäre es ja schlimmer gekommen, in den allerersten Monaten nach dem Kriegsende war die Stadt nämlich geteilt gewesen, auf dem linken Ennsufer saßen die Amerikaner, auf dem rechten die Russen, die in ihrem Teil der Stadt sogar eine eigene Verwaltung aufgebaut, sich dann aber doch ganz nach Niederösterreich zurückgezogen hatten.
Hitler hatte den Krieg verloren. Er ganz allein offenbar, hätte man glauben mögen, wenn man den Leuten zuhörte. Aber man hatte den »Umbruch« überlebt. Viele hatten ihn nicht überlebt, über manche von denen redete man, über viele andere nicht. Das Leben ging weiter.
Es ging auch auf dem schon erwähnten Turnplatz weiter. Er gehörte, glaube ich, dem Österreichischen Turnerbund, damals redete man freilich immer noch von den »Deutschen Turnern«. Als die Bombenkrater zugeschüttet waren, wurden hier gleich wieder Sonnwend- oder Julfeiern abgehalten. Da standen die Immer-noch-Deutschtümler um ein großes Feuer herum, lauschten manch einer trutzigen Rede und sangen. In einem ihrer Lieder hieß es »… da kommen wir gegangen, mit Spießen und mit Stangen.«
Auch einen Tennisclub gab es hier. Oft habe ich dem Platzwart beim Spritzen oder beim Abziehen der beiden Plätze zugesehen, oder wie er einen kleinen Wagen hinter sich herzog, um kalkweiße Linien auf den ziegelroten Staub zu setzen. Meiner Erinnerung nach spielten nur ältere Leute. Das seien, hat jemand einmal gesagt, alles alte Nazis, die da unten Tennis spielten. (Lange glaubte ich, mit »alte Nazis« sei eine ganz besondere Spezies alter Menschen gemeint; meine Frage, worin sie sich denn von anderen Alten unterschieden, woran man sie denn erkennen könne, blieb unbeantwortet.) Eine alte Dame sehe ich beinahe noch vor mir, schlank und braungebrannt; heute erinnert mich das Bild an Leni Riefenstahl, von der ich damals natürlich nichts wußte. Immer spielte sie mit einem weißhaarigen alten Herrn, sie standen einfach da, spielten einander die Bälle so genau zu, daß nur selten ein kleiner Schritt zur Seite nötig war, um ihn zu erreichen. Selbst ein Wechsel von der Vorhand auf die Rückhand kam nicht oft vor. Viele Minuten lang dauerten die Ballwechsel, und lange habe ich geglaubt, es käme beim Tennisspielen darauf an, einen Ball so lange wie nur möglich im Spiel zu halten, wie wir es selbst beim Federballspielen versuchten, wo mitgezählt wurde, wie oft der Ball hin und herflog.
Auf dem Michaelerplatz, gleich gegenüber von der Schule und neben der Konditorei Kreuzer gab es ein winziges Buch- und Papiergeschäft, dessen Besitzer ein steifes Bein (oder ein Holzbein?) hatte. Er sei Träger des Blutordens, einer der ganz wenigen in Steyr, sagte man über ihn, und lange wußte ich nicht, was das bedeutete. Auf der anderen Straßenseite, schon in der Schlüsselhofgasse, hatte er Lagerräume, in deren Schaufenstern er ganz unbeanstandet immer noch NS-Literatur feilbot. Bis weit in die sechziger Jahre hinein.
Meine Kindheit verging – subjektiv gesehen – in einer heilen Welt. Aber es hatte bis kurz vor meiner Geburt in Steyr ein Außenlager des KZ Mauthausen gegeben, man hatte die Kazettler auch in der Stadt selbst arbeiten gesehen. Im Krematorium in Steyr wurden Leichen aus Mauthausen verbrannt, wenn die Öfen dort überlastet gewesen waren. Heute weiß ich, daß nicht gar so wenige Steyrer davon wußten. Heute weiß ich, daß anno 38 viele Sozialdemokraten im bis dahin »roten Steyr« zu den Nazis übergelaufen und in meinem Geburtsjahr 1945, als wäre nie etwas gewesen, zu den Roten zurückgekehrt waren. Heute weiß ich, daß einer, den ich in meiner Kindheit als angesehenen Geschäftsmann kannte, ein paar Jahre vorher den Nazis als offizieller Henker gedient und tatsächlich Todesurteile vollstreckt hatte. Die Schuldigen von damals lebten zu Zeiten meiner Kindheit ebenso in der Stadt wie jene, die nur zugeschaut hatten. Und jene wenigen, die sich dagegen gewehrt hatten, waren – heute weiß ich es – in diesen meinen Kindheitsjahren nicht sehr angesehen, nicht sehr beliebt.
Eher als das Kind einer bestimmten Familie war ich, hatte ich später oft das Gefühl, das Kind einer bestimmten Zeit, nämlich der Nachkriegszeit.
4
DRAUSSEN KLOPFT JEMAND an die Zimmertür, ich werfe den Zigarettenstummel in die Klomuschel. Ich werde zur Computertomographie abgeholt. Ein Zivildiener wartet mit einem Rollstuhl auf mich. Die »Kurve« müsse ich mitnehmen, sagt eine Schwester und drückt mir eine Mappe in die Hand, auf der mein Name steht. Diese Mappe heißt »Kurve«? Warum? Das kann die Schwester, so rasch gefragt, auch nicht sagen. Sie habe, stellt sie fest, noch nie darüber nachgedacht. Vielleicht komme es von jenen Tafeln, die früher an den Fußenden der Spitalsbetten hingen, darauf waren die Ergebnisse der Fiebermessungen aufgezeichnet, die Fieberkurven also. Meine Mappe ist noch fast leer, bis auf das Formular, das man unten bei der Aufnahme ausgefüllt hat, ein Blatt mit den EKG-Zacken und ein langes Band mit immer gleichen Computeretiketten, mein Name darauf, das Geburtsdatum und die Versicherungsnummer, dazu noch ein Strichcode. Solche Etiketten hat der Assistenzarzt schon auf die Röhrchen mit meinem Blut geklebt.
Der Zivildiener schiebt mich zum Lift, wir fahren hinunter in den Keller, dann lange unterirdische Gänge entlang, mit denen die einzelnen Gebäude offenbar verbunden sind. Sonntägliche Ruhe allüberall.
Wie das mit der Computertomographie ist, weiß ich aus dem Fernsehen. Ich leg mich hin und tu, was man mir sagt: »Einatmen – ausatmen – jetzt nicht mehr atmen!« Dann fährt das ringförmige Trumm über mich drüber. »Sie können wieder atmen.« Und dann das ganze noch einmal. War’s das schon? Das war’s schon. Und das Ergebnis? Wie schaut’s aus da drin in meinem Bauch? Das alles müsse, sagt mir der Radiologe, erst ausgewertet werden.
Ich werde in mein Zimmer zurückgekarrt. Schon denke ich, fällt mir auf, »mein Zimmer«. Eine halbe Stunde später kommt der Primar: Es handelt sich um eine Invagination. Die Sache hat auf einmal einen Namen. Ein hübscher Name, bei dem mir, sage ich, allerdings etwas ganz anderes einfällt als das, worum es sich vermutlich handelt. Ein Teil des Dünndarms habe sich in den Dickdarm eingestülpt, sagt Dr. Haidinger. Das komme sonst fast nur bei Säuglingen vor – oder bei Hunden. Also gut: Bei Säuglingen, bei Hunden und bei mir. Und was tut man dagegen? Operieren, das sei gar kein Problem. Ich will aber nicht operiert werden, auf gar keinen Fall will ich aufgeschnitten werden. Was macht man denn bei Säuglingen, operiert man die auch? Nein, da versuche man, das Problem anders zu beheben, sozusagen mechanisch. »Dann will ich, daß man das bei mir auch versucht.« Haidinger ist skeptisch, er werde noch einmal mit dem Radiologen telefonieren. Er werde gleich wieder da sein.
Stattdessen kommt aber ein Chirurg. Er will mir das mit der Operation erklären. Das sei gar kein so großer Eingriff, vor allem gar kein komplizierter. Nur dränge die Zeit, das sei praktisch schon ein Darmverschluß, also lebensbedrohlich. Ich lasse mich nicht überreden, der Chirurg stöhnt ein bißchen ob so viel Unverstand, aber ich bestehe darauf, daß diese andere Möglichkeit, von der Haidinger gesprochen hat, versucht wird. Der Chirurg hält mich, es ist ihm deutlich anzusehen, für einen Idioten. Er werde noch einmal mit dem Primar Haidinger reden.
Der kommt ein paar Minuten später. Was ich mir wünsche, müsse vom Radiologen gemacht werden, unterm Röntgengerät. Der Radiologe sei bereit dazu. Das klingt, als habe man ihn dazu überreden müssen. Die Prozedur, sagt der Primar, müsse ohne Narkose durchgeführt werden, weil ich mich dabei auf Anweisung hin bewegen müsse, es werde nicht angenehm sein. Ich werd’s aushalten, sage ich. Dr. Haidinger wünscht mir Glück.
Man bereitet mich vor, mißt wieder den Blutdruck, zapft mir wieder Blut ab. Dann muß ich ein Krankenhaus-Nachthemd anziehen, hinten offen. Diesmal bringt man mich nicht im Rollstuhl hinunter zur Radiologie, sondern im Bett.
Der fensterlose Raum ist nur schwach beleuchtet, eine Schwester erwartet mich, und hinter einer Glasscheibe sehe ich – als Silhouette nur – den Radiologen. Eine Liege, daneben ein kleiner Tisch mit allerhand Zeug drauf, darüber schwebend Gerätschaften, die ich für Teile der Röntgenapparatur halte. Die Tür zu einer Toilette steht offen, drinnen brennt Licht.
»Wird so was öfter auch bei Erwachsenen gemacht?« will ich wissen. Selten, aber doch, höre ich. Und mir fällt ein: Heute ist ja Sonntag, da gibt es nur Bereitschaftsdienst, das müßte ein besonders glücklicher Zufall sein, wenn der da hinter der Scheibe gerade der kompetenteste Mann des Hauses wäre …
Ob er das selbst schon bei einem Erwachsenen gemacht habe, frage ich den Radiologen. Er behauptet ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihm glauben mag. Ob der Versuch denn erfolgreich gewesen sei, danach frage ich lieber nicht.
Das soll nun geschehen: Man wird rektal einen Kontrastmittelbrei in meinen Darm einbringen und den dann mit Druckluft den ganzen Dickdarm entlang, bis zu seinem Anfang vorschieben, wo er den eingestülpten Dünndarm wieder ausstülpen soll. Das könne, sagt man mir, eine Weile dauern. Mit dem Röntgengerät werde man feststellen, wie weit man jeweils schon vorgedrungen sei.
Ich soll mich nun hinlegen. Seitenlage. Die Schwester schiebt mir ein Röhrl in den Hintern. Ich folge den Anweisungen, drehe mich auf den Bauch, dann wieder zurück in die Ausgangslage, »und jetzt bitte nach rechts drehen, nein, nicht ganz so weit« …
Hinter der Glasscheibe sehe ich nun auch den Chirurgen, mit dem ich gesprochen, dessen Dienste ich verschmäht habe. Ist er gekommen, weil er doch noch eine Chance sieht, mich aufzuschneiden?
Die Schmerzen kommen langsam, ganz andere Schmerzen als gestern und vorgestern. Schärfer, schneidender. Es muß nun schon eine ganze Menge Luft in mir sein. Der Radiologe schimpft das dritte Mal über dieses Scheiß-Röntgengerät, das ihm offenbar nicht das zeigt, was er sehen müßte. Was heißt das für mich?
Die Schwester, eine Art Assistentin wohl eher, scheint die Tücken des Gerätes zu kennen und schlägt vor, es ein paarmal hintereinander aus- und gleich wieder einzuschalten. Und das funktioniert dann auch.
Die Schmerzen sind nun wirklich schlimm, schlimmer als alles bisher in meinem Leben. »Wie lange dauert das noch?« Ich bekomme keine Antwort, aber die Schwester legt mir für einen Augenblick die Hand auf die Schulter und bläst mir dann wieder Luft in den Darm. Längst habe ich mich aus dem Nachthemd herausgewurschtelt, nur der linke Arm steckt noch drin, ich schlüpfe heraus und lasse das Hemd, ein nasser Fetzen jetzt, auf den Boden fallen. Wie sehr ich schwitze, ist mir bisher nicht aufgefallen.
»Bitte jetzt wieder auf den Bauch drehen!« Auf dem Bauch kann ich aber nicht mehr liegen, dazu ist er viel zu sehr aufgebläht. So groß war er nicht einmal damals, als ich fast hundert Kilo wog. Und jetzt wird er immer noch größer. Ich stütze mich auf den Knien und Ellbogen ab und versuche mir das Bild vorzustellen: Ich nackt auf allen vieren, mit einem Schlauch im Arsch.
Lange, denke ich, halt ich das nicht mehr aus. Aber was heißt das schon? Was ist, wenn ich’s nicht mehr aushalte? Fall ich dann in Ohnmacht? Dann kann ich mich freilich nicht mehr dorthin drehen, wo der Radiologe mich haben will. Aber ich werde nicht in Ohnmacht fallen, weil es mich vorher zerreißen wird, in ein paar Minuten werde ich einfach zerplatzen, all die Luft in meinem Bauch wird mich einfach zerreißen.
Not lehrt beten, sagt man. Und meine Not ist groß. So ist auch die Versuchung groß, ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken oder – was weiß ich – ein Gelübde abzulegen für den Fall, daß ich das hier heil überstehe. Aber ich bete nicht. Und wenn ich es doch noch tun sollte, dann wird, sage ich mir, mein neues Buch nicht erscheinen. (Das werde ich später meinen kleinen privaten Atheismus-Test nennen.) »Einiges über den lieben Gott« geht davon aus, daß eben dieser eine Erfindung des Menschen ist, nicht viel mehr als eine literarische Gestalt. Wenn ich ihn jetzt aber – und seien Not und Pein auch noch so groß – anrufe, dann hieße das ja, daß ich selber an die Prämisse meines Buch nicht glaube. Und dann sollte es auch nicht erscheinen. Ob ich mich, wäre ich doch schwach geworden, daran gehalten hätte, kann ich nicht sagen. Vielleicht, es scheint mir denkbar, wäre ich doch nachsichtig mit mir gewesen. Jetzt hilft mir diese Festlegung: Ich bete nicht, ich halte aus, was noch auszuhalten ist. Und einmal muß es ja zu Ende sein. Zeitbegriff habe ich längst keinen mehr. Später rekonstruiere ich dann, daß es fast eine Stunde gedauert haben muß.
Irgendwann ist es dann tatsächlich vorbei. Ist der Versuch gelungen? Der Arzt glaubt ja, und die Schwester zieht das Rohr aus meinem Hintern. Ich springe auf, renne zur Toilette hin, dort entlade ich mich explosionsartig, bei noch offener Tür und ehe ich mich noch ganz hingesetzt habe.
Man bringt mich zurück auf die Station, ich bin erschöpft, ich telefoniere noch mit Tonja, ich schlafe ein und wache fast genau um Mitternacht auf, da fällt mir ein: Ich hätte sterben können, und wäre ich gestorben, dann würde mein neues Buch in einer überholten Fassung erscheinen. Habe ich gestern wirklich gewußt, daß ich hätte sterben können? Ich glaube, ja.