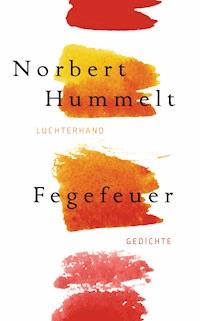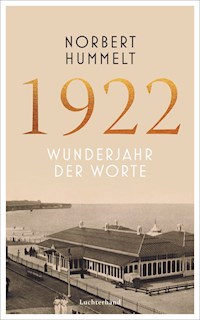
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Aufbruch in die Moderne. 1922 ist ein Jahr von unglaublicher schöpferischer Energie: ein Wunderjahr der modernen Literatur. Eine Fülle literarischer Werke erscheint, die den Gang der Weltliteratur verändern. In Paris wartet James Joyce voller Ungeduld auf die ersten Exemplare seines »Ulysses«. Virginia Woolf ist in London dabei, sich ihren eigenen Raum zu erschreiben. Rainer Maria Rilke vollendet, was er einst auf Schloss Duino begonnen hat. Katherine Mansfield steckt ihre ganze Kraft in ihre Short Stories. Und im englischen Seebad Margate findet T.S. Eliot radikale Töne für das widersprüchliche Lebensgefühl des noch jungen 20. Jahrhunderts. Quer durch Europa begleitet Norbert Hummelt diese Autoren und Autorinnen durch ein aufregendes Schaffensjahr und fängt dabei die spannungsgeladene politische Stimmung der Zeit ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Aufbruch in die Moderne
1922 ist ein Jahr von unglaublicher schöpferischer Energie: ein Wunderjahr der modernen Literatur. Eine Fülle literarischer Werke erscheint, die den Gang der Weltliteratur verändern. In Paris wartet James Joyce voller Ungeduld auf die ersten Exemplare seines »Ulysses«. Virginia Woolf ist in London dabei, sich ihren eigenen Raum zu erschreiben. Rainer Maria Rilke vollendet, was er einst auf Schloss Duino begonnen hat. Katherine Mansfield steckt ihre ganze Kraft in ihre Short Stories. Und im englischen Seebad Margate findet T. S. Eliot radikale Töne für das widersprüchliche Lebensgefühl des noch jungen 20. Jahrhunderts. Quer durch Europa begleitet Norbert Hummelt diese Autoren und Autorinnen durch ein aufregendes Schaffensjahr und fängt dabei die spannungsgeladene politische Stimmung der Zeit ein.
Zum Autor
Norbert Hummelt wurde 1962 in Neuss geboren und lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für sein lyrisches Gesamtwerk wurde er 2021 mit dem Rainer-Malkowski-Preis ausgezeichnet. Zuvor hatte er u.a. den Hölty-Preis für Lyrik, den Rolf-Dieter-Brinkmann-Preis, den Mondseer Lyrikpreis sowie den Niederrheinischen Literaturpreis erhalten. Er übertrug T. S. Eliots Gedichtzyklen »Das öde Land« und »Vier Quartette« neu ins Deutsche und ist Herausgeber der Gedichte von W.B. Yeats. Bei Luchterhand erschienen zuletzt seine Gedichtbände »Fegefeuer« und »Sonnengesang«.
Norbert Hummelt
1922
Wunderjahr der Worte
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Arbeit des Autors an diesem Buch wurde durch die Kunststiftung NRW gefördert.Der Autor dankt außerdem der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Fondation Rilke in Sierre und dem Stadtarchiv Neuss für die Unterstützung seiner Arbeit.
Originalveröffentlichung Februar 2022
Copyright © 2022 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung einer Postkarte »Westbrook Promenade/Pavilion« von © margatelocalhistory.co.uk
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-27009-4V003www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
www.twitter.com/luchterhandlitww
Die Welt ist alles, was der Fall ist.
Wittgenstein
INHALT
PROLOG Die Wunderkammer
I.
Post am Sonntag
Ein Essen mit James Joyce
Ach, wie schön war’s auf Duino
Der bessere Handwerker
Grippewelle
II.
Orpheus singt
Weißer Rauch
Verkündigung
Orkan
Nervennahrung
Fastenzeit
III.
Auf und davon
Blick ins Chaos
Überzähliges Dasein
Von Männern und Frauen
IV.
Der übelste Monat
Ostersonntag in Rapallo
Zweckfreies Blühen
Masse und Macht
V.
Maifeiern
Unreal City
Gipfeltreffen
Rosen und Krisen
VI.
Lesen und Hören
Gral und Ritual
Bloomsday
Unentschieden
Koenigsallee
Drüsen
VII.
Gewitter
Der leere Platz
Duell im Morgengrauen
Sommerfrischen
Die Verschwundenen
VIII.
Über den Wolken
Kursverfall
Welttheater
Pflaumenkuchenzeit
Mythische Methode
IX.
Untergang
Ein Sommer ohne Picknick
Blauer Montag
Eau de Cologne
X.
Tod durch Wasser
Wartezimmer
Sag mir, wo du stehst
Ein Haufen zerbrochener Bilder
Kanarienvögel
Tanz den Mussolini
XI.
Badegäste
Allerseelen
Ausdruckstanz
Bald Mitternacht
Trauerfeiern
Wundervolle Dinge
XII.
Briefmarken
Fußnoten
Wintersachen
Schwefelhölzer
EPILOGAnnus mirabilis
Anhang
Auswahlbibliographie
Personenregister
PROLOG Die Wunderkammer
Was vor hundert Jahren war, kann keiner mehr erzählen. Niemand, mit dem man sprechen könnte, weiß es noch aus eigenem Erleben. Was einmal wichtig genug erschien, um es aufzuschreiben, steht in Büchern, vorausgesetzt, es wurde auch gedruckt und die Bücher sind noch aufzutreiben. Manches ist dokumentiert in Bild- und Schallarchiven, selten das, was man gerade sucht; die historischen Ereignisse, oder jene, die als solche gelten, sind leicht abrufbar, aber sie sind nicht das gelebte Leben. Mit Glück finden sich handgeschriebene Briefe. Die mündliche Überlieferung aber reicht kaum so weit hinab, dass sich die Stimmung eines einzigen Tages, ein Vorgang, ein Gespräch, ein Mienenspiel heraufholen ließe, so wie es vielleicht überhaupt nur Gedichten gelingt. Die Eltern lebten damals noch nicht, heute sind sie verstorben, und ihre Eltern, die damals jung waren, liegen lange schon im Grab.
Manche Dinge von vor hundert Jahren aber können wir uns vorstellen, weil sie lange Zeit auf die gleiche Weise gehandhabt wurden, oder doch so lange, dass sie unser Leben noch berühren konnten. So sehe ich die Handgriffe vor mir, die meine Großmutter, damals eine junge Frau von noch nicht 23 Jahren, am 2. Februar des Jahres 1922 ausgeführt haben wird, einem Donnerstag, an dem die nächtlichen Bodentemperaturen im westlichen Deutschland leicht unter dem Gefrierpunkt lagen. An diesem Tage war Mariä Lichtmess, das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, und damit kamen in katholischen Häusern die Bräuche der Weihnachtszeit in einem Akt des Aufräumens zum Abschluss. Meine Großmutter räumte die Krippenfiguren zusammen, im Wohnzimmer der Parterrewohnung in der Schillerstraße 29 in Neuss am Rhein. Sie nahm dabei jede Figur einzeln von der mit grünlich grauem Packpapier und Moos bedeckten, auf der Anrichte liegenden Sperrholzplatte, wickelte sie vorsichtig in dünne Servietten (wie man ein Neugeborenes in Windeln wickelt) und ließ sie bis zum nächsten Weihnachtsabend im Karton verschwinden. Ich habe diesen Vorgang später oft genug bezeugt und selbst verrichtet, um es mir vorstellen zu können, wie Hirten und Schafe, Ochs und Esel und die Heilige Familie in einem Seifenkarton verschwanden sowie die Heiligen Drei Könige mitsamt Kamel, die zuletzt gekommen waren, am Epiphaniastag, dem 6. Januar. Ich habe dieses Einpacken stets als schalen Akt der Entzauberung empfunden. Was aber jene junge Frau gedacht haben mag, die einmal meine Großmutter werden sollte, wer kann es wissen? Ihre Mutter war im Jahr zuvor gestorben, sie führte den Haushalt für ihre Brüder und ihren Vater, der im Einwohnerbuch 1922 für Neuss und Umgebung als Tagelöhner geführt wird, so dass auch diese Prozedur nun ihr oblag, unter den Augen ihrer hochbetagten Großmutter, die sich im letzten Lebensjahr befand und die man bei uns die Hundertjährige nannte, obwohl sie abweichenden Urkunden zufolge erst 99 oder gar erst 96 war, als sie im Sommer 1922 starb.
Ich muss zu solchen Bildern Zuflucht nehmen, weil ich nie mit meiner Großmutter darüber gesprochen habe, wie es war, als sie jung war. Dabei war sie meine einzige überlebende Verwandte, die ich zu einer Zeit, als ich selbst schon erwachsen war, über den Ersten Weltkrieg und die Zeit danach hätte befragen können. Sie war ja meine Großmutter und schien nie jung gewesen zu sein, dabei wirkte sie mit ihren bis ins hohe Alter schwarzen streng geflochtenen Haaren zugleich auf mich, als könne sie, wie die Sibylle von Cumae, nicht sterben. Eine einzige Erinnerung an mündlich Erzähltes verbindet sich mit meiner Großmutter und dem Jahr 1922. Sie soll in diesem Jahr das letzte Mal in ihrem Leben in Köln gewesen sein, das doch weniger als eine halbe Bahnstunde von Neuss entfernt liegt, und danach überhaupt nie wieder verreist sein. Es hat mich stets beeindruckt, wie sich ihr Lebenskreis immer enger um sie schloss und wie gelassen, wie selbstbestimmt sie damit umging. Nachdem sie aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, frühzeitig entschieden hatte, die Stadt nicht mehr zu verlassen, in der sie geboren worden war, mochte sie uns eines Tages auch nicht mehr besuchen kommen. Sie stellte dann auch die Kirchgänge ein, und da sie nie zum Arzt ging und das Einkaufen die Sache meiner im Haus verbliebenen Tante war, wird sie die enge Wohnung im Hochparterre viele Jahre überhaupt nicht mehr verlassen haben, bis es dann so weit war, dass sie im Krankenbett in jenem Wohnzimmer residierte, in dem zur Weihnachtszeit die Krippe stand. Dieses Zimmer war zugleich das Bücher- und Bilderzimmer, und es war und blieb die Wunderkammer meiner Phantasie. An Sonntagnachmittagen, nach dem Kaffeetrinken, saß ich oft in diesem Zimmer und nahm eines der Bücher aus dem Regal, besonders gern die Bildbände aus der Reihe der Blauen Bücher im Verlag Langewiesche-Brandt, und blätterte darin. Ich kann mich nicht erinnern, meine Großmutter jemals in einem Buch lesen gesehen zu haben. Ihr genügte die Tageszeitung. Sie saß nur da und saß uns vor und schien darüber selbst zu einem Bild zu werden, das an der Wand der Wunderkammer hätte hängen können. Eigentlich weiß ich über sie viel weniger als über die Dichter, die vor hundert Jahren schrieben und die ich mir als Begleiter und Gewährsleute zu eigen machte.
In das Wohnzimmer meiner Großmutter drang nie ein Sonnenstrahl, Vorhänge dichteten es zur Straße ab, und auch die Zeit verging darin anders. Die Uhr mit dem Westminsterschlag ging immer deutlich nach, Kalenderblätter wurden nicht beizeiten abgerissen.
Und doch war es ein Teil der Welt und war es auch an jenem Donnerstag, dem 2. Februar 1922, als ein irischer Schriftsteller in einem italienischen Restaurant in Paris gleich zwei Dinge auf einmal zu feiern hatte: seinen vierzigsten Geburtstag und das Erscheinen seines neuen Romans. Dass es sich zugleich um den Tag Mariä Lichtmess handelte, wird James Joyce dennoch bewusst gewesen sein, denn er war streng katholisch aufgewachsen. Am selben Tag versuchte ein aus Prag gebürtiger Dichter deutscher Sprache namens Rainer Maria Rilke in seinem Refugium, einem alten Wohnturm im Schweizer Kanton Wallis, die lange unterbrochene Arbeit an Elegienfortzuführen, die er ein Jahrzehnt zuvor auf einem Schloss an der Adria begonnen hatte, als ihn der fieberhafte Drang nach einem neuen Werk überkam und er nun ein Sonett nach dem anderen schrieb. Thomas Stearns Eliot, ein junger amerikanischer Dichter, der in London lebte, war an diesem Abend zum Essen verabredet und konnte vom frischen Abschluss eines langen Gedichts berichten, das ihm ohne die Hilfe eines Freundes nicht gelungen wäre.
Vorgänge weit außerhalb der großmütterlichen Wunderkammer, kein Buch dieser Autoren stand dort jemals im Regal, und nur in meinem Kopf besteht diese merkwürdige Verbindung. Und immerfort geschehen unendlich viele Dinge gleichzeitig in dieser Welt, stehen in Beziehung zueinander oder tun es nicht. Franziska Kemmerling, meine Großmutter, räumte die Krippenfiguren zusammen. Sie hatte niemals ein Zimmer für sich allein, und dass es Frauen gab, die nichts anderes taten als Bücher schreiben, wird ihr an diesem Abend kaum in den Sinn gekommen sein, an dem die englische Schriftstellerin Virginia Woolf, in Hörweite der echten Glocken von Westminster, mit Fieber im Bett lag und an ihren unvollendeten neuen Roman dachte, während ihre Kollegin Katherine Mansfield in Paris auf Heilung ihres Lungenleidens hoffte und unausgesetzt in ihr Tagebuch schrieb.
Wenige Jahre nach Ende des bis dahin furchtbarsten aller Kriege waren die weitaus meisten Menschen in Europa damit befasst, sich über Wasser zu halten und nicht noch tiefer ins Elend zu rutschen. Die Gräben zwischen den verfeindeten Nationen waren noch tief, und besonders Deutschland war international isoliert und kam unter der Last der im Versailler Vertrag festgelegten Reparationszahlungen dem wirtschaftlichen Zusammenbruch immer näher. Das bereitete den Boden für extreme Ideologien. Aufruhr und politische Morde waren an der Tagesordnung, die Zeitungen kündeten nahezu allmorgendlich davon.
Rückhaltlos neu zu denken konnte aber auch sehr fruchtbar sein. In den Künsten herrschte eine große Aufbruchsstimmung. Alte Übereinkünfte galten nicht mehr, das Ausmaß der Zerstörung hatte den Horizont weit aufgerissen. Das Medium, das die meisten Menschen erreichte, sie trösten und begeistern konnte, war zweifellos der Film, die stärksten Signale der Erneuerung aber kamen aus der Literatur. Wenn die Welt schon aus den Fugen war, konnte man ihr mit traditionellen Erzählformen nicht mehr beikommen. Neue literarische Formen, Bewusstseinsstrom und innerer Monolog, Zitatmontage und Fragment, Explosion der Stile und Vielzahl der Stimmen waren besser geeignet, das Zerbrochene zu fügen. Und wenn die Gegenwart öde und unfruchtbar war, dann ließ sich ihr im Rückgriff auf alte Mythen ein Spiegel vorhalten, ironisch oder elegisch, alles war möglich, alles erlaubt, wenn es nur frisch und großartig war.
Besonders in der angelsächsischen Welt spricht man von 1922 als dem Annus mirabilis der Klassischen Moderne. Was für ein Wunderjahr 1922 für die Literatur werden sollte, wie radikal neu darin gedacht und geschrieben werden würde, das konnte damals wohl nur Ezra Pound überblicken, der von Paris aus den großen Umbruch organisierte. Und selbst er konnte nicht planen, was sich in den Nachbarkünsten noch ereignen sollte in der kurzen Zeitspanne, die zwischen dem Erscheinen von Joyce’ Roman Ulysses Anfang Februar und Eliots Gedicht The Waste Land Mitte Dezember verstrich: Wassily Kandinsky ging ans Bauhaus, Walt Disney brachte den ersten Zeichentrickfilm heraus, Ludwig Wittgenstein den Tractatus, Louis Armstrong revolutionierte den Jazz … während Albert Einstein auf Vortragsreisen rund um die Erde das neue physikalische Weltbild erklärte, vor hellauf begeisterten Zuhörerscharen. In den Metropolen, in London, Moskau, Paris und Berlin aber suchten die von Krieg und Wirtschaftskrise gebeutelten Europäer Zerstreuung im Nachtleben, in Tanztheatern und Varietés; Tänzerinnen wie Anita Berber und Valeska Gert erprobten auf der Bühne ein befreites weibliches Körpergefühl und waren ihrer Zeit weit voraus.
Der 2. Februar 1922 war ansonsten ein nahezu normaler Tag. In Italien trat die Regierung zurück, und in Deutschland streikten die Eisenbahner. Wegen dieses Streiks, so berichtete die Neuß-Grevenbroicher Zeitung in einer Notiz gleich unterhalb des Wetterberichts, seien die Ränge bei der Reichstagssitzung am Vortag noch weniger gefüllt gewesen als gewöhnlich, da die Abgeordneten es vorgezogen hätten, morgens nach Hause zu fahren, ehe überhaupt kein Zug mehr fuhr. Überall in Europa aber blieb es nun schon wieder eine Stunde länger hell als zur Zeit der Wintersonnenwende.
I.
Post am Sonntag
Der 1. Januar 1922 war ein Sonntag. In Berlin empfing Reichspräsident Friedrich Ebert erstmals seit Kriegsende das Diplomatische Corps. Auf den Schiffen der deutschen Kriegsmarine wurden die Kriegsflaggen des Kaiserreiches eingeholt. In der Presse konnte man Berichte über eine Hungersnot in Russland lesen, von der Millionen Menschen bedroht waren, besonders an der Wolga und im Süden des Landes. Eine Missernte, eine große Dürreperiode im Sommer 1921 war vorausgegangen. »Täglich sterben Tausende an Hunger und Seuchen«, stand in der Frankfurter Zeitung. »Berge von Leichen türmen sich stellenweise auf.« Es stehe protokollarisch fest, dass Leichenteile zur Stillung des Hungers benutzt worden seien, nachdem man sich lange mit einem aus gemahlenen Baumrinden, Steppengras und Eicheln gebackenen Brot begnügt habe. Eine Springflut zerstörte weite Teile des Strandes von Westerland auf der Nordseeinsel Sylt. Dabei wurden zwei Lesehallen hinweggespült, auch das Strandcasino war gefährdet.
In Lausanne wiederum, dem Hauptort des Schweizer Kantons Waadt, bestieg ein hochgewachsener Mann den Zug, um nach Paris zu reisen. Dort war er mit seiner Frau verabredet. Er hatte mehrere Wochen in nervenärztlicher Behandlung verbracht, während dieser Zeit aber auch den Schlussteil eines längeren Gedichts geschrieben, das ihm nicht leichtfiel und in dem viel von Dürre die Rede war, wenn auch mehr im spirituellen Sinn. In Paris hoffte er, es einem Kollegen zeigen zu können, der ihm womöglich dabei zur Hand gehen würde, dieses Gedicht druckfertig zu machen.
Eine gute Bahnstunde östlich von Lausanne erhielt ein anderer Dichter an diesem Tage Post. Woran wir ablesen können, dass in diesen in dieser Hinsicht gesegneten Zeiten die Post sogar an Sonn- und Feiertagen kam. Die Post brachte ein Paket, und was darin war, ergriff Rainer Maria Rilke über die Maßen. In seinem winterfesten Turm, dem Château de Muzot oberhalb von Sierre im Kanton Wallis, den er mit Hilfe seiner gegenwärtigen Geliebten, Baladine Klossowska, gefunden hatte, am liebsten jedoch allein bewohnte, hoffte er, endlich weiter an diesen Elegien schreiben zu können, die ihm vor zehn Jahren zugefallen waren, als er auf dem viel herrlicheren Schloss Duino der Fürstin Marie von Thurn und Taxis am Nordufer der Adria lebte, und die seither in seinem Kopf herumspukten und jede andere nennenswerte literarische Arbeit blockierten. Er hatte sich einen ganzen Weltkrieg lang und seither schon wieder mehr als drei Jahre darum bemüht, war aber in all dieser Zeit so gut wie nicht vorangekommen. Was nicht zuletzt daran lag, dass er diese Elegien, deren Anfang ihm, so meinte er, von einer nichtmenschlichen Stimme während eines Sturmes eingesagt worden war, für derart bedeutend und großartig hielt, dass sogar er, Rilke, es vielleicht nicht schaffen könnte, sie aus der großen Wolke, die über ihm schwebte, herunterzuladen.
Nun aber kam dieses Paket. Es enthielt den handschriftlichen Bericht vom Sterben einer jungen Frau, verfasst von deren Mutter. Ihr Name war Wera Ouckama Knoop, und sie war mit gerade neunzehn Jahren an Leukämie gestorben. Das war nun bereits zwei Jahre her. Rilke war ihr vor Jahren in München begegnet, sie war eine Spielgefährtin seiner Tochter Ruth gewesen, und nachdem diese sich kürzlich verlobt hatte, hatte er den Kontakt zu Weras Mutter wiederaufgenommen. Weiter wäre vielleicht nichts geschehen, wenn Wera nicht auch Tänzerin gewesen wäre. Rilke beschrieb sie später in einem Brief: »Dieses schöne Kind, das erst zu tanzen anfing und, bei allen, die sie damals sahen, Aufsehen erregte, durch die ihrem Körper und Gemüt eingeborene Kunst der Bewegung und Wandlung –, erklärte ihrer Mutter unvermutet, daß sie nicht länger tanzen könne oder wolle …« Aus dieser eben begonnenen Bewegung, aus all dem, was verheißungsvoll erschienen war, so wie ein junges Leben immer Verheißung darstellt, hatte sie der Tod gerissen. Das war eine Mischung, die einen Dichter wie Rilke anziehen musste, an der sich seine Phantasie entzünden konnte. Ob dies dann aber auch wirklich geschieht, ist eine ganz andere Frage. Während des Krieges waren so viele Menschen gestorben, so viele waren noch jung gewesen, viele unter ihnen gewiss auch künstlerisch veranlagt. Selbst ein so sehr um Rückzug bemühter Mensch wie Rilke konnte nicht anders, als davon Kenntnis zu nehmen, und doch hatte das seine Elegien (abgesehen von der vierten, die er im November 1915 in München schrieb) nicht vorangebracht. Diesmal aber lagen die Dinge anders. Sicher nicht ohne Absicht hatte er Weras Mutter brieflich »um irgendein kleines Ding« gebeten, »das Wera lieb gewesen ist, womöglich eines, das wirklich bei ihr war«. Vielleicht hatte Rilke an eine Locke gedacht, eine Haarspange, ein Strumpfband, all das trauen wir ihm zu, um daran eine Art Voodoo-Zauber zu vollführen. Stattdessen aber kam ein ausführlicher Bericht, Gertrud Ouckama Knoop schickte ihm ihre Aufzeichnungen, die sie während der Krankheit ihrer Tochter angefertigt hatte. Die Aufzeichnungen selbst sind nicht erhalten, es sollen sechzehn eng beschriebene Seiten gewesen sein, ohne begleitende Karte. Ein wenig fragt man sich, warum sie in die Paketpost gegangen waren. Lagen vielleicht noch Socken bei, Kerzen, eine Flasche Wein? Wein eher nicht, denn Rilke trank mäßig bis gar nicht, was zu den unbegreiflichen Zügen an ihm gehört. Kerzen aber wurden in Muzot immer dringend gebraucht, es gab nämlich kein elektrisches Licht, und Rilke schrieb gern in der Nacht, weil »da doch die großen fremden Gedanken« bei ihm aus und ein gingen, wie er in der ersten Elegie geschrieben hatte. Noch dazu war die Zeit der Raunächte, der dunkelsten Tage im ganzen Jahr.
»Ich träumte, ich sei mit Grandma nach Ägypten gesegelt – ein leuchtend weißes Schiff«, notiert Katherine Mansfield am Neujahrstag in London in ihr Tagebuch. Schiffsreisen gehörten zu ihren frühesten Kindheitseindrücken; bereits als Säugling und dann wieder mit fünf Jahren hatte sie Überfahrten von ihrer Heimatstadt Wellington in Neuseeland nach Picton auf der Südinsel erlebt. Diese Welt lag für sie weit entfernt, nur in ihren Träumen hatte sie Zugriff darauf, und in ihrem Schreiben. Am Nachmittag arbeitet sie an einer neuen Kurzgeschichte, »Das Taubennest«. »Ich war nicht aufgelegt zum Schreiben; es schien unmöglich. Und doch, als ich drei Seiten fertig hatte, waren sie ganz in Ordnung.«
T. S. Eliot war mittlerweile in Paris angekommen. Die letzten Monate waren überhaupt nicht gut für ihn gewesen, und sein ohnehin angespannter Zustand, den er in den stets korrekten Anzügen nur notdürftig verstecken konnte, hatte ihn an den Rand eines Zusammenbruchs geführt. Gewohnt, mehr auf die neurotischen Zustände seiner Frau Vivien als auf seine eigenen zu achten, hatte er sich doch einmal um sich selbst kümmern müssen und ließ sich für drei Monate krankschreiben. Das brachte ihn endlich einmal weg von der aufreibenden Arbeit bei der Lloyds Bank in London, wo er im Colonial and Foreign Department mit der Abrechnung deutscher Vorkriegsschulden befasst war. Von Mitte Oktober 1921 an hatte er sich, zuerst zusammen mit seiner Frau, in Margate einlogiert, einem Seebad an der Küste von Kent. Die Ärzte hatten ihm strikte Erholung verordnet, auch durfte er am Tag nur zwei Stunden lesen und dies nur zu seiner Unterhaltung, aber eine solche Unterhaltung gibt es für einen Dichter nicht, wenn er sich von seinen Büchern fernhalten soll. Das Einzige, das ihm hätte helfen können, war das Schreiben. Vivien reiste nach zwei Wochen wieder ab, und an einem seiner einsamen Tage von Margate, vielleicht Anfang November, nahm Eliot an der Strandpromenade in einem Unterstand Platz, dem Nayland Rock Shelter, und sah hinaus auf das Meer. Vielleicht sah er das Meer nicht einmal, sondern schaute nur vor sich hin. Er hatte etwas zu schreiben dabei und notierte in einer jähen Aufwallung seiner Kraft rund fünfzig knappe Zeilen am Stück. Das war für Eliot sehr viel. Er war zu allen Zeiten ein Dichter, der sehr wenige Verse schrieb, und ein Schaffensrausch, wie Rilke ihn in seinem Leben einige Male erlebte, war für Eliot ganz und gar außerhalb seiner Reichweite. Aber was er hier aufschrieb, das hatte Substanz, es kam aus einer Bedrängnis heraus, wie sie größer nicht hätte sein können, und er tat eigentlich nichts, als diese Bedrängnis mit Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit auf den Punkt zu bringen: In Margate Sands. / Ich kriege nichts / Mit nichts zusammen. / Die Nägel kaputt, die Hände schmutzig. Eliot war zu dem Schluss gelangt, dass es eigentlich nicht Depressionen waren, unter denen er litt, sondern Abulie – ein Zustand negativer Kälte, in den er sich sein Leben lang schon eingeschlossen fühlte, aber »nothing wrong with my mind«, wie er an den Schriftstellerkollegen Richard Aldington schrieb. Die Abulie gilt nicht als eigenständige Krankheit, sondern als Symptom anderer Grunderkrankungen wie Depression oder schizophrene Psychose, und geht mit einer Schwäche der Sensibilität einher, auch mit wortkarger Sprache mit langen Pausen bis hin zur Stummheit und einer Unfähigkeit zu langen Monologen. Fürchterlich, wenn’s einen hat, schlimm auch für die anderen, aber dem Gedicht, an dem Eliot arbeitete, sollte das alles sehr zugutekommen. Die Kur in Margate reichte jedenfalls nicht, und auf Empfehlung einer Freundin, Lady Ottoline Morrell, die in London einen Salon unterhielt, hatte Eliot sich an Dr. Roger Vittoz in Lausanne gewandt, der irgendetwas Gutes an ihm bewirkt haben musste. Vittoz war kein Analytiker. Es gehörte zu seinen Methoden, den Kopf eines Patienten in seine Hände zu nehmen und ihn zu bewegen, bestärkende Worte und Vorstellungen mehrfach laut auszusprechen. Eliot wollte eigentlich schon an Heiligabend abreisen, aber er verlängerte für eine Woche, und in dieser letzten Woche konnte er auch schreiben. Vivien fand, er sehe viel besser aus, und Eliot war begierig, in Paris zusammen mit Ezra Pound am Manuskript zu arbeiten. Denn ohne ihn, den nimmermüden Impresario, die Mutter der Kompanie der modernen Dichter, den Eliot chère maître nannte, hätte er gar nicht gewusst, was er von diesem ganzen Sack Fragmente eigentlich halten sollte, den er unter dem etwas ulkigen Titel He Do The Police In Different Voices angehäuft hatte. So sollte es am Ende nicht heißen, aber wie dann? Bevor es aber an die Arbeit ging, trafen sie sich noch mit James Joyce zum Essen, und auch darauf hatte Eliot sich gefreut.
Rilke war es ausgesprochen recht, mit niemandem zum Essen verabredet zu sein. Baladine, seine Geliebte, die nur zu gern bei ihm in Muzot gewesen wäre, hatte er vorsorglich nach Berlin expediert. Um dabei selbst ein gutes Gewissen zu haben, hatte er ihr zu Weihnachten einen extralieben Brief geschrieben, der sie wissen ließ, dass er zu arbeiten habe und dazu der Einsamkeit bedurfte. Seine Haushälterin Frida Baumgartner würde zur Mitternachtsmesse gehen, darauf freute er sich schon im Voraus, »so werd ich ganz allein im stillen Hause sein, von halb elf an«. Schließlich hatte er sich ja nicht umsonst für einen derart abgelegenen Ort entschieden. Das Château de Muzot, ein Wohnturm aus dem 13. Jahrhundert und nur dem Namen nach ein Schloss, stand und steht noch immer auf nicht zu steiler Höhe unweit von Sierre, über dem Tal der Rhone. Wie er in dem Patrizier Werner Reinhart aus Winterthur einen großzügigen Freund fand, der das Anwesen nur von einem Bild her kannte, aber es doch gleich mietete und später kaufte, damit Rilke dort seine ersehnte Ruhe haben könnte, gehört zu den vielen glücklichen Fügungen in dessen Leben. Rilke im Torbogen, Rilke mit Baladine auf dem Balkon, der hinter der Mauer des Weingartens aufragende Turm mit dem gestuften Giebel: Diese Fotos fehlen in keiner Rilke-Biographie. Baladine suchte die Stoffe aus, die über den Fenstern zu hängen kamen, wählte die Farben, in denen die Wände gestrichen wurden, Rilke hing seine aus Russland mitgebrachten Ikonen auf; eine annehmliche kleine Behausung für zwei, aber wohnen wollte er dort allein. Und je weiter die Menschen von ihm entfernt waren, desto lieber schrieb er ihnen. Am 4. Januar dankte er Gertrud Ouckama Knoop mit dem ihm eigenen Überschwang für das Traurige, das sie ihm zugesandt hatte. »Läse man dies und es beträfe irgendein junges Mädchen, das man nicht gekannt hat, so wär’s schon nahe genug. Und nun geht’s Wera an, deren dunkler, seltsam zusammengefaßter Liebreiz mir so unsäglich unvergeßlich und so unerhört heraufrufbar ist, daß ich, im Augenblick, da ich dies schreibe, Angst hätte, die Augen zu schließen, um ihn nicht mit einem Male mich, in meinem Hier- und Gegenwärtigsein, ganz übertreffen zu fühlen …« Man verliert irgendwie aus dem Blick, wovon die Rede ist, und halb dichtet er wohl schon. Und immer wieder schaut er diese Ansichtskarte an, die seine liebende Baladine ihm bei ihrem letzten Besuch dagelassen hat. Die Reproduktion einer Federzeichnung von Cima da Conegliano, einem venezianischen Künstler, sie zeigt den Gott Orpheus, wie er musizierend unter den Tieren des Waldes sitzt. Ein Zufall? Nein, ein Wink natürlich. Wie hatte doch Stefan George formuliert: »winke sind / Von alters her die sprache der götter.«
Ein Essen mit James Joyce
Sie werde künftig keine Rezensionen mehr schreiben, diesen guten Vorsatz notiert Virginia Woolf am 3. Januar in Richmond an der Themse in ihr Tagebuch; die Redakteure pfuschten ihr zu sehr in ihre Artikel hinein, von denen viele anonym erschienen. So konnte es nicht weitergehen, es lenkte vom eigenen Schreiben ab, und ärgerlich war es noch dazu.
Katherine Mansfield vertraut dem Tagebuch jeden Morgen ihre Träume an. Oft spielen Schiffe und der Strand darin eine Rolle. Sie lebt weit weg von ihrer Heimat, unterstützt zwar von ihrem Vater, aber fallen gelassen von ihrer Mutter. Diese hatte Katherine, als sie mit zwanzig Jahren ungewollt schwanger war, noch unter ihrem Geburtsnamen Kathleen Beauchamp, ins bayerische Bad Wörishofen verfrachtet, wo sie unbemerkt entbinden sollte, sie dort aber allein gelassen. Ein Koffer, den sie auf einen Schrank wuchten wollte, erwies sich als zu schwer; eine Fehlgeburt war die Folge. Fortan war sie nur noch in ihrem Schreiben zu Hause. In einer deutschen Pension nannte sie 1911 ihr erstes Buch, veröffentlicht unter ihrem neuen Namen, der sie berühmt machen sollte.
Am Freitag, dem 6. Januar, begannen in Cannes die Verhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Obersten Rat der Alliierten. Sie betrafen den Aufschub der Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem Vertrag von Versailles zu leisten hatte, und dauerten eine ganze Woche, bis sie ergebnislos abgebrochen wurden. Deutschland wurde durch Walther Rathenau vertreten, der immerhin erwirken konnte, dass nun statt zwei Milliarden Goldmark pro Jahr alle zehn Tage 31 Millionen abzustottern waren. Diese kleine Einigung führte in Frankreich zum Rücktritt des Premiers Aristide Briand, dem man das Entgegenkommen gegenüber den Deutschen übelnahm. Briand hatte am Rande der Konferenz gerade noch mit seinem britischen Amtskollegen Lloyd George Golf gespielt. Die Presse untertitelte die Bilder mit den Worten: »Sie hatten nichts Besseres zu tun.« Ob von diesen Dingen auch bei Tisch die Rede war, als Joyce, Eliot und Pound in Paris dinierten? Eliot verstand zweifellos mehr von Geld als Joyce, wenn man damit Haushalten meint, und kannte sich sogar beruflich mit deutschen Schulden aus, Pound wiederum hegte sehr eigene Ansichten, was den Kapitalverzinsungszwang betraf. Aber es gab noch einen vierten Mann am Tisch, den amerikanischen Verleger Horace Liveright. Pound hatte das Essen arrangiert, um für seine Protegés Türen zu öffnen.
Ein Essen mit James Joyce, das war für Eliot inzwischen eine leichtere Übung als im August 1920, als er erstmals das Vergnügen mit dem irischen Kollegen gehabt hatte. Eliot, der schon länger ein Bewunderer der in Zeitschriften vorabgedruckten Kapitel aus Ulysses war, hatte darauf gebrannt, die Bekanntschaft des Autors zu machen. Als er wieder einmal eine Visite in Paris plante, schrieb er einen sehr höflichen ersten Brief an den sechseinhalb Jahre Älteren.
Lieber Mr Joyce, Ezra Pound hat mir ein Päckchen für Sie übergeben. Ich werde am Sonntag, dem 15., in Paris sein und am Montag wieder abreisen. Ich werde im Hôtel d’Élysée wohnen, Rue de Beaune 3, wo Pound war. Ich hoffe, Sie können mit mir an diesem Abend dinieren. Bitte. Können Sie mich dort so um halb sieben, sieben treffen? Sie nehmen das Päckchen an sich, und ich wäre sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen. Sie werden keine Zeit haben zu antworten. Aber bitte kommen Sie. Mit freundlichen Grüßen, T. S. Eliot.
Was in diesem Päckchen war, das er überbringen sollte, das wusste Eliot freilich nicht, und zurückhaltend, wie er war, wird er Pound auch nicht danach gefragt, sondern es als eine diskrete diplomatische Mission betrachtet haben. Joyce kam in das Hotel, und die Geschichte dieses Abends hat der Dritte im Bunde, der Maler und Schriftsteller Wyndham Lewis, überliefert. Eliot wird vor diesem Treffen nervös gewesen sein, da es ihm etwas bedeutete, Joyce kennenzulernen. Umgekehrt dürfte sich Joyce keine großartigen Gedanken gemacht haben, denn dieser Eliot, von dem ihm Pound nun schon seit Jahren erzählte, interessierte ihn im Grunde nicht. Erstens, weil ihn andere Schriftsteller insgesamt nicht besonders interessierten. Zweitens, weil es sich um Lyrik handelte, die Joyce von seinem Anspruch auf literarische Innovation merkwürdig ausnahm. Er hatte mit Gedichten debütiert, der Sammlung Chamber Music, diese Gedichte waren recht hübsch, nachromantisch, hochmusikalisch, traditionell gereimt, so dass sie auch seiner Frau Nora gefielen. Danach hatte er nur noch vereinzelt Gedichte geschrieben, zarte, fragile Strophen, aus Erlebnisanlässen, aber weit entfernt von der grundstürzend modernen Prosa, die er im Ulysses entwarf. Ob er Eliots 1917 erschienenes Debüt Prufrock and Other Observations je gelesen hatte, das ebenso wie die Ulysses-Vorabdrucke in Zeitschriften von Pound lanciert worden war, ist stark zu bezweifeln – zur Vorbereitung der Paketübernahme am 15. August 1920 aber jedenfalls nicht.
Im Hôtel d’Élysée erschien Joyce – wie Lewis festhielt, in Lacklederschuhen, mit starken Brillengläsern, schmalem Oberlippenbärtchen – mit seinem Sohn Giorgio, mit dem er wortreich Italienisch sprach, und wahrscheinlich hatte er nicht vor, lange zu bleiben. Er reichte Eliot seine Rechte zu einem schlaffen Händedruck, wurde aber munterer, als er sah, dass auch Wyndham Lewis dabei war, Mitbegründer des Vortizismus (einer englischen Kunstrichtung, die vom Kubismus inspiriert war). Joyce und Lewis waren beide vom selben Jahrgang, und sie kannten sich schon. Pech für Eliot, der von der Unterhaltung abgeschnitten war und von Joyce als »Ihr Freund Eliot« bezeichnet wurde. So hielt er sich erst einmal an seine Mission und übergab mit zeremonieller Geste das Päckchen: »Dies ist das Päckchen, das ich in meiner Notiz erwähnte.« – »Aha«, gab Joyce gelangweilt zurück, »dies ist also das Päckchen, das Sie in Ihrer Notiz erwähnten?« – »Ja, so ist es.« Joyce stellte nun das Päckchen auf den Tisch in der Hotellobby, wo sie saßen. Es war von dem in jeder Weise kunstreichen Ezra Pound aber so geschickt verknotet worden, dass ein Taschenmesser nötig schien, es zu öffnen. »Ah, Sie benötigen ein Taschenmesser?«, erbot sich Eliot sogleich sehr eifrig. »Ich fürchte nur, ich habe keins.« Leider hatte auch Giorgio keins dabei, was sein Vater nicht verstehen wollte. Schließlich musste eine Nagelschere herhalten, und dann kam endlich der Inhalt des Päckchens ans Licht. Eingewickelt in braunes englisches Packpapier kam ein Paar alter brauner Schuhe auf dem gutbürgerlichen französischen Tisch zu stehen, nebst verschiedenerlei nicht näher definierter Leibwäsche, was die ganze Tischgesellschaft in einige Verlegenheit stürzte. »Oh!«, entfuhr es Joyce. Dann ließ er die Schuhe stehen und setzte sich wieder hin, wie zuvor die Beine übereinanderschlagend.
Eliot hielt das für den passenden Moment, um die Frage nach dem Dinner wieder aufzubringen. Dabei, so beschreibt Lewis, habe er, mit seinem Bostoner Akzent, wie ein junger US-Präsident gewirkt, in dessen Gesicht sehr langsam ein Mona-Lisa-Lächeln aufsteigt. Um die Sache voranzubringen, wollte Joyce nun seinen Sohn mitsamt den Schuhen heim zu Nora schicken, der Giorgio ausrichten sollte, dass der Vater heute nicht zum Abendessen käme. Giorgio aber weigerte sich vehement, sich schicken zu lassen, und Joyce musste seine ganze angekratzte väterliche Autorität aufbringen, um ihn samt den Schuhen aus dem Gruppenbild verschwinden zu lassen. Sobald dies jedoch geglückt war, drehte er auf und verwandelte sich – so knapp er auch immer bei Kasse war, denn sonst hätte Pound wegen der Schuhe ja keinen Aufwand betreiben müssen – in einen höchst spendablen und zuvorkommenden Gastgeber, der es sich nicht nehmen lässt, die besten Weine und Speisen im Restaurant auf seinen Deckel zu nehmen. Dabei kehrte er, der sonst Stunde um Stunde an einem einzigen Satz seines Romans feilen konnte, so sehr den lustigen Iren heraus, dass schwer zu entscheiden blieb, wieweit dies alles eine Pose war. Zweifellos war es irritierend für Eliot, jemandem zu begegnen, der noch höflicher sein konnte als er selbst, ohne es damit völlig ernst zu meinen, und das nach Belieben einzusetzen wusste. Eliot fand dieses Benehmen schlicht arrogant.
Nun hatte Joyce eigentlich schon seit Monaten nichts anderes mehr zu tun, als die Fahnen seines in Kürze erscheinenden Buches durchzusehen, die laufend zwischen Paris und Dijon hin- und hergingen, aber immer noch voller Druckfehler waren. In Dijon saß Maurice Darantière, der Meisterdrucker, in Paris er selbst und Sylvia Beach, Inhaberin des Buchladens Shakespeare and Company, die sich aus Begeisterung für ihren Lieblingsautor erboten hatte, ein Buch herauszubringen, das weder in Großbritannien noch in den USA erscheinen konnte. In beiden Ländern war der Roman als obszön verboten worden, bevor er überhaupt fertig war – dafür hatte der Vorabdruck einzelner Episoden in den Zeitschriften Little Review und The Egoist gesorgt.
Natürlich muss man dafür den nachwirkenden viktorianischen Geist der Prüderie verantwortlich machen, nicht umsonst war es in den USA eine puritanische Liga, die sich diesem angeblich ruchlosen Buch in den Weg warf, aber Joyce, der von Jesuiten erzogen worden war und seinem katholischen Glauben nicht zuletzt wegen der heuchlerischen Sexualmoral abgeschworen hatte, legte es auf solche Konfrontationen zweifellos auch an. In dem Bestreben, ganz frei zu sein und keiner Autorität zu gehorchen, war der Gebrauch von tabuisierten Wörtern, Ideen und Vorstellungen ein unwiderstehlicher Test, um herauszufinden, wie weit er auf seinem Weg schon gelangt war – und wie rückständig die Welt um ihn herum. Schon bei der endlos verzögerten Publikationsgeschichte seiner Kurzgeschichtensammlung Dubliner wollte er sich einzelne Worte, die Anstoß erregten, nicht abhandeln lassen (es waren so harmlose Vokabeln wie bloody dabei), und er wies völlig zu Recht die Selbstzensur der Geschichte »Eine Begegnung« zurück, in der ein erwachsener Mann in Sichtweite zweier Knaben masturbiert. Das las sich im Text wiederum recht dezent und man konnte es beinahe überlesen; wenn man es aber einmal erkannt hatte, dann nicht mehr.In seinem autobiographischen Roman Porträt des Künstlers als junger Mann ließ Joyce sein Alter Ego Stephen Dedalus den berühmt gewordenen Schwur tun: Ich will nicht länger dem dienen, an das ich nicht länger glaube, ob es sich nun mein Zuhause, mein Vaterland oder meine Kirche nennt; und ich werde mich in einer Form des Lebens oder der Kunst ausdrücken, so frei wie ich kann und so vollständig wie ich kann, und zu meiner Verteidigung nur jene Waffen gebrauchen, deren Gebrauch ich mir erlaube: Schweigen, Exil und Schläue. Deshalb hatte er von Dublin fortgemusst und war nacheinander nach Triest, Zürich und Paris gegangen, um sich radikal freizuschreiben, und diese Befreiung sollte nun im Ulysses gipfeln, der auf vorher nicht gekannte Weise das unzensierte Bewusstsein seiner Figuren sichtbar machte, ihre unorthodoxen Gedanken, Wünsche, Ängste und Obsessionen.
Das alles fand die Amerikanerin Sylvia Beach furchtbar faszinierend, die eigentlich einen französischen Buchladen in New York hatte eröffnen wollen, sich dann aber für einen amerikanischen Laden in Paris entschied. Ermuntert von ihrer Freundin, der literarischen Buchhändlerin Adrienne Monnier, die ihr auch den Drucker Darantière vermittelt hatte, als sich Sylvia Beach zu ihrer verlegerischen Großtat entschloss. Sylvia Beach fand James Joyce darüber hinaus auch sehr nett, und ganz anders als Eliot fand sie ihn keine Spur arrogant. (Es wäre auch sehr unklug von ihm gewesen, dies ihr gegenüber zu sein.) Shakespeare and Company führte stets das Allerneueste und Modernste, was es an englischsprachiger Literatur gab, und war auch eine Leihbücherei, denn nicht jeder, der ein Buch lesen wollte, konnte sich auch leisten, es zu kaufen. (Joyce gab, was er entliehen hatte, selten zurück.) Der Laden befand sich damals in der Rue de l’Odeon 12, am linken Seineufer, im 6. Pariser Arrondissement, gleich in der Nachbarschaft des Buchladens von Adrienne Monnier. In dieser 176 Meter kurzen Straße sammelten sich in den zwanziger und dreißiger Jahren all die berühmten amerikanischen Exilautoren, Gertrude Stein und Ernest Hemingway, Ezra Pound und Thornton Wilder, John Dos Passos und Sherwood Anderson und wie sie alle hießen, die dann als Lost Generation berühmt werden sollten.
Heute und schon seit vielen Jahren liegt die Buchhandlung gleichen Namens in der Rue de la Bûcherie am Seine-Kai in Sichtweite von Notre-Dame, und angezogen von ihrem Ruhm ging ich in den achtziger Jahren dorthin und erkundigte mich nach der Adresse von Samuel Beckett, man gab mir auch Antwort, aber ich hatte sie mir nicht recht gemerkt und wusste nicht, ob Rue Saint Jacques oder Boulevard Saint Jacques und stand eine Stunde lang ergebnislos vor einem Haus in einer von beiden, ohne auf Samuel Beckett zu treffen.
Joyce hatte wie gesagt nichts anderes zu tun, als die Druckbögen von Darantière zu korrigieren, aber das sah er selbst anders. Er konnte nämlich nicht aufhören und nutzte die Fahnen zum Weiterdichten, und statt zu korrigieren, schrieb er immer mehr Text hinzu. Das tat er vornehmlich im Liegen, das Bett war sein bevorzugter Ort zum Schreiben, und nicht nur darunter litt die Lesbarkeit seiner Handschrift – was die Stenotypistinnen, die seinen Text abschrieben, schier zur Verzweiflung brachte. Der Hauptgrund hierfür war sein Augenleiden. Joyce hatte ein Glaukom, auch als Grüner Star bekannt, und so wie Beethoven ausgerechnet sein Gehör verlieren musste, befand sich der Meister der Schrift schon in der Mitte seiner schöpferischen Jahre in einem Prozess allmählichen Erblindens. Joyce hatte außerdem Anfälle von Iritis, Regenbogenhautentzündung, einer furchtbar schmerzhaften Angelegenheit. In Zürich war Joyce einmal mitten in einem Iritisanfall operiert worden.
Sylvia Beach beschreibt in ihren Memoiren voller Bewunderung, mit welcher Geduld er die Krankenhausbehandlungen auf sich nahm, bei denen gelegentlich Blutegel zum Einsatz kamen und die ihn mitten in der Fertigstellung seines entscheidenden Buches trafen. Aber auch von solcher Agonie ließ er sich nicht abhalten, seine Gedächtnisübungen zu machen. Joyce hatte seit seiner Jugend die Angewohnheit, große Mengen Text auswendig zu lernen, besonders Verse. So hielt er sich im Krankenhaus damit aufrecht, Walter Scotts »The Lady of the Lake«zu rezitieren. Es mag uns bei der Lektüre des Ulysses dämmern, in welchem Ausmaß Joyce beim Schreiben dieses Romans auf seine Memorierungskünste angewiesen war – die schiere Dichte der Verweise, die sein Buch so unerschöpflich machen, erforderte, all diese Bezüge im Kopf zu haben, während wir uns heute mit Suchfunktionen so bequem auch durch größte Textmengen bewegen und jedes von uns gerade benötigte Detail auffinden können.
Joyce aber hatte sein Buch und alles, was dazu wichtig war, im Kopf, das war sein Speicher, und es wäre ihm wohl auch möglich gewesen, Fehlendes aus dem Kopf heraus neu zu schreiben, wenn es verloren gegangen oder ins Feuer geworfen worden wäre – was mit einigen Seiten des Circe-Kapitels (der weitaus längsten Episode des Romans) tatsächlich geschah. Nachdem nämlich die neunte Circe-Stenotypistin das Handtuch geworfen hatte, musste Sylvia Beach ihre Schwester bitten, sich in die Handschrift ihres Autors einzulesen, und nachdem auch diese Schwester keine Zeit mehr hatte, kam eine Freundin zum Einsatz. Als diese aber einige Seiten aus dem Manuskript ihren Freund sehen ließ, war der über deren Inhalt so entsetzt, dass er sie kurzerhand in den Kamin warf (die Episode spielt in einem Bordell). Nun hatte Joyce aber keinerlei Sicherungskopie, die einzige Abschrift des Kapitels, die es überhaupt gab, befand sich auf dem Atlantik auf dem Weg zu John Quinn, dem New Yorker Rechtsanwalt, der notleidenden modernen Schriftstellern ihre Manuskripte abkaufte (und in dessen Besitz später auch das Manuskript von Eliots Waste Land gelangte, das über Jahrzehnte darin verschollen blieb). Wie Sammler aber nun mal so sind, wollte Quinn seinen Kauf nicht mehr herausrücken und fand sich nur widerstrebend bereit, eine weitere Abschrift erstellen zu lassen, um den Fortgang der Herstellung nicht länger zu blockieren. Unter solchen Schwierigkeiten ging ein großes Werk dem Druck entgegen, so umkämpft und angefeindet war schon vor Erscheinen ein einzelnes seiner Kapitel, noch dazu eines, das man, trotz einiger ganz unerhörter Szenen, bis heute nur mit einer Mischung aus Staunen und Strapaze lesen kann.
Dass unter den vier Herren, die Anfang Januar 1922 in Paris um einen Restauranttisch saßen, mindestens zwei waren, deren Werke einmal so etwas wie die Kronjuwelen der literarischen Moderne darstellen sollten, war ihnen auf recht unterschiedliche Weise bewusst. James Joyce war sich nur bei einem sicher, nämlich bei sich selbst, und schloss Gleichrangigkeit von vornherein aus. Eliot war sich bei Joyce sicher, bei sich selbst freilich noch nicht, hielt aber auch sehr viel von Pound. Pound war sich bei Joyce und Eliot sicher und hatte deshalb den New Yorker Verleger Liveright hinzugebeten, seine eigenen Ansprüche hielt er stolz zurück. Liveright war geneigt, die Dinge wie Pound zu sehen, und machte den beiden anderen ein Angebot. Während Joyce aber schon vor dem Nachtisch ablehnte, sollte sich die Sache mit Eliot hinziehen, genau genommen war sein Text ja auch noch längst nicht fertig. Dass es aber hinter den sieben Bergen einen deutschsprachigen Dichter gab, der in Kürze ein ebenso bedeutendes, ebenso herausforderndes, wenn auch völlig andersartiges Werk vollenden würde, ahnte in Paris an diesem Abend niemand, und Rilke selbst konnte nur darauf hoffen.
Ach, wie schön war’s auf Duino
»Die ganze Nacht von Besuchen in fremden Häusern geträumt, leeren Zimmern, Nr. 39, Fahrten auf und ab im Aufzug etc.«, notierte Katherine Mansfield am 8. Januar 1922 in ihr Tagebuch. Am selben Tag trat Éamon de Valera von seinem Amt als vorläufiger Präsident der Irischen Republik zurück. Er protestierte damit gegen den mit Großbritannien geschlossenen Friedensvertrag. Der in Paris lebende irische Autor James Joyce hatte derweil andere Sorgen. Am 9. Januar schrieb er an den Maler Myron C. Nutting, den er wegen der richtigen Farbe für seinen Buchumschlag um Hilfe bat. Ulysses sollte in den Nationalfarben Griechenlands erscheinen, weiß auf blauem Grund. Denn die Wanderungen des Protagonisten Leopold Bloom wiederholten auf ironische Weise die Irrfahrten des Odysseus nach der Eroberung von Troja, nur beschränkten sich die Wege Blooms auf die Stadt Dublin und den 16. Juni 1904 samt der Nacht zum folgenden Tag, während Odysseus zehn Jahre lang auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen war. Es musste jedenfalls das richtige Blau sein, und zur Anschauung hatte Joyce dem Maler eine griechische Flagge geschickt, damit er dieses Blau anrühren konnte. »Miss Beach möchte diese Farbe, wenn möglich, gern morgen haben. Das Blau ist in Ordnung, aber vielleicht etwas verblasst, weil die Flagge einige Zeit in der Sonne hing.«
Rilke schrieb in Muzot wieder einmal einen Brief an seine mütterliche Freundin, die Fürstin Marie von Thurn und Taxis. »Ich bin jetzt endlich mit der mühsamen Aufarbeitung meiner Briefrückstände fertig, hunderte und hunderte lagen angehäuft, und kann an Innerlicheres denken.« Innerlicheres meinte, sich den Elegien wieder anzunähern, die vor genau zehn Jahren auf Schloss Duino über ihn gekommen waren. Duino aber war im Weltkrieg zerstört worden, die Mauern standen nicht mehr, hinter die er sich zurückgezogen hatte, und nun galt es, »den dortigen Erinnerungen so nah als möglich zu kommen, an sie anzuschließen, sie fortzusetzen, das Verlorene mindestens in mir wieder aufzubauen!« Den zerstörten Mauern von Duino entsprachen die Elegienfragmente, die er nun seit Jahren mit sich herumtrug, ohne dass ihm bisher eingefallen war, wie es weitergehen könnte.
Kommt man heute nach Duino, dann ist es wiederum die Zerstörung, die man sich nicht vorstellen kann. Längst steht das, wie Rilke es treffend beschrieben hatte, immens am Meer hingetürmte Schloss, mit seinen gelben Mauern, wieder auf dem Felsen hoch über dem Golf von Triest, noch immer ist es im Besitz der Familie von Thurn und Taxis, oder Torre e Tasso, wie sie auf Italienisch heißen. Wenn man, nach halbstündiger Fahrt von Triest, aus dem Bus steigt, ist man zunächst überrascht, dass gleich vor dem Burgtor das alte Fischerdorf beginnt. Die exponierte Lage und das große, von Rilke so ersehnte Einsamkeitsgefühl erschließt sich aber sogleich, wenn man das Tor passiert hat. Denn der Weg führt auf das Schloss zu, und was hinter dem Schloss liegt, ahnt man schon, es ist nichts als der Himmel und das Meer.
Aber linker Hand verlockt ein Hinweisschild, den Gang zum Schloss noch aufzuschieben und einer anderen Spur zu folgen, in eine Phase der Geschichte, die Rilke nicht mehr erleben musste. 1943 wurde das wiedererbaute Duino von der Wehrmacht besetzt, die Hakenkreuzflagge wehte vom Turm, und Zwangsarbeiter der Organisation Todt mussten einen gewaltigen Bunker graben, hundert Stufen tief kann man hinabsteigen, und dann öffnet sich der Berg und man tritt hinaus unter Stechpalmen und Zypressen und hat von unten den Blick den Burgberg hinauf und sieht das weite blaue Meer und den Küstenweg nach Sistiana.
Ein damals fünfjähriger Junge, dessen Familie zu den Bediensteten auf Duino gehörte, erinnert sich an die unterirdischen Explosionen und wie er seine Kindheit auf dem Schloss erlebte: »Am liebsten hatte ich aber die Aussicht vom Fenster zu den Felsen nach Sistiana. Wenn ich zu den Felsen und zum Meer blickte, hatte ich manchmal das Gefühl, ich könnte fliegen.«
Das lässt sich an diesem Ort gut nachvollziehen, und schon etwas weniger befremdlich mutet es nun an, wie Rilke sich von dort an Engel wenden konnte, oder diese sich an ihn, und dass es just die auf Duino entstandenen ersten beiden Elegien sind, in denen das Wort Weltraum vorkommt. Aber nicht bloß der Raum weitet sich vor Duino, sondern auch die Zeit. In Ruinen liegt, seit Jahrhunderten, die alte Burg unten am Wasser, auf einem kleinen Sporn, mit der vorgelagerten Dante-Insel und dem nur vom Meer her sichtbaren Stein, der Weiße Dame genannt wird. Dass der Autor der Göttlichen Komödie dort gewesen sein soll, wird nur einer von vielen magisch anmutenden Reizen gewesen sein, die es dem damals 36-jährigen Dichter im Winter 1911/12 umso attraktiver machten, die Einladung der Fürstin anzunehmen. Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe war nicht zuletzt eine der reichsten Frauen Österreichs, das Stammschloss ihrer Familie lag in Böhmen, und dort war Rilke ebenso gern gesehen wie in ihrer nicht weniger luxuriösen Etagenwohnung in Venedig, nach dort war es von Duino ja nur ein Sprung. Beschweren konnte Rilke sich wahrlich nicht. Nur wartete er auch damals wieder einmal auf den Neuanfang des Schreibens, das ihm nach dem Abschluss seines Romans Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge abhandengekommen war. Nur kein Neid, sage ich mir stets, wenn ich mir all die noblen Wohnungen vergegenwärtige, die Rilke von Damen und gelegentlich auch von Herren aus adligen wie aus großbürgerlichen Kreisen so bereitwillig angeboten worden waren. Die Gastgeber hofften dabei auf seine Gesellschaft, er hoffte darauf, möglichst ungestört bleiben zu dürfen, was nicht in jedem Fall auf eine Win-win-Situation hinauslief.
Im Januar 1912 war es still geworden auf Duino, und die anderen Gäste, wie der Philosoph Rudolf Kassner, auch er ein Günstling der Fürstin und einer von Rilkes wenigen männlichen Freunden, hatten sich verzogen. Es mehrten sich um ihn die zeichenhaften Ereignisse, Rilke dachte über die Geister Verstorbener nach, von denen es hieß, sie gingen auf Duino um, und besonders hatte ein rätselhaftes Naturerlebnis auf ihn eingewirkt. Er hatte sich im Park des Schlosses an einen starken alten Baum gelehnt und dabei das immer drängendere Gefühl gehabt, als sei eine Energie da, die ihn hinüber auf die andere Seite zöge – in den anderen, ans hiesige Leben angrenzenden Bereich. Wenn man so etwas erlebt, dann muss man schreiben, anders hält man es nicht aus. Und ein wenig hatte Rilke sich auch schon warm geschrieben, mit dem Zyklus Das Marien-Leben, aber er wollte noch mehr. Was dann geschah, hat Marie von Thurn und Taxis in ihren Erinnerungen an Rilke beschrieben. Es fing mit einem Brief an, den er beantworten musste, einem Geschäftsbrief, über den er sich geärgert hatte. In so einer Lage kann man eigentlich nicht dichten. Aber es ging ein starker Wind, eine Bora, das war gut so, denn es pustete dem Dichter die Stirn frei.
Rilke ging ganz in Gedanken versunken auf und ab, da die Antwort auf den Brief ihn sehr beschäftigte. Da, auf einmal, mitten in seinem Grübeln, blieb er stehen, plötzlich, denn es war ihm, als ob im Brausen des Sturmes eine Stimme ihm zugerufen hätte: »Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel / Ordnungen?« … Lauschend blieb er stehen. »Was ist das?«, flüsterte er halblaut … »was ist es, was kommt?« Er nahm sein Notizbuch, das er stets mit sich führte, und schrieb diese Worte nieder und gleich dazu noch einige Verse, die sich ohne sein Dazutun formten.
Das ist die berühmte Ursprungsgeschichte der Elegien, sie klingt ein wenig nach Pfingstwunder, nach moderner Heiligenlegende. Die Fürstin freute sich an so einer tollen Geschichte, schließlich handelte es sich um ihr Schloss, nach diesem waren die Elegien am Ende benannt, und sie betrachtete Rilke als ihren Dichter. Im Grunde ist es merkwürdig, wenn wir es uns klarmachen: Die Stimme, die Rilke da hörte, rief etwas, das nur aus seiner Warte Sinn ergab, eben nicht von jemandem aus, der »der Engel Ordnungen« angehörte. Also hatte er seinen eigenen unterdrückten, im Irrealis formulierten Schrei von außen gehört, und es ist eigentlich diese leicht schräge Verschiebung, die das Ereignis beglaubigt.
Nicht zufällig hatte sich Rilke in dieser Zeit mit dem Gedanken an eine Psychoanalyse getragen, seine alte Freundin Lou Andreas-Salomé, die im Begriff stand, sich von Freud zur Analytikerin ausbilden zu lassen, hatte ihm einen Therapeuten empfohlen, und Rilke hatte sogar erwogen, das mit dem Schreiben ganz sein zu lassen. Das kam ihm nun wieder sehr abwegig vor, denn was er da begonnen hatte, war schon in den ersten Versen ausreichend komplex, um ihn ganz allein zu beschäftigen, und zwar so, als sei er viele.
Draußen, auf den zum Meer gewandten Terrassen des Schlosses, steht ein weißer Steintisch, daneben ein Schild, das behauptet: La terrazza dove R. M. Rilke ha scritto le »Elegie Duinesi« – Die Terrasse, wo R. M. Rilke seine Duineser Elegien geschrieben hat. Das ist so nicht ganz richtig, denn im Winter von Duino entstanden nur die ersten zwei, nebst ein paar Stücken, Versgruppen, Ansätzen. Vor allem aber fragt man sich, ob es Rilke an diesem Tisch zum Schreiben nicht zu kalt war, erst recht, wenn die Bora wehte. War er wenigstens in dicke Decken gehüllt?
In Muzot schaute Rilke nun auf diese Stücke, Versgruppen, Ansätze, die seit geschlagenen zehn Jahren auf sein Eingreifen warteten. Wie sollte er aus ihnen das Schloss wieder erbauen, wie konnte er sein Werk zu Ende bringen? Wie schön war es doch auf Duino gewesen! Woran er freilich gar nicht denken konnte, war, dass er in jener Zeit nur eine halbe Busstunde entfernt von James Joyce gewohnt hatte. Dieser schlug sich in Triest damals schon seit sieben Jahren als Sprachlehrer an der Berlitz School durch, um seine Frau und ihre beiden kleinen Kinder zu ernähren, und war mit seiner Situation als Schriftsteller mit Recht völlig unzufrieden. Der Streit um die Publikation der Dubliner zog sich seit Jahren endlos hin, und das Porträt des Künstlers war auch noch nicht fertig. Wer war überhaupt James Joyce? Rilke hatte den Namen noch nie gehört, er las ohnehin nicht gern Englisches, und wenn er überhaupt einmal einen Ausflug von Duino aus machte, dann fuhr er nach Venedig und nicht nach Triest. Und wer war Rilke? Joyce hatte den Namen noch nie gehört. Dabei wäre dessen Malte Laurids Brigge für ihn interessant gewesen, ein Bildungsroman wie das Porträt des Künstlers, an dem er schrieb. Aber er las nicht gern Deutsches, obwohl er es konnte, er ließ es aus Protest gegen diese erzkatholischen Habsburger, auf deren Territorium er sich leider befand, er lernte lieber Italienisch, und das war auch die Sprache, die er und Nora zu Hause mit den Kindern redeten. Außerdem war Joyce unendlich weit davon entfernt, auf so ein Schloss eingeladen zu werden, wie man es Rilke zu Füßen legte, er pfiff auch darauf, er fühlte sich als Sozialist, schon allein, weil er das älteste von dreizehn Kindern war. Dabei hätten sie sich schon zehn Jahre früher in Paris über den Weg laufen können, Anfang des Jahrhunderts, als Joyce vor seinem Elternhaus und der Kirche und Rilke vor Clara Westhoff und ihrer gemeinsamen Tochter davongelaufen war.
An diese Dinge aber dachte jetzt niemand, Joyce nicht, der es nicht abwarten konnte, ob sein Buch auch pünktlich zu seinem vierzigsten Geburtstag fertig werden würde, und Rilke nicht, als er den Brief an die Fürstin frankiert hatte und nach draußen sah, in den Schnee. Es war immer noch der 9. Januar 1922.
Der bessere Handwerker
In London scheint am 10. Januar die Sonne und taut den letzten Schnee von den Dächern. In Paris waren Eliot und Pound nun schon ein paar Tage an der Arbeit, in Pounds Studio in der Rue Notre-Dame-des-Champs 70. Vivien war nach Lyon abgereist, Eliot hatte sich im Casino de Paris eine Vorstellung der Mistinguett, einer legendär langbeinigen Sängerin, angesehen, und so gab es nichts, was die beiden Männer hätte aufhalten können. Außer vielleicht das Manuskript selbst, das sich in einem schwierigen Zustand befand. Sicher, auch Rilke hatte es mit Fragmenten zu tun, aber was sollte denn Eliot sagen? Alles, was er hatte, waren Fragmente, und ob sie überhaupt jemals so etwas wie einen Zusammenhang ergeben könnten, war ausgesprochen fraglich. Er hatte zwar die Idee, mehrere große Teile zu bilden, vier oder fünf. Aber jeder dieser Teile bestand wieder aus lauter kleineren Passagen, die voneinander sehr verschieden waren. Es gab gereimte Strophen, erzählerische Stücke und jede Menge versprengtes Zeug, gedrechselte Zitatmontagen, Undefinierbares.
Rilke hatte mit seinen Fragmenten etwas ganz anderes vor: Ihm ging es um das »Anheilen der Bruchstellen«, wie er sich ausdrückte, er wollte einfach weiterschreiben, wo er hatte abbrechen müssen, und am Ende sollte es so aussehen, als habe es niemals eine Störung gegeben – so, wie ein Knochen nach einem Bruch zusammenwächst, und am Ende ist alles heil. Und so klingen sollte es auch, getragen von einer einzigen Stimme, der des Dichters nämlich, der im Zustand der Erleuchtung spricht.
Das war für Eliot utopisch. Es lagen viel zu viele verstreute Knochen, Stücke und Splitter herum, als dass sich daraus noch eine heile Figur hätte bilden lassen. Das stand so ähnlich sogar in den Versen selbst formuliert. »Du siehst doch nur / Einen Haufen zerbrochener Bilder«, »Mit diesen Bruchstücken stützte ich meine Trümmer«. Tatsächlich konnte man sich so gut wie jedes der Bruchstücke in seiner Mappe wie von einer anderen Stimme gesprochen vorstellen, nur die des Dichters war irgendwie nicht dabei.
Genau das fand nun Ezra Pound ausgesprochen gut, ja, er fand es großartig. In dieser Fragmentierung lag etwas ganz Neues, darin lag das radikal Moderne, um das es ihm ging. So musste man jetzt schreiben, in diesem heillos kaputten Europa. Eliot hatte es drauf, es steckte da in seinem Manuskript, man musste es nur richtig herausholen und stark machen. Und Pound war nicht zimperlich darin, Eliot zu zeigen, wie das gehen sollte. Er strich ganze Passagen einfach weg, umfangreiche Teile, die Eliot wichtig gewesen waren, sonst hätte er sie nicht abgetippt. Etwa zehn Tage lang währte dieses Lektorat, das man als die wohl großartigste Kooperation bezeichnen darf, die zwei Dichter je am Manuskript eines von ihnen vollführten. Am Ende schnitt Pound rund die Hälfte der Verse weg. Entscheidend ist freilich, wo er das Messer ansetzte. Mehrere weitschweifige Passagen, die nach Eliots Vorstellung zum ersten, dritten und vierten Teil gehören sollten, strich er ganz, darunter breit erzählerische ebenso wie ziseliert gereimte. Man sieht daran, dass es Pound nicht darum ging, das Gedicht in eine bestimmte Richtung zu drängen, in die es vorher nicht unterwegs gewesen wäre. Er holte einfach das Beste hervor und schied das nicht so Gute aus. Gottfried Benn sagte einmal, Lyrik müsse exorbitant sein oder gar nicht – was aber exorbitant ist und was nicht, ist sehr die Frage.
Pound konnte das am Werk des anderen messerscharf erkennen. Zum Beispiel kappte er die ziemlich langweilige Eröffnungsszene, die Schilderung einer Sauftour. »Wir tranken uns erst mal warm, als wir in Toms Laden waren«, so hätte es nach Eliots Plan losgehen sollen. Aber Pound hatte den viel besseren Anfang schon entdeckt: »April is the cruellest month« – »April ist der übelste Monat von allen«. Vom vierten Kapitel, »Death By Water«, ließ er so gut wie gar nichts stehen, dafür gefiel ihm sehr, was Eliot aus Lausanne mitgebracht hatte. »What The Thunder Said« sollte dieser Schluss heißen, und man sieht heute in der Faksimile-Edition des lange verschollenen Manuskripts, wie Pound an den Rand geschrieben hatte: »O. K. from now on I think.« Eliot hätte jetzt ziemlich bedient sein können, als er Mitte des Monats nach London zurückkehrte, denn leicht ist es ja für einen Autor nicht, sich derart gerupft zu finden, aber nach allem, was wir wissen, nahm er den fachlichen Rat seines Freundes dankbar an. Das heißt, ein wenig verschnupft war er schon. Das lag an der Grippewelle, die durch Europa rollte und auch ihn erfasst hatte, was er für den Rest des Monats in keinem Brief zu erwähnen vergaß.
Auch Virginia Woolf liegt krank danieder und freut sich überhaupt nicht auf ihren vierzigsten Geburtstag. Wie soll man sich auch freuen, wenn die Kraft nicht da ist, weder zum Lesen noch zum Schreiben.
Die lungenkranke, 33-jährige Katherine Mansfield ist fieberhaft bei der Arbeit. Es ist der beste Weg, um ihre Schmerzen zu betäuben. Die Kurzgeschichte »Eine Tasse Tee«schreibt sie über vier bis fünf Stunden in einem Rutsch. Eine andere Geschichte, »Das Puppenhaus«,ist von der amerikanischen Zeitschrift The Dial angenommen worden. Bevor sie in die Post geht, muss sie noch sauber abgeschrieben werden, und dafür ist ihr Mann als Schreibkraft zuständig. »Ein scheußlicher, kalter Tag … Jack und ich ›tippten‹. Ich hasse das Diktieren, aber ich finde die Geschichte immer noch gut. Ist sie es?« So etwas fragt sich ein Autor immer, besonders, wenn der Schreibprozess noch nicht lange zurückliegt. Ihre Lunge ächzt. Sie überlegt, nach Paris zu gehen. Sie hat von einem russischen Arzt gehört, der sie womöglich heilen könnte.