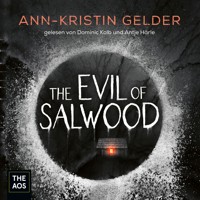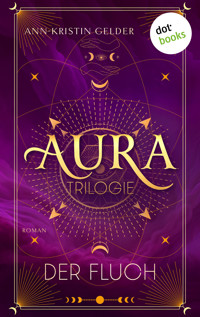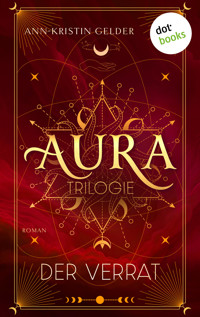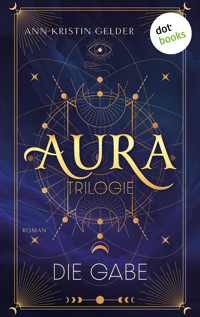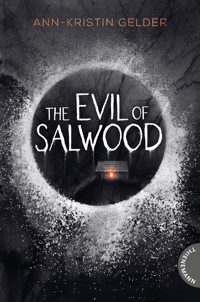9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jahrelang wähnte Louisa sich in Sicherheit. Die Erinnerung an das dunkelste Kapitel ihrer Vergangenheit war beinahe verblasst. Doch dann erhält sie eine verstörende Mail. Im Betreff ein Countdown: »Noch 21 Tage«. Der Inhalt, eine Horrorgeschichte. Sie beschreibt Louisas eigenen Tod. Eine dumpfe Beklommenheit ergreift von ihr Besitz. Plötzlich fühlt Louisa sich beobachtet, verfolgt, kämpft gegen ihre wachsende Angst. Und dann lässt eine weitere Mail keinen Zweifel mehr zu: Jemand will mit ihr abrechnen, jemand, der ihr Geheimnis kennt. Der Countdown läuft, und für Louisa gibt es kein Entrinnen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Jahrelang wähnte Louisa sich in Sicherheit. Die Erinnerung an das dunkelste Kapitel ihrer Vergangenheit war beinahe verblasst. Doch dann erhält sie eine verstörende Mail. Im Betreff ein Countdown: »Noch 21 Tage«. Der Inhalt, eine Horrorgeschichte. Sie beschreibt Louisas eigenen Tod. Eine dumpfe Beklommenheit ergreift von ihr Besitz. Plötzlich fühlt Louisa sich beobachtet, verfolgt, kämpft gegen ihre wachsende Angst. Und dann lässt eine weitere Mail keinen Zweifel mehr zu: Jemand will mit ihr abrechnen, jemand, der ihr Geheimnis kennt. Der Countdown läuft, und für Louisa gibt es kein Entrinnen …
Autorin
Ann-Kristin Gelder, Jahrgang 1981, ist Deutsch- und Musiklehrerin. Sie lebt mit ihrem Mann, zwei Katern, drei Kindern und zwölf Musikinstrumenten an der Weinstraße. Wenn sie nicht gerade an einem neuen Roman schreibt, geht sie geocachen oder steht mit Band oder Chor auf der Bühne.
Ann-Kristin Gelder
21 Tage
Psychothriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe November 2021
Copyright © 2021 by Ann-Kristin Gelder
Copyright © Deutsche Erstausgabe 2021 by
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: © Trevillion Images / Buffy Cooper; FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
BH · Herstellung: ik
Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-25530-5V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
EINS
Der Tod fand Louisa im fahlen Schein des aufgehenden Mondes.
Obwohl es bereits stockdunkel draußen ist, geht mir dieser Satz in Endlosschleife durch den Kopf, und ich muss mich mit Gewalt dazu zwingen, mich auf die Straße zu konzentrieren.
Immer wieder werden Regenböen gegen die Windschutzscheibe geweht, und die Welt verschwindet für einige Sekunden hinter einem nassen Schleier. Trotz höchster Intervallstufe kommen die Scheibenwischer nicht gegen die Wassermassen an.
Es war eine dumme Idee, das letzte Design noch fertigzustellen, länger als alle anderen im Büro zu bleiben und meinen Yogakurs sausen zu lassen. Jetzt muss ich durch Regen und Sturm zurückfahren. Ich bin nur wenige Kilometer von meinem Haus entfernt, doch es fühlt sich an, als könnte es nicht weiter weg sein.
Wenn ich heute Morgen etwas früher aufgestanden wäre, hätte ich den Auftrag vor der Telefonkonferenz beenden können, ohne in Zeitnot zu geraten. Alternativ hätte ich abwarten können, bis sich die Wetterlage ein wenig gebessert hat, um mich dann auf den Heimweg zu machen. Verdammte Ungeduld. Schon am helllichten Tag ist die kurvenreiche Strecke durch den Wald anstrengend zu fahren. In einer stürmischen Nacht ist sie grauenvoll. Zu allem Übel ist das angekündigte Gewitter trotz meiner Beschwörungen natürlich nicht in die andere Richtung gezogen. Im Gegenteil. Als würde es mir folgen, ist jeder Donner lauter als der vorige. Blitze zerreißen die Finsternis, tauchen die Umgebung in grelles Licht. Die Schwärze wirkt anschließend nur noch tiefer. Die Baumstämme sind feucht vom Regen und reflektieren das aufzuckende Licht. Die dahinterliegende Dunkelheit scheint voller sich windender Schatten zu sein. Ich kann nicht sagen, wie oft ich schon erschrocken bin, weil ich mir eingebildet habe, eine menschliche Silhouette allein am Straßenrand zu sehen. Meine Augen sind überreizt von dem schnellen Wechsel zwischen Hell und Dunkel.
Wieder wandern meine Gedanken zu der Mail, die ich vor zwei Tagen erhalten habe.
Noch einundzwanzig Tage
Der Tod fand Louisa im fahlen Schein des aufgehenden Mondes.
Sie stand in ihrer Küche, machte Abendessen. Eine willkommene Ablenkung. Eine Ablenkung von der Angst, die in den vergangenen Stunden ihr ständiger Begleiter gewesen ist.
Am Nachmittag hatte sie eine Nachricht erhalten, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Aus der nahe gelegenen Nervenheilanstalt war ein Patient entkommen. Ein Soziopath, der es liebte, mit seiner Beute Katz und Maus zu spielen. Ein kaltblütiger Mörder, der seine bisherigen Opfer mit einer Spiegelscherbe markiert hatte, um sie dann in seinen tödlichen Plan zu verwickeln. Die Polizei hatte die Warnung ausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten, und Louisa brauchte keine zweite Einladung, um der Aufforderung zu folgen.
Trotzdem wollte das kalte Gefühl in ihrem Innern nicht verschwinden. Sie konzentrierte sich auf das Messer in ihrer Hand, mit dem sie die Zutaten schnitt. Knoblauch. Schafskäse. Tomaten.
Bis …
Ein Knirschen ließ sie innehalten.
Das Messer zitterte in ihrer Hand.
Wer ist da?
Ein Geräusch aus dem Flur, fast unhörbar. So flüchtig und hohl, dass es auch das Wispern des Windes sein könnte. Doch der Wind weht nicht durch das Haus.
Ist es … er?
Nein. Lächerlich.
Warum sollte er ausgerechnet sie wählen?
Warum sollte er ausgerechnet in ihr Haus eindringen?
Warum sollte er ausgerechnet ihrem Leben ein Ende setzen wollen?
Warum nicht?
Kein Grund zur Sorge.
Wieder das Geräusch. Deutlich näher.
Allen Grund zur Sorge.
Louisa.
Sie umfasst den Griff ihres Messers fester. Öffnet die Tür. Lauscht in die Stille.
Er kommt.
Ein fremder Geruch in der Luft. Nicht alleine.
Zögerliche Schritte. Banges Warten.
Vor ihr etwas am Boden.
Glänzend und boshaft. Gezackt. Scharfkantig.
Die Scherbe. Die Spiegelscherbe.
Zu spät.
Sie ist sich ihrer eigenen Zerbrechlichkeit nicht bewusst.
Jetzt wird sie ihr vor Augen gehalten.
Ihr Spiegelbild.
Zersplittert wie die Scherbe.
Er ist da.
Diese Worte … Diese seltsame Mischung aus Sätzen und direkten Sinneseindrücken ist mir nicht unbekannt. Sie ist mir schon einmal begegnet. Vor ungefähr fünfzehn Jahren. Und damals ist die Sache alles andere als gut ausgegangen.
Nein. Nicht darüber nachdenken. Nicht jetzt. Ich hatte mich die letzten drei Tage einigermaßen im Griff, also werde ich es auch heute Abend schaffen.
Für einen Moment ziehe ich in Erwägung, an den Straßenrand zu fahren, um dort zumindest den Höhepunkt des Unwetters abzuwarten, doch alles in mir sträubt sich, auch nur eine Minute länger in der Dunkelheit unterwegs zu sein als nötig. Ich kenne die Strecke auswendig. Zwei enge Linkskurven, anschließend knapp drei Kilometer geradeaus. Wieder eine Kurve, dann mein Haus. Eine Viertelstunde. Maximal.
Ich drehe das Radio noch lauter, damit die Musik den grollenden Donner und den prasselnden Regen übertönt. Kein Grund zur Sorge.
Allen Grund zur Sorge.
Es ist bloß ein Gewitter, und laut Faraday ist das Auto währenddessen ein sicherer Ort. Trotzdem wäre ich lieber zu Hause. In meinem weichen Bett mit den kuscheligen Kissen, eine Tasse Salbeitee in der Hand, den ich mir fast jeden Abend zum Einschlafen koche.
Eine Bewegung am Straßenrand holt mich jäh aus meinen Gedanken. Zu abgehackt und ruckartig, um von einem sturmgepeitschten Baum oder Busch zu stammen. Ein Tier?
Instinktiv reiße ich das Steuer zur Seite und trete auf die Bremse. Mein Fiat schlingert, gerät ins Schleudern. Für einige grauenhafte Augenblicke verlieren die Reifen die Bodenhaftung und rutschen über den regenglatten Asphalt. Ich stoße einen erstickten Schrei aus und umklammere das Lenkrad mit beiden Händen. Nur Sekunden später greifen die Reifen wieder, und das Auto kommt mitten auf der Fahrbahn zum Stehen.
Ich drehe den Schlüssel, und Motor und Musik ersterben abrupt. Obwohl die Tropfen nach wie vor auf das Dach trommeln, ist die Stille übermächtig. Als hielte die Zeit den Atem an. Fast bin ich dankbar für den nächsten Donnerschlag, der mich aus dem seltsamen Schwebezustand reißt.
Ich atme einmal tief durch und zwinge meinen rasenden Puls wieder auf ein normales Tempo. Es ist nichts passiert. Ich habe überreagiert, weil ich wegen der Gewitteratmosphäre angespannt bin. Ich habe mich lediglich erschreckt, weil …
Ja, weshalb eigentlich?
Ein unangenehmes Kribbeln läuft mir über den Rücken.
In einer solchen Nacht kann einem die Fantasie Streiche spielen. Und trotzdem bin ich sicher, etwas am Straßenrand gesehen zu haben, was dort nicht hingehört. Nicht in einen dichten Wald, mehrere Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. Eher schon in ein Horrorkabinett oder eine Geisterbahn.
Eine dunkel gekleidete Gestalt. Eine Gestalt mit einer schwarzen Skimaske, die das Licht der Scheinwerfer aufzusaugen schien.
Ist es … er?
Nein. Lächerlich.
Ich streiche mir eine Haarsträhne aus der Stirn, beiße mir auf die Unterlippe und starte den Motor. Die plötzlich wieder einsetzende dröhnende Musik lässt mich zusammenzucken, und ich verfluche meine eigene Schreckhaftigkeit.
Ich drehe mich halb um und setze einen knappen Meter zurück, um das Auto wieder gerade auf die Straße zu bringen.
Zusammenreißen.
Kurze Zeit später bin ich erneut auf Kurs, allerdings nach wie vor über die Maßen angespannt. Immerhin hat sich mein Herzschlag beruhigt. Leider nur so lange, bis ich in der Dunkelheit vor mir etwas auf der Straße liegen sehe. Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Die eingebildete Gestalt hat mir schon gereicht. Was ist nun los?
Vor ihr etwas am Boden.
Abermals verringere ich mein Tempo und bin dankbar dafür, dass dieses Mal keine Vollbremsung nötig ist, weil ich ohnehin nur in mäßiger Geschwindigkeit unterwegs war. Etwa zwei Meter vor dem Hindernis halte ich an und schalte das Radio aus. Die Scheinwerfer meines Wagens zerschneiden scharf die Dunkelheit, die abseits des Lichtkegels jetzt dicht und bedrohlich wirkt. Die Blitze und die darauffolgenden Donnerschläge sind seltener geworden.
Ich strecke mich ein wenig und spähe mit zusammengekniffenen Augen nach draußen in die Dunkelheit. Als ich erkenne, was meine Weiterfahrt verhindert, bin ich erleichtert und frustriert zugleich. Ein großer Ast liegt auf der Straße. Kein Wunder bei dem Sturm. Nicht wirklich gefährlich, aber nach dem ersten Schreck würde jetzt wohl schon ein Kaninchen ausreichen, um mich in Panik zu versetzen.
Ich lasse das Auto ein Stückchen nach vorne rollen, sodass die Scheinwerfer den Ast vollständig erfassen. Er glänzt vor Nässe und ist an seiner breitesten Stelle bestimmt armdick. Und natürlich liegt er so auf der Straße, dass nicht einmal mein kleiner Fiat daran vorbeipasst. Ich habe heute echt kein Glück.
Was nun?
Das Klügste wäre, umzudrehen und zu Josy zu fahren. Ungeachtet der Uhrzeit würde sie mir einen Kaffee kochen und mich in eine dicke Decke gewickelt vor den Kamin setzen. Andererseits ist es nicht mehr weit nach Hause. Selbst im Schneckentempo dürfte ich nur wenige Minuten brauchen – sofern ich diesen Ast irgendwie beiseiteschaffen kann.
Ich durchwühle meine Handtasche nach meinem Handy und atme auf, als ich sehe, dass ich trotz des Unwetters und des Walds um mich herum guten Empfang habe.
Spontan rufe ich Josy über die Kurzwahltaste an.
»Hey, Süße«, meldet sie sich nach dem zweiten Klingeln. »Bist du zu Hause? Ich habe es vorhin schon mal bei dir versucht.«
»Noch nicht ganz«, erwidere ich. »Ein dämlicher Ast blockiert die Straße.«
»Du bist noch unterwegs?«, fragt Josy.
»Ich habe länger gearbeitet«, erkläre ich kleinlaut.
»Himmel, Lou.« Josys Stimme klingt gereizt. »Es gab eine Unwetterwarnung, hast du nichts davon mitbekommen?«
»Ich dachte, so schlimm würde es schon nicht werden«, verteidige ich mich. »Und es wäre auch kein Problem, wenn nicht der Ast auf der Fahrbahn läge.«
»Ausgerechnet heute musstest du Überstunden machen«, murmelt sie. »Während sich alle anderen beeilen, um rechtzeitig zu Hause zu sein, bevor es richtig losgeht. Und jetzt?«
»Werde ich versuchen, das Mistding an den Straßenrand zu ziehen. Sieht nicht allzu schwer aus«, entgegne ich, ernte von Josy aber bloß ein skeptisches Brummen.
»Fahr besser zurück in die Stadt«, sagt sie. »Du kannst bei uns übernachten. Ich koche dir einen Kaffee und lege ein paar Holzscheite in den Kamin.«
Unwillkürlich muss ich lächeln, beschließe aber, lieber aktiv zu werden. In der Zeit, die ich schon mit Josy telefoniere, hätte ich den Ast dreimal aus dem Weg räumen können. Kurz bilde ich mir wieder ein, eine Gestalt im Schatten der Bäume zu sehen. Aber niemand wusste, dass ich ausgerechnet heute Überstunden machen würde. Es ist denkbar unwahrscheinlich, dass mir hier im Wald jemand auflauert.
Warum sollte er ausgerechnet sie wählen?
»Ich steige jetzt aus«, verkünde ich, schnalle mich ab und öffne die Autotür. Sofort weht mir eine Sturmbö Regen ins Gesicht, sodass ich mir meine Kapuze über den Kopf ziehe, um das Handy vor der Feuchtigkeit zu schützen. Es im Auto zu lassen kommt nicht infrage. Josys Stimme beruhigt mich. Langsam gehe ich im Licht der Scheinwerfer auf das Hindernis zu. Meine Gestalt wirft einen langen Schatten auf den glänzenden Asphalt.
»Du bist echt mutig«, sagt Josy mit einer Ruhe, die im krassen Kontrast zu den tobenden Naturgewalten um mich herum steht.
»Bin gleich da«, sage ich, ohne auf das Kompliment oder die Kritik – ganz sicher bin ich mir nicht, was es war – einzugehen.
Ich schaue mich einmal um. Vollkommen sinnlos, da ich ohnehin nur Dunkelheit sehen kann. Dann trete ich testweise gegen den Ast. Da er sich überraschend leicht bewegen lässt, klemme ich mir das Handy zwischen Schulter und Ohr und zerre ihn unter vollem Körpereinsatz zur Seite. Kurze Zeit später ist die Straße wieder frei. Ich richte mich auf und blinzle in das grelle Licht der Scheinwerfer.
»Alles okay?«, will Josy wissen.
»Ja«, erwidere ich knapp, während ich zum Auto zurückgehe. »Ich denke, du kannst auflegen.«
»Schick mir eine Nachricht, wenn du daheim bist«, sagt Josy, was ich natürlich verspreche.
Wir verabschieden uns, und ich öffne die Fahrertür.
Als ich wieder im warmen und trockenen Auto sitze, lasse ich mich in das weiche Polster sinken und blicke auf die nun freie Straße. Obwohl ich mich nur kurz von meinem Wagen entfernt habe, steigt ein komisches Gefühl in mir auf. Hektisch schalte ich die Innenbeleuchtung an und prüfe die Rückbank. Sie ist leer. Natürlich.
Dann wird mir klar, wie gut ich von außen sichtbar bin, und ich mache das Licht wieder aus. Diese ganze Situation macht mich regelrecht paranoid, ich bin froh, wenn ich endlich zu Hause bin. Obgleich es keine Anhaltspunkte dafür gibt, werde ich den Eindruck nicht los, dass ich in dieser Gewitternacht nicht alleine bin.
Ich schnalle mich an, drehe den Zündschlüssel und aktiviere die Innenverriegelung. Das gleichmäßige Brummen des Motors beruhigt meine überreizten Nerven.
Noch wenige Kilometer und ich bin zu Hause. Der Regen hat mittlerweile nachgelassen, sodass ich die Geschwindigkeit der Scheibenwischer herunterregeln kann. Flüchtig bilde ich mir ein, einen unbekannten Geruch im Auto wahrzunehmen. Würzig und irgendwie herb, mit einem Hauch von Tabak. Sicher nur der durch den Regen verstärkte, typische Waldduft. Kein Grund zur Beunruhigung.
Ein fremder Geruch in der Luft. Nicht alleine.
Und doch verspüre ich den geradezu zwanghaften Wunsch, mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist, dass ich nach wie vor alleine im Wagen bin. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, fasse ich nach hinten und berühre mit den Fingerspitzen etwas Weiches.
Haare.
Mein Herz bleibt für einen Moment stehen, und ich rechne fest damit, dass sich gleich kalte Finger um mein Handgelenk schließen. Bis ich mich an den flauschigen Badvorleger erinnere, den ich gestern Nachmittag gekauft habe und der zusammengerollt hinter meinem Sitz liegt.
Erschöpft stoße ich die angehaltene Luft aus. Wenn ich nicht bald daheim bin, erleide ich noch einen Nervenzusammenbruch.
Mit einem Seufzen schalte ich die Musik an, dieses Mal deutlich leiser als zuvor, aber laut genug, um mitsingen zu können. Ich sollte dringend aufhören, mich selbst so verrückt zu machen.
Drei Songs später lichtet sich endlich der Wald. Mir wird fast schwindlig vor Erleichterung, erst jetzt realisiere ich, wie angespannt ich war. Beim nächsten nächtlichen Gewitter werde ich mich bei Josy und ihrem Mann einquartieren oder notfalls im Büro übernachten. Beides dürfte weniger nervenaufreibend sein als der überstandene Horrortrip.
Aufatmend biege ich in meine Einfahrt ein. Heute wäre es wirklich schön, nicht alleine zu wohnen und einen Mann oder zumindest Freund zu haben, mit dem ich über meine Schreckhaftigkeit lachen könnte.
Mit einem Anflug von Niedergeschlagenheit parke ich meinen Fiat in der Garage und öffne die hintere Tür, um den Badvorleger herauszuholen, der vorhin für einen Schockmoment gesorgt hat. Als ich mich wieder aufrichte, bemerke ich einen Lichtreflex im Augenwinkel.
Glänzend und boshaft. Gezackt. Scharfkantig.
Ich stelle die Tüte zur Seite und beuge mich nach vorne. Eisige Kälte breitet sich in mir aus, die nichts mit dem kühlen Herbstwetter zu tun hat.
Auf der Rückbank hinter dem Fahrersitz liegt eine Spiegelscherbe. Klein genug, um sie bei einem schnellen Blick im schummrigen Licht der Innenbeleuchtung zu übersehen, aber definitiv nicht so winzig, dass sie mir gestern beim Verstauen der Tüte nicht aufgefallen wäre. Ich bin mir ganz sicher, dass sie noch nicht im Auto lag, als ich vorhin vom Büro losgefahren bin. Als ich realisiere, was das zu bedeuten hat, wird mir übel.
Jemand war in meinem Wagen.
Ich kämpfe gegen die Panik an, schließe die Augen und konzentriere mich auf meine Atemzüge. Die schwarze Gestalt am Waldrand. Der Ast auf der Straße. Hat tatsächlich jemand die Gelegenheit genutzt, um mir einen Streich zu spielen?
Ich weiche einige Schritte zurück und greife nach der Handschaufel aus Metall, die ich mit anderen Gartenwerkzeugen in der Garage aufbewahre. Sofort fühle ich mich besser. Jederzeit bereit zuzuschlagen, prüfe ich sorgfältig den Innenraum des Autos. Doch ich finde nichts – bis auf die Spiegelscherbe, die im trüben Licht der Garagenlampe funkelt, als wollte sie mich verhöhnen.
Kurz entschlossen nehme ich einen alten Lappen vom Regal, wickle das scharfe Glasstück darin ein und stecke es in meine Handtasche.
Die Tüte mit meinem Einkauf in der einen, die erhobene Schaufel in der anderen Hand verlasse ich schließlich die Garage. Die wenigen Meter durch den Vorgarten ziehen sich ewig hin. Jede Sekunde erwarte ich, dass sich ein Angreifer auf mich stürzt. Nichts passiert.
Im Haus schließe ich zweimal die Tür von innen ab und gestatte mir einen Moment der Erleichterung. Ich bin daheim. In Sicherheit.
Nachdem ich einen Kontrollgang durch alle Zimmer inklusive der drei Kellerräume gemacht und sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss sämtliche Lichter angeschaltet habe, fühle ich mich zumindest nicht mehr unmittelbar bedroht. Ob ich die Scherbe vorhin beim Losfahren doch übersehen habe? Aber wie ist sie auf dem Sitz gelandet? Wer hat sie dort hingelegt? Bei der Erinnerung daran, dass ich früher mit Freunden ähnlichen Blödsinn gemacht habe, regt sich mein schlechtes Gewissen.
Ich schicke die versprochene kurze Nachricht an Josy, versorge meinen Kater Mozart mit Futter und stelle mich anschließend unter die Dusche. Obwohl ich mindestens eine Viertelstunde lang heißes Wasser auf mich niederprasseln lasse, kann es die unterschwellige Kälte nicht vertreiben, und auch später im Bett ist das Unbehagen nicht verschwunden. Es hat sich in mir eingenistet wie ein ungebetener Besucher, der mich von einer Zimmerecke aus beobachtet und einfach nicht verschwinden will. Auf den ersten Blick nicht zu sehen, aber dennoch da.
Ich lege die Gartenschaufel neben mein Kopfkissen, um mich der Illusion von Schutz hinzugeben, und versuche, an etwas Schönes zu denken. Leider erfolglos, die Beklommenheit hat mich weiterhin in ihren Klauen.
Sie ist sich ihrer eigenen Zerbrechlichkeit nicht bewusst.
Jetzt wird sie ihr vor Augen gehalten.
Ich wurde ausgewählt.
ZWEI
Noch achtzehn Tage.
Mit einem unguten Gefühl blicke ich auf den Betreff der Mail, die laut Anzeige um 6:55 Uhr eingegangen ist. Nachdem die vergangene Nacht voll von Albträumen von glitzernden Spiegelscherben und boshaften schwarzen Gestalten war, dauert es einige Sekunden, bis mein Gehirn das Wesentliche realisiert. Bei der Mail handelt es sich um eine weitere Gruselgeschichte mit einer zufällig generierten Adresse aus Ziffern und Buchstaben als Absender.
Eigentlich hätte sie im Spam landen müssen, die Betreffzeile liest sich wie das einmalige Angebot einer Wunderdiät, die innerhalb von wenigen Tagen zur Traumfigur verhilft. Leider weiß ich sehr genau, dass der Inhalt sich nicht mehr von einer solchen Werbung unterscheiden könnte.
Kurz ziehe ich in Erwägung, die Nachricht mit einem Rechtsklick in den Papierkorb meines privaten Mail-Accounts zu befördern, doch irgendetwas hält mich davon ab. Vermutlich das Wissen, dass mir der Mist selbst dann keine Ruhe lassen würde.
Der Tod fand Louisa an einem kühlen und regnerischen Abend.
Ich greife nach meiner Kaffeetasse und zwinge mich zum Weiterlesen. Obwohl ich bereits ahne, was kommt, will ich Sicherheit haben.
Ich beuge mich ein wenig nach vorne.
Die Sonne war längst hinter dem Horizont verschwunden, und die Fichten im Garten neigten sich im auffrischenden Wind.
Eine ausgelassene Filmnacht mit ihren Freundinnen war geplant, doch was letztendlich daraus wurde, hatte nichts mehr mit dem ursprünglichen Plan gemein.
Eine Liebeskomödie. Unmengen an Essen und Getränken. Angeregte Gespräche. Gelächter.
Der Film war nicht besonders gut, die Stimmung umso besser.
Bis …
Ein unbekanntes Geräusch sorgte für jähe Stille. Der Film wurde angehalten, man sah sich um.
Nichts Besorgniserregendes. Nichts Bedenkliches.
Nichts Greifbares, aber trotzdem da. Ein Knistern? Ein Scharren?
Halbherzig wurde der Film weitergeschaut, bis ein schrilles Klingeln den Abend durchschnitt.
Ein kurzer Schreckmoment, dann Erleichterung. Das Telefon. Nur das Telefon.
Unbekannte Nummer.
Sie nahm das Gespräch an. Ein Fehler.
Der Anrufer hatte keine guten Absichten. Keine guten Absichten.
Louisa. Komm nach draußen. Komm zu mir.
Sie legte auf, lachte. Ein Telefonstreich.
Ihr Lachen klang hohl.
Die Aufmerksamkeit der anderen war wieder auf den Fernseher gerichtet, bis das trockene Schaben erneut ertönte.
Unruhe. Beklommenheit, die zu Angst wurde.
Drei junge Frauen alleine im Haus. Die nächsten Nachbarn weit entfernt. Ein großer Garten, um den sie viele beneideten. Jetzt Grund zur Unsicherheit.
Der Fernseher schwieg.
Wieder das Kratzen. Eindeutig von der Terrassentür. Fingernägel, die über Glas fuhren? War das der Anrufer? War er hier?
Eine Stimme von draußen. So flüchtig und hohl, dass es auch das Wispern des Windes sein könnte. Doch der Wind spricht nicht.
Louisa.
Ungläubige Blicke. Der Pulsschlag dröhnt in ihren Ohren. Sie sind nicht allein in dieser Nacht.
Ein Aufwallen von Mut. Tollkühnheit?
Sie steht auf, läuft zu der Tür. Die Freundinnen bleiben zurück.
»Geh nicht.«
Louisa will nicht hören. Sie durchbricht die letzte Barriere, die sie von der Dunkelheit trennt.
»Wer ist da?«
Atemgeräusche in der Nacht. Das Rascheln von trockenem Herbstlaub. Ein Aufblitzen in der Schwärze.
Er kommt.
Sie schreit auf, dreht sich um, will flüchten. Sie ist nicht schnell genug.
Zu spät.
Er ist da.
Ich starre auf den Bildschirm, und die Worte verschwimmen für einen Moment vor meinen Augen. Viel zu heftig stelle ich den Kaffeebecher ab, sodass die Keramik mit einem lauten Knall auf der Tischplatte landet.
Fiona, die mir gegenübersitzt, blickt von ihrem Monitor auf.
»Alles klar, Lou?«, vergewissert sie sich.
»Natürlich.« Ich grinse verlegen. »Ich habe mich nur in der Entfernung verschätzt. Lag bestimmt daran, dass ich gerade eine Nachricht von meinem Horrorkunden bekommen habe, der mit dem neuen Entwurf schon wieder nicht zufrieden ist.«
Ich weiß selbst nicht, weshalb ich zu dieser Schwindelei greife. Vermutlich, weil die Wahrheit, dass mich eine klischeehafte Gruselgeschichte aus dem Konzept gebracht hat, zu peinlich wäre und zu viele Fragen aufwerfen würde.
Meine Arbeitskollegin mustert mich nachdenklich. »Du bist blass«, stellt sie fest.
»Schlecht geschlafen«, sage ich betont gelassen, und das ist immerhin keine Lüge. Dank des gestrigen Vorfalls und der Albträume bin ich in der Nacht mehrfach schweißgebadet hochgeschreckt.
»Und du bist dir wirklich sicher, dass sonst nichts ist?«, lässt Fiona nicht locker.
»Absolut«, erwidere ich mit all meiner Überzeugung, nehme als Beweis einen weiteren Schluck Kaffee und achte diesmal darauf, die Tasse betont leise abzusetzen.
Fiona zuckt mit den Schultern, bevor sie den Blick wieder auf ihren Bildschirm richtet. Auch ich gebe vor, mich an die Arbeit zu machen, doch in Wirklichkeit gehen mir die beiden ersten Sätze der zwei Mails, die ich bisher erhalten habe, nicht aus dem Kopf. An konzentrierte Arbeit ist unter diesen Umständen kaum zu denken.
Der Tod fand Louisa im fahlen Schein des aufgehenden Mondes.
Der Tod fand Louisa an einem kühlen und regnerischen Abend.
Diese verfluchten Mails haben schon jetzt viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen.
In den folgenden Stunden arbeite ich weitgehend störungsfrei und überstehe außerdem die anberaumte Telefonkonferenz, in der ich das Farbkonzept eines neuen Logos mit einem sehr speziellen Kunden bespreche.
Gegen Mittag schaut Carsten, der Geschäftsführer und gleichzeitig mein direkter Vorgesetzter, vorbei und kündigt an, für die ganze Firma beim Chinesen zu bestellen. Als er sich mir zuwendet, breitet sich Wärme in mir aus, und ich hoffe, dass mein Make-up ausreichend deckt, um meine mit Sicherheit geröteten Wangen zu verbergen.
»Für dich das Übliche, Lou?«, fragt er mit seiner angenehmen Stimme, die immer ein wenig rau klingt. »Gebratene Nudeln mit Hühnchen?«
Ich nicke wortlos und täusche Gelassenheit vor, obwohl mir allzu bewusst ist, dass Carsten nur wenige Zentimeter hinter mir steht und mir vermutlich über die Schulter schaut.
»Sieht gut aus«, lobt er und geht etwas zur Seite. Als er sich auf meine Schreibtischplatte stützt, fällt mein Blick auf den schmalen goldenen Ehering an seiner linken Hand. »Eventuell könnten Sie über einen etwas weniger grellen Rosaton nachdenken, vielleicht kombiniert mit Grau?«, fügt er hinzu, was mir ein ersticktes Lachen entlockt.
»Das war mein Vorschlag«, erwidere ich, »aber der Kunde hat sich dagegen entschieden. ›Die Farben sollen knallen!‹, waren seine Worte.«
»Hätte ich mir denken können«, sagt Carsten mit seinem typischen schiefen Lächeln.
Bevor ich mich für das versteckte Kompliment bedanken kann, richtet er sich auf und verlässt unser Büro, um die Essensbestellung der Entwicklungsabteilung im Nebenraum aufzunehmen. Dabei ruhen meine Augen auf seiner durchaus ansprechenden Rückansicht.
»Chef«, erinnert mich Fiona grinsend. »Glücklich verheiratet.«
»Ist mir durchaus klar«, schnappe ich zurück und widme mich erneut der Farbgestaltung des Logos.
Bis zu meinem Feierabend gelingt es mir, weder über die beunruhigenden Mails noch über die Spiegelscherbe in meinem Auto nachzudenken, doch schon als ich am späten Nachmittag vor meinem Fiat stehe, überfällt mich wieder Beklommenheit.
Bevor ich in den Wagen steige, prüfe ich sorgfältig sowohl Rückbank als auch Fuß- und Kofferraum. Erwartungsgemäß finde ich nichts, bin aber weiterhin angespannt. Bisher habe ich mich in meinem Wagen immer sicher gefühlt. Bloß ein Klick und die Zentralverriegelung ist aktiv. Seit mir klar geworden ist, dass sich ein Unbekannter Zugang verschafft haben muss und somit höchstwahrscheinlich im Besitz einer Kopie meines Schlüssels ist, sieht die Sache anders aus. Hoffentlich legt sich dieses unterschwellige Gefühl der Bedrohung in Kürze, und das Ganze stellt sich als dummer Scherz heraus. Vermutlich ist in erster Linie gar nicht der nächtliche Vorfall der Grund meiner Angst, sondern die Erinnerungen, die durch die Scherbe in Kombination mit den Mails geweckt wurden. Die Erinnerungen und das schlechte Gewissen.
Glücklicherweise sind es von meiner Firma bis zu dem Café in der Innenstadt, in dem ich mit Josy verabredet bin, nur wenige Minuten Fahrt. Hoffentlich wird ein Gespräch mit meiner besten Freundin alles ins rechte Licht rücken.
»Ich kann verstehen, dass du Panik hattest«, sagt Josy kurz darauf, nachdem ich ihr geschildert habe, was nach unserem Telefonat geschehen ist. »Du hättest dich noch mal melden können.«
»Ich wollte keinen Stress machen«, winke ich ab. »Und eigentlich ist ja auch nichts passiert, abgesehen davon, dass ich fast durchgedreht wäre. Allerdings habe ich heute Morgen –«
Ich verstumme, weil in diesem Moment der Kellner die von uns georderten Latte macchiato bringt.
»Allerdings hattest du heute Morgen ein Gespräch mit deinem heißen Chef?«, bietet Josy an, nachdem sie genießerisch einen Schluck getrunken hat.
»Das auch. Lässt sich im Büro nicht vermeiden«, antworte ich grinsend. »Aber eigentlich wollte ich dir von einer weiteren Mail erzählen, die ich bekommen habe.«
»Eine weitere Mail?« Josy zieht verständnislos eine Braue hoch. »Was meinst du?«
»Am Montag kam die erste. Anonym. Der Betreff war Noch einundzwanzig Tage«, sage ich. »Der der heutigen ist Noch achtzehn Tage.«
Josy winkt ab. »Und jetzt bist du irritiert, weil man dir Tabletten für eine Penisverlängerung anbietet, die innerhalb von weniger als drei Wochen Wirkung zeigen sollen?«
»Nein«, erwidere ich ernst.
Meine Freundin erkennt sofort, dass etwas nicht stimmt. Sie stellt ihr Glas auf den Tisch und mustert mich auffordernd. »Also?«
»Die Mails bestanden aus Gruselstorys«, sage ich und fasse mit wenigen Worten die Handlungen der beiden Texte zusammen. Josy hört mir schweigend zu, und ihr Gesichtsausdruck verdüstert sich merklich, als ich von der Spiegelscherbe im Wagen erzähle.
»Es ist nicht das erste Mal, dass derartige Geschichten in meinem Leben auftauchen«, sage ich vage, hebe für eine kurze Gnadenfrist meinen Kaffee an die Lippen und nehme einen Schluck. Die folgende Beichte wird unangenehm.
»Alles hat während der Schulzeit angefangen. Ich war sechzehn und Teil einer festen Clique. Wir waren eine verschworene Gruppe, nur im Viererpack anzutreffen, und haben einigen Quatsch angestellt. Nick war mein erster Freund, ich lag ihm buchstäblich zu Füßen, habe jeden Blödsinn mitgemacht, den er vorgeschlagen hat. Eigentlich war alles recht harmlos, aber einmal haben wir für eine Schularbeit einen Schummelplan ausgeklügelt.«
Josy lacht. »Wie heftig.«
»Astrid, ein Mädchen aus unserer Klasse, hat uns belauscht, als wir darüber gesprochen haben.«
»Astrid«, wiederholt Josy. »War sicher nicht einfach für sie mit dem Namen.«
»Sie war eher eine Einzelgängerin und hatte wenig Freunde, weil sie jede Gelegenheit genutzt hat, um sich vor den Lehrern hervorzutun. Jedenfalls hat sie uns vor der Arbeit hochgehen lassen und dafür gesorgt, dass wir alle schlechte Noten bekommen haben«, sage ich, ohne auf Josys Kommentar zu Astrids Namen einzugehen. »Im Nachhinein war ihr Verhalten natürlich nicht toll, aber andererseits hatten wir uns nicht so auf die Arbeit vorbereitet, wie wir es hätten tun sollen. Damals sahen wir die Dinge jedoch anders: Astrid war schuld an dem Debakel. Wir waren unglaublich wütend und beschlossen, Rache zu nehmen, ihr gründlich Angst einzujagen. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee mit der Wette gekommen.«
»Eine Wette.« Josy stöhnt. »Das riecht schon nach Ärger. Worum ging es? Ist das die Verbindung zu diesen Mails?«
»Nick hatte schon davor gerne Geschichten erfunden, und ich muss zugeben, dass sie meistens ziemlich gut waren. Du kennst sicher diese typische Story von einem Verrückten, der aus der Irrenanstalt ausgebrochen ist und in der Gegend sein Unwesen treibt?«
Josy runzelt die Stirn. »Wer kennt sie nicht.«
»Er hat behauptet, er würde es schaffen, jemanden davon zu überzeugen, dass dieser Blödsinn wahr ist. Wir anderen haben dagegen gewettet. Die Wahl ist auf Astrid als Versuchskaninchen gefallen, einfach, weil wir in dem Moment eine Rechnung mit ihr offen hatten. Wir waren so unglaublich sauer auf sie, also haben wir uns gemeinsam die Geschichte über den sogenannten Countdown-Mörder ausgedacht, der seinem Opfer Mails schreibt, in denen er Todesszenarien schildert und in deren Betreff steht, wie lange es noch zu leben hat.«
»Noch einundzwanzig Tage«, murmelt Josy.
»Ganz genau«, bestätige ich die von ihr gezogene Verbindung. »Wir haben Astrid also zuerst in Panik versetzt und uns anschließend bei ihr unter dem Vorwand angebiedert, sie zu trösten. Dabei hat Nick, der das Ganze organisiert hat, um seine blöde Wette zu gewinnen, beiläufig erwähnt, dass das Verschicken von Drohmails, deren Inhalt in die Tat umgesetzt wird, gut zu dem Countdown-Mörder passen würde, der angeblich aus einer Irrenanstalt ausgebrochen ist und nun ein Opfer sucht, das er mit einer Spiegelscherbe markieren will.«
Josy schnaubt ungläubig. »Und das hat Astrid euch abgenommen? Ganz ehrlich, ich hätte auch dagegen gewettet.«
»Zuerst nicht«, gebe ich zu. »Sie war zwar beunruhigt, aber nicht überzeugt. Doch dann haben wir angefangen, Details der Horrorgeschichten aus den Mails wahr werden zu lassen. Wir haben ihr eine Scherbe in ihren Schulrucksack gesteckt, sie verfolgt, ohne dass sie uns erkannte, nachts an ihrem Fenster gekratzt und sind sogar über die Terrasse in ihr Haus eingebrochen, um in ihrem Zimmer Spuren des vermeintlichen Mörders zu hinterlassen. Irgendwann hat sich das verselbstständigt, und es ging gar nicht mehr um die Wette. Unsere Ideen wurden immer extremer, wir überboten uns regelrecht gegenseitig, während Nick die Durchführung koordiniert hat. Und jedes Mal sah es hinterher so aus, als wäre Astrid dem Tod nur knapp entronnen. Damit sie sich auf die Mails nicht einstellen konnte, verschickten wir sie in unregelmäßigen Abständen. Einmal lag sogar fast eine Woche dazwischen. Aber der Countdown bis zur letzten Geschichte und damit ihrem angeblich sicheren Tod tickte kontinuierlich runter.«
»Vermutlich hat Astrid bei jeder längeren Pause gehofft, dass der Spuk ein Ende hat«, sagt Josy. »Echt fies, die ganze Aktion, aber eigentlich ist doch nichts Schlimmes geschehen, oder?«
»Dazu komme ich jetzt«, sage ich, und Josy lehnt sich ein Stück nach vorne.
»Es war am letzten Tag, am Tag Zero, wie ihn Nick nannte. In der letzten Mail hatten wir ein Szenario geschildert, bei dem der verrückte Mörder seinem Opfer an einer Brücke auflauert, weil wir wussten, dass Astrid auf dem Weg von der Schule nach Hause eine überqueren musste. Sie wohnte in einem der Einsiedlerhöfe etwas außerhalb, deshalb erschien uns die kaum benutzte Brücke als der perfekte Tatort.«
Während ich spreche, schaue ich auf den Milchschaum vor mir, der langsam in sich zusammenfällt. Auch nach all den Jahren hat die Sache nichts von ihrem Schrecken verloren. Jetzt weiß ich, dass wir unser Spiel damals nicht auf die Spitze hätten treiben dürfen.
»Zwei von uns folgten ihr, die anderen beiden warteten auf der anderen Seite der Brücke. Wir waren dunkel gekleidet und hatten uns Skimasken besorgt, weil wir das ganze Theater mit einem dramatischen Knalleffekt auflösen wollten. Natürlich musste Astrid annehmen, vom Countdown-Mörder verfolgt zu werden, der ihren Tod mit der entsprechenden Geschichte angekündigt hatte.«
Ich schließe kurz die Augen und beiße mir auf die Lippen, während Josy atemlos meinem Bericht lauscht.
»Astrids Schritte wurden immer schneller, bis sie schließlich rannte. Sie war vollkommen fertig mit den Nerven, weinte, schrie. Erst in dem Moment realisierten wir, dass wir zu weit gegangen waren. Wir riefen ihren Namen, aber dadurch wurde sie nur noch panischer. Und plötzlich bog sie ab, um den Weg über die Gleise zu nehmen, die sechs Meter unterhalb der Brücke verliefen. Wahrscheinlich, weil sie anders handeln wollte als das Opfer in der Geschichte, die sie per Mail erhalten hatte.«
Meine Stimme bricht, und ich muss mich mehrfach räuspern. Es ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Nach all den Jahren breche ich mein Versprechen, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Es fällt mir unglaublich schwer.
»Die Böschung war extrem steil, dazu kam dieser scharfkantige Schotter überall. Sie ist den Abhang hinabgeschlittert, hat die Balance verloren, ist gefallen und direkt auf den Schienen gelandet. Wenig später rauschte ein Zug heran und vorüber. Einige Horrorsekunden lang waren wir sicher, dass er sie erwischt hatte, doch dann entdeckten wir Astrid auf der anderen Seite der Gleise. Arme und Oberkörper von den Funken der bremsenden Zugräder verbrannt, blutend, zitternd und vollkommen verstört – aber immerhin lebendig. Wir sind abgehauen, bevor der Zug vollständig zum Stehen kam.«
»Mein Gott«, murmelt Josy. »Das ist echt …«
Sie verstummt, als würden ihr die Worte fehlen.
»Echt furchtbar«, beendet sie schließlich ihren Satz. »Die Arme. Zuerst über einen knappen Monat hinweg dieser Druck und die Angst und dann ein solches Erlebnis. Sie muss komplett am Ende gewesen sein, und ihre Eltern waren sicher wütend auf euch wegen dieser Aktion. Gab es Konsequenzen?«
Ich weiche ihrem Blick aus und schlucke. »Nein. Keine«, gestehe ich tonlos, woraufhin mich Josy fassungslos mustert. »Natürlich haben ihre Eltern Kontakt mit unseren aufgenommen«, sage ich. »Aber man entschied sich dafür, die Sache im Sande verlaufen zu lassen, immerhin war alles gut ausgegangen. Also, fast jedenfalls. Es dauerte, bis die Verbrennungen verheilt waren.«
»Wow.« Josy fährt mit einem Finger abwesend über den Rand ihres Latte-macchiato-Glases. »Wenn ihr mein Kind dermaßen gequält hättet, wäre ich garantiert ausgeflippt. Das hätte ich euch niemals durchgehen lassen.«
»Ich schätze, Astrids Eltern wollten vermeiden, dass sie zum Gesprächsthema wird. Sie waren ohnehin eher zurückhaltende Leute. Ganz davon abgesehen war Nicks Vater damals in der Lokalpolitik aktiv und Bürgermeisterkandidat. Das hat sicher ebenfalls seinen Teil zu ihrer Reaktion beigetragen. Jedenfalls wurde uns nach einer ordentlichen Standpauke gesagt, wir sollten den Vorfall vergessen und nicht mehr darüber reden. Und das haben wir getan.«
»Die Familie hat also wirklich keine weiteren Schritte gegen euch eingeleitet?«, erkundigt sich Josy, und trotz ihres neutralen Tonfalls kann ich die Anklage in ihrer Frage hören.
»Nein.« Ich schüttle den Kopf. »Nachdem Astrids Verbrennungen in einem Krankenhaus behandelt worden waren, wurde sie in eine psychiatrische Klinik verlegt, und die Familie zog weg. Wir haben sie aus den Augen verloren. Bis uns einige Jahre später …« Ich presse die Lippen zusammen und umfasse mein Glas etwas fester. »Bis uns einige Jahre später die Nachricht erreichte, dass sie sich umgebracht hat. Ich bin mir sicher, ihr Tod steht im Zusammenhang mit dem, was wir ihr angetan haben. Die Vergangenheit hat sie schließlich doch noch eingeholt.«
Für längere Zeit herrscht Schweigen, dann lehnt sich Josy wieder mir entgegen. »Was ihr damals getan habt, war grausam.«
»Ich weiß. Die Sache ging mir auch wirklich nahe«, gebe ich zu. »Erst als ich für mein Studium weggezogen bin, konnte ich sie etwas verdrängen. Trotzdem werde ich mir das nie verzeihen. Wenn wir geahnt hätten, zu welcher Katastrophe diese dumme Wette führen würde … Natürlich waren wir jung und unvernünftig, aber das ist weder eine Begründung noch eine Rechtfertigung. Wir haben Astrids Leben nicht nur zerstört, sondern es ihr letztendlich auch genommen.«
»Und jetzt hast du zwei Mails bekommen, die euren von früher gleichen«, kehrt Josy zum eigentlichen Thema zurück. An ihrer Stimme höre ich, wie schwierig es für sie ist, mich nicht dafür zu verurteilen, was ich als Jugendliche getan habe.
»Sie erinnern stark daran.« Ich hebe hilflos die Schultern. »Der Inhalt, der gesamte Stil. Die fragmentarischen Sätze, die Kombination aus Handlung und Empfindung.«
»Sind es dieselben Geschichten?«, fragt Josy.
»Ich weiß es nicht«, erwidere ich ehrlich. »Genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was wir damals geschrieben haben. Wobei die erste Mail, die ich bekommen habe, definitiv anders ist als unsere von früher. In unseren Texten kam die Flucht des Mörders aus der Anstalt nie vor. Davon haben wir Astrid nur erzählt. Wir verschickten sie von einem Account, den Nick extra dafür angelegt hatte. Wir lieferten ihm Ideen für Horrorszenarien, und er formulierte sie dann in kleinere Episoden um.«
»Eigentlich gibt es bloß eine Möglichkeit«, sagt Josy, nachdem sie einige Schlucke ihres Latte macchiato genommen hat, »denn einen Zufall schließe ich nach deiner Erzählung aus. Zwei Gruselstorys, die Spiegelscherbe … Anscheinend will jemand für dich die Vergangenheit wiederaufleben lassen.«
Ich nicke bedrückt. »Das habe ich mir auch überlegt, aber wer? Wir waren alle froh, die Sache hinter uns zu lassen. Niemand hat mehr darüber gesprochen, und als die Familie weggezogen ist, waren alle erleichtert. Niemand hat sich mehr bemüht herauszufinden, wie es Astrid geht. Von ihrem Tod haben wir nur zufällig erfahren. Weshalb also sollte sich jemand die Mühe machen, nach dem damaligen Vorbild Mails zu verfassen und sie mir zu schicken? Und weshalb ausgerechnet jetzt?«
»Astrid hat während ihrer Zeit in der psychiatrischen Klinik garantiert noch andere Menschen ins Vertrauen gezogen«, mutmaßt Josy. »Durchaus möglich, dass sie Freundschaften geschlossen hat.«
»Du meinst, dass sich jemand an Astrids Stelle an mir rächen will?«
Josy zuckt mit den Schultern. »Alternativ könnte es jemand aus deiner alten Clique sein.«
Ich überlege. Vorstellbar wäre es. Zwar wüsste ich nicht, aus welchem Grund, nichtsdestotrotz sollte ich diese Möglichkeit in Erwägung ziehen.
»Ich habe seit Jahren nichts mehr von den anderen gehört«, erwidere ich. »Warum sollte einer von ihnen auf die Idee kommen, mir seltsame Geschichten zu schicken?«
»Vielleicht ist es nur der verunglückte Versuch einer witzigen Kontaktaufnahme?«, schlägt Josy vor. »Am besten, du wartest einfach ab. Versuche, die Mails zu ignorieren und dir nicht allzu viele Gedanken zu machen. Schließlich ist bisher ja nichts passiert.«
Klar. Abgesehen davon, dass eine Spiegelscherbe wie von Geisterhand plötzlich in meinem Wagen lag und ich mir nach wie vor sicher bin, eine schwarze Gestalt im Wald am Straßenrand gesehen zu haben.
Um Josy nicht weiter zu beunruhigen, setze ich ein halbherziges Lächeln auf. »Du hast recht. Ich werde einfach abwarten. Wahrscheinlich wird nichts mehr passieren, sodass ich mich später nur darüber ärgere, mir so viele Gedanken gemacht zu haben.«
Während der nächsten Stunde widmen wir uns angenehmeren Themen, beratschlagen über das perfekte Geburtstagsgeschenk für Josys Mann und besprechen die Filmauswahl für unseren Mädelsabend am kommenden Sonntag. Die Zeit vergeht wie im Flug, weshalb wir spontan beschließen, gemeinsam im Café zu Abend zu essen.
Als wir deutlich später als geplant nach draußen treten, ist es stockdunkel. Der kalte Wind lässt mich frösteln, und ich kuschle mich enger in meine Jacke. Immerhin regnet es nicht.
Nachdem wir uns mit einer Umarmung verabschiedet haben, beginne ich, im Kofferraum meines Fiats zu wühlen, als würde ich nach etwas suchen. Erst als meine Freundin außer Sicht ist, öffne ich die hintere Tür und unterziehe den Innenraum einer genauen Musterung. Hätte ich das in ihrem Beisein getan, wäre ihr sofort klar gewesen, dass ich in keinster Weise so cool bin, wie ich mich gegeben habe.
Am liebsten würde ich ihr hinterherrufen und sie anflehen, umzukehren und bei mir zu übernachten. Seit dem Tod meiner Eltern fühle ich mich oft einsam, und nicht zum ersten Mal denke ich darüber nach, das von ihnen finanzierte Haus, in dem ich jetzt lebe, zu verkaufen. Für mich alleine ist es viel zu groß; eine kleine Wohnung in Stadtnähe wäre absolut ausreichend.
Erst nachdem ich mich mehrfach davon überzeugt habe, dass in meinem Auto alles ist wie zuvor, setze ich mich hinters Steuer, lehne mich zurück und atme einmal tief durch. Es ist lächerlich, dass ich mich dermaßen leicht aus dem Konzept bringen lasse. Ein Stückchen Glas und zwei anonyme Mails. Seit wann bin ich so schnell zu verunsichern?
Gegen zwanzig Uhr stelle ich den Motor aus. Mit einer Hand greife ich nach meiner Tasche, mit der anderen nach der kleinen Schaufel, die seit gestern Abend mein steter Begleiter ist. Auf dem Weg von der Garage bis zum Haus muss ich mich zusammenreißen, um mich nicht bei jedem Schritt umzusehen. Erst als ich die Tür hinter mir zugeknallt, zweimal abgeschlossen und die Sicherheitskette vorgelegt habe, fühle ich mich etwas wohler. Gleichzeitig steigt Frust in mir auf. Ich reagiere vollkommen überzogen. Zugegeben, was damals geschehen ist, war furchtbar. Aber es ist vorbei, und es gibt keinen Grund, mich heute noch davon beeinflussen zu lassen.
Entschlossen dränge ich sämtliche Erinnerungen in die hinterste Ecke meines Gehirns zurück und widme mich stattdessen meinem Kater, der mich mit beharrlichem Gemaunze darauf aufmerksam macht, dass es allerhöchste Zeit für sein Abendessen ist.
Nachdem ich Mozart versorgt habe, mache ich es mir mit einem Tee und meinem Laptop auf der Couch bequem. Ich habe gerade die Seite meines Streamingdienstes geöffnet, da klingelt es an der Tür. Stirnrunzelnd stelle ich den Computer zur Seite und stehe auf. Für unangemeldeten Besuch unter der Woche ist es ziemlich spät.
Schnell nehme ich den Hausschlüssel aus der Schale auf der Flurkommode, schließe auf und öffne die Tür einen Spalt weit, wobei ich darauf achte, dass Mozart nicht entwischt.
»Hi, Lou«, grüßt Carsten, und sein Anblick lässt mein Herz sofort doppelt so schnell schlagen.
Ich gehe einen Schritt zurück, um die Kette auszuhängen, und nutze die Gelegenheit, um schnell meine schulterlangen Locken auszuschütteln. Zum Glück habe ich mich noch nicht abgeschminkt. Demonstrativ gelassen öffne ich erneut.
»Hallo, Chef«, sage ich mit einem angedeuteten Lächeln und bitte ihn mit einer auffordernden Geste herein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: