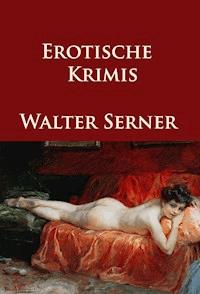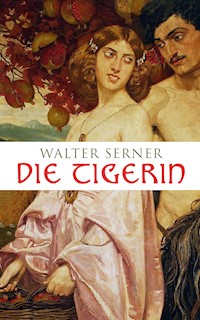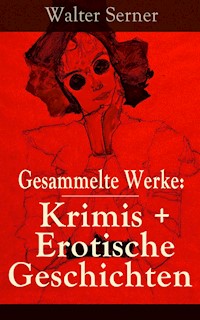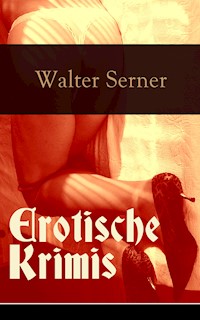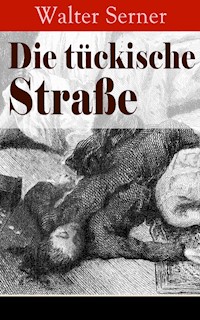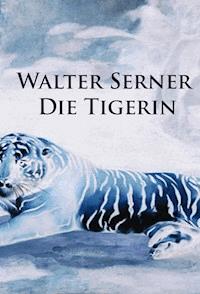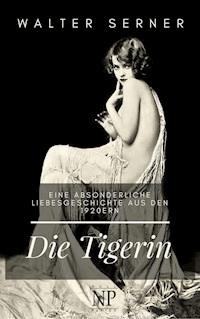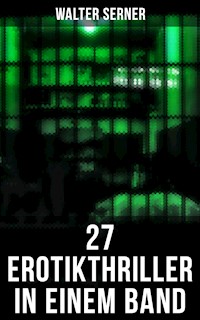
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Walter Serners Buch '27 Erotikthriller in einem Band' ist eine einzigartige Sammlung von Kurzgeschichten, die die Leser in die düstere und erotische Welt des Autors entführt. Serner, ein wichtiger Vertreter der literarischen Avantgarde der Weimarer Republik, zeichnet sich durch seinen provokativen Schreibstil und seine unkonventionelle Herangehensweise an das Genre aus. Jede Geschichte in diesem Band fesselt den Leser mit unerwarteten Wendungen und einer intensiven Atmosphäre. Durch die Kombination von Erotik und Spannung schafft Serner eine fesselnde Lektüre, die den Leser in ihren Bann zieht. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
27 Erotikthriller in einem Band
Books
Inhaltsverzeichnis
Der Vicomte
war in der Absicht nach Marseille gekommen, mit Bec-Salé und Gugusse einen großen Coup zu machen.
Er hatte eben ein kleines Café auf dem Boulevard Baille verlassen, als er vor der Auslage einer Buchhandlung stehenblieb: ein Kriminalroman, dessen blutrünstiges Titelbild weithin leuchtete, hatte es ihm angetan. Seine Jugendleidenschaft lebte in alter Macht wieder auf: er nahm ein Exemplar in die Hand, blätterte darin und entfernte sich lesend. Das war immer schon sein Truc gewesen.
Unter einem Haustor las er stehend weiter. Das Buch war langweilig und dumm. Schon wollte er es wegwerfen, als ein Einfall seinen schmalen feinen Mund kräuselte. Er riß noch einige Seiten mit den Fingern auf, verknitterte das Titelblatt ein wenig und löste den kleinen Zettel der Firma des Buchhändlers ab. Hierauf ging er langsam zurück, trat in die Buchhandlung und bot dem Inhaber dessen eigenes Buch zum Kauf an. Er empfing zwei Francs.
Diese in der hohlen Hand schwenkend, schlenderte er vor sich hin, als er, plötzlich aufsehend, vor Wut aufzischte: er hatte den Geheimagenten Rebbis erkannt, der sich ihm wie zufällig näherte. Da eine Begegnung unvermeidlich geworden war, zog er es vor, Rebbis freundlich zu winken.
Der war dermaßen durchsonnt von diesem glücklichen Zusammentreffen, daß es ihm nur schlecht gelang, so zu tun, als suche er in seiner Erinnerung. Als er sich hinreichend gequält zu haben glaubte, zog er den Hut: »Ah, monsieur le vicomte! Was für ein überraschendes Wiedersehen!«
»Überraschend?« Der Vicomte blinzelte listig.
Rebbis frottierte sich betreten die Hand. »Sie glauben also neuerdings …«
»Nein.« Der Vicomte schmunzelte zart. »Sondern daß Sie immer noch …«
»Ich werde Sie überzeugen.« Rebbis nahm mit jener einzigartigen Innigkeit, mit der man nur sein Opfer liebt, den Arm des Vicomte. »Aber stecken Sie doch schon das Geld ein!«
Der Vicomte, der bloß davon überzeugt war, daß Rebbis ihn schon längere Zeit beobachtet hatte und die Herkunft des Geldes kannte, lächelte frech. »Ich wollte Ihnen gerade eine Mominette anbieten. Henri da drüben kennt mich. Ich bestelle Anisette und er bringt …«
»Immer noch der Alte«, sagte Rebbis lachend. »Gehen wir also hinüber. Die Luft hier ist übrigens fehlerlos.«
»Das sagten Sie auch in Paris vor der Brasserie Lavenue, als Sie mir vorschlugen, Madame Briffant in der Avenue Loewendall auf den Plafond zu klopfen.«
»Die Sache hätte Sie groß gemacht.«
»Oder – krumm.« Der Vicomte legte die zwei Francs vor sich auf das Marmortischchen und schneuzte sich geräuschvoll, um seine Heiterkeit zu maskieren.
»Ich versichere Ihnen …« Rebbis spielte, während er ein verblüffendes Gesicht aufsetzte, an dem großen runden Stein seiner Krawattennadel.
»Kosten Sie den Absinth!« Der Vicomte änderte ganz unerwartet den Ton. »Was tun Sie jetzt?«
»Es ist ja doch nur Anisette.« Rebbis kordialisierte flott mit. »Ich amüsiere mir den Kopfschmuck weg und schiebe Auskünfte.«
Der Vicomte wunderte sich, als glaube er es.
»Aber«, machte Rebbis gedehnt und warnte sich mit dem Zeigefinger. »Citroën ist eine Canaille.«
»Sie lügen ja beleidigend.« Der Vicomte trank und sah in sein Glas.
»Hören Sie, Vicomte …«
Und während Rebbis weitschweifig begründete, daß er der berühmten Automobilfabrik die schwierigsten Privatinformationen besorge, dachte der Vicomte unausgesetzt darüber nach, wie er ihn sich vom Halse schaffen könnte. Schließlich kam er zu dem Schluß, daß ihm nichts anderes übrigblieb, als seinen gewagtesten Truc loszulassen. »Hé, Rebbis, wie gefällt Ihnen das?« Er hatte mit einem Mal seinen Browning in der Faust und richtete den Lauf auf die Bar.
Rebbis schwieg sofort und blickte, die Hand bereits in der Tasche an seiner Waffe, scharf auf den Browning des Vicomte.
»Henri!« rief der Vicomte durchdringend. »Stell einen Stöpsel mit einem Streichholz auf die Etagère dort oben!«
Henri, ein flinker schlanker Bursche, tat es scheu, aber schnell.
Die Gäste an den umstehenden Tischen staunten mit gläsernen Augen umher.
Der Vicomte stand auf, zielte auf das Streichholz und schoß. Im selben Augenblick aber sauste seine Linke, die einen Schlagring umklammert hielt, über sein Waffe hinweg auf Rebbis Schläfe, der sofort blutüberströmt zusammenbrach.
Der Vicomte feuerte noch zwei Schüsse in die Luft, bevor er mit einem wilden Satz über die Bar sprang, durch die dahinter befindliche Tür und durch das Fenster, das vom Nebenraum aus auf den Hof führte.
Als Rebbis unter den Händen des rasch herbeigerufenen Arztes zu sich kam, blickte er zuerst auf den Schrank: das Streichholz war weg. Er ließ sich den Stöpsel herunterreichen. »Da ist die Kugelspur … Wo ist der Kellner Henri?«
Henri war gleich dem Vicomte unauffindbar …
Die auf dieses Ereignis folgenden Tage benützte Rebbis ausschließlich dazu, die Buchhandlung auf dem Boulevard Baille und das gegenüberliegende kleine Café scharf überwachen zu lassen. Mit dem Resultat, daß auch nach zwei Wochen nicht die kleinste brauchbare Beobachtung registriert werden konnte. Erst in der dritten Woche fiel es einem Flic auf, daß zwei jugendliche Kokotten, Joop und Miette geheißen, beim Verlassen des kleinen Cafés sich wiederholt nach allen Seiten umblickten. Er folgte ihnen und konnte feststellen, daß sie in einem alten baufälligen Haus in der Rue St. Bruno verschwanden.
Andern Tags wartete Rebbis persönlich auf dem Boulevard Baille. Joop und Miette kamen denn auch gegen fünf Uhr nachmittags, hielten sich etwa eine Stunde in dem kleinen Café auf und verließen es ebenso vorsichtig wie tags zuvor. Als sie das Haus in der Rue St. Bruno betreten hatten, eilte Rebbis zur Tür, postierte seinen Begleiter in den Hausflur und stieg mit Hilfe seiner elektrischen Taschenlampe eine bereits angemorschte Holztreppe empor. Er hatte kaum die erste Etage erreicht, als ihm von hinten ein dickes Wolltuch über das Gesicht gerissen wurde …
Als er wieder sah, saß er auf einem Holzstuhl in einem anscheinend leeren Zimmer. Aus einer Ecke hinter ihm kam ein schwacher Lichtschein. Er wandte sich nach ihm um und erhielt gleichzeitig eine fürchterliche Ohrfeige.
Bec-Salé, den er ebenfalls von Paris her kannte, stand breitspurig vor ihm und lachte, sich die zerbeulte Glatze reibend. »Hein, sale dresseur des mouches? Läufst kleinen Mädchen nach?«
Rebbis biß die Zähne aufeinander. In seinem Kopf hackte es so schmerzhaft, daß ihm Tränen in die Augen kamen.
»Pleure pas pour ça!« Bec-Salé versetzte ihm eine zweite Ohrfeige.
Rebbis sah rot. Rasend vor Wut stürzte er vor, lag aber sofort auf dem Boden, von dem er sich erst nach Minuten aufzurichten vermochte. Halb besinnungslos taumelnd schleppte er sich zu dem Stuhl.
Da trat Henri ein, die Hände tief in den weiten braunen Samthosen. »Y a pas d’erreur. C’est Rebbis!« Er betrachtete ihn mit dem feuchtmatten Blick des Homosexuellen. Dann trat er näher, spie ihm ins Gesicht und riß ihm einige Haare an der Schläfe aus. Als Rebbis schwach die Hand hob, stieß er den Stuhl unter ihm fort. Rebbis krachte zu Boden.
Schließlich kam der Vicomte. Er sah Rebbis schmerzhaften Versuchen, sieh zu erheben, bewegungslos zu. Erst als es Rebbis gelungen war, an der Wand sich hochzuschieben, sagte er scharf: »Sie wollten mich hier bei fehlerloser Luft, die nur Sie selber verpesten, mit einer Sache à la Madame Briffant exen. Ich hielt es daher für weise, Ihnen zwei kleine Mädchen zu schicken.«
Rebbis war trotz den fast unerträglichen Schmerzen imstande, sich zu ärgern. »Ich räume gern ein … daß Sie nur … nur diesem Umstand es zu verdanken haben, mich hier zu sehen.«
Des Vicomte stechend aufleuchtende Augen verrieten ihm, daß er keine Sekunde zu verlieren hatte.
»Ihr Truc mit dem Buchhändler war wunderbar«, stieß Rebbis schnell hervor.
»Das ist sogar wahr.«
»Ich habe mich auch überzeugt, daß Sie das Streichholz tatsächlich heruntergeschossen haben. Fabelhaft!«
»Auch das ist wahr.«
»Und Ihre Flucht … und wie Sie mich hierher lockten … spät, aber sicher … Alles erstklassige Sachen. Mein Kompliment.«
»Nehme ich und werfe es Ihnen wieder an den Kopf.«
»Vicomte, Sie sind ein Gigant!«
»Esel! Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?«
Rebbis löste sich mühsam von der Wand und wankte ins Zimmer vor. In der Mitte blieb er vor Schwäche stehen. »Wir zahlen sehr viel«, lispelte er.
»Immerhin sind vor drei Monaten Ihre Flics sogar auf die Straße gestiegen.«
»Der Präfekt ist im Grunde vernarrt in Sie. Ich würde Sie ihm nicht einmal einzureden brauchen.«
»Was für ein Sonntagsherz Sie haben!«
Rebbis machte einen Schritt nach vorn. »Mein Wort darauf, daß …«
Der Vicomte wich ausspuckend zur Seite.
»Ich übernehme Ihre Leute.«
»Albern!«
»Ich werde alles tun, was Sie wollen. Ich werde …«.
Der Vicomte sah ihm wie müde auf die Brust. »Sie haben eine schöne Krawattennadel. Ich wundere mich, daß Gugusse sie übersehen hat.«
»Ein schwarzer Onyx. Nichts Besonderes.« Rebbis strich sich das verknitterte Plastron zurecht und spielte mit dem Stein. »Sie wollen also nicht?«
»Nein, zum Teufel!«
»Warum nicht? Es ist doch das bessere Geschäft. Und absolut sicher für Sie.«
Der Vicomte blies ihm auf den Mund.
Rebbis überwand sich schluckend. »Ich begreife Sie nicht. Sie sind doch wie alle hochbegabten Kriminellen nur von den Umständen ins Verbrechen hineingetrieben worden. Wie die sozialen Verhältnisse heute liegen, gibt es von da keinen Aufstieg mehr. Nur ein elendes Proletarierleben, wenn Sie einmal zurück wollen. Sie wissen aber auch, daß Sie, wenn Sie dieses Leben fortsetzen, ja doch über kurz oder lang unter der Guillotine liegen. Und nun biete ich Ihnen die Rehabilitierung an und wahrhaftig kein Proletarierleben. Die Sicherheit erhalten Sie dadurch, daß Ihre Ernennung zum Kommissär im Regierungsblatt erscheint, bevor Sie sich melden. Und da sagen Sie nein? Warum?«
Der Vicomte näherte sein Gesicht und schrie: »Weil ich Vicomte bin und kein Flic!«
»Ich bin nicht so naiv, Ihnen derlei zu glauben. Sie mißtrauen mir.«
»Wie kamen Sie mir hier auf die Spur?«
Rebbis besann sich lange. Dann entschied er sich, da sein Gehirn versagte, für die Wahrheit. »Ich erkannte Sie auf dem Boulevard Baille wieder. Trotz Ihrer guten Maske. Das ist meine Spezialität. Ich merke mir eine Augenpartie, eine Stirnpartie, ein Ohr.«
Der Vicomte schwieg nachdenklich. Dann sagte er hastig, »jemand muß mich verraten haben. Wer?«
Rebbis lächelte geschmeichelt. »Sie irren. Ich sah Sie aus dem Buchladen kommen, mit dem Geld in der Hand. Irgendwie kamen Sie mir verdächtig vor. Mein Blick ist geschult. Ich ging um Sie herum, um Ihnen zu begegnen und Ihr Gesicht zu sehen. Ich erkannte Sie sofort. An Ihrem Mund.«
»Und nachher gingen Sie zu dem Buchhändler sondieren.«
»Nein. Ich ließ den Buchladen überwachen.«
Der Vicomte stampfte auflachend mit dem Fuß. »Woher kennen Sie dann meinen Truc? … Ah, Ihr erstes Wort hier war also schon eine Falle.«
»Den Buchladen hielt ich für eine Verständigungs-Etappe.« Rebbis begann am ganzen Körper zu zittern. »Sagen Sie mir, Vicomte, was haben Sie mit mir vor! Ich kann Ihnen vielleicht von größtem Nutzen sein …«
»Geschmeiß!« Der Vicomte wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. »Bon. Ich lasse Sie frei, wenn Sie vier Dossiers für mich stehlen und mich über den Inhalt einiger anderer informieren.«
Rebbis griff sich an den Kopf; er verwünschte sich, weil ihm kein Ausweg einfallen wollte. Plötzlich aber huschte ein kleines Lächeln über seine Nase hinweg.
Der Vicomte sah es und wußte, daß er ihn hintergehen wollte. »Nun?«
»Ich bin bereit.«
»Merci.« Der Vicomte wandte ihm verächtlich den Bücken. »Bec-Salé!«
Da hob Rebbis die rechte Hand an die schwere Silberfassung des Steins in seiner Krawatte. Seine Finger zuckten ein bißchen. Und mit einem Ruck riß er den Onyx heraus, an dem im Schein der Petroleumlampe eine lange schmale Dolchnadel aufblinkte.
Als aber seine Faust sich gegen den Rücken des Vicomte schnellen wollte, fiel durch die Türspalte ein Schuß.
Rebbis taumelte röchelnd zurück.
Bec-Salé stürzte herein, versetzte Bebbis einen Fußtritt in den Hintern, so daß er in die Knie brach, und hierauf einen Faustschlag ins Genick, der ihn zu Boden streckte.
Der Vicomte, der auf dem Kinn des Daliegenden einen dünnen Faden Blutes erblickte, neigte sich über ihn. Und erst jetzt sah er die Dolchnadel.
»Bec-Salé, hast du deshalb …?«
Bec-Salé nickte.
Der Vicomte reichte ihm die Hand.
Gugusse und Henri erschienen in der Tür.
»Das Auto ist in einer halben Stunde auf der Place Castellani«, meldete Henri.
Gugusse stieß mit dem Fuß verächtlich gegen den Leichnam. »Grotte! … Der unten ist für acht Tage verstaut.«
»Und was machen wir«, fragte Bec-Salé, »wenn alles glattgeht, mit unseren achthunderttausend?«
»Schluß!« Der Vicomte zog seine Mütze aus der Tasche. »Wir tauchen unter, frisieren uns und werden in Reims ein Bar-Restaurant. Joop und Miette können wir gut brauchen.«
Sein Truc
war wirklich erstklassig. Er hatte weder den Vorteil, der oft ein Nachteil ist, einfach zu sein, noch den Nachteil, Komplikationen herbeizuführen. Er reüssierte stets und immer glatt und hatte der Betroffene einigermaßen von seiner Verblüffung sich erholt, so erwartete ihn die neue, nicht herausbringen zu können, wie es geschehen war. Fest stand altem Anschein nach bloß, daß ein Tic die Hauptrolle in den Manövern spielte, welche Mister Gam riesige Summen eintrugen und den Schwergeschädigten das komplette Nachsehen.
Als Fénor es hatte, hatte er es buchstäblich. Er stand nämlich an der Ecke der Rue Frochot, wo das Nachtrestaurant Le Rat Mort sich befindet, und sah Mister Gam nach, der langsam die Place Pigalle überquerte und, in Zwischenräumen von etwa fünf bis zwanzig Sekunden, mit dem Kopf zuckte. Das war sein Tic.
Mister Gam war längst im Nebel verschwunden, als Fénor immer noch unbeweglich dastand. Plötzlich blickte er auf und zuckte mit dem Kopf, als könnte ihm die Nachahmung jener Bewegung irgendwie Aufschluß über die Methode geben, mit deren Hilfe Mister Gam ihm zehntausend Francs abgenommen hatte. Auch ihm war es, als ob jener Tic das Wichtigste gewesen wäre. Er vermochte aber weder ihn sich zu erklären, noch den Rest. Schließlich ließ er den ganzen Hergang noch einmal an sich vorüber.
Er war von Mister Gam, dem er beim Verlassen des Gaumont-Palace begegnet war, zum Souper eingeladen worden und hatte angenommen, obwohl er von den Verlusten gehört hatte, die unter verschiedenen Umständen einige seiner Bekannten in Gesellschaft Mister Gams auf unerklärliche Weise erlitten hatten. Daß jene Umstände sich durchaus von der Gelegenheit unterschieden, die Mister Gam veranlaßt hatte, ihn zum Souper einzuladen, hatte sein anfängliches Mißtrauen verscheucht: Mister Gam konnte nicht wissen, daß er zehntausend Francs, welche ihm infolge einer zufälligen Begegnung im Gaumont-Palace übergeben worden waren, in seiner Brusttasche trug; und er konnte nicht wissen, daß er, Fénor, sich daselbst befinde, denn er hatte erst im letzten Augenblick, lediglich von einer Laune bestimmt, sich dazu entschlossen, ins Cinema zu gehen. Beim Souper war Mister Gam, wie immer, überaus amüsant gewesen, hatte treffende Beobachtungen und witzige Bemerkungen über die anwesende Lebewelt gemacht und einige seiner Reiseabenteuer erzählt, die alle sich dadurch auszeichneten, daß banale Handlungen und groteske Zufälle einen unwahrscheinlichen und deshalb umso interessanteren Vorfall herbeigeführt hatten. Diese mit geschickter Disposition und feiner Diktion erzählten Geschichten hatten auf Fénor durchaus den Eindruck gemacht, wahr zu sein, umsomehr als Mister Gam in ihnen entweder nur eine nebensächliche Rolle spielte oder sogar eine passive. Und es war gerade während einer solchen Erzählung gewesen, als Fénor, seine Krawatte richtend, ahnungslos mit der Hand über seine linke Brustseite streifte: die harte Wölbung, welche das Portefeuille verursachte, war verschwunden. Ein schneller Griff in die Tasche hatte bestätigt, woran er eigentlich nicht mehr gezweifelt hatte. Mister Gam schien keine Notiz von dieser Feststellung genommen zu haben und sprach in seiner suggestiven Art weiter, ohne daß seine weiche vibrierende Stimme auch nur das geringste Déséquilibre verraten hätte. Nur sein Kopfzucken, das zuvor außerordentlich häufig stattgefunden hatte, wurde nun auffällig seltener.
Fénor fröstelte. Er war überzeugt, daß dieser Tic die Lösung enthielt. Vielleicht diente er als Verständigungsmittel, vielleicht gab er Morsezeichen? Fénor grinste müde, schloß mit einer resoluten Geste den Mantelkragen und winkte einem Taxi. Als es über den Boulevard de Courcelles rollte, jubelte er innerlich auf, daß er sich beherrscht und nichts von seiner tobenden Wut sich hatte anmerken lassen; und lächelte darüber, welch fürchterliche Szenen die ihm vorhergegangenen Opfer ergebnislos aufgeführt hatten. Plötzlich wurde sein kluges Gesicht starr. Und mit einem halb unterdrückten Aufschrei schlug er sich auf die Knie: er hatte gefunden, was allein ihm eine Chance bot, Mister Gams Truc zu entdecken.
»Ich muß mich noch einmal von ihm hineinlegen lassen«, sagte er mehrmals laut vor sich hin. »Und ich muß dabei aufpassen, als befände ich mich in Todesgefahr.« –
Die nächsten Tage verbrachte Fénor fast ausschließlich mit vergeblichen Versuchen, Mister Gam auf unverdächtige Weise in den Weg zu kommen. Hierauf versuchte er es mit sorgsam gefälschten Rohrpostkarten, die Mister Gam zu Rendezvous bestellten, mit fingierten Telefongesprächen, die ihn auf vielerlei Art in eine bestimmte Straße bringen sollten, und endlich mit einer Depesche aus Melun. Nichts verfing. Fénor gab es resigniert auf, diesen Überfuchs anzulocken, und mußte sich entschließen, die so sehr herbeigesehnte Begegnung einem Zufall zu überlassen.
Dieser war ihm bereits am Abend nach diesem Entschluß hold. Fénor befand sich, eben als er aus der Rue Castiglione auf die Place Vendôme einbog, ganz plötzlich neben Mister Gam, welcher, die Hände in den Manteltaschen, unbeweglich dicht an der Mauer stand.
Fénor wich, allerdings ohne jede Überlegung, schnell zurück und bog um die nur ein paar Schritte entfernte Ecke. Hier blieb er stehen und dachte nach. Nach wenigen Sekunden war es für ihn außer Zweifel, daß Mister Gam jemandem auflauerte. Sein Plan war sofort gefaßt.
Fénor schlenderte an die Ecke heran und lugte vorsichtig hervor: Mister Gam stand nach wie vor unbeweglich da und hatte aller Wahrscheinlichkeit nach den Eingang des Hotel Ritz im Auge. Fénor lehnte sich an die Mauer, zündete sich eine Zigarette an und tat nur von Zeit zu Zeit einen Blick um die Ecke.
Endlich, nach etwa zehn Minuten Wartens, löste Mister Gams Rücken sich langsam von der Hauswand.
Fénor folgte Mister Gam in einem Abstand von ungefähr vierzig Schritten, sah, wie er in der Nähe des Hotel Ritz einem älteren, schon etwas beleibten Herrn geschickt in den Weg trat, sofort mit ihm in ein sehr lebhaftes Gespräch geriet und kurz darauf an dessen Seite das Restaurant Edouard VII. betrat. Fénor ließ eine Viertelstunde verstreichen. Dann betrat er gleichfalls das elegante Restaurant. Es gelang ihm, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ungesehen zu bleiben und an dem hinter Mister Gams Rücken befindlichen Tisch Platz zu nehmen. Gleichzeitig mit dem Diner bestellte er den Figaro, um eine Deckung parat zu haben, falls Mister Gam eine Wendung nach rückwärts machen sollte.
Der Mister Gam gegenüber sitzende Herr war Fénor unbekannt, aber ein in jeder Hinsicht ganz ausgezeichnet gewähltes Opfer. Er trug eine fingernagelgroße Perle in der Krawatte, zwei Brillantringe, die auf mindestens fünfzigtausend Francs zu schätzen waren, und hörte, was Fénor ein hämisches Lächeln entlockte, seinem unausgesetzt sprechenden Tischgenossen mit devoter Begeisterung zu.
Fénor bedauerte sehr, daß er Mister Gams Gesicht nicht sehen konnte, beschied sich jedoch rasch, als er bemerkte, daß die Zahl der Kopfzuckungen von Minute zu Minute zunahm. Einige forschende Blicke genügten, um festzustellen, daß weder einer der Gäste an den Nebentischen noch einer der Kellner auf das Kopfzucken achtete. Man hatte es zwar allenthalben mit Verwunderung wahrgenommen, sich aber sofort damit abgefunden und es weiterhin ignoriert.
Es verstrich fast eine halbe Stunde, ohne daß der bis zum Schweißausbruch aufmerksam beobachtende Fénor irgend etwas hätte bemerken können, das seine wilde Neugier auch nur im geringsten befriedigt hätte.
Mit einem Mal aber schien es ihm, als wäre in den Ausdruck der Augen des gespannt zuhörenden älteren Herrn etwas Blödes, Glotzendes geraten, das vorher nicht dagewesen war. Fénor sah noch schärfer hin und glaubte, eine unnatürliche Unbeweglichkeit in der ganzen Haltung jenes Herrn bemerken zu können. Eine leise in ihm sich erhebende Vermutung wurde ihm fast zur Gewißheit, als er sich ein wenig zur Seite neigte und sah, daß Mister Gams linke Hand fest auf der seines Gegenüber lag. Und fast gleichzeitig geschah es.
Mister Gam ergriff mit der Rechten seine Serviette und fuhr mit ihr seinem Opfer übers Gesicht, als wollte er ihm in liebenswürdiger Weise ein Stäubchen entfernen. Seine Linke aber senkte sich blitzschnell in die fremde Brusttasche, eskamotierte das ergatterte Portefeuille in die Serviette und legte diese dann neben sich auf den Tisch.
Fénor hatte eigentlich bereits genug gesehen. Es interessierte ihn aber doch noch, zu wissen, wie Mister Gam das Portefeuille verschwinden lassen würde. Es dauerte denn auch nicht lange, da glitt die Serviette unauffällig zu Boden, genau zwischen die Füße Mister Gams, die sich alsbald unter sie schoben und, von ihr bedeckt, allerlei Bewegungen ausführten, um schließlich mit einem Ruck still zu stehen. Nach einigen Minuten beugte sich Mister Gam nachlässig zur Seite, um die Serviette aufzuheben. Dabei lanzierte er schnell das Portefeuille in den linken inneren Hosenrand, in dem kunstgerecht eine kleine Tasche angebracht war …
Fénor, der das Restaurant daraufhin sofort verlassen hatte, wartete im Schatten der Vendôme-Säule, überzeugt, Mister Gam bald erscheinen zu sehen.
Nach einer Viertelstunde fuhren zwei Polizeibeamte im Taxi vor. Und nach einer weiteren Viertelstunde stürzte Mister Gams Opfer in heftigster Aufregung aus dem Restaurant, sprang in das noch wartende Taxi und fuhr in der Richtung der Rue de la Paix davon. ›Zweifellos zum nächsten Privatdetektiv.‹ Fénor lächelte selbstzufrieden.
Bald darauf erschien Mister Gam unter dem Portal des Restaurants, umgeben von einer Schar schwatzender gestikulierender Kellner und den eifrig auf ihn einsprechenden Beamten, die er mit immer abweisenderen Handbewegungen sich vom Leibe hielt, und ging, als man ihn endlich in Ruhe ließ, langsamen Schrittes auf die Rue Castiglione zu.
Fénor folgte ihm bis unter die Arkaden des Hotel Continental. Der um diese Nachtstunde nur spärliche Verkehr, auf den Fénor im Nu seinen Plan aufgebaut hatte, war nicht einmal vorhanden. Das zerstreute seine letzten Bedenken.
Er rannte auf den Fußspitzen ganz nahe an Mister Gam heran, stellte ihm von hinten ein Bein, riß dem Hingestürzten das gestohlene Portefeuille aus der Hosenbeintasche und steckte es ein.
Mister Gam war rasch wieder auf den Beinen und so verdutzt über die Anwesenheit Fénors, daß er gar nicht daran dachte, seinen über und über staubig gewordenen Mantel zu säubern. »Sie hier?« hauchte er, verwirrt versuchend, sich zu sammeln.
»Allerdings.« Fénor wartete, brennende Schadenfreude in den Augen.
Mister Gam strich sich mit beiden Händen die Wangen entlang, abwechselnd Fénor und die Straße musternd. Seine kleinen grauen Augen flackerten eigentümlich. Miteins hielten seine Hände inne. Sein Kopf senkte sich langsam, fast unmerklich.
Fénor, dem keine der Bewegungen Mister Gams entgangen war, sah, wie er den rechten Fuß am linken Knöchel rieb. ›Um festzustellen, ob der kostbare Raub noch an seinem Platz ist.‹ Fénor grinste höhnisch.
»Also Sie!«, zischte im selben Augenblick Mister Gam. »Geben Sie mir wenigstens die achttausend Francs heraus, die zuviel darin sind.«
»Sie geben also zu, mir zehntausend Francs gestohlen zu haben, Herr Hypnotiseur?«
»Patati patata.« Mister Gam nahm sich, plötzlich wieder völlig ruhig geworden, eine Zigarette. »Sie haben sich Ihr Geld nicht ungeschickt zurückgeholt. Sie mögen es behalten. Aber was nicht Ergebnis Ihrer Arbeit ist, kommt Ihnen nicht zu.«
Fénor rückte lachend an seinem Hut. »Nicht Ergebnis meiner Arbeit? Ist ein gut in den Weg gestellter Fuß ein schlechterer Truc als ein vorzüglich verwendeter Tic? Es wäre übrigens sehr liebenswürdig von Ihnen, mir den eigentlichen Zweck Ihres köstlichen Tics zu verraten. Alle restlichen Details Ihres Arbeitens sind mir jetzt endlich klar.«
»Mit Vergnügen.« Mister Gam lächelte verbindlich. »Er dient lediglich der Verschleierung der Hypnose. Er fesselt die Aufmerksamkeit meines Mannes in hohem Grade, macht es ihm aber andererseits unmöglich, zu bemerken, daß ich ihm unausgesetzt in die Augen sehe.« Er hatte sich während dieser Worte Fénor genähert, ergriff plötzlich mit beiden Händen dessen Kopf, preßte sie auf die Schläfen und stierte ihm in die Augen …
Als Fénor zu sich kam, lehnte er, halb eingesunken, an einem Arkadenpfeiler. Ein Polizist stand neben ihm, klopfte ihm auf die Schulter und riet ihm freundlich, doch endlich heimzugehen. Fénor nickte mechanisch und ging.
Nach einigen Schritten erinnerte er sich. Die Zähne aufeinanderknarrend, griff er in die Tasche: das Portefeuille, das er erjagt hatte, war verschwunden; aber auch sein eigenes, in dem sich allerdings bloß zweihundert Francs befunden hatten.
Er hätte sich nicht wochenlang fast krank geärgert, wenn er gewußt hätte, daß das gestohlene Portefeuille nur neunhundert Francs enthalten hatte.
Ein ungewöhnlicher Handel
Tralcof griff, kaum daß er erwacht war, hastig nach dem Telefonapparat, der auf dem Nachttischchen stand, und lächelte verschmitzt, während er auf die Stimme der Beamtin wartete. »Central 46 88 … Ja … Die Signorina Forbena, bitte … Ja … Luisa? Guten Morgen. Ausgeschlafen? … Aber das muß doch wieder einmal aufhören. Ich glaube, daß es für die Erhitzung erkalteter Beziehungen genügt, wenn man sie drei Wochen lang … Wie? Sechs Wochen? Si. Also wenn man sie sechs Wochen lang auf den Rost eines flammenden Bruchs legt. Poetisch, nicht? … Ja, du hast recht. Ich war stets ein sachlicher Träumer. Du glaubst mir doch hoffentlich kein Wort. Jetzt, da mich die Sehnsucht treibt … Ja, bitte, treibt. Also jetzt kann ich es dir ja eingestehen, daß ich mit dir nur gebrochen habe, weil es so nicht mehr weiterging und weil … Was ich eigentlich will? O, du Tiefsinnige! Erstens mich mit dir aussöhnen, um die Friedlichkeit meiner seit drei, scusate, seit sechs Wochen schwer troublierten Nächte wiederherzustellen … Ach, ich pfeife darauf, ob du es glaubst oder nicht. Wichtig ist mir nur, daß du wiederherstellst … Nicht? … Wirklich nicht? Warte bitte, bevor du mir endgültig abläutest, mein Zweitens ab … Ja, heißgeliebtes Mädchen … Du lachst nicht einmal? Dann allerdings ist die Gefahr des Abgeläutetwerdens beträchtlich gestiegen … Ja, ja, ja, also kurz und gut und zweitens: wie konntest du eine derart fürchterliche Dummheit machen, dich mit diesem Frauenzimmer in der Via Chiaia zu zeigen und noch dazu am hellen Mittag? … Ob ich sie kenne? Ganz Neapel kennt diese Person. Wie konntest du nur! … O, ich vermute, daß es ein Rückzug ist, wenn man nach solch einer feuchten Mitteilung plötzlich keine Zeit mehr hat … Was? Um sieben Uhr? Zur Wiederherstellung? … Nein? … Also um sieben Uhr. Arrivederci!«
Tralcof ließ sich schmunzelnd in die Kissen zurückgleiten: er war nun sicher, daß er jene schöne Frau, die er am Tag vorher am Arm Luisas, das erste Mal in seinem Leben, gesehen hatte, in wenigen Tagen kennen würde.
Abends aß er mit Luisa im Esposito auf der Piazza S. Ferdinando.
Luisa hatte sofort, als er bei ihr eingetreten war, Frau Vercelli in leidenschaftlicher Weise zu verteidigen begonnen: sie sei die Witwe eines römischen Colonels, der in Tripolis gefallen wäre, bewohne drei Zimmer im Hotel Britannique auf dem Corso Vittorio Emanuele und verkehre überhaupt nur mit zwei Menschen, mit Lina Dini und Carlo Gelli, durch den sie zufällig ihre Bekanntschaft gemacht habe. Luisa war während dieser Verteidigungsrede geradezu aufgeregt gewesen.
So hatte Tralcof, ohne selbst auch nur ein einziges Wort gesagt zu haben, mühelos erfahren, was er zu wissen wünschte; daraufhin die Möglichkeit eingeräumt, daß er sich geirrt haben könnte, daß vielleicht eine verblüffende Ähnlichkeit vorläge, und, schnell ablenkend, Luisa eine gut disponierte Liebeserklärung gemacht, die zwar zu keinem deutlichen Ergebnis führte, aber immerhin zur Annahme der Einladung zum Diner.
Beim Dessert, dem vorzüglich gebändigte Sprachattacken und mehr oder weniger heftige Wiederannäherungsversuche auf dem Souterrain vorhergegangen waren, ließ Tralcof eine kleine Pause eintreten, um mit der erforderlichen Harmlosigkeit sagen zu können: »Nein, ich glaube doch nicht daß ich mich geirrt habe. Die Ähnlichkeit war zu groß.«
»Du mußt dich geirrt haben.« Luisa wurde augenblicklich wieder aufgeregt, so daß Tralcof verwundert aufmerksam wurde. »Es ist gänzlich ausgeschlossen, daß Pina nicht ist, was sie scheint.«
Tralcof lächelte dünn. »Pina sagst du bereits? Also schon so intim? Nun, ich erinnere dich an das, was ich dir früher öfter zu bedenken gab: daß man immer nur etwas zu sein scheint und daß es deshalb lediglich darauf ankommt, herauszubekommen, ob man den frühzeitig und endgültig angenommenen Schein vor sich hat oder einen nur vorübergehend angenommenen.«
Luisa machte eine eigensinnige Handbewegung und fistelte nervös: »Laß bitte deine Erziehungsversuche! Darauf falle ich nicht mehr herein. Außerdem hat mir Pina tatsächlich bewiesen, daß sie es ehrlich mit mir meint.«
Tralcof schwieg schlauerweise und beschränkte sich darauf, als er Luisas forschenden Blick auf sich gerichtet fühlte, wie für sich hin zweifelnd den Kopf zu bewegen.
»Du kannst dich ja selbst davon überzeugen, wenn du willst.« Luisa spielte ärgerlich mit ihrer Serviette. »Ich gehe morgen mit ihr und Gelli ins Theater. Komm in die Loge! Ich stelle dich vor.«
Tralcof zuckte, sehr mit seinem Vorgehen zufrieden, leicht die Achseln und nahm seine Bestrickungstätigkeit wieder auf, die ihn denn auch nach Mitternacht in Luisas Bett brachte …
Als er am nächsten Abend in Frau Vercellis Loge erschien, war Luisa deshalb so heiter, daß der günstige Eindruck, den er auf jene machte, noch durch die naheliegende Vermutung, er konnte diese Heiterkeit hervorgerufen haben, erhöht wurde.
Tralcof erkannte sogleich, wie vorteilhaft seine Situation sich gestaltete, und zögerte nicht, ihr kräftig nachzuhelfen: er ignorierte Frau Vercelli fast, verwickelte aber Luisa und Gelli in eine schlechthin betörend amüsante Konversation und verließ, als es ihm gelungen war, der finster abseits Sitzenden ein Lächeln zu entlocken, überraschend unvermittelt die Loge.
Am folgenden Morgen war es daher Luisa, die anklingelte, um ihn mit jenen gewissen halben Tönen heißen Stolzes zu bitten, sie abends abzuholen und ins Hotel Britannique zu begleiten.
Daselbst verursachte Tralcof mit boshafter Genugtuung ein eisiges Diner, indem er sich darauf beschränkte, mit dem Kopf zu nicken oder ihn leise zu schütteln. So daß der sonst sehr zähe Gelli es nach einigen verzweifelten Versuchen aufgab, Tralcof zum Reden zu bringen.
Umso größer war darum dessen Erfolg, als er, wahrend man noch Kaffee trank, ans Klavier ging und die reizvollsten deutschen und französischen Kabarettschlager spielte, zwischendurch sang und scherzte und schließlich die gewagtesten Späße machte, welche Frau Vercelli immer wieder vor die Wahl stellten, ihn hinauszuwerfen oder zu bewundern. Da sie selbstverständlich dieses vorzog, war es nicht weiter verwunderlich, daß sie Luisa neugierig fragte: »Ist er immer so?«
»Nein, so war er noch nie.« Luisa ahnte nicht einmal, was alles sie mit dieser Feststellung vernichtete.
Denn Frau Vercelli zweifelte nun nicht länger, wem Tralcofs Götterstimmung gelte, und erkannte, daß dessen vorhergegangene Launen bewußte, auf sie gerichtete Manöver waren.
Als Luisa und Tralcof spät nachts sich verabschiedeten, bat Frau Vercelli um Bücher. Tralcof, bereits innerlich sich als Sieger huldigend, versprach welche; Luisa, sie zu bringen.
Doch Tralcof kam ihr zuvor. Schon am andern Morgen. Und zwar um acht, überzeugt, Frau Vercelli noch im Bett anzutreffen und gleichwohl vorgelassen zu werden.
Kaum hatte das Zimmermädchen, das ihm mitgeteilt hatte, er möge ein wenig warten, den Salon verlassen, als Tralcof kurzerhand Frau Vercellis Schlafzimmer betrat.
»Giorno. Ich wußte, daß Sie nicht warten würden.« Frau Vercelli blieb, ihm nur den Kopf zuwendend, im Bett liegen.
Tralcof ließ die Bücher fallen. »Sie … Sie … Sie …« keuchte er, nicht ohne effektvolle Klimax, und warf sich, nicht weniger bedacht, auf Frau Vercelli, die ihn ohne den geringsten Widerstand empfing und nach einer Stunde immer noch festhielt.
Erst als eine ganz besonders durchgearbeitete Erschöpfung stattgefunden hatte, begann sie zu sprechen. »Bist du wirklich Luisas Apoll?«
»So daneben vorbei gewesen.« Tralcofs mächtig geschwungene Brauen zuckten wie gekränkt. »Vor vielen Monaten einmal habe ich, gewiß, über … ich fing nur deinetwegen wieder an.«
»Sie muß schon reichlich bejahrt sein, das Wesen.«
»Dreiunddreißig.«
»Si. Seit sechs Jahren.« Frau Vercelli ließ Tralcof nicht aus den Augen. »Bei diesem Leben geht es eben rasch.«
»Kokotte ist sie eigentlich nicht.«
»Doch.«
»Du willst mich aushorchen.« Tralcof zupfte mißtrauisch an ihren Achselhaaren.
»Vielleicht. Liebst du sie?«
»Wie macht man denn das?«
»Bene. Hat sie mich beschimpft?«
»Nein. Vielmehr dich heftig als anständige Frau verteidigt, als ich dich eine schwere Kavallerie-Hure nannte.«
»Was?« Frau Vercelli, deren prächtiger Oberkörper vipernähnlich aufgeschnellt war, ließ sich alsbald grinsend zurücksinken. »Übrigens weshalb, wenn man fragen darf?«
»Zur Orientierung. Sage mir, auf wen eine Frau schimpft, und ich werde dir sagen, welche von beiden vorzuziehen ist.«
»Nett. Aber sie hat mich doch nicht beschimpft.«
»Eine Frau, die eine andere verteidigt, muß schwer hineingefallen sein.«
»Bravo. Aber beobachtet sprichst du noch besser. Hör mal, willst du mit mir arbeiten?« Frau Vercelli räusperte aufmunternd.
Tralcof setzte sich auf, es mit Erfolg vermeidend, erstaunt zu sein. »Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, daß du mir in jeder Hinsicht willkommen wärst. Und wenn du mein Liebhaber bleiben wolltest, umso herzlicher.«
Frau Vercelli weidete sich, fast mit leisem Hohn, an Tralcofs gespielter Gleichgültigkeit. »Die Veränderung wäre nicht zu deinem Nachteil. Wieviel gibt dir Luisa, carissimo?«
»Sind Sie … Bist du dessen sicher?«
»Er verspricht sich! Also doch noch ein wenig beleidigt.«