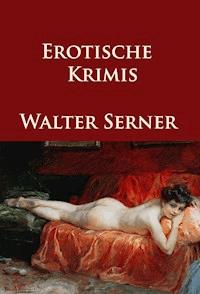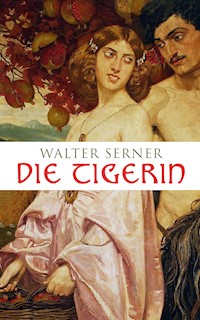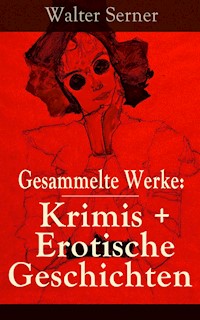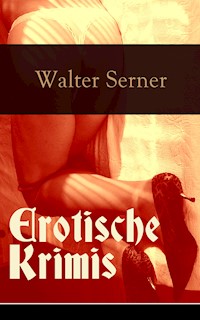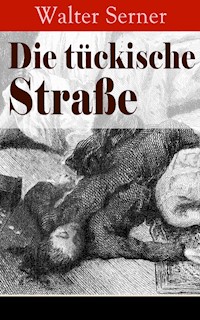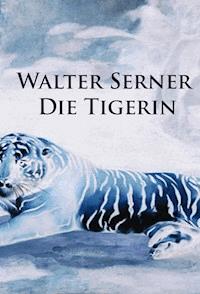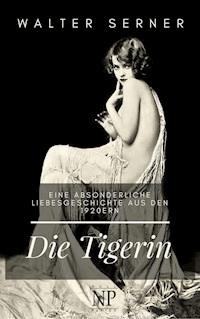Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Fiese, erotische und böse Geschichten von Huren, Dieben – den großen und den kleinen – und Mördern, Halunken und sonstigen Halsabschneidern. Walter Serner ist der »Maupassant der Kriminalistik« [Theodor Lessing] Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Serner
Der elfte Finger
Erotische Kriminalgeschichten
Walter Serner
Der elfte Finger
Erotische Kriminalgeschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: P. Steegemann, Hannover, 1923 (260 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962815-68-4
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Ein Meisterstück
Sein Truc
Ein ungewöhnlicher Handel
Wunder über Wunder
Das Zéro
Der Vicomte
Die dilettierende Pension
Eine kuriose Karriere
Lampenfieber
Das steile P
Faule Zeiten
Der Sturm auf die Villa
Bukarest – Budapest
Der berühmte Zedde
Die Bande Kaff
Sprotte schmust
Das ominöse Schild
Der Abreiser
Die Ermordung des Marchese de Brignole-Sale
P. L. M.
Pfeffer weiß sich zu helfen
Das Geheimnis der Concetta Capp
Das sicherste Spiel
Eros vanné
Der gelbe Terror
Überkombiniert
Un débrouillard
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Ein Meisterstück
Madame Guercelles war eine jener Kokotten, die hübsch genug sind, um nicht die Straße machen zu müssen, und klug genug, um es verhindern zu können, für eine Kokotte gehalten zu werden. Da ihr zudem eine kleine Revenue, welche die Familie ihres toten Mannes ihr ausgesetzt hatte, die Möglichkeit bot, wenn es einmal nicht mehr anders ginge, als Kleinbürgerin zu leben, verfügte sie trotz ihrer großen Jugend über eine ganz außerordentliche Sicherheit.
Es war daher nicht verwunderlich, dass auch de Parno, ein Hoteldieb größten Stils, als er ihr in der Hall des Hotels Beau Rivage in Genf begegnete, nach eingehender Prüfung ihres dezenten Schmucks und ihrer restlichen Haltung, sie für eine vornehme Witwe hielt, die darauf aus ist, einen zweiten Gatten zu finden. Nach dieser Feststellung wäre sie für ihn erledigt gewesen, wenn er nicht eines Abends, gelegentlich einer zufälligen Begegnung im Korridor der zweiten Etage, eine Nervosität an ihr wahrgenommen hätte, welche seinem erfahrenen Auge verdächtig erschien.
Schnell huschte er in die Toilette, wartete, bis die Tür von Madame Guercelles Zimmer sich geschlossen hatte, und bezog hierauf seinen Beobachtungsposten, den er bereits seit Tagen innehatte, um die Gewohnheiten der Gräfin Banffy, auf deren höchst wertvollen Schmuck er es abgesehen hatte, zu studieren.
Nach etwa einer Viertelstunde verließ Madame Guercelles, einen braunen Regenmantel um die Schultern, ihr Zimmer, lief auf den Fußspitzen in schnellstem Tempo den Korridor entlang und verschwand geräuschlos hinter einer Tür, die augenscheinlich nur angelehnt war.
De Parno, der nicht ohne Interesse konstatiert hatte, dass Madame Guercelles Zimmer neben dem der Gräfin lag, merkte sich die Nummer der Tür, welche Madame Guercelles soeben aufgenommen hatte, und begab sich, überaus vergnügt, noch in die Hall, wo er sich unauffällig dem Portier näherte, um ihn in ein Gespräch zu ziehen. Alsbald wusste er, dass Madame Guercelles in dem Appartement des Konsuls a. D. Steffens aus Hamburg sich befand, eines eleganten alten Herrn, der ihm bereits des öfteren im Speisesaal aufgefallen war.
Diese Nacht schlief de Parno besonders vorzüglich, wie stets, wenn er eine sichere und überdies amüsante Sache vor sich hatte.
Am nächsten Nachmittag ließ er Madame Guercelles im Lesezimmer über seinen Stock stolpern und sprang ihr absichtlich so ungeschickt bei, dass sie zu Fall kam. Während er ihr half, sich aufzurichten, stammelte er eine Entschuldigung über die andere, bemühte sich mit Erfolg, zu erröten und überhaupt alle Merkmale schwerster innerer Verwirrung darzubieten, und ergriff das Händchen, welches ihm Madame Guercelles liebenswürdig lächelnd zum Dank entgegenstreckte, mit zitternder Beglücktheit.
Noch am selben Abend kamen sie, während man den Kaffee in der Hall nahm, ins Gespräch. De Parno gelang es mit größter Leichtigkeit, jugendlichste Verliebtheit zu heucheln, und nicht viel schwieriger war es ihm, seiner rasch und im richtigen Augenblick vorgebrachten Biografie Glauben zu sichern.
Madame Guercelles, welcher der schlanke dunkle männliche Italiener über alles gefiel, betrachtete deshalb zum ersten Mal seit dem Tode ihres Gatten einen Mann nicht lediglich mit dem Kalkül der Kokotte, sondern mit jenem halbversponnenen Blick, hinter dem der Traumgeliebte der Backfischjahre seine Auferstehung feiert. Gleichwohl war sie zu klug, um dieser plötzlichen süßen Aufwallung zu erliegen. Sie schützte Müdigkeit vor und zog sich, nicht ohne eine Einladung zum Tee für den folgenden Tag anzunehmen, bestrickend lächelnd zurück.
De Parno folgte ihr vorsichtig und sah wiederum, wie sie den Korridor entlanglief und im Zimmer des alten Konsul verschwand. Im Nu war er an der Tür ihres Zimmers, zog sie hinter sich zu und öffnete mit seinem Aluminium-Taschenbesteck die verschlossene innere Tür. Nachdem er, das elektrische Licht kurz an- und abdrehend, zu seinem größten Bedauern gesehen hatte, dass nach dem Zimmer der Gräfin keine Tür führte, trat er zur Rekognoszierung1 auf den Balkon, den er nach kurzer Zeit sehr zufriedengestellt verließ. Dann drehte er das Licht wieder an und setzte sich mitten ins Zimmer in ein Fauteuil.2
Daselbst erblickte ihn, nach drei Stunden zurückkehrend, Madame Guercelles, wie er, mit allen Zeichen heftigster Erregung, ein Paar ihrer Seidenstrümpfe leidenschaftlich küsste.
Nachdem er sich vergewissert hatte, den gewünschten Eindruck hervorgebracht zu haben, sprang er entsetzt auf und warf sich, demütig um Verzeihung bettelnd, Madame Guercelles zu Füßen.
»Wie lange sind Sie schon hier?« hauchte sie, deren Eitelkeit mit ihrer Besorgnis kämpfte.
De Parno verkniff ein Lächeln. »Vielleicht fünf Minuten.«
Eine gewisse schmerzhafte Spannung auf Madame Guercelles puppenhaftem Gesicht ließ langsam nach. Sie trat, bereits wieder im Besitz ihrer vollen Sicherheit, von de Parno weg und setzte sich würdevoll auf einen Stuhl. »Stehen Sie auf!« befahl sie herrisch und fügte wie gequält hinzu: »O Gott, wie konnten Sie nur! … Aber welches Glück, dass ich noch nicht zu Bett war! … Unbegreiflich, dass ich vergessen konnte, die Tür abzusperren.«
»Ich weiß selbst nicht, was da über mich gekommen ist«, stöhnte de Parno. »Aber es war stärker als ich. Ich musste hinauf … in Ihre Nähe … Ich hielt es nicht länger aus … Bitte, glauben Sie nicht, dass ich eine schlechte Absicht hatte, Tiennette.«
»Tiennette?« In Madame Guercelles Augen dunkelte es drohend.
»Verzeihen Sie bitte … Ich habe diesen Namen in Gedanken so oft geflüstert, dass …«
»Wie, und Sie wussten auch meine Zimmer-Nummer?«
»Ich habe Sie doch schon vom ersten Augenblick an … Ich folge Ihnen ja bereits seit Tagen …« De Parno spielte mit seinen Fingern wie ein ertappter Gymnasiast.
Auf Madame Guercelles Nase sprang eine kurze Angst auf: ›Wenn er doch etwas beobachtet hätte?‹ Aber ein schneller Blick auf seine spielenden Finger beruhigte sie. »Gehen Sie jetzt!«
De Parno ging. Langsam. Stockend. Ungelenk.
An der Tür wandte er sich noch einmal um, die Lippen schmerzlich verzogen, in den Augen einen hündisch zärtlichen und zugleich wehmutsvollen Blick. Das war zu viel.
Das war zu viel für Madame Guercelles ohnehin tief aufgerührte Jugendträume. Sie erhob sich majestätisch, trat auf de Parno zu und reichte ihm ihr Händchen, das er stürmisch ergriff und, fast schluchzend vor Glück, mit heißen Küssen besäte.
Madame Guercelles, neuerlich im Bann jener süßen Aufwallung, erlag ihr nun. Sie hob de Parnos Kopf hoch, fasste ihn mit beiden Händen und zog seinen bebenden Mund langsam auf den ihren.
De Parno ließ sich, sehr behutsam abgestuft, in Glut geraten, packte Madame Guercelles immer fester, ächzte immer heftiger und gelangte ohne Schwierigkeiten auf den Punkt, wo er sich ohne Gefahr besinnungslos gebärden und zur Tat hinreißen lassen konnte.
Madame Guercelles ließ sie mit ausgezeichnet verstecktem Genuss an sich begehen …
Tags darauf erwartete de Parno sie an der Ecke der Rue du Mont Blanc und fuhr mit ihr in den Parc des Eaux-Vives zum Tee.
Als Madame Guercelles nach zwei Stunden allein in das Hotel zurückkehrte, war sie, was sie selbst sehr erstaunte, in de Parno sozusagen sterblich verliebt, ja kokettierte bereits in Ansehung der vornehmen Mailänder Familie, der er angehörte, und dem Vermögen, das er besaß, mit dem für sie nun wieder hold gewordenen Gedanken, sich zum zweiten Male zu verheiraten.
Am Abend, während sie an verschiedenen Tischen einander gegenübersaßen, stellte de Parno mit Befriedigung fest, dass der alte Konsul an Appetitlosigkeit litt und überhaupt allem Anschein nach mit einer schweren Verstimmung rang; und eine halbe Stunde später, dass die Gräfin Banffy zum Aufbruch drängte, um, was sie jeden zweiten Tag zu tun pflegte, den Kursaal zu besuchen.
Beim Kaffee in der Hall bestürmte er deshalb Madame Guercelles, ihn um zehn Uhr bei sich zu empfangen. Nach den obligaten, immer schwächer werdenden Weigerungen gab sie, verschämt das Köpfchen senkend, endlich nach und schritt eilig hinweg, als wollte sie so vermeiden, nicht schließlich doch noch anderen Sinnes zu werden.
De Parno lachte sich innerlich ins Fäustchen, ließ sich eine halbe Flasche Heidsick sec bringen und, nachdem sie geleert war, vom Groom Mantel und Hut aus seinem Zimmer holen. Hierauf schlenderte er, eine Zigarette lässig in den Fingern, aus dem Hotel.
Dicht neben dem Gartengitter blieb er jedoch stehen, wartete wenige Minuten und lugte dann vorsichtig nach dem Hoteleingang: niemand war zu sehen. Mit einigen raschen Schritten war er wieder an der Tür und huschte hinter einen Flügel. Hier wartete er, bis ein Kellner, der allein in der Hall an einer Säule lehnte, weggegangen war, rannte, von niemandem gesehen, auf die Treppe und gewann in vier Etappen, immer wieder vor erscheinendem Personal sich verbergend, Madame Guercelles Zimmer.
Nach einer halben Stunde wand sich diese in holdesten Entzückungen. »Silvio, fühlst du, dass ich dich mit dem Herzen liebe?« Sie war der Auffassung, mit dieser Frage de Parno in diesem Augenblick endgültig zu beseligen.
De Parno schloss, wie ins Innerste getroffen, die Augen und verharrte sekundenlang regungslos. Dann griff er, gleichsam um seiner übermenschlichen Erregung Herr zu werden, durch das Hemd hindurch sich auf die auf und nieder wogende Brust. Dies jedoch lediglich, um einen daselbst befindlichen Gegenstand, der an seinem Halse hing, loszulösen, zu öffnen und blitzschnell Madame Guercelles auf Nase und Mund zu pressen. Es dauerte nur einige Sekunden, bis die Narkose ihre Wirkung getan hatte …
De Parno kleidete sich hastig an, nahm Madame Guercelles Schmuck an sich und eilte auf den Balkon, von dem aus er mit einem kleinen, wenn auch nicht ganz ungefährlichen Sprung den Balkon des Nebenzimmers erreichte, dessen Tür zufälligerweise offenstand. Mit Hilfe seiner elektrischen Taschenlampe orientierte er sich und fand nach langem Suchen (er musste zwei Handkoffer aufschneiden) die stählerne Schmuckkassette, die er mit einem von ihm selbst konstruierten Instrument erbrach. Hierauf befestigte er, irreführungshalber, ein gut eingeseiftes Seidenseil am Gitter des Balkons, tat, bevor er es aufwarf, einen raschen Blick auf die leeren Tische der Terrasse und ließ die hirschledernen Handschuhe, welche er während des Arbeitens getragen hatte, auf dem Balkon liegen. Den Rückweg trat er durch das Zimmer der Gräfin an, dessen innere Tür er zweimal abschloss.
Ungesehen in der Hall angelangt, schlug er den Kragen hoch, schlich sich in das leere Lesezimmer und entfernte den Portier, von dem nicht zu erwarten war, dass er sein Pult so bald verlassen würde, dadurch, dass er eine fast mannshohe chinesische Vase mit einem Fußtritt von ihrem Sockel gegen die Wand stieß, an der sie krachend zertrümmerte. Der Portier rannte erschreckt herzu, de Parno im selben Augenblick aus dem Hotel.
Fünf Minuten später hatte er seine Beute einer hübschen Krankenschwester, welche auf der Hotelseite promenierte, zugesteckt, und nach weiteren fünf Minuten erschien er in einer Loge des Kursaals, trat während der folgenden Pause, um sich ein ganz besonders festes Alibi zu zimmern, der Gräfin Banffy im Vestibül auf die Schleppe, dass es nur so knatterte, und entschuldigte sich so devot, dass die Gräfin ihm mit bestem Willen nicht böse sein konnte …
Um Mitternacht wurde der Diebstahl bemerkt. Der Verdacht fiel sofort auf Madame Guercelles, deren Beziehungen zu dem alten Konsul und zu einem gleichfalls im Hotel wohnenden jungen Franzosen dem Hotelpersonal nicht unbekannt geblieben waren. Da sie um elf Uhr vormittags noch nicht erschienen war, klopfte man und schloss, als keine Antwort erfolgte, die Tür auf.
Madame Guercelles, der ein Riechfläschchen unter die Nase gehalten wurde, fühlte sich nach einer Viertelstunde so weit wohl, dass sie den Zusammenhang zu begreifen begann. Sie hütete sich, zu sagen, was sie wusste, und verließ sich darauf, dass es, zudem angesichts ihres fehlenden Schmucks, schwer war, ihre Behauptung, sie müsse während des Schlafs narkotisiert worden sein, zu widerlegen.
In den Zimmern des alten Konsuls und des jungen Franzosen wurden ebenfalls Durchsuchungen vorgenommen; die beiden Herren waren sehr erstaunt, als sie erfuhren, dass ihr zärtliches Geheimnis keines war.
De Parno, auf den nicht der kleinste Schatten eines Verdachtes gefallen war, lächelte leise, als er Madame Guercelles abends im Speisesaal gegenübersaß.
Aber auch Madame Guercelles lächelte. Sie hatte mit ihrem bescheidenen Schmuck nicht allzu viel eingebüßt, dafür aber eine Erfahrung gewonnen, die jeden Rückfall in Jugendträume ausschloss und ihr jene letzte Sicherheit gab, welche allein die große Kokotte gewährleistet.
Später ging sie in der Hall, die Kaffeetasse in der Hand, an de Parno vorbei und zischte ihm schnell zu: »Das war ein Meisterstück.«
De Parno tat, als hätte er nichts gehört.
Identifizierung, Erkundung <<<
Lehnstuhl, Lehnsessel oder Armsessel <<<
Sein Truc
war wirklich erstklassig. Er hatte weder den Vorteil, der oft ein Nachteil ist, einfach zu sein, noch den Nachteil, Komplikationen herbeizuführen. Er reüssierte stets und immer glatt und hatte der Betroffene einigermaßen von seiner Verblüffung sich erholt, so erwartete ihn die neue, nicht herausbringen zu können, wie es geschehen war. Fest stand altem Anschein nach bloß, dass ein Tic die Hauptrolle in den Manövern spielte, welche Mister Gam riesige Summen eintrugen und den Schwergeschädigten das komplette Nachsehen.
Als Fénor es hatte, hatte er es buchstäblich. Er stand nämlich an der Ecke der Rue Frochot, wo das Nachtrestaurant Le Rat Mort sich befindet, und sah Mister Gam nach, der langsam die Place Pigalle überquerte und, in Zwischenräumen von etwa fünf bis zwanzig Sekunden, mit dem Kopf zuckte. Das war sein Tic.
Mister Gam war längst im Nebel verschwunden, als Fénor immer noch unbeweglich dastand. Plötzlich blickte er auf und zuckte mit dem Kopf, als könnte ihm die Nachahmung jener Bewegung irgendwie Aufschluss über die Methode geben, mit deren Hilfe Mister Gam ihm zehntausend Francs abgenommen hatte. Auch ihm war es, als ob jener Tic das Wichtigste gewesen wäre. Er vermochte aber weder ihn sich zu erklären, noch den Rest. Schließlich ließ er den ganzen Hergang noch einmal an sich vorüber.
Er war von Mister Gam, dem er beim Verlassen des Gaumont-Palace begegnet war, zum Souper eingeladen worden und hatte angenommen, obwohl er von den Verlusten gehört hatte, die unter verschiedenen Umständen einige seiner Bekannten in Gesellschaft Mister Gams auf unerklärliche Weise erlitten hatten. Dass jene Umstände sich durchaus von der Gelegenheit unterschieden, die Mister Gam veranlasst hatte, ihn zum Souper einzuladen, hatte sein anfängliches Misstrauen verscheucht: Mister Gam konnte nicht wissen, dass er zehntausend Francs, welche ihm infolge einer zufälligen Begegnung im Gaumont-Palace übergeben worden waren, in seiner Brusttasche trug; und er konnte nicht wissen, dass er, Fénor, sich daselbst befinde, denn er hatte erst im letzten Augenblick, lediglich von einer Laune bestimmt, sich dazu entschlossen, ins Cinema zu gehen. Beim Souper war Mister Gam, wie immer, überaus amüsant gewesen, hatte treffende Beobachtungen und witzige Bemerkungen über die anwesende Lebewelt gemacht und einige seiner Reiseabenteuer erzählt, die alle sich dadurch auszeichneten, dass banale Handlungen und groteske Zufälle einen unwahrscheinlichen und deshalb umso interessanteren Vorfall herbeigeführt hatten. Diese mit geschickter Disposition und feiner Diktion erzählten Geschichten hatten auf Fénor durchaus den Eindruck gemacht, wahr zu sein, umsomehr als Mister Gam in ihnen entweder nur eine nebensächliche Rolle spielte oder sogar eine passive. Und es war gerade während einer solchen Erzählung gewesen, als Fénor, seine Krawatte richtend, ahnungslos mit der Hand über seine linke Brustseite streifte: die harte Wölbung, welche das Portefeuille verursachte, war verschwunden. Ein schneller Griff in die Tasche hatte bestätigt, woran er eigentlich nicht mehr gezweifelt hatte. Mister Gam schien keine Notiz von dieser Feststellung genommen zu haben und sprach in seiner suggestiven Art weiter, ohne dass seine weiche vibrierende Stimme auch nur das geringste Déséquilibre verraten hätte. Nur sein Kopfzucken, das zuvor außerordentlich häufig stattgefunden hatte, wurde nun auffällig seltener.
Fénor fröstelte. Er war überzeugt, dass dieser Tic die Lösung enthielt. Vielleicht diente er als Verständigungsmittel, vielleicht gab er Morsezeichen? Fénor grinste müde, schloss mit einer resoluten Geste den Mantelkragen und winkte einem Taxi. Als es über den Boulevard de Courcelles rollte, jubelte er innerlich auf, dass er sich beherrscht und nichts von seiner tobenden Wut sich hatte anmerken lassen; und lächelte darüber, welch fürchterliche Szenen die ihm vorhergegangenen Opfer ergebnislos aufgeführt hatten. Plötzlich wurde sein kluges Gesicht starr. Und mit einem halb unterdrückten Aufschrei schlug er sich auf die Knie: er hatte gefunden, was allein ihm eine Chance bot, Mister Gams Truc zu entdecken.
»Ich muss mich noch einmal von ihm hineinlegen lassen«, sagte er mehrmals laut vor sich hin. »Und ich muss dabei aufpassen, als befände ich mich in Todesgefahr.« –
Die nächsten Tage verbrachte Fénor fast ausschließlich mit vergeblichen Versuchen, Mister Gam auf unverdächtige Weise in den Weg zu kommen. Hierauf versuchte er es mit sorgsam gefälschten Rohrpostkarten, die Mister Gam zu Rendezvous bestellten, mit fingierten Telefongesprächen, die ihn auf vielerlei Art in eine bestimmte Straße bringen sollten, und endlich mit einer Depesche aus Melun. Nichts verfing. Fénor gab es resigniert auf, diesen Überfuchs anzulocken, und musste sich entschließen, die so sehr herbeigesehnte Begegnung einem Zufall zu überlassen.
Dieser war ihm bereits am Abend nach diesem Entschluss hold. Fénor befand sich, eben als er aus der Rue Castiglione auf die Place Vendôme einbog, ganz plötzlich neben Mister Gam, welcher, die Hände in den Manteltaschen, unbeweglich dicht an der Mauer stand.
Fénor wich, allerdings ohne jede Überlegung, schnell zurück und bog um die nur ein paar Schritte entfernte Ecke. Hier blieb er stehen und dachte nach. Nach wenigen Sekunden war es für ihn außer Zweifel, dass Mister Gam jemandem auflauerte. Sein Plan war sofort gefasst.
Fénor schlenderte an die Ecke heran und lugte vorsichtig hervor: Mister Gam stand nach wie vor unbeweglich da und hatte aller Wahrscheinlichkeit nach den Eingang des Hotel Ritz im Auge. Fénor lehnte sich an die Mauer, zündete sich eine Zigarette an und tat nur von Zeit zu Zeit einen Blick um die Ecke.
Endlich, nach etwa zehn Minuten Wartens, löste Mister Gams Rücken sich langsam von der Hauswand.
Fénor folgte Mister Gam in einem Abstand von ungefähr vierzig Schritten, sah, wie er in der Nähe des Hotel Ritz einem älteren, schon etwas beleibten Herrn geschickt in den Weg trat, sofort mit ihm in ein sehr lebhaftes Gespräch geriet und kurz darauf an dessen Seite das Restaurant Edouard VII. betrat. Fénor ließ eine Viertelstunde verstreichen. Dann betrat er gleichfalls das elegante Restaurant. Es gelang ihm, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ungesehen zu bleiben und an dem hinter Mister Gams Rücken befindlichen Tisch Platz zu nehmen. Gleichzeitig mit dem Diner bestellte er den Figaro, um eine Deckung parat zu haben, falls Mister Gam eine Wendung nach rückwärts machen sollte.
Der Mister Gam gegenüber sitzende Herr war Fénor unbekannt, aber ein in jeder Hinsicht ganz ausgezeichnet gewähltes Opfer. Er trug eine fingernagelgroße Perle in der Krawatte, zwei Brillantringe, die auf mindestens fünfzigtausend Francs zu schätzen waren, und hörte, was Fénor ein hämisches Lächeln entlockte, seinem unausgesetzt sprechenden Tischgenossen mit devoter Begeisterung zu.
Fénor bedauerte sehr, dass er Mister Gams Gesicht nicht sehen konnte, beschied sich jedoch rasch, als er bemerkte, dass die Zahl der Kopfzuckungen von Minute zu Minute zunahm. Einige forschende Blicke genügten, um festzustellen, dass weder einer der Gäste an den Nebentischen noch einer der Kellner auf das Kopfzucken achtete. Man hatte es zwar allenthalben mit Verwunderung wahrgenommen, sich aber sofort damit abgefunden und es weiterhin ignoriert.
Es verstrich fast eine halbe Stunde, ohne dass der bis zum Schweißausbruch aufmerksam beobachtende Fénor irgend etwas hätte bemerken können, das seine wilde Neugier auch nur im geringsten befriedigt hätte.
Mit einem Mal aber schien es ihm, als wäre in den Ausdruck der Augen des gespannt zuhörenden älteren Herrn etwas Blödes, Glotzendes geraten, das vorher nicht dagewesen war. Fénor sah noch schärfer hin und glaubte, eine unnatürliche Unbeweglichkeit in der ganzen Haltung jenes Herrn bemerken zu können. Eine leise in ihm sich erhebende Vermutung wurde ihm fast zur Gewissheit, als er sich ein wenig zur Seite neigte und sah, dass Mister Gams linke Hand fest auf der seines Gegenüber lag. Und fast gleichzeitig geschah es.
Mister Gam ergriff mit der Rechten seine Serviette und fuhr mit ihr seinem Opfer übers Gesicht, als wollte er ihm in liebenswürdiger Weise ein Stäubchen entfernen. Seine Linke aber senkte sich blitzschnell in die fremde Brusttasche, eskamotierte das ergatterte Portefeuille in die Serviette und legte diese dann neben sich auf den Tisch.
Fénor hatte eigentlich bereits genug gesehen. Es interessierte ihn aber doch noch, zu wissen, wie Mister Gam das Portefeuille verschwinden lassen würde. Es dauerte denn auch nicht lange, da glitt die Serviette unauffällig zu Boden, genau zwischen die Füße Mister Gams, die sich alsbald unter sie schoben und, von ihr bedeckt, allerlei Bewegungen ausführten, um schließlich mit einem Ruck still zu stehen. Nach einigen Minuten beugte sich Mister Gam nachlässig zur Seite, um die Serviette aufzuheben. Dabei lanzierte er schnell das Portefeuille in den linken inneren Hosenrand, in dem kunstgerecht eine kleine Tasche angebracht war …
Fénor, der das Restaurant daraufhin sofort verlassen hatte, wartete im Schatten der Vendôme-Säule, überzeugt, Mister Gam bald erscheinen zu sehen.
*
Nach einer Viertelstunde fuhren zwei Polizeibeamte im Taxi vor. Und nach einer weiteren Viertelstunde stürzte Mister Gams Opfer in heftigster Aufregung aus dem Restaurant, sprang in das noch wartende Taxi und fuhr in der Richtung der Rue de la Paix davon. ›Zweifellos zum nächsten Privatdetektiv.‹ Fénor lächelte selbstzufrieden.
Bald darauf erschien Mister Gam unter dem Portal des Restaurants, umgeben von einer Schar schwatzender gestikulierender Kellner und den eifrig auf ihn einsprechenden Beamten, die er mit immer abweisenderen Handbewegungen sich vom Leibe hielt, und ging, als man ihn endlich in Ruhe ließ, langsamen Schrittes auf die Rue Castiglione zu.
Fénor folgte ihm bis unter die Arkaden des Hotel Continental. Der um diese Nachtstunde nur spärliche Verkehr, auf den Fénor im Nu seinen Plan aufgebaut hatte, war nicht einmal vorhanden. Das zerstreute seine letzten Bedenken.
Er rannte auf den Fußspitzen ganz nahe an Mister Gam heran, stellte ihm von hinten ein Bein, riss dem Hingestürzten das gestohlene Portefeuille aus der Hosenbeintasche und steckte es ein.
Mister Gam war rasch wieder auf den Beinen und so verdutzt über die Anwesenheit Fénors, dass er gar nicht daran dachte, seinen über und über staubig gewordenen Mantel zu säubern. »Sie hier?« hauchte er, verwirrt versuchend, sich zu sammeln.
»Allerdings.« Fénor wartete, brennende Schadenfreude in den Augen.
Mister Gam strich sich mit beiden Händen die Wangen entlang, abwechselnd Fénor und die Straße musternd. Seine kleinen grauen Augen flackerten eigentümlich. Miteins hielten seine Hände inne. Sein Kopf senkte sich langsam, fast unmerklich.
Fénor, dem keine der Bewegungen Mister Gams entgangen war, sah, wie er den rechten Fuß am linken Knöchel rieb. ›Um festzustellen, ob der kostbare Raub noch an seinem Platz ist.‹ Fénor grinste höhnisch.
»Also Sie!«, zischte im selben Augenblick Mister Gam. »Geben Sie mir wenigstens die achttausend Francs heraus, die zu viel darin sind.«
»Sie geben also zu, mir zehntausend Francs gestohlen zu haben, Herr Hypnotiseur?«
»Patati patata.« Mister Gam nahm sich, plötzlich wieder völlig ruhig geworden, eine Zigarette. »Sie haben sich Ihr Geld nicht ungeschickt zurückgeholt. Sie mögen es behalten. Aber was nicht Ergebnis Ihrer Arbeit ist, kommt Ihnen nicht zu.«
Fénor rückte lachend an seinem Hut. »Nicht Ergebnis meiner Arbeit? Ist ein gut in den Weg gestellter Fuß ein schlechterer Truc als ein vorzüglich verwendeter Tic? Es wäre übrigens sehr liebenswürdig von Ihnen, mir den eigentlichen Zweck Ihres köstlichen Tics zu verraten. Alle restlichen Details Ihres Arbeitens sind mir jetzt endlich klar.«
»Mit Vergnügen.« Mister Gam lächelte verbindlich. »Er dient lediglich der Verschleierung der Hypnose. Er fesselt die Aufmerksamkeit meines Mannes in hohem Grade, macht es ihm aber andererseits unmöglich, zu bemerken, dass ich ihm unausgesetzt in die Augen sehe.« Er hatte sich während dieser Worte Fénor genähert, ergriff plötzlich mit beiden Händen dessen Kopf, presste sie auf die Schläfen und stierte ihm in die Augen …
Als Fénor zu sich kam, lehnte er, halb eingesunken, an einem Arkadenpfeiler. Ein Polizist stand neben ihm, klopfte ihm auf die Schulter und riet ihm freundlich, doch endlich heimzugehen. Fénor nickte mechanisch und ging.
Nach einigen Schritten erinnerte er sich. Die Zähne aufeinanderknarrend, griff er in die Tasche: das Portefeuille, das er erjagt hatte, war verschwunden; aber auch sein eigenes, in dem sich allerdings bloß zweihundert Francs befunden hatten.
Er hätte sich nicht wochenlang fast krank geärgert, wenn er gewusst hätte, dass das gestohlene Portefeuille nur neunhundert Francs enthalten hatte.
Ein ungewöhnlicher Handel
Tralcof griff, kaum dass er erwacht war, hastig nach dem Telefonapparat, der auf dem Nachttischchen stand, und lächelte verschmitzt, während er auf die Stimme der Beamtin wartete. »Central 46 88 … Ja … Die Signorina Forbena, bitte … Ja … Luisa? Guten Morgen. Ausgeschlafen? … Aber das muss doch wieder einmal aufhören. Ich glaube, dass es für die Erhitzung erkalteter Beziehungen genügt, wenn man sie drei Wochen lang … Wie? Sechs Wochen? Si. Also wenn man sie sechs Wochen lang auf den Rost eines flammenden Bruchs legt. Poetisch, nicht? … Ja, du hast recht. Ich war stets ein sachlicher Träumer. Du glaubst mir doch hoffentlich kein Wort. Jetzt, da mich die Sehnsucht treibt … Ja, bitte, treibt. Also jetzt kann ich es dir ja eingestehen, dass ich mit dir nur gebrochen habe, weil es so nicht mehr weiterging und weil … Was ich eigentlich will? O, du Tiefsinnige! Erstens mich mit dir aussöhnen, um die Friedlichkeit meiner seit drei, scusate, seit sechs Wochen schwer troublierten Nächte wiederherzustellen … Ach, ich pfeife darauf, ob du es glaubst oder nicht. Wichtig ist mir nur, dass du wiederherstellst … Nicht? … Wirklich nicht? Warte bitte, bevor du mir endgültig abläutest, mein Zweitens ab … Ja, heißgeliebtes Mädchen … Du lachst nicht einmal? Dann allerdings ist die Gefahr des Abgeläutetwerdens beträchtlich gestiegen … Ja, ja, ja, also kurz und gut und zweitens: wie konntest du eine derart fürchterliche Dummheit machen, dich mit diesem Frauenzimmer in der Via Chiaia zu zeigen und noch dazu am hellen Mittag? … Ob ich sie kenne? Ganz Neapel kennt diese Person. Wie konntest du nur! … O, ich vermute, dass es ein Rückzug ist, wenn man nach solch einer feuchten Mitteilung plötzlich keine Zeit mehr hat … Was? Um sieben Uhr? Zur Wiederherstellung? … Nein? … Also um sieben Uhr. Arrivederci!«
Tralcof ließ sich schmunzelnd in die Kissen zurückgleiten: er war nun sicher, dass er jene schöne Frau, die er am Tag vorher am Arm Luisas, das erste Mal in seinem Leben, gesehen hatte, in wenigen Tagen kennen würde.
Abends aß er mit Luisa im Esposito auf der Piazza S. Ferdinando.
Luisa hatte sofort, als er bei ihr eingetreten war, Frau Vercelli in leidenschaftlicherweise zu verteidigen begonnen: sie sei die Witwe eines römischen Colonels, der in Tripolis gefallen wäre, bewohne drei Zimmer im Hotel Britannique auf dem Corso Vittorio Emanuele und verkehre überhaupt nur mit zwei Menschen, mit Lina Dini und Carlo Gelli, durch den sie zufällig ihre Bekanntschaft gemacht habe. Luisa war während dieser Verteidigungsrede geradezu aufgeregt gewesen.
So hatte Tralcof, ohne selbst auch nur ein einziges Wort gesagt zu haben, mühelos erfahren, was er zu wissen wünschte; daraufhin die Möglichkeit eingeräumt, dass er sich geirrt haben könnte, dass vielleicht eine verblüffende Ähnlichkeit vorläge, und, schnell ablenkend, Luisa eine gut disponierte Liebeserklärung gemacht, die zwar zu keinem deutlichen Ergebnis führte, aber immerhin zur Annahme der Einladung zum Diner.
Beim Dessert, dem vorzüglich gebändigte Sprachattacken und mehr oder weniger heftige Wiederannäherungsversuche auf dem Souterrain vorhergegangen waren, ließ Tralcof eine kleine Pause eintreten, um mit der erforderlichen Harmlosigkeit sagen zu können: »Nein, ich glaube doch nicht dass ich mich geirrt habe. Die Ähnlichkeit war zu groß.«
»Du musst dich geirrt haben.« Luisa wurde augenblicklich wieder aufgeregt, sodass Tralcof verwundert aufmerksam wurde. »Es ist gänzlich ausgeschlossen, dass Pina nicht ist, was sie scheint.«
Tralcof lächelte dünn. »Pina sagst du bereits? Also schon so intim? Nun, ich erinnere dich an das, was ich dir früher öfter zu bedenken gab: dass man immer nur etwas zu sein scheint und dass es deshalb lediglich darauf ankommt, herauszubekommen, ob man den frühzeitig und endgültig angenommenen Schein vor sich hat oder einen nur vorübergehend angenommenen.«
Luisa machte eine eigensinnige Handbewegung und fistelte nervös: »Lass bitte deine Erziehungsversuche! Darauf falle ich nicht mehr herein. Außerdem hat mir Pina tatsächlich bewiesen, dass sie es ehrlich mit mir meint.«
Tralcof schwieg schlauerweise und beschränkte sich darauf, als er Luisas forschenden Blick auf sich gerichtet fühlte, wie für sich hin zweifelnd den Kopf zu bewegen.
»Du kannst dich ja selbst davon überzeugen, wenn du willst.« Luisa spielte ärgerlich mit ihrer Serviette. »Ich gehe morgen mit ihr und Gelli ins Theater. Komm in die Loge! Ich stelle dich vor.«
Tralcof zuckte, sehr mit seinem Vorgehen zufrieden, leicht die Achseln und nahm seine Bestrickungstätigkeit wieder auf, die ihn denn auch nach Mitternacht in Luisas Bett brachte …
Als er am nächsten Abend in Frau Vercellis Loge erschien, war Luisa deshalb so heiter, dass der günstige Eindruck, den er auf jene machte, noch durch die naheliegende Vermutung, er konnte diese Heiterkeit hervorgerufen haben, erhöht wurde.
Tralcof erkannte sogleich, wie vorteilhaft seine Situation sich gestaltete, und zögerte nicht, ihr kräftig nachzuhelfen: er ignorierte Frau Vercelli fast, verwickelte aber Luisa und Gelli in eine schlechthin betörend amüsante Konversation und verließ, als es ihm gelungen war, der finster abseits Sitzenden ein Lächeln zu entlocken, überraschend unvermittelt die Loge.
Am folgenden Morgen war es daher Luisa, die anklingelte, um ihn mit jenen gewissen halben Tönen heißen Stolzes zu bitten, sie abends abzuholen und ins Hotel Britannique zu begleiten.
Daselbst verursachte Tralcof mit boshafter Genugtuung ein eisiges Diner, indem er sich darauf beschränkte, mit dem Kopf zu nicken oder ihn leise zu schütteln. Sodass der sonst sehr zähe Gelli es nach einigen verzweifelten Versuchen aufgab, Tralcof zum Reden zu bringen.
Umso größer war darum dessen Erfolg, als er, wahrend man noch Kaffee trank, ans Klavier ging und die reizvollsten deutschen und französischen Kabarettschlager spielte, zwischendurch sang und scherzte und schließlich die gewagtesten Späße machte, welche Frau Vercelli immer wieder vor die Wahl stellten, ihn hinauszuwerfen oder zu bewundern. Da sie selbstverständlich dieses vorzog, war es nicht weiter verwunderlich, dass sie Luisa neugierig fragte: »Ist er immer so?«
»Nein, so war er noch nie.« Luisa ahnte nicht einmal, was alles sie mit dieser Feststellung vernichtete.
Denn Frau Vercelli zweifelte nun nicht länger, wem Tralcofs Götterstimmung gelte, und erkannte, dass dessen vorhergegangene Launen bewusste, auf sie gerichtete Manöver waren.
Als Luisa und Tralcof spät nachts sich verabschiedeten, bat Frau Vercelli um Bücher. Tralcof, bereits innerlich sich als Sieger huldigend, versprach welche; Luisa, sie zu bringen.
Doch Tralcof kam ihr zuvor. Schon am anderen Morgen. Und zwar um acht, überzeugt, Frau Vercelli noch im Bett anzutreffen und gleichwohl vorgelassen zu werden.
Kaum hatte das Zimmermädchen, das ihm mitgeteilt hatte, er möge ein wenig warten, den Salon verlassen, als Tralcof kurzerhand Frau Vercellis Schlafzimmer betrat.
»Giorno. Ich wusste, dass Sie nicht warten würden.« Frau Vercelli blieb, ihm nur den Kopf zuwendend, im Bett liegen.
Tralcof ließ die Bücher fallen. »Sie … Sie … Sie …« keuchte er, nicht ohne effektvolle Klimax, und warf sich, nicht weniger bedacht, auf Frau Vercelli, die ihn ohne den geringsten Widerstand empfing und nach einer Stunde immer noch festhielt.
Erst als eine ganz besonders durchgearbeitete Erschöpfung stattgefunden hatte, begann sie zu sprechen. »Bist du wirklich Luisas Apoll?«
»So daneben vorbei gewesen.« Tralcofs mächtig geschwungene Brauen zuckten wie gekränkt. »Vor vielen Monaten einmal habe ich, gewiss, über … ich fing nur deinetwegen wieder an.«
»Sie muss schon reichlich bejahrt sein, das Wesen.«
»Dreiunddreißig.«
»Si. Seit sechs Jahren.« Frau Vercelli ließ Tralcof nicht aus den Augen. »Bei diesem Leben geht es eben rasch.«
»Kokotte ist sie eigentlich nicht.«
»Doch.«
»Du willst mich aushorchen.« Tralcof zupfte misstrauisch an ihren Achselhaaren.
»Vielleicht. Liebst du sie?«
»Wie macht man denn das?«
»Bene. Hat sie mich beschimpft?«
»Nein. Vielmehr dich heftig als anständige Frau verteidigt, als ich dich eine schwere Kavallerie-Hure nannte.«
»Was?« Frau Vercelli, deren prächtiger Oberkörper vipernähnlich aufgeschnellt war, ließ sich alsbald grinsend zurücksinken. »Übrigens weshalb, wenn man fragen darf?«
»Zur Orientierung. Sage mir, auf wen eine Frau schimpft, und ich werde dir sagen, welche von beiden vorzuziehen ist.«
»Nett. Aber sie hat mich doch nicht beschimpft.«
»Eine Frau, die eine andere verteidigt, muss schwer hineingefallen sein.«
»Bravo. Aber beobachtet sprichst du noch besser. Hör mal, willst du mit mir arbeiten?« Frau Vercelli räusperte aufmunternd.
Tralcof setzte sich auf, es mit Erfolg vermeidend, erstaunt zu sein. »Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, dass du mir in jeder Hinsicht willkommen wärst. Und wenn du mein Liebhaber bleiben wolltest, umso herzlicher.«