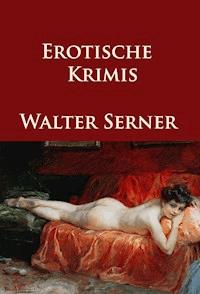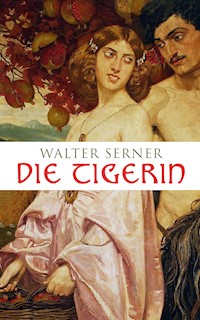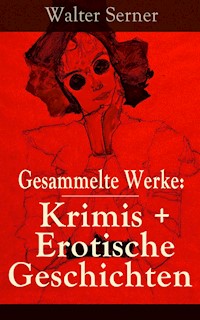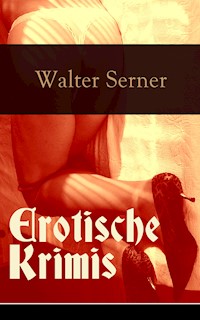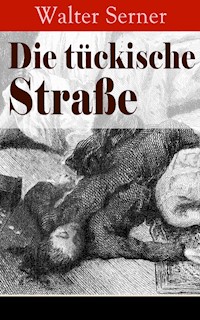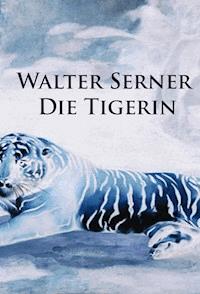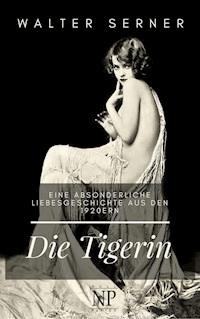6,99 €
Mehr erfahren.
Walter Serner gilt als Meister der verruchten Pose, des amoralischen Affronts. Das Generalthema seiner Kriminalgeschichten ist die Faszination des Bösen. In mondänem Argot feiert hier ein durch und durch moderner Autor das blühende Laster der Großstadt und deren zwielichtige Helden: leichte Mädchen und schwere Jungs, Tagediebe und Nachtschwärmer, Damen von Welt und solche mit Vergangenheit, Gentleman-Gauner, Schieber und Schlepper. Ein hochkarätiges Lesevergnügen nicht nur für Fans des Kultautors!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
WALTER SERNER
Der rote Strich
Kriminalgeschichten
Herausgegeben und umfassend kommentiert
von Andreas Puff-Trojan
Nachwort von Xaver Bayer
MANESSE VERLAG
ZÜRICH
Die Ermordung des Marchese de Brignole-Sale
Sorhul blieb unter den Arkaden der Piazza Deferrari stehen und beobachtete interessiert die Gruppen von Männern, die in allen Ecken standen, schrien und gestikulierten, sodass man hätte vermuten können, jeden Augenblick müsse eine Keilerei beginnen.
Plötzlich fühlte Sorhul sich von hinten berührt. Ein abgerissen daherschlotternder alter Mann flüsterte ihm etwas zu; als er sich nicht verstanden sah, sprach er französisch, die Adresse eines Nachtlokals nennend.
Sorhul lehnte höflich ab, erhielt aber trotzdem mit liebenswürdiger Aufdringlichkeit ein gelbes Kärtchen in die Hand geschoben, das er, ohne es zu lesen, gedankenlos einsteckte.
In der Via Venti Settembre, eben als er die Zolezi-Ecke passierte, sprach ihn eine unauffällig, aber elegant gekleidete Dame an, die eine üppige blonde Süddeutsche hätte sein können. Sie behauptete nach wenigen Worten, Hunger zu haben.
Das imponierte Sorhul. «Sie lügt vielleicht wirklich nicht oder ist auf bemerkenswerte Weise raffiniert», sagte er sich und führte sie, sehr neugierig geworden, zu Fossati, einem der vornehmsten Restaurants von Genua.
Zu seinem Erstaunen benahm sie sich durchaus korrekt, ja war mit gewissen kleinen Gebräuchen, die das Gewohntsein derartiger Milieus bedingen, wohlvertraut.
Nach dem Braten versuchte Sorhul, sich zu orientieren. «Sind Sie wirklich Italienerin? Sie sprechen ein akzentfreies Französisch.»
«Was soll das.» Sie legte ihre kraftlosen, ein wenig feuchten Finger, die so gar nicht zu ihrem Körper passten, auf Sorhuls Hand. «Ob ich Ihnen nun die Wahrheit sage oder ein Märchen vorsetze, Sie werden mir auf keinen Fall glauben. Vielleicht aber lieber noch das Märchen. Denn die Wahrheit ist zu dumm.»
Sorhul sah, sehr angeregt, auf seinen Teller. Die linke Hälfte seines Gesichtes zog sich zusammen, sodass die andere wie gelähmt aussah.
«Hm. Ich halte Sie für so intelligent, mit dieser vorzüglichen Vorbemerkung mich umso sicherer einem Märchen zuführen zu wollen.»
Sie zog ihre Hand langsam zurück. «Es ist besonders schwer, ja beinahe unmöglich, sich zu verständigen, wenn man nicht wenigstens ein ganz klein wenig Vertrauen – vorgibt. So wie der bessere Spieler dem schwächeren etwas vorgibt.»
«Wiederum vorzüglich.» Sorhuls Neugier schoss hoch auf, seine Stirn leicht rötend. «Aber ich wundere mich im Grunde stets, wenn es mir gelingt. Das ist eine der klarsten Quellen des Misstrauens.»
Sie schwieg. Es schien Sorhul, als lächle sie ganz unmerklich. Deshalb sagte er heiter: «Es ist wohl überhaupt unmöglich, anders als à fonds perdu1 zu reden.»
«Doch nicht. Oft genügt es, überhaupt miteinander zu reden, um das gegnerische Ziel zu erkennen. Was man redet, ist gänzlich gleichgültig.»
Sorhul, dem diese Maxime geläufig war, wurde ebendeshalb unwillig. «Lassen wir das. Das führt zu nichts. Wollen Sie Geld?»
«Selbstverständlich.»
«Sehr gut. Wie viel?»
Sie hatte plötzlich einen kleinen Bleistift in der Hand. «Hier ist meine Adresse.» Sie schrieb sie, Sorhuls Ärmel schnell zurückschiebend, hinten auf die Manschette. «Welche Gegenleistung verlangen Sie?»
Sorhuls Augen arbeiteten entzückt. «Sind Sie dessen sicher?»
«Absolut.»
«Weshalb?»
«Sie sehen viel zu gut aus, um – poire2 zu sein.»
Sorhul hatte sich längst abgewöhnt, auch auf die geschicktesten Schmeicheleien hineinzufallen. «Hier haben Sie zwanzig Lire. Das ist nicht viel, genügt aber …» Er grinste kokett, «… um sich bis morgen über Wasser zu halten. Vielleicht kann ich Sie brauchen. Nur noch eine Frage: Sie machen alles?»
«Unter Umständen, gewiss.»
Es gelang Sorhul nicht, festzustellen, an welches Metier sie bei dieser Zustimmung dachte …
Anderntags packte ihn doch wieder die Neugier: die Unbekannte von Fossati wollte ihm nicht aus dem Kopf. Er kannte das Leben und seine Überraschungen zu genau, um nicht zu wissen, dass diese Neugier unbegründet war; dass Seltenes sich nie einstellt, sondern auf einmal da ist; und dass das, was ihn bei der Signorina Francesca Palbi in der Via San Luca erwartete, entweder etwas ihm bereits Bekanntes sein würde oder bestenfalls noch unbekanntes Triviales. Aber sein Blut war auf. Mehr als je. Noch nie war er so sprungbereit gewesen, wie seitdem er mit Adrienne Rom verlassen hatte.
Nach dem Déjeuner3 verschwand er und gab beim Verlassen des Hotels einem Chasseur4 den Auftrag, Madame zu sagen, dass er in einer Stunde zurück sein werde …
Die Portiera in der Via San Luca musterte ihn, während sie ihn, scheinbar schwerhörig, den Namen der Signorina Palbi zweimal zu wiederholen zwang, außerordentlich gewissenhaft. Später fiel Sorhul ein, dass schon dieser Umstand allein ihn hätte misstrauisch machen müssen. Dann teilte ihm die Alte mit, dass diese Dame nicht mehr hier wohne, sondern in der Via Lomellini 16 parterre rechts.
«Nicht übel», dachte Sorhul im Weitergehen, «seine richtige Adresse zu erschweren.»
Angelangt, wurde er, kaum dass er die Schwelle der Wohnung überschritten hatte, hinterrücks niedergeschlagen.
Obwohl sein Kopf ganz entsetzlich schmerzte, besaß er doch die Geistesgegenwart, sich besinnungslos zu stellen und bewegungslos liegen zu bleiben.
Man warf ihn auf ein Sofa, leerte seine Taschen aus und ließ ihn dann liegen.
Nach einiger Zeit hörte er die Stimme der Signorina Palbi und die eines aller Wahrscheinlichkeit nach noch jungen Mannes. Die beiden sprachen italienisch, aber so schnell und leise, dass Sorhul, der diese Sprache ein wenig verstand, es sofort aufgab, weiter hinzuhorchen.
Nach Minuten verstörten, völlig leeren Daliegens wagte er, das rechte, der Sofawand zugekehrte Auge langsam zu öffnen und den Kopf, der sofort von Neuem heftig zu hämmern begann, sachte dem Raum zuzudrehen: er sah einen schäbig gekleideten Mann von etwa vierzig Jahren, der einen langen dicken Strick hastig zu entwirren sich abmühte, und die Signorina Palbi vor einem runden Tischchen, auf dem sie seine Papiere durchsah. Daneben lagen seine Banknoten und sein Browning.
Sofort schloss Sorhul das Auge und drückte vorsichtig seinen Unterleib in das Sofa, um etwas zu fühlen.
Und er fühlte es. Seine Hose besaß nämlich zwei hintere Taschen. In der links befand sich stets (eine alte weise Gepflogenheit) ein blind geladener Browning, in der rechts ein scharf geladener. Auf dem runden Tischchen im Zimmer aber lag sein blind geladener Browning.
Sorhul wartete noch einige Sekunden, um die Reihenfolge der zu machenden Bewegungen sich zu vergegenwärtigen. Dann sprang er blitzschnell auf, die Waffe in der Faust …
Unterwegs warf er den Revolver, den er jenem Halunken abgenommen hatte, in einen Mülleimer und trat in eine Bar, um seine Aufregung und deren galligen Geschmack hinunterzuspülen. Dabei zählte er das Geld, das er aus der Handtasche der Signorina Palbi entfernt hatte. «Vierzehnhundert Lire! Das ist zwar für einen dermaßen gut gezielten Kopfhieb nicht viel. Für meine unverzeihliche Dummheit aber eine angemessene Belohnung.»
Als er das Hotel Miramare betrat, fürchtete er miteins, seine Annahme, das holde Gaunerpaar würde sich nicht rühren, könnte doch falsch sein. Der so überdeutliche, ihm gleichwohl erst jetzt einfallende Umstand aber, dass es ihm nicht einmal bis in den Flur gefolgt war, beruhigte ihn.
Adrienne empfing ihn vergnügt und ahnungslos.
Sorhul ließ sich wortlos in ein Fauteuil fallen und schob die Haare oberhalb der rechten Schläfe zurück: eine fürchterliche blutunterlaufene Beule wurde sichtbar.
Adrienne biss die Zähne auf einander. Ihr Mund verriss sich bösartig. «Wer? … Wo?» Ihre Augen wurden ganz klein.
Sorhul heuchelte, um diese Wirkung, die er genoss, noch zu vertiefen, große Ermattung und beschloss, die spätere Erzählung seines Abenteuers durchaus zu seinen Gunsten zu gestalten; treu seiner Erfahrung, dass erzählte Schlappen lächerlich machen und nur mitangesehene manchmal einen guten Eindruck.
Mit einem Mal aber schrie er fast auf: er hatte einen großartigen Einfall …
An einem der folgenden Abende trug Adrienne, seit Wochen mit den Gewohnheiten im Palazzo Rosso des Marchese de Brignole-Sale vertraut, während die Dienerschaft aß, den van Dyck5, den sie aus dem Rahmen gebrochen hatte, hinunter in das Seitenportal in der Via Laro, wo Sorhul ihn rasch vom Holz riss, zusammenrollte und unter seinem Inverneß6 verbarg. Hierauf fuhr er ins Hotel zurück.
Adrienne versteckte sich in einer Treppennische und wartete, als sie den Marchese heimkommen sah, noch einige Minuten, bevor sie, tief verschleiert wie stets, bei ihm eintrat. Es fiel ihr nicht schwer, die aufgetragene Komödie der Erschöpfung und nervösen Erregtheit zu mimen, schließlich unter heftigem Schluchzen dem Marchese in die Arme zu sinken und scheinbar gelegenheitsweise sich nehmen zu lassen, was sie bisher konstant verweigert hatte. Die Koinzidenz dieser Hingabe mit dem Verschwinden des Bildes hielt Sorhul für das beste Mittel, dem Marchese jeden Verdacht gegen Adrienne zu nehmen.
Der Diebstahl wurde am nächsten Morgen, sehr frühzeitig, entdeckt.
Bereits gegen Mittag erfolgte die Verhaftung eines gewissen Giacomo Cazzi, dessen Reklamekärtchen, ein Passepartout für eine Opiumhöhle, auf der Treppe, wohin Sorhul es platziert hatte, gefunden worden war. Er vermochte sein Alibi nicht nachzuweisen, da er beruflich die Straßen durchstreift hatte.
Bei Sorhul und Adrienne wurde eine Haussuchung vorgenommen, die resultatlos verlief. Sorhul selbst hatte darauf bestanden, obwohl der Marchese den Verdacht der Polizei empört zurückwies; umso mehr, als er Adriennes heroischen Widerstand bewunderte und nach ihrem so plötzlichen Fall, den er für einen zwar seltsamen, aber dem launischen Leben eben eigenen Zufall hielt, verliebter war denn je. Er begriff ohne Weiteres, dass Adrienne, die ihm jetzt schwüle Liebesepisteln7 sandte, nicht mehr zu ihm zu kommen wagte, litt aber so sehr darunter, dass Sorhul nicht länger zögern zu dürfen glaubte, seinen großartigen Einfall auszuführen.
In der folgenden Nacht fuhr Adrienne, nur mit einem kleinen Handkoffer versehen, in einem geschlossenen Taxi in das Hotel Bristol, wo der Marchese sie in einem eleganten Doppelzimmer erwartete und außer sich war vor Glück.
Nach zwei Tagen war Adrienne von ihrer augenblicklichen Situation dégoutiert8 und wünschte, eine kleine möblierte Wohnung in einem Privathaus gemietet zu erhalten.
Der Marchese war sofort einverstanden, da es ihm um vieles billiger zu stehen kam, und begab sich noch am selben Tag, auf Adriennes Rat hin, in die Via San Luca, um mit der Signorina Palbi wegen eines von dieser zu vermietenden Appartements zu verhandeln.
Inzwischen hob Adrienne das ganze Guthaben (über zwanzigtausend Lire), das der Marchese ihr eröffnet hatte, unverzüglich ab und reiste nach Florenz.
Sorhul blieb noch in Genua, um die Entwicklung der Ereignisse abzuwarten und keinen Verdacht zu erregen.
Da allgemein angenommen wurde, dass der Marchese mit Adrienne die Honigwochen irgendwo am Meer verbringe, beunruhigte man sich nicht weiter über sein Verschwinden.
Daraufhin reiste Sorhul, den van Dyck in den Boden seines größten Koffers eingenäht, gleichfalls nach Florenz, wo er täglich mit großer Spannung die Zeitungen erwartete. Endlich eines Morgens sah er schon von Weitem auf dem Genueser «Secolo» eine riesige Manschette9. Er eilte zu dem Kiosk und las: «Ermordung des Marchese de Brignole-Sale. Verhaftung des Mörderpaares. Neue Spur in der Affaire des van Dyck-Diebstahls.»
Vierundzwanzig Stunden später waren Sorhul und Adrienne in Wien. Erst hier gab er ihr den «Secolo» zu lesen.
Als Adrienne ihn sinken ließ, sagte er: «Dass die Schädeldecke des Marchese dünner ist als die meine, konnte ich allerdings nicht wissen.» Hierauf begann er mit der Erzählung seines Abenteuers, das ihm die Kopfwunde eingetragen hatte. Da er es nun mit Leichtigkeit zu seinen Gunsten gestalten konnte, machte er auf Adrienne einen unauslöschlichen Eindruck, dessen stürmische Wirkung er unverzüglich genoss. Auf dem Divan.
Homingmans schönste Komposition
Homingman hatte die Bekanntschaft Fifitts auf der Enzpromenade gemacht, indem er plötzlich von hinten grußlos mit den Worten neben sie trat: «Ich würde mich freuen, wenn Sie sich langweilten.»
Fifitt hatte gelacht, und man war ins Gespräch gekommen. Und als Homingman sie nach einer Stunde vor dem Badhotel verließ, hatte sie ihm ein Wiedersehen versprochen, wenn auch nicht fixiert, und den Wunsch geäußert, in seiner Erinnerung als Fifitt zu existieren und nicht anders. Er erreichte ohne Schwierigkeiten sechzehn Spaziergänge an der Enz und vier auf dem Sommerberg und schließlich eine Autofahrt nach Baden-Baden, allwo es in dem auf einer Anhöhe gelegenen Hotel Grethel sich begab, was insoferne eines besonderen Reizes nicht entbehrte, als Homingman ein Pyjama sich ausleihen musste, das viel zu kurz, und Fifitt ein Nachthemd, das viel zu eng war.
Damit war für Homingman, der das Tempo seines Lebens zu gut kannte, um nicht davon überzeugt zu sein, dass niemals ein Wiedersehen erfolgen würde, diese Episode beendet. Er fuhr nach Kopenhagen, Fifitt nach München. Er trauerte während der Eisenbahnfahrt Fifitts schlanken Beinen nach, diese einen ganzen Tag seinen seltenen Küssen. Dann war es aus.
Als aber Homingman den zweiten Frühling, der auf diesen Sommer folgte, in San Remo verbrachte, sah er schon am dritten Tag im Speisesaal des Riviera Palace Fifitt allein an einem Tisch sitzen. Er drückte sich augenblicks. Denn seine Situation, ohnehin bereits von äußerster Kompliziertheit, hätte durch eine unbesonnene Wiederaufnahme der Beziehungen zu Fifitt eine weitere Komplikation erlitten. Er setzte sich in der Hall10 in einen versteckt stehenden Klubsessel, entzündete sich eine Kyriatzi11 und kurbelte sein Gehirn an.
Sein Leben hatte kurz nach jener schönen Nacht im Hotel Grethel eine so missliche Wendung genommen, dass die Kopenhagener Polizei sein Photo unter der Nummer 225 in ihr Album eingereiht hatte. Er maß diesem Umstand keine allzu große Wichtigkeit bei, war vielmehr so raffiniert, ihn sich zunutze zu machen. Er verschmähte es, eine gründliche Metamorphose an sich vorzunehmen, und beschränkte sich darauf, die zahllosen Herren und Damen, die im Restaurant, im Café und auf den Promenadenbänken neben ihm sich niederließen, scheinbar halb blind, schwerhörig oder sonstwie invalid waren, auch gerne an allerlei nervösen Störungen litten, in ihrem ohnedies traurigen Beruf zu unterstützen, indem er tat, als sehe er sie überhaupt nicht, und ihnen gelegentlich Lügen zu hören gab. Er wollte warten, bis eine angemessene Beute sich zeigte, und mit Hilfe derer, die dazu kommandiert waren, sie ihm zu entreißen, sie sich holen. Und er wollte so komponieren, dass seine Undurchschaubarkeit von nie noch erreichter Vollkommenheit wäre.
Nun, diese Beute war in Darmstadt im Hotel zur Traube in Gestalt einer jungen, über alle Zweifel reichen und zudem sehr schönen ungarischen Großbäckerstochter erschienen. Homingman hatte, kaum dass er sie erblickte hatte, sofort sich zurückgezogen. Das war seine Stärke. «Vermeide jedes überraschende Zusammentreffen, das stets zu Extemporalien12 zwingt, sondern komponiere deine Absichten!» Also war in seinem kleinen Notizbuch zu lesen, in dem er alsbald auf sein wichtigstes Axiom stieß: «Von zwei Objekten wähle nicht das größere, sondern das glattere!» Da er, der seiner schönen Ungarin nach San Remo nachgereist war, für einen der folgenden Abende ein zweckentsprechendes Rendez-vous im Westend Hotel präpariert hatte, wog er die beiden Objekte. Leider ohne Erfolg, weil Fifitts Gewichtsverhältnisse ihm fehlten. Nach einer zweitägigen Enquête13 jedoch kannte er diese. Die neuerliche Gewichtsprüfung fiel zugunsten Fifitts aus, die Alexandra von und zu Stettenhausen hieß und die einzige Tochter ihrer verwitweten und anhanglosen Mutter war. Dass die schöne Ungarin größere Reichtümer besaß, wurde durch die rekommandablere14 Glätte der Sache Fifitt aufgewogen. Und nun machte Homingman sich ans Komponieren. Der Umstand, dass die Polizei das Hotel innen und außen belagert hielt, musste als zentraler Punkt angesehen werden. In Fällen, die infolge der Umsicht des gejagten Wilds die übliche sporadische Überwachung als unsicher befürchten lassen, wählt nämlich die Polizei die lückenlose Umklammerung. Ihr Kalkül, wer den einzelnen Häscher rasch herausschnüffelte, wäre am ehesten zur Annahme geneigt, es seien gar keine da, wenn er nur Häscher sähe, war im Falle Homingman freilich deplatziert. Denn dieser hatte in seiner jeweiligen Umgebung nie noch etwas anderes gesehen als Feinde und stets lediglich sich bemüht, Objekte zu suchen.
Noch am selben Abend lächelte er, seine Komposition vollendet im Kopf, die in der Hall rings um ihn eifrig konversierende Umklammerungs-Staffel freundlich an und sagte sich: «Ein Gefängnis ist das Leben ohnedies. Aus diesen lebenden Mauern aber werde ich mit dem Finger ausbrechen.» Und alsbald winkte er mit dem Zeigefinger. Die Konversationen versiegten augenblicks. Wohl ein halbes Schock15 lauernder Augen teilte sich in zwei Teile: die einen flogen in die Richtung, in der Homingmans Finger gewinkt hatte, die anderen hafteten auf ihm selber, der liebenswürdig grinste. Er hatte gleichsam rhetorisch gewinkt und bloß das Vergnügen der realisierten Metapher sich geleistet. Hierauf ging er siegesgewiss in den Speisesaal und auf den Tisch Fifitts zu. Um ihr den Übergang zu erleichtern, setzte er sich sofort neben sie und erzählte ihr, allerdings auch in Hinsicht auf das plötzlich hinter ihm sitzende Lauscherpärchen, die Erlebnisse seiner ersten Autofahrt nach St. Raphael, die niemals stattgefunden hatte. Dann flüsterte er schnell, dass er am nächsten Vormittag von zehn bis zwölf in den Giardini Marsaglia promenieren werde, und verabschiedete sich überkorrekt von der weidlich Konsternierten. Und eine Viertelstunde später erschien er in der Hall des Westend Hotel, wo an diesem Abend ein kleiner Ball stattfand, zu dessen Teilnehmern Vilma Kököllö zählte. Er trat diskret neben sie und sagte leise vor ihrem Ohr: «Sie haben auf der rechten Schulter einen Schmutzfleck. Gestatten Sie, dass ich Sie hinausführe.» Dabei hielt er ihr den Arm hin, den sie verdutzt ergriff. Im Korridor bearbeitete er mit seinem Taschentuch dezent ihren Rücken. Dieser Tätigkeit sah eine alte Dame zu, deren Indignation16 er auf den ersten Blick als adjustiert17 erkannte. Weshalb er, während er Vilma so nahe an ihr vorbeiführte, dass sie sie streifte, mit den Worten grüßte: «Buona sera,18 Madame Reichsgräfin.»
Vilma, die aus dem Erstaunen gar nicht herauskam, stotterte: «Aber was … Reichsgräfin …? Und Sie sagen ‹buona sera›?»
«Wenn ich jemandem zu verstehen geben will, dass ich ihn kenne, aber keine Ahnung habe, wer er ist, grüße ich in mehreren Sprachen. Dann besteht die Hoffnung, dass er mir in seiner Muttersprache antwortet, oder die Chance, dass er verschwindet.»
Vilma lachte aus vollem Hals: Homingman hatte die erste Attacke gewonnen. Und gewann im Verlaufe des Abends fast eine Schlacht. Er rollte den ganzen linken Flügel Vilmas auf. Und zwar mit Hilfe eines halben Dutzend neuerdings hinzugekommener Ballgäste, die alle das Riviera Palace verlassen hatten, wie um eigens ihm als Komparsen zu dienen. Tags darauf sprach ganz San Remo über diesen unerhörten Vorfall.
Und vormittags elf Uhr zwölf Homingman darüber mit Fifitt, die ihn, an seine Eskapaden von Baden-Baden sich erinnernd, sofort in Verdacht gehabt hatte, als sie beim Frühstück vom Nebentisch her die erste Version vernahm. «Das sieht Ihnen ähnlich. Schweigen Sie! Es ist ganz aussichtslos für Sie, zu leugnen. Aber sagen Sie mir, ob es wirklich so war.»
«Ja, wie soll es denn eigentlich gewesen sein?», fragte Homingman erheitert, aber wohlüberlegterweise leise resigniert.
«Sie ist also ohnmächtig geworden?»
«Dazu hat man sie gezwungen!»
«Sie wollten wohl sagen, dass Sie sie dazu gezwungen haben.»
«Keineswegs. Sondern die Umstehenden.»
«Jawohl, weil sie gesehen haben, wie Sie Ihre Hand missbrauchen wollten.»
«Eine Interpretation, die falsch ist.» Homingman rollte langsam die Schultern. «Vielleicht habe ich jene Geste nach dem Unterrock Fräulein Kököllös lediglich gemacht, um die Umstehenden zu Interpretationen zu veranlassen.»
«Sie schwindeln.»
Homingman, der aufrichtig gewesen war, gähnte. «Daran zweifelt meist niemand, wenn ich es nicht tue. Nur wenn ich lüge, glaubt man mir manchmal.»
«Ganz wie in Wildbad.» Fifitt zeigte lächelnd ihre schönen Zähne. «Aber Spaß beiseite, ich finde es sehr chic von den jungen Leuten, die es sahen, dass sie sich auf Fräulein Kököllö stürzten und sie gleichsam zur Ohnmacht zwangen.»
Homingman lachte brutal. «Aber sie haben ihr doch die Röcke links hochgeschoben und Strumpf und Unterhöschen untersucht, als hätte ich da eine Giftschlange oder Bazillenkultur angelegt.»
«Deshalb möchte ich ja von Ihnen wissen, wie es eigentlich war. Denn grundlos machen wohlerzogene junge Leute doch so etwas nicht. Das wäre ein zu geschmackloser Scherz.»
«Die jungen Leute waren eben nicht wohlerzogen, sondern ganz einfach unverschämt. Das hatte ich ja auch erwartet.»
«So, das hatten Sie erwartet!» Fifitt schritt schneller aus, schlug aber den Weg in die Berge ein statt den nach dem Corso. «Sie erwarten das wohl von allen wohlerzogenen jungen Leuten?»
Homingman, der sich verplappert hatte, lenkte ein: «Sie unterstellen meinen Worten eine ungerechte Verallgemeinerung. Und im Übrigen ist mir dieses Seide gewordene ungarische Beugel19 schon zum Hals heraus. Wenn ich nicht wohlerzogen wäre, würde ich nach diesem Vorfall mich überhaupt nicht mehr um sie kümmern.»
Das beruhigte Fifitt, die zwar nicht eifersüchtig war, aber nicht wünschte, dass die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen zu ihm durch Nebenbeschäftigungen verzögert oder geschmälert würde. Denn sie war ein in jeder Hinsicht emanzipiertes Persönchen, das, weit davon entfernt, in ihn verliebt zu sein, ihn bloß als Amüsement schätzte; tags die Konversation, nachts die Position.
Während sie, in Schwarzwald-Erinnerungen schwelgend, den letzten Villen sich näherten, folgte ihnen in dem üblichen Abstand ein ältliches Ehepaar. Deshalb schrieb Homingman in einem Augenblick, da Fifitt ihre Haare ordnete, auf eine Streichholzschachtel: «Ce soir à dix heures»20 und ließ sie zu Boden fallen, was das weibliche Auge in seinem Rücken veranlasste, an dieser Stelle zurückzubleiben, um die Person, welche die Streichholzschachtel suchen würde, zu agnoszieren21. Und nach zehn Minuten riss er unversehens einen Zweig ab, knickte ihn und hängte ihn über einen Ast. Das ihm folgende männliche Auge hielt es jedoch für ratsamer, auf seinen Fersen zu bleiben. Aber Homingman war um ein anderes Manöver nicht verlegen: er zog, als sie in einen Fichtenwald kamen, Fifitt hinter zwei dicke Bäume, wechselte noch dreimal das Versteck und wartete schließlich hinter einem Sandhaufen, bis sein Verfolger sich verloren hatte. Fifitt, die über sein Verhalten sich wunderte, erklärte er, das faschistische Italien verfolge mit Vorliebe die illegitimen Zärtlichkeiten fremdländischer Nichtstuer. Fifitt war es zufrieden; auch, dass er sie auf vielerlei Fußsteigen zu dem gleichfalls auf einer Anhöhe gelegenen Hotel Bellavista führte, wo er ihr zu déjeunieren22 vorschlug.
Als sie daselbst gegen zwei Uhr die Toilette zu benützen wünschte, wies er ihr den Weg. Er öffnete sogar selbst die Tür, in die er Fifitt jedoch schnell hineinstieß. Denn es war gar nicht die Toilette, sondern das von ihm beim Portier meuchlings gemietete Zimmer, in dem es bald stürmisch zuging.
Um sechs Uhr nachmittags stiegen sie nach San Remo hinunter, trennten sich aber, als sie in die Villenzone kamen, und dinierten im Riviera Palace, durch zwei Tische von einander geschieden. Homingman vermied es vereinbarungsgemäß, mit Fifitt zu sprechen, und begab sich gegen zehn Uhr ins Westend Hotel, wo auch an diesem Abend ein Ball stattfand. Wider Erwarten, wenn auch nicht wider das seine, erschien Vilma ebenfalls auf diesem Ball. Sie beging wie so viele den Fehler, zu glauben, das Peinliche eines Vorfalls würde am besten aus der Welt geschafft, wenn man so tue, als wäre gar nichts Peinliches vorgefallen. Und dieses Getue ist gerade für alle Welt das Peinliche. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass Vilma, die Homingman nicht zu begegnen erwartet hatte, einen zweiten Fehler beging: sie eilte sofort auf ihn zu, obwohl der unerhörte Vorfall vom Abend vorher durchaus noch keine befriedigende Erklärung gefunden hatte. Auch nicht für Vilma, die der brennende Wunsch, sie zu erhalten, zu Homingman getrieben hatte. Kaum dass sie mit ihm ein wenig abseits geraten war, stöhnte sie denn auch schon: «Also jetzt werden Sie mir unverblümt sagen, was gestern abends …» Ihre Augen sprühten böse. «Ich begreife absolut noch nichts.»
Homingman holte sich eine Haarsträhne, als versuche er, nachzudenken. «Wenn ich aufrichtig sein soll …»
«Sie müssen!» Vilma stieß ihm den Fächer auf die Brust.
Homingman nahm vorsichtig sein Kinn in die Hand. «Ja also … Es war in der Hauptsache …» In diesem Augenblick gewahrte er schräg hinter sich das unvermeidliche Ohr der Polizei und sich gegenüber Fifitt, die soeben zur Tür hereinkam. Sein Gehirn hüpfte. Und komponierte ihm das reizvollste Detail. Er neigte sich, wie um leiser zu sprechen, Vilma zu und sagte, in Wirklichkeit aber lauter als vordem: «Dr. Mesch hat das Schächtelchen gefunden. Auch der geknickte Zweig hat seine Schuldigkeit getan, wie ich sehe.»
«Aber … Ich verstehe kein Wort …» Vilmas Stirn wich weit zurück.
Homingman schob sie rasch vor sich her, um aus dem Bereich der Polizeiohren zu kommen, und explizierte: «Herr Dr. Mesch aus dem Hotel Royal hatte beim Tee im Westend ein Schächtelchen mit Perlen verloren. Während des Balls bildete ich mir ein, es unter Ihren Füßen zu sehen. Meine impulsive Geste hat dieses alberne Rudel von Keuschheitsknaben für einen Angriff auf Ihre Tugend gehalten.»
«Diese Knaben haben mich doch aber visitiert23!»
Homingman mimte den Erstaunten. «Was? Ja, das wusste ich doch gar nicht. Ah, da haben sie Sie wohl für die Diebin gehalten. Eine Unverschämtheit! Aber seien Sie außer Sorge! Dr. Mesch hat das Schächtelchen heute unversehrt wiedergefunden.»
Vilma machte immer ratlosere Augen. «Haben Sie nicht noch von einem geknickten Zweig gesprochen?»
Homingman visperte: «Moment! Pardon!», eilte spornstreichs durch die Tür, öffnete in dem menschenleeren Korridor ein Fenster, stieß einen ohrenzerreißenden Fingerpfiff aus und sprang in den Hof hinunter. Hierauf lief er durch den hinteren Eingang ins Hotel zurück, wo er in der Hall vom Portier gemächlich seinen Mantel verlangte. In dem Hotelauto, das ohnedies zum Bahnhof fahren wollte, ließ er sich zum Riviera Palace bringen, nahm langsam seinen Zimmerschlüssel und stieg noch langsamer die Treppe empor, um es so arrangieren zu können, dass er ungesehen statt in die zweite Etage in die dritte einbiegen und mit dem Schlüssel, den Fifitt ihm gegeben hatte, in deren Zimmer verschwinden konnte. Sein Fingerpfiff war für diese das verabredete Zeichen gewesen, nach zehn Minuten in ihr Hotel zu fahren.
Für die Polizei aber ein Zwischenfall, der sie die ganze Nacht auf den Beinen hielt. Denn sie glaubte an einen abenteuerlichen Coup Homingmans und hielt den Pfiff für das Signal für seine Komplizen. Die Umgebung des Westend Hotel wurde gründlich abgesucht, drei Streifen in die nahen Wälder geschickt und unausgesetzt gefragt und geforscht. Aber erst gegen acht Uhr morgens fand sich eine Spur. Der Portier, der abgelöst worden war, nachdem er Homingman den Mantel ausgehändigt hatte, kam in die Hall, um seinen Dienst anzutreten. Von den Beamten bestürmt, sagte er, was er wusste. Da fuhr das Hotelauto vor, dessen Chauffeur die Mitteilung des Portiers bestätigte und unverzüglich mit dem leitenden Kommissär und drei Beamten ins Riviera Palace rasen musste. Nachdem Homingmans Zimmer vergeblich durchwühlt worden war, fuhr der Kommissär fauchend ins Westend Hotel zurück, wo er die schöne Ungarin sofort einem zweiten Kreuzverhör unterzog. Das erste hatte bis drei Uhr morgens gedauert, weil sie sehr verdächtigerweise von einem gewissen Dr. Mesch gesprochen hatte, der von niemandem in San Remo gesehen worden war, von einem Schächtelchen Perlen, das er verloren haben sollte, und von einem geknickten Zweig, von dem sie selber nichts begriff. Da sie auch diesmal wieder auf diese seltsamen Details zurückkam, wurde sie unter scharfer Eskorte samt ihrer weinenden Mutter ins Riviera Palace gebracht, was während der Nacht verweigert worden war, und in ihrem Zimmer streng bewacht.
Um neun Uhr klingelte Homingman, ohne dass Fifitt es sah, dem Zimmermädchen, mit dem er zweimal geschlafen hatte. Als er sicher war, ihr zu begegnen, trat er auf den Korridor, lief ihr just vor der Tür in die Arme und eilte, äußerste Verlegenheit heuchelnd, in die Toilette, kurz darauf Fifitt hinunter zum Frühstück.
Nach einer Viertelstunde kam Homingman und setzte sich, ihren leisen Protest ignorierend, ihr gegenüber. Als der Kellner ihn sah, schrie er fast auf. In wenigen Sekunden war der Frühstückssalon voll von Gästen und Personal. Endlich kam auch die Polizei.
Homingman, deren Zustand wohl kennend, fragte immer wieder, warum man ihn denn gesucht und wer gepfiffen habe; er wäre, als er den Pfiff gehört hätte, in der Toilette gewesen und nachher mit dem Hotelauto …
«Aber Sie haben die Nacht nicht in Ihrem Zimmer zugebracht», krähte der Kommissär.
Homingman streckte sich arrogant. «Ich schlafe, wo es mir passt.»
«Sie sind verpflichtet, auszusagen.» Der Kommissär krächzte nur so, wurde aber verlegen, weil er wusste, dass er unrecht hatte.
«Ist ein nächtlicher Fingerpfiff, dessen Grund Sie weder kennen noch dessen Folgen, eine hinreichende Basis für solche Inkommodierungen24?» Homingman wandte ihm den Rücken.
Da aber kam dem Kommissär unverhoffte, für Homingman freilich die erhoffte Hilfe. Das Zimmermädchen der dritten Etage trat vor und rächte sich: «Aber Herr Homingman hat doch im Hotel geschlafen. Ich habe ihn selber aus Nummer 53 herauskommen sehen.»
«Wer wohnt auf Nummer 53?», fragte der Kommissär scharf.
Alle wussten es und wandten sich ab. Und da Fifitt blutrot wurde, wusste es auch der Kommissär. Wütend zog er mit seinen Edilen25 ab.
Nach vier Wochen heiratete in Mainz Fräulein Alexandra von und zu Stettenhausen sehr wider ihren Willen, aber notgedrungenerweise Herrn Robert Homingman, der mit dieser seiner schönsten Komposition Vollkommenstes vollbracht hatte. Seine Schwiegermutter rang die Hände und war entschlossen, nach einem halben Jahr die Scheidung zu erzwingen. Es kam aber nicht dazu, da Fifitt nach einigen verzweifelten Ehebrüchen, die übrigens Homingmans Meisterhand von hinten nieder zu dirigieren gewusst hatte, es aufgab, einen ebenbürtigen Positionsersatz zu finden.
Vilma Kököllö aber laboriert immer noch an einer schweren Psychose, in der Perlen und geknickte Zweige eine große Rolle spielen. Sogar Professor Alfred Adler26 vermochte mit diesem Fall nichts anzufangen und glaubt noch heute an Schizophrenie.
Ein bedeutender Schlepper
Dungyerszki, der ein sehr bewegliches Gehirn besaß, bemerkte eines Abends, als er wieder definierte, dass ein Zuhälter einem Reichsgrafen durchaus vorzuziehen sei, da jener als Mitgiftjäger in Raten vor dem in Ehren, nämlich dem Reichsgrafen, nicht nur voraushabe, dass Madame auch etwas davon habe, sondern überdies das Risiko, nämlich den Mut. Dungyerszki liebte es seit mehreren Wochen, zu definieren, weil es ihn sehr unternehmungslustig machte und sich selber interessanter.
An diesem Abend beschloss er denn endlich, nicht mehr zu hungern, vielmehr mit sich hervorzutreten und seine interessante Person zu fruktifizieren27.
Er begab sich dieserhalb in die Kaufinger Straße und trat neben eine sehr farbig gekleidete und mit zweifelhaften Bijous28 fast verhängte junge Dame mit der höflichen Frage: «Was verstehen Sie unter ‹Laster›, meine Gnädige?»
«Wie, mein Herr?»
«Ich möchte mir die Frage gestatten, was Sie unter ‹Laster› verstehen.»
«Gengern S’ weg. Frozzeln29 S’ an andere als mi.»
«Weit gefehlt, meine Gnädige. Und damit Sie davon überzeugt sein können, hier meine Antwort: Laster ist eine Beschäftigung, welche es der Tugend ermöglicht, vorhanden zu sein.»
«Sö san einer. Gehn S’, sagn S’ dös no amal.»
«Gerne.» Dungyerszki repetierte langsamer und tonvoller.
«Jessas, san Sö einer. Aber wo er recht hat, hat er recht.» Die junge Dame lächelte animiert.
«Nun wird es Ihnen aber sicherlich nicht schwerfallen, meine Gnädige, mir zu sagen, was Sie unter ‹Tugend› verstehen.»
«Na, sagn S’ es nur glei, dass Sie’s los wern.»
«Sie sind Psychologin. Nun denn …»
«Was bin i? Sö, gebn S’ acht, was sagn.»
«Konträr, es war ein Lob. Nun denn: Tugend ist die Abwesenheit jeder Möglichkeit, sich dem Laster zu widmen.»
«Härn S’, Sö gfalln mer. Was ham S’ denn für an Beruf?»
«Den, keinen zu haben. Denn ein Beruf ist der gelungene Nachweis des Mangels jeder besseren schlechten Eigenschaft.»
Die junge Dame lachte lieblich auf, sah schnell auf ihre Armbanduhr und holte sich hierauf, kurz entschlossen, Dungyerszkis Unterarm: «Kommen S’, ’s is erscht sechse. Trinken S’ a Halbe mit mir.»
Dungyerszki tat es, ließ sich «Zki» nennen, versprach erfreut, am nächsten Vormittag in der Kudlacher Straße 16 vorzusprechen und etwas für seine Garderobe zu tun. Hierauf wünschte er zwecks Veranstaltung einer Mahlzeit zwei Mark, erhielt sie mit einer geradezu großartig generösen Geste und verließ Fräulein Milli gehobenen Gemütes.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2015 by Manesse Verlag, Zürich
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-17223-7
www.manesse.ch