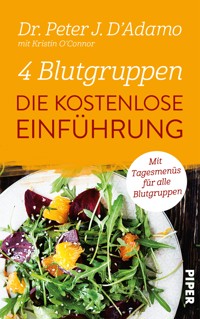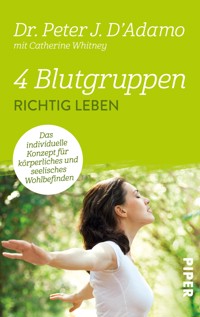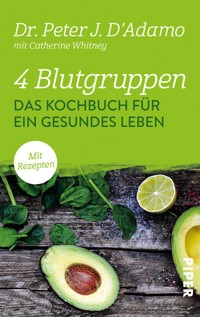
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wenn Sie die Ratschläge von Dr. D'Adamo zu seinem revolutionären Blutgruppenkonzept stärker in Ihren Alltag einbeziehen wollen, wenn Sie etwas für Ihre Gesundheit und Ihr körperliches Wohlbefinden tun wollen, dann sollten Sie dieses Kochbuch lesen. Es enthält nicht nur zahlreiche schmackhafte Rezepte, die mit namhaften Küchenchefs entwickelt wurden, und eine kurze Einführung in die Blutgruppendiät, sondern auch für jede der vier Blutgruppen einen ausführlichen Speiseplan über einen ganzen Monat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
In Liebe für Christl und Dad
Einige Rezepte aus diesem Buch wurden bereits in »4 Blutgruppen. 4 Strategien für ein gesundes Leben« abgedruckt. Es handelt sich dabei um Rezepte, die für alle vier Blutgruppen geeignet sind. Mit wenigen Ausnahmen wurden diese hier nicht nochmals abgedruckt. Die deutsche Ausgabe wurde gegenüber dem amerikanischem Original leicht gekürzt.
Aus dem Amerikanischen von Erica Mertens-Feldbausch
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2015
ISBN 978–3-492–95753-3
© 1998 Hoop-A-Joop, LLC
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Cook Right For Your Type – The Practical Kitchen Companion to ›Eat Right For Your Type‹«, G. P. Putnam’s Sons, New York 1998
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München, 2000
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Shutterstock.com/zoryanchik
Redaktion: Linda Strehl
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Danksagungen
Es ist mir eine große Freude, den Leserinnen und Lesern meines Buches 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben nun dieses Begleitkochbuch vorzustellen – ein hilfreicher Ratgeber für die praktische Einbeziehung der Blutgruppendiät in den Küchenalltag. Der vorliegende Band ist das Resultat gemeinsamer Anstrengungen vieler Menschen, denen ich zu Dank verpflichtet bin. Zu ihnen zählen:
Die Mitarbeiter des Verlages Putnam für ihre Unterstützung meiner Arbeit; allen voran meine Lektorin Amy Hertz (B-Typ), deren persönliches und berufliches Engagement der Blutgruppendiät zu einem durchschlagenden Erfolg verhalf; und meine Agentin Janis Vallely (0-Typ), dank deren Ermunterung und Beratung dieses Projekt verwirklicht werden konnte.
Mein besonderer Dank gilt all jenen, die an der Entstehung von 4 Blutgruppen – Das Kochbuch für ein gesundes Leben engagiert mitgewirkt haben:
Catherine Whitney (0-Typ), meine Mitautorin, und ihr Team Martha Mosko D’Adamo (0-Typ) und Paul Krafin (A-Typ), sorgten für den systematischen Aufbau des Textes und brachten ihn in Form. Aus dieser Verschmelzung von fundiertem Text, sorgsamer Recherche und Aufmerksamkeit für das Detail erwuchs ein zuverlässiger Ratgeber.
Mit Sachverstand und Phantasie kreierten unsere beiden Ernährungsexpertinnen Martine Lloyd Warner (0-Typ) und Gabrielle Lloyd Sindorf (0-Typ) die schmackhaften Rezepte in diesem Buch.
Jane Dystel (B-Typ), Catherines Agentin, stand jederzeit mit nützlichen Ratschlägen zur Seite, und Sally Cardy Mosko (A-Typ) sorgte für die übersichtlichen Tabellen.
Cheryl Miller (0-Typ) unterstützte mich durch hilfreiche Ideen und Rezeptvorschläge, und Janet Schuler (0-Typ) durch ihre Arbeit als Sekretärin.
Zu danken habe ich auch meinem Assistenten Scott Carlson (A-Typ) für den reibungslosen Ablauf aller Büroarbeiten, der tüchtigen Krankenschwester Carolyn Knight (A-Typ) und meinen zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wendy Carlson (A-Typ), Melissa Danelowski (0-Typ) und Richard Tuzzio (0-Typ).
Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich den Experten, die mir bei diesem Projekt ihre Unterstützung zuteil werden ließen, allen voran Michael Finney (A-Typ), Jay Fiano (B-Typ), Dr. Michael Schacter (0-Typ), Dr. Ronald Hoffman (0-Typ), Dr. Joseph Pizzorno (A-Typ), Dr. Thomas Kruzel (B-Typ), Dr. William Mitchell (0-Typ) und Dr. Jeffrey Bland (0-Typ) sowie Paul Schulick (B-Typ) und Thomas Newmark (A-Typ). Als besonderes Privileg empfand ich die enge Zusammenarbeit mit Dr. Gregory Kelly (A-Typ), einem hochbegabten Kliniker, dessen Integrität, Professionalität und Fähigkeiten als Redakteur entscheidend zur Glaubwürdigkeit dieses Buches beitrugen.
Überdies danke ich den Zehntausenden von Leserinnen und Lesern, durch die die Blutgruppendiät weithin bekannt wurde. Ihre Berichte über Erfolge und Schwierigkeiten und zahllose hilfreiche Vorschläge brachten die Wissenschaft einen Schritt weiter. Durch die Fülle von Zuschriften und Anregungen via Post und Internet fühle ich mich Tag für Tag aufs neue ermutigt.
Nicht zuletzt habe ich das Glück, auf den Beistand und die Ermunterung durch meine Familie bauen zu können: Christl (B-Typ) und Dad (A-Typ); mein Bruder James D’Adamo (A-Typ), dessen Verlobte Ann (A-Typ) und meine Schwester Michele (AB-Typ). Meine besondere Anerkennung gilt meiner Schwiegermutter Mary Mosko (0-Typ) für ihr unerschütterliches Vertrauen und ihren Mut. Und schließlich fühle ich mich tagtäglich inspiriert durch die Lebendigkeit meiner kleinen Töchter Claudia (A-Typ) und Emily (A-Typ) und die hingebungsvolle Liebe meiner Frau Martha (0-Typ).
Ein wichtiger Hinweis:
Halten Sie sich bei den in diesem Buch enthaltenen Rezepten in puncto Blutgruppen genau an die Angaben. Ab und zu werden Sie in einem Rezept eine Zutat finden, die Sie entsprechend unseren Empfehlungen eigentlich vermeiden sollten. Meist handelt es sich dabei um sehr kleine Mengen (z. B. eines Gewürzes), die Sie, wenn Sie gesund sind und sich streng an die Ernährungsempfehlungen halten, vertragen werden.
Nachdem Sie sich mit diesen Empfehlungen vertraut gemacht haben, können Sie selber Menüs zusammenstellen und Ihre Lieblingsrezepte so abwandeln, daß sie für die jeweilige Blutgruppe gut verträglich sind.
Autor und Verlag übernehmen keinerlei Verantwortung, was den individuellen Gesundheitszustand von Leserinnen und Lesern oder allergische Erscheinungen angeht, die ärztlicher Überwachung bedürfen.
Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und überprüft. Vorschläge und Anregungen stellen aber – soweit es die Verantwortlichkeit von Autor oder Verlag betrifft – keinen Ersatz für fachlichen Rat oder sachkundige Hilfestellung dar und entbinden Leserinnen und Leser nicht von ihrer Pflicht, im Hinblick auf ihre individuelle Gesundheit in eigener Verantwortung den Arzt aufzusuchen.
Autor und Verlag sind weder haftbar noch verantwortlich für irgendwelche Nachteile oder Schäden, die angeblich aus einer in diesem Buch enthaltenen Information oder einem darin gemachten Vorschlag erwachsen. Die gilt uneingeschränkt auch für jedwede nachteilige oder negative Reaktion auf eines der angeführten Rezepte.
Teil I
Der Weg zur gesunden Ernährung
1 Die Blutgruppendiät
Individuell und typgerecht
In den zwei Jahren seit Erscheinen von 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben bin ich mit unzähligen Menschen ins Gespräch gekommen – im Rahmen von Fernsehauftritten und Vorträgen, via Internet, Telefon und Briefwechsel sowie in meiner Praxis. Viele waren neugierig, manche eher skeptisch, und einige von ihnen sind vom Nutzen der Blutgruppendiät mittlerweile überzeugt. Auf meiner Homepage berichten Menschen – teilweise in bewegenden Einzelheiten – von ihren Bemühungen, einer chronischen Krankheit auf die Spur zu kommen oder ihrer Fettleibigkeit Herr zu werden. Ihre Geschichten weisen vielerlei gemeinsame Elemente auf, sind aber im Kern einzigartig und individuell – wie die Menschen selbst auch. Und dank dieser Geschichten bin ich mir der breitgefächerten Verschiedenartigkeit der Menschen noch stärker bewußt als je zuvor.
Bringt die Blutgruppendiät wirklich etwas? Nach der Auswertung von Tausenden ärztlich attestierten Resultaten bei Leserinnen, Lesern und Patienten weiß ich nun folgendes: Die Blutgruppendiät nützt neun von zehn Menschen, und je gravierender das Problem, desto rascher zeigt sich ihr günstiger Effekt. Doch die eigentliche Frage, die sich jeder Mensch stellen muß, heißt: »Nützt diese Diät mir persönlich etwas?« Wichtiger als eine Theorie, die sich ganz allgemein für jeden als vorteilhaft erweist, ist eine Methode, die der Verschiedenartigkeit der Menschen Rechnung trägt.
Blutgruppendiät ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Genaugenommen wird die Individualität zur mächtigen Verbündeten und erlaubt damit ein tieferes Verständnis für das Warum und Weshalb eines bestimmten Krankheits- beziehungsweise Gesundheitszustandes. Ignoriert man individuelle Abweichungen oder spielt man sie herunter, werden sie zu Stolpersteinen, die fundiertem, medizinischem Wissen im Wege liegen. Hören oder lesen Sie also etwas über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, sollten Sie sich immer fragen: »Ist hier die Rede von mir?«
Wie läßt sich nun herausfinden, ob die Blutgruppendiät Ihnen von Nutzen ist oder nicht? Zunächst einmal müssen Sie bereit sein, Ihre festen Vorstellungen von Ernährung zu ändern. Wir sind alle darauf »geeicht«, Nahrung und Medizin als zwei voneinander getrennte Elemente zu betrachten, und werden kaum jemals dazu angeregt, darüber nachzudenken, in welch vielfältiger Art und Weise sich die von uns aufgenommene Nahrung auf jede einzelne Körperzelle auswirkt. Und deshalb empfindet man es vielleicht als lästig, sich mit neuen Vorstellungen und Ideen auseinanderzusetzen, wie sie in der Blutgruppendiät vorgestellt werden. Hält man sich jedoch vor Augen, daß der größte Teil der heutigen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Jahrhundert gewonnen wurde, ist leicht vorstellbar, daß wir gerade erst anfangen zu begreifen, welche Auswirkungen Nahrungsmittel auf unsere Organsysteme zeitigen.
4 Blutgruppen – Das Kochbuch für ein gesundes Leben entstand als Antwort auf den Ruf nach praktischen Möglichkeiten, die Blutgruppendiät in das Alltagsleben einzubeziehen. Betrachten Sie dieses Buch als Hilfestellung für die Umsetzung der Empfehlungen in die Praxis, damit Sie alle Vorteile einer Ihrer Gesundheit bekömmlichen Ernährung voll ausschöpfen können.
Die Blutgruppendiät ist nicht mit kategorischen Ge- und Verboten gekoppelt und kennt keinerlei strikte Regeln und Vorschriften. Ebenso wenig bedeutet sie eine künstlich herbeigeführte Werteverschiebung in Ihrer bisherigen Lebensweise. Typgerechte Ernährung bedeutet nichts anderes, als sich dem uralten Code entsprechend zu ernähren, der noch heute in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers schlummert. Betrachten Sie diese Form der Ernährung einfach als eine der vielen Spielarten menschlicher Individualität.
2 Der genetische Fingerabdruck
Die Bedeutung der Blutgruppe
Die Erforschung der Blutgruppen führt bis zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte zurück. Es war die Erforschung individueller Merkmale, die die Erkenntnis brachte, daß jeder einzelne Mensch in den Zellen seines Körpers einen genetischen Fingerabdruck trägt.
Ehe Sie damit beginnen, sich das Kochbuch zunutze zu machen, sollten Sie unbedingt wissen, weshalb Ihre Blutgruppe einen so nachhaltigen Einfluß auf Ihre Ernährung und damit auf Ihre Lebensqualität ausüben kann. Keineswegs ein neutraler Faktor, fungiert die Blutgruppe vielmehr als Regelventil in Ihrem Immun- und Verdauungssystem – als eine Art biologischer Wachhund, der Ihren Organismus in seiner Fähigkeit unterstützt, sich am Leben und gesund zu erhalten.
In meinem ersten Buch 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben findet sich eine ausführliche Erläuterung des Wirkmechanismus, über den Ihre Blutgruppe auf die zugeführte Nahrung reagiert – entweder zum Wohle oder zum Schaden Ihres Organismus. Überdies enthält es eine detaillierte Beschreibung der anthropologischen Gegebenheiten, aus denen sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die vier unterschiedlichen Blutgruppen entwickelten. Zum besseren Verständnis dieses Kochbuches empfehle ich Ihnen deshalb unbedingt die Lektüre von 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben. Im folgenden gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung der in diesem Buch enthaltenen Informationen.
Der Schlüssel zum Überleben
Fast alle Menschen, einschließlich Ärzte, betrachten die Bedeutung der Blutgruppe nur im Zusammenhang mit Bluttransfusionen. Wie begrenzt diese Sicht der Dinge ist, wird deutlich, wenn man an die Schlüsselrolle denkt, die die Blutgruppe für das Überleben der Menschheit spielte. Halten Sie sich eines vor Augen: Ohne die einzigartigen Anpassungsprozesse des Blutes wäre die menschliche Rasse nicht imstande gewesen zu überleben.
Alle vier Blutgruppen entstanden als Reaktion auf die physiologische Entwicklung der Spezies Mensch und die Veränderungen der klimatischen Gegebenheiten und Lebensbedingungen, die sich seit Erscheinen des Menschen auf diesem Planeten über Äonen hinweg vollzogen. Und damit erklärt sich die lebenswichtige Bedeutung der Blutgruppe. Die im Laufe der Evolution stattgefundenen Anpassungsprozesse stärkten nicht nur unsere Immunabwehr gegen neuartige Bakterien, Viren und umweltbedingte Angreifer, sondern ermöglichten es auch unserem empfindlichen Verdauungssystem, sich auf eine Vielfalt ungewohnter Nahrungsmittel einzustellen.
Der 0-Typ
Die erste bekannte Blutgruppe – der 0-Typ – geht bis auf unsere Cro-Magnon-Vorfahren zurück und ist noch heute weltweit am weitesten verbreitet. Charakteristisch für den als »Jäger« bezeichneten 0-Typ ist sein kräftiges, widerstandsfähiges Immunsystem und sein robuster Verdauungsapparat. Hauptnahrungsmittel der Urmenschen war Fleisch, und dank der Leistungsfähigkeit ihres Immun- und Verdauungssystems konnten sie damit überleben. Der 0-Typ besitzt einen ungewöhnlich hohen Gehalt an Magensäure und ist deshalb imstande, dem Fleisch die meisten Nährstoffe zu entziehen und eine derart proteinreiche Kost wirksam zu verwerten.
Gewissermaßen waren die frühen Vertreter des 0-Typs die ersten Menschen, die beim Essen immer auf den Beinen waren. Auf der Jagd folgten sie ihrer Beute, töteten sie, verzehrten das Fleisch und zogen weiter. Im Laufe der Zeit aber begannen die riesigen Herden jagdbaren Wildes sich zu lichten. Mit der Weiterentwicklung der menschlichen Rasse zwang der Drang zu überleben viele Menschen dazu, sich die Fähigkeit anzueignen, Nahrungsmittel selbst zu erzeugen und zum Schutz vor Hungersnöten Vorräte anzulegen. Dieses neue System setzte voraus, daß sich Menschen in einem geographisch günstigen Landstrich niederließen und zu ortsfesten Gemeinschaften zusammenschlossen, die den Kreislauf von Ackerbau und Viehzucht in Gang hielten. Das Leben in festen Gemeinschaften verlangte nicht nur soziale Veränderungen, sondern wurde auch zum Nährboden neuer Krankheiten.
Der A-Typ
Etwa zwischen 25000 und 15000 v. Chr. begann der A-Typ in Erscheinung zu treten. Sein Immunsystem veränderte sich im Vergleich zu jenem des 0-Typs und war auf die Abwehr von Infektionen und bakteriellen Erkrankungen ausgerichtet, die die Gemeinschaften dezimierten. Der Verdauungsapparat des A-Typs paßte sich einer Ernährung an, die den Organismus vorwiegend mit pflanzlichem Eiweiß, insbesondere aus Gemüse und Getreide, versorgte. Gleichzeitig lieferten Seen, Flüsse und Meere Fisch und Meeresfrüchte in Hülle und Fülle und waren damit eine weitere, unerschöpfliche Quelle an Proteinen für die Ernährung des Menschen. Bezeichnet wird der A-Typ als »Landwirt«.
Der B-Typ
Zwischen 15000 und 10000 v. Chr. entwickelte sich der B-Typ. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der wachsende Strom von Menschen über die Jagdgründe der Jäger vom frühen Typ 0 hinaus ausgebreitet und bewegte sich nun von den festen Ackerbaugemeinschaften des A-Typs weiter über den Globus – eine Entwicklung, die dem B-Typ die Bezeichnung »Nomade« eintrug. Jahrhundert um Jahrhundert zogen volkreiche Stämme über die endlosen Weiten einer noch primitiven, sich ständig wandelnden Welt und ernährten sich vom Fleisch und den Milchprodukten ihrer Rinder-, Ziegen- und Schafherden sowie von allem Eßbaren, das sich ihnen auf ihrer Wanderschaft bot. In puncto Immunabwehr und Verdauungsapparat vereinigte der B-Typ zahlreiche Eigenschaften des 0- und A-Typs in sich und entwickelte damit ein ausgewogeneres und widerstandsfähigeres Immun- und Verdauungssystem als die genannten Blutgruppen.
Der AB-Typ
Bis vor vergleichsweise kurzer Zeit gab es nur drei Blutgruppen; dann – vor etwa 1000 bis 1500 Jahren – entwickelte sich der noch heute seltene AB-Typ. Nach wie vor ist nicht ganz eindeutig geklärt, was zur Entstehung dieser jüngsten Blutgruppe führte, und deshalb nennt man den AB-Typ oftmals den »Rätselhaften«. Möglicherweise ist die vollständige Ausbildung dieser Blutgruppe noch nicht abgeschlossen. Nach heutigen Erkenntnissen vereint der AB-Typ die meisten Stärken und Schwächen von Typ A und B in sich. Menschen vom Typ AB besitzen im Vergleich zu den anderen Blutgruppen ein komplexeres, »sprunghafteres« Immun- und Verdauungssystem – ein Faktum, das sich positiv und negativ gleichermaßen auswirken kann. Auf der positiven Seite steht die Vielfalt von Reaktionen des Immun- und Verdauungssystems; auf der negativen hingegen die Veranlagung für die Schwächen und Anfälligkeiten des A- und B-Typs.
Die biochemische Struktur der Blutgruppen
Was bewirkt nun die Blutgruppe im Organismus und macht damit ihren Einfluß so bedeutsam? Jede Blutgruppe wird nach ihren biochemischen Unterscheidungsmerkmalen – insbesondere ihren Antigenen – bezeichnet.
Antigene sind biochemische Marker, die an der Oberfläche der Körperzellen sitzen und die Bildung von Antikörpern in Gang setzen. Jede Blutgruppe besitzt ein besonderes Antigen mit seiner eigenen spezifischen biochemischen Struktur.
Stellen Sie sich die biochemische Struktur der Blutgruppen gewissermaßen als Antennen vor, die von den Zelloberflächen aus weit in den Raum hineinragen. Diese Antennen bestehen aus langen Molekülketten des Einfachzuckers Fucose. Fucose bildet die einfachste Blutgruppe – den Typ 0.
Blutgruppe A: Ihre Zellen gleichen denen des 0-Typs, besitzen jedoch im Unterschied zu diesen zwei Antennen. Blutgruppe A entsteht durch die Kombination des 0-Antigens Fucose mit einem anderen Einfachzucker namens N-Acetyl-Galactosamin. Diese beiden Zucker entsprechen also dem Typ A.
Blutgruppe B: Ihre Zellen gleichen jenen des A-Typs und sind gleichfalls mit zwei Antennen ausgestattet. Im Unterschied zu Blutgruppe A besteht die zweite Antenne aber aus dem Einfachzucker D-Galactose. Mit anderen Worten – Blutgruppe B ergibt sich aus der Kombination der beiden Zucker Fucose (0-Antigen) und D-Galactose.
Blutgruppe AB: Charakteristisch für diese Blutgruppe sind drei Antennen – bestehend aus den Molekülketten von Fucose (0-Typ), N-Acetyl-Galactosamin (A-Typ) und D-Galactose (B-Typ). In diesem Fall entsprechen die drei Zucker, die einzeln oder in Kombination die übrigen drei Blutgruppen bilden, der Blutgruppe AB.
Zusammenhang zwischen Blutgruppe und Ernährung
Nun stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Blutgruppe und Ernährung. Zwischen dem Blut des Menschen und den Nahrungsmitteln, die er zu sich nimmt, kommt es zu einer chemischen Reaktion. Bewirkt wird dieses Geschehen durch die sogenannten Lektine – Eiweißverbindungen unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, die in Nahrungsmitteln reichlich vorkommen. Lektine führen zu Agglutinationen (Verklumpungen), die sich auf das Blut auswirken. Verzehren Sie ein Nahrungsmittel, das für Ihr Blutgruppen-Antigen unverträgliche Lektinproteine enthält, greifen diese Lektine ein Organ an und beginnen, die Blutzellen in der betreffenden Region zu verklumpen. Im Endeffekt hemmen Lektine den Ablauf körpereigener Vorgänge und beeinträchtigen Verdauung, Insulinproduktion, das Stoffwechselgeschehen und das hormonale Gleichgewicht.
Viele Menschen, die in meinem Buch 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben erstmals etwas über Lektine lasen, fragten mich, weshalb sie noch nie zuvor etwas über diese Eiweißverbindungen gehört hatten. Einige Leute waren skeptisch und meinten, Ärzte und Ernährungsfachleute hätten auf die Auswirkungen von Lektinen wohl schon längst aufmerksam gemacht, käme ihnen tatsächlich eine so gravierende Bedeutung zu. Erstaunt nahmen diese Skeptiker zur Kenntnis, daß bereits Hunderte von wissenschaftlichen Abhandlungen über die Auswirkungen von Lektinen existierten. Die Tatsache, daß darüber so gut wie nichts bekannt wurde, verleiht den Lektinen den Anstrich eines wohlgehüteten Geheimnisses. Offenkundig war 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben die erste Publikation, durch die die Ergebnisse der umfangreichen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten erstmals in die breite Öffentlichkeit gelangten.
Das Wissen um die potentiellen Risiken der Lektine heißt nicht, daß Sie sich nun plötzlich bei allem, was Sie verzehren, ängstigen müßten. Letztendlich gibt es eine Fülle von Lektinen, und an ihnen führt kein Weg vorbei. Entscheidend ist, jene Lektine zu meiden, die die blutgruppenspezifischen Zellen agglutinieren. Gluten beispielsweise, das in Weizen am häufigsten vorkommende Lektin, unterscheidet sich in seiner Form von dem für Soja charakteristischen Lektin und bindet sich an eine andere Kombination von Zuckermolekülen. Gluten bleibt an der Schleimhaut des Dünndarms haften und kann bei manchen Blutgruppen, insbesondere dem 0-Typ, massive Entzündungen und schmerzhafte Reizungen hervorrufen. Hühnerfleisch wiederum, das sich mit den Blutgruppen 0 und A verträgt, enthält in seinem Muskelgewebe ein Lektin, das die Blutzellen vom B- und AB-Typ verklumpt.
Den Speisezettel auf die Blutgruppe abstimmen
Zunächst eine grundlegende Anmerkung: Seiner Blutgruppe entsprechend besitzt der Mensch die Veranlagung zu bestimmten Stärken und Schwächen. Diese Stärken und Schwächen lassen sich optimal nutzen beziehungsweise auf ein Mindestmaß herabsetzen – vorausgesetzt, wir kennen die Bedürfnisse unseres Organismus und ernähren uns und unsere Familie dementsprechend.
Kernaussage von 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben ist die Tatsache, daß bestimmte Nahrungsmittel und bestimmte Blutgruppen einander ergänzen, während andere Nahrungsmittel demselben Typ abträglich sind und den Organismus schwächen. Vorrangiges Einbeziehen zuträglicher Nahrungsmittel in die tägliche Kost und konsequentes Weglassen weniger bekömmlicher Nahrungsmittel kann die Ausgewogenheit Ihres Immun- und Verdauungssystems auf optimale Weise begünstigen. Die meisten der mit Ihrem Typ verträglichen Nahrungsmittel entsprechen der evolutionsbedingten Entwicklung Ihrer Blutgruppe. Im Klartext heißt dies – die Nahrungsmittel, die sich mit Ihrer Blutgruppe vertragen, sind oftmals dieselben wie jene, von denen sich die Urmenschen während der Entstehung Ihrer Blutgruppe vorwiegend ernährten. Hier einige Beispiele:
Kennen Sie Ihre Blutgruppe?
Ihre Blutgruppe können Sie auf verschiedene Weise erfahren.
1. Spenden Sie Blut. Aber auch wenn Sie dies nicht möchten, können Sie bei vielen Blutspendediensten gegen Entrichtung einer Gebühr Ihre Blutgruppe bestimmen lassen.
2. Fragen Sie Ihren Arzt, aber wundern Sie sich nicht, wenn er Ihre Blutgruppe nicht kennt. Im Rahmen routinemäßiger Labortests (z. B. Cholesterinbestimmung oder andere Werte) werden Blutgruppenbestimmungen üblicherweise nicht automatisch, sondern nur auf Verlangen vorgenommen.
0-Typ: Am besten spricht dieser Typ auf eine proteinreiche Kost an, die unter anderem Fleisch, Geflügel und Fisch sowie eine Vielfalt an Obst und Gemüse einschließt. Viele Getreidesorten, Hülsenfrüchte und Milchprodukte sind der Blutgruppe 0 nicht zuträglich.
A-Typ: Optimal für diese Blutgruppe ist eine vorwiegend vegetarische Ernährung; darunter Sojaprodukte, Bohnen und andere Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse und Obst, und dazu hin und wieder etwas Fisch.
B-Typ: Zur idealen Ernährung zählen Wildbret, Kaninchen, Hammel und Lamm. Meiden hingegen sollte der B-Typ Huhn. Im Gegensatz zur Blutgruppe 0 und A vertragen Angehörige der Gruppe B viele Milchprodukte, während ihnen manche Getreidesorten, Bohnen und Hülsenfrüchte zu schaffen machen. Zum Ausgleich dafür bietet sich aber eine reiche Vielfalt an Gemüse und Obst. In fast jeder Hinsicht ist die Blutgruppe B am anpassungsfähigsten.
AB-Typ: Der Speiseplan dieser Blutgruppe ist ziemlich komplex – eine Kombination aus der Kost für Typ A und B. Als AB-Typ können Sie fast alles essen, was sich für den A- und B-Typ eignet, müssen aber den Verzehr fast aller Nahrungsmittel vermeiden oder einschränken, die bei den beiden genannten Blutgruppen Verklumpungen verursachen. Die ideale Diät für den AB-Typ ist eine vorwiegend vegetarische Kost, ergänzt durch etwas Fleisch und Milchprodukte.
Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen und Nahrungsmitteltabellen, die sich für eine typgerechte Ernährung als hilfreich erweisen. Nahrungsmittel der Kategorie »sehr bekömmlich« sollten Sie bevorzugt auf den Speiseplan setzen, und jene der Kategorie »zu vermeiden« so weit wie möglich weglassen. Dazwischen liegt die breite Palette »neutraler« Nahrungsmittel für die Einbeziehung in eine insgesamt ausgewogene und gesunde Ernährung. Nach den Erfahrungen unzähliger Menschen kann eine auf die individuelle Blutgruppe zugeschnittene Kost im Kampf gegen Allergien oder andere chronische Erkrankungen ungewöhnliche und beinahe unmittelbare Ergebnisse zeitigen. Eine Kost auf der Basis der Blutgruppendiät führt unter Umständen auch rasche Veränderungen herbei, wie beispielsweise Gewichtsabbau, Wiederherstellung einer normalen Insulinproduktion und die Beseitigung lästiger Verdauungsprobleme sowie einen Zuwachs an Energie und Ausdauer.
Das Geheimnis typgerechter Ernährung
Sehr bekömmlich: Nahrungsmittel, die im Organismus wie Arznei wirken.
Neutral: Nahrungsmittel im Sinne von »Essen« ohne spezifische arzneiliche oder toxische Effekte auf den Organismus.
Zu vermeiden: Nahrungsmittel, die im Organismus wie Gift wirken.
Noch bedeutsamer ist der langfristige Nutzen einer solchen Ernährung. Die Blutgruppendiät kann sich als hilfreich erweisen, wenn es um die Bekämpfung schwerer Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht, um die Abwehr häufig vorkommender Viren und Infektionen, oder um die Eliminierung jener Toxine und Fette, die Übergewicht und Fettleibigkeit fördern; hinzu kommt die Verlangsamung des Zellverschleißes – einer Begleiterscheinung des Alterungsprozesses. Und was das Beste daran ist – all diese Vorteile können Sie sich im Rahmen einer gesunden, sättigenden und abwechslungsreichen Ernährung verschaffen. 4 Blutgruppen – Das Kochbuch für ein gesundes Leben bietet eine Fülle ausgezeichneter Rezepte, Tips und Hinweise für die Zubereitung und Ernährung sowie Speisepläne, die Ihnen von Anfang an den richtigen Weg weisen. Lebensqualität und gute Gesundheit liegen nicht zuletzt in Ihrer Hand.
3 Füllhorn der Natur
Was Nahrung wirklich bedeutet
»Catch-as-catch-can« – diese mittlerweile landläufige Redensart beschreibt sehr treffend die Nahrungssuche der Urmenschen. Im wesentlichen Fleischesser, verzehrten sie alles an Fleisch, dessen sie habhaft werden konnten. Das heißt aber nun keineswegs, daß unsere frühen Vorfahren sich ausschließlich von tierischer Kost ernährten. Pflanzen und Früchte waren seit eh und je Bestandteil der menschlichen Nahrung. Im großen und ganzen sind Menschen eher Allesesser als reine Pflanzen- oder Fleischesser, doch zahlreiche Kulturen unterscheiden sich von dieser »Norm«. So leben beispielsweise die in der Arktis heimischen Inuit (Eskimos) und die Massai-Stämme Afrikas vorwiegend von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft, während sich die afrikanischen Bantu als Pflanzenesser vegetarisch ernähren. Diese scheinbaren Extreme stehen in perfektem Gleichklang mit unserem Wissen über die Blutgruppen. Ein Großteil der fleischessenden Inuit und Massai haben Blutgruppe 0, während sich die Auswirkungen der Entwicklung von Typ A bei den veganischen (streng vegetarischen) Bantu so deutlich zeigt, daß man eine eigene Untergruppe nach ihnen benannnte – den Typ A-Bantu.
Betrachtet man den Einfluß der Nahrung auf die Blutgruppe bei unseren Vorfahren, zeigt sich ein vergleichsweise einfaches Bild. Heute hingegen, in unserer modernen Zeit, ist alles komplizierter geworden – nicht selten mit verhängnisvollen Folgen. Im Zuge technologischer Fortschritte in Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie büßten die Nahrungsmittel zunehmend an Naturbelassenheit ein und gingen wichtige Nahrungsbestandteile verloren. So führten beispielsweise im Asien des 20. Jahrhunderts neue Verfahren für das Schälen und Polieren von Reis zur Ausbreitung von Beriberi – einer Thiamin-Mangelkrankheit, der Millionen zum Opfer fielen. Ein weiteres Beispiel kommt aus den Entwicklungsländern, wo das traditionelle Stillen von Säuglingen mehr und mehr durch die Verabreichung von Flaschennahrung ersetzt wird. Dieser Umstand ist mitverantwortlich für zahllose Fälle von Fehl-, Mangel- oder Unterernährung und Durchfallerkrankungen mit tödlichem Ausgang.
Die wohl bedeutsamste Entwicklung war der allmähliche Übergang von einer Vielfalt von Kohlenhydraten auf Getreide, insbesondere Hybridweizensorten als Grundnahrungsmittel. Heute wissen wir, daß der überreichliche Verzehr von Getreide und Bohnen die Entwicklung von Diabetes, Herzkreislauferkrankungen, Fettleibigkeit und vielen anderen ernsthaften Krankheiten begünstigt. Diese Nahrungsmittel enthalten einen besonders hohen Anteil an Lektinen, die in unterschiedlichem Ausmaß blutgruppenspezifisch reagieren.
Eine weitere Entwicklung mit negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit ist das Raffinieren von Zucker und das Härten von Fetten. Was unsere Vorfahren an Fleisch aßen, war ausgesprochen mager und sehnig, und kein Viehzüchter würde heute auch nur den Versuch wagen, ein solches Fleisch auf den Markt zu bringen. Heute ist der Gaumen der westlichen Gesellschaft den Wohlgeschmack gut durchwachsenen Rindfleisches gewohnt. Das Fleisch, das der Menschheit zu gedeihlichem Wachstum verhalf – mager, naturbelassen und frei von Chemikalien, Pestiziden und Hormonen – war meilenweit entfernt vom fettreichen T-Bone-Steak oder dem doppelten Cheeseburger unserer Tage.
Ausgewogenheit ist nicht alles
Seit längerem schon setzen Ärzte und Ernährungswissenschaftler gesunde Ernährung mit ausgewogener Ernährung gleich. Ausgewogenheit definierte man als Deckung des von Experten ermittelten Tagesbedarfes an Nährstoffen, die der Körper für sein allgemeines Wohlbefinden benötigt. Bei den Empfehlungen zur täglichen Nährstoffzufuhr berücksichtigte man lediglich zwei Unterscheidungsmerkmale – Alter und Geschlecht (mit einer einzigen Ausnahme: werdende und stillende Mütter). Im Klartext heißt dies: Nach Auffassung unserer Ernährungsexperten spielt das breite Spektrum anderer, individuell unterschiedlicher Kriterien bei dieser Gleichung offenbar keine Rolle.
Das Ganze ist ein klassisches Beispiel plumper Vereinfachung. Man nimmt die Gesamtbevölkerung, vereinfacht auf die Allgemeingrößen Alter und Geschlecht und baut auf dieser Basis die Vorgaben auf. Dieses Modell dürfte bestenfalls bei Hungerzuständen anwendbar sein oder in Notstandssituationen und bei Naturkatastrophen. Es fragt sich, weshalb sich unser gesamtes Ernährungskonzept auf ein Modell gründet, das für die absolute Mindestversorgung gedacht ist. Derart vereinfachte Ernährungsrichtlinien bedeuten eine Reduzierung dieser Thematik auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Das richtige Modell für die Ernährung des Menschen hingegen ist Polymorphismus (Vielgestaltigkeit). Wir alle sind polymorphe Wesen, deren individuelle Unterschiede in jeder einzelnen Zelle des Körpers festgehalten sind.
Ein grundlegendes Manko konventioneller Ernährunglehre ist die Tatsache, daß sie sich in erster Linie mit den Zusammenhängen zwischen Ernährung und Krankheit befaßt. Auf der Basis relativ unbedeutender klinischer Studien versucht man, statistisch relevanten, häufig vorkommenden Problemen auf die Spur zu kommen, die mit der Ernährung in Verbindung stehen könnten, und diese Erkrankungen auf einfache, konsequente Weise zu behandeln. Gestützt wird dieses Vorgehen zum Großteil durch Forschungseinrichtungen, die von gesellschaftlichen Normen, einschließlich dem Großkapital, massiv beeinflußt werden. Tatsächlich wird die Nahrungsmittel- und Ernährungsforschung zum überwiegenden Teil von Lebensmittel- und Pharmakonzernen finanziert.
Nach Erscheinen von 4 Blutgruppen – vier Strategien für ein gesundes Leben sah ich mich zu meinem Erstaunen wiederholt der Kritik ausgesetzt, meine Behauptungen seien wissenschaftlich nicht untermauert; und dies, obwohl sich in der einschlägigen Literatur Hunderte von Veröffentlichungen über den Zusammenhang zwischen Blutgruppe, Ernährung und Krankheit finden. Offensichtlich waren die sogenannten Nahrungsmittelexperten derart damit befaßt, bestimmte Ernährungsnormen zu propagieren, daß sie es sich nicht erlauben konnten, ein Konzept zu akzeptieren, das sich nicht in ihre Vorgehensweise einfügte.
Die traditionelle Ernährungwissenschaft ist ins Hintertreffen geraten. Blutgruppenforschung ist nämlich nicht mehr in einen staubigen Winkel verbannt, und auf Naturheilverfahren spezialisierte Ärzte wie ich selbst gelten nicht mehr als Außenseiter. Im Gegenteil – viele Kollegen, die mich in meinen Bemühungen besonders nachhaltig unterstützen, sind Schulmediziner, die ihren Patienten die Blutgruppendiät deshalb empfehlen, weil sie etwas bringt.
In ihrem Konzept gründen sich Ernährungsrichtlinien zumeist auf die Behandlung von Krankheiten und die Vorbeugung gegen Mangelkrankheiten. Die üblicherweise empfohlene Tagesdosis für Vitamin C beispielsweise, einer wichtigen Stütze unseres Immunsystems, reicht gerade einmal zur Vorbeugung gegen die Vitamin-C-Mangelkrankheit Skorbut aus, obwohl bekannt ist, daß bei Infektionen und vielen anderen krankhaften Zuständen der Vitamin-C-Bedarf auf das Zwanzigfache steigen kann.
Dennoch sind derlei allgemeine Ernährungsrichtlinien auch von Nutzen. Sie tragen dazu bei, dem weltweit verbreiteten Problem einer Fehlernährung gegenzusteuern. So empfiehlt man heute beispielsweise den Genuß ballaststoffreicher, nicht veredelter Nahrungsmittel anstelle von industriell hergestellten Produkten – für den Durchschnittsbewohner der westlichen Industrienationen immerhin ein beachtlicher Schritt nach vorn. Bedauerlicherweise treten aber die traditionellen Ernährungsrichtlinien gewissermaßen auf der Stelle.
Was tun, wenn man sich nicht falsch ernährt und bereits damit begonnen hat, auf »gesunde« Nahrungsmittel umzustellen? Anders als Hippokrates, der den Rat gab: »Laß deine Nahrung deine Arznei und deine Arznei deine Nahrung sein«, gründen sich die modernen Ernährungsrichtlinien auf eine Trennung von Nahrung und Medizin. Die Blutgruppendiät bietet eine Chance, diese wechselseitige Beziehung wiederherzustellen. Entstanden ist dieses Konzept auf dem Fundament systematischer Untersuchungen von vielerlei Faktoren wie beispielsweise Anthropologie, Genetik, Immunantworten, Krankheiten usw., die teilweise auf den ersten Blick mit Ernährungswissenschaft scheinbar nichts zu tun haben.
Vertrauen Sie auf die Natur. Welcherart Nahrung Ihnen am besten bekommt, ist von Anfang an durch Ihre Blutgruppe festgelegt.
Was Sie über Nährstoffe wissen sollten
Ernährungskunde ist keine abstrakte Wissenschaft. Sie befaßt sich mit der Beziehung zwischen den Nahrungsmitteln, die wir verzehren, und deren Auswirkungen auf unsere Körperfunktionen. Und nur dies zählt.
Zum besseren Verständnis der Blutgruppendiät sollten Sie sich mit den wichtigsten Elementen der Ernährung vertraut machen. Unter dem Begriff Ernährung versteht man die Aufnahme von Nahrung und die Verdauungsprozesse des Organismus – Stoffwechsel, Energiefreisetzung sowie Abtransport und Ausscheidung von Abfallprodukten (Schlacken). Nährstoffe sind Substanzen, die für die Aufrechterhaltung normaler Körperfunktionen unentbehrlich sind. Die vom Menschen aufgenommenen Nahrungsmittel müssen etwa 45 bis 50 überaus wichtige Substanzen in ausreichender Menge enthalten; dazu Wasser und Sauerstoff. Diese mit der Nahrung aufgenommenen Stoffe werden vom Organismus in lebenserhaltende Substanzen umgewandelt. Zu den wichtigsten Nährstoffen zählen Kohlenhydrate, Fette (Lipide) und Proteine (Eiweiß), Vitamine und Mineralstoffe sowie Sauerstoff und Wasser.
Vom Körper aufgenommene Nährstoffe werden durch Stoffwechselvorgänge in Energie umgewandelt, die als Wärmeeinheit »Kalorie« (Joule) definiert ist. Die aus den einzelnen Nährstoffen gewonnenen Energiemengen sind unterschiedlich. So liefert beispielsweise 1 g Protein 4 Kalorien, 1 g Kohlenhydrate gleichfalls 4 Kalorien und 1 g Fett etwas mehr als 9 Kalorien.
Im großen und ganzen unterscheidet man zwischen fünf Kategorien von Nährstoffen – Proteine (Eiweiß), Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe. Ehe wir uns aber mit dem individuellen, blutgruppenspezifischen Nährstoffbedarf befassen, zunächst ein kurzer Blick auf die Funktionen dieser Nährstoffe.
Proteine (Eiweiß)
Jede einzelne Zelle des menschlichen Körpers enthält Protein, und via Nahrung zugeführtes Protein sorgt für den notwendigen Nachschub. Proteine – für Gewebewachstum und -erneuerung unentbehrlich – sind aus chemischen Verbindungen, den sogenannten Aminosäuren, aufgebaut. 13 der 22 Aminosäuren kann der Organismus selbst bilden; die restlichen 9, als essentiell bezeichneten Aminosäuren hingegen müssen ihm über die Nahrung zugeführt werden.
In tierischen Nahrungsmitteln findet sich vollständiges Protein, das heißt, sie enthalten alle für die Gesunderhaltung des Organismus notwendigen essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge. Pflanzliches Eiweiß ist unvollständig und muß zur Deckung des Aminosäurebedarfs mit dem Protein aus vielerlei verschiedenen Pflanzen kombiniert werden. Im Eiweißanteil bestimmter Nahrungsmittel, wie beispielsweise von Hülsenfrüchten und Meerestieren, finden sich jene Lektine, die blutgruppenspezifisch Verklumpungen verursachen, und daraus erklärt sich die Unterschiedlichkeit der für die einzelnen Blutgruppen optimalen Proteinlieferanten.
Proteine werden nicht in reiner Form, sondern mit der Nahrung in Verbindung mit anderen Nährstoffen aufgenommen. Ein Stück Fleisch beispielsweise könnte einen Fettanteil von 20 Prozent haben. Bei der Berechnung der zugeführten Eiweißmenge müssen also das Fett und andere Nahrungsbestandteile abgezogen werden.
Kohlenhydrate
Seit eh und je sind Kohlenhydrate die reichste und auch die preiswerteste Nahrungsquelle. Bei diesen Nährstoffen unterscheidet man zwischen zwei Gruppen – den einfachen und den komplexen (zusammengesetzten) Kohlenhydraten. Einfache Kohlenhydrate (Monosaccharide) bestehen aus Einfachzucker wie Fructose, Glucose und Galactose. Komplexe Kohlenhydrate (Oligo- oder Polysaccharide) setzen sich aus mehreren oder zahlreichen Einfachzuckern zusammen und werden im Pflanzen- und Menschenorganismus in Zucker umgewandelt. Ein typisches Beispiel hierfür sind die in Getreide und einigen Wurzel- und Knollengemüsen vorkommenden Stärken. Nahezu zwei Drittel der vom Menschen verwerteten Nahrungsenergie stammen von Kohlenhydraten; den Rest liefern Fette und Proteine.
Viele kohlenhydratreiche pflanzliche Nahrungsmittel enthalten Fasern – die sogenannten Ballaststoffe –, die zwar keine Nährstoffe liefern, als unverdauliche Nahrungsbestandteile aber bei Ernährung und Verdauung eine wichtige Rolle spielen. In Wasser nicht lösliche Ballaststoffe, wie beispielsweise Zellulose, kommen vorwiegend in Weizenvollkorn und Weizenkleie vor sowie in Obstund Gemüseschalen. Zellulose wird von den Dickdarmbakterien zur Fettsäure Butyrat umgebaut, die den Darmzellen wiederum als Energiequelle dient und zudem eine Schutzwirkung gegen Dickdarmkarzinom besitzt. Ballaststoffreiche Kost sorgt für eine Vergrößerung des Stuhlvolumens, beugt damit einer Verstopfung und anderen Beschwerden, wie beispielsweise Divertikulose, vor. Obst, Gemüse und Vollkornbrot sowie Nüsse und Hülsenfrüchte sind hervorragende Ballaststofflieferanten. Wasserlösliche, vorwiegend in Obst, Gemüse, Bohnen und Hafer vorkommende Fasern sollen zu einer Herabsetzung des Cholesterinspiegels beitragen. Allerdings enthalten ballaststoffreiche Nahrungsmittel oftmals auch mehr oder minder reichlich Lektine. Aus diesem Grunde ist es ratsam, die Ballaststoffquellen Ihrer Kost mit Bedacht auszuwählen.
Fette
Ende der Leseprobe