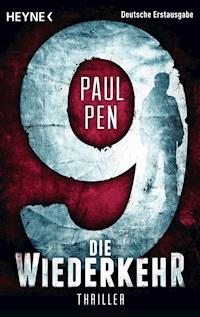
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ich kenne den Tag deines Todes!
Léo ist neun Jahre alt. Eines Tages entdeckt er einen Brief in seiner Schultasche, in dem ihm sein eigener Tod prophezeit wird. Léos Schicksal scheint unausweichlich: Am 14. August 2009 soll er sterben. Aber niemand glaubt ihm. Welche Macht ist es, die die spanische Kleinstadt Arenas schon seit Jahrzehnten heimsucht? Immer wieder geschehen dort blutige Gewaltverbrechen. Ein düsteres Schicksal scheint alle Opfer zu verbinden. Stück für Stück offenbart sich das schreckliche Muster: Jedes Mal, wenn ein Opfer stirbt, wird das nächste geboren – und niemand kann dem Fluch entkommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Zum Buch
Der neunjährige Leo lebt in der spanischen Kleinstadt Arenas. Leo ist der geborene Außenseiter. Während die anderen Schüler nach dem Unterricht in den Tankstellenshop Open gehen, um Süßigkeiten zu kaufen, wartet er jeden Tag alleine auf seine Mutter. Das Open, in dem vor einigen Jahren ein Mann erschossen wurde, ist ihm unheimlich. Zahlreiche Legenden ranken sich um die Tankstelle, in der immer wieder Menschen zu Tode gekommen sind. Leo setzt niemals einen Fuß in die Tankstelle – bis er eines Abends mit seinem Vater dort einkaufen geht. Wieder zu Hause, entdeckt er in der Außentasche seines Schulranzens einen Brief, adressiert »an einen neun Jahre alten Jungen«: Unter keinen Umständen dürfe er am 14. August 2009 das Open betreten, denn es könnte ihn das Leben kosten. Von Panik ergriffen versucht Leo, sich seinen Eltern anzuvertrauen, die das Ganze für eine Erfindung ihres Sohnes halten. Was Leo auch tut – niemand glaubt ihm … Eine unheimliche Macht scheint über Arenas und seine Einwohner zu herrschen, und nach und nach zeigt sich, dass Leos Schicksal mit der Geschichte des Apothekers Aarón verknüpft ist. Aarón erkennt, dass Leos prophezeiter Tod nach einem entsetzlichen Muster erfolgen wird: Jedes Mal, wenn jemand im Open stirbt, kommt in Arenas ein Baby zur Welt – das nächste Opfer. Leos Tod scheint unausweichlich …
Zum Autor
Paul Pen, geboren 1979 in Madrid, studierte audiovisuelle Kommunikation und arbeitet als Zeitschriften-Redakteur und Drehbuchautor für das spanische Fernsehen. Er veröffentlichte Kurzgeschichten und Anthologien und wurde in der spanischen Thriller- und Fantastik-Szene für diverse Preise nominiert.
Mehr Informationen zum Autor unter www.paulpen.com.
PAULPEN
DIEWIEDERKEHR
Thriller
Aus dem Spanischen vonNadine Marie Mutz und Hanna Grzimek
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe El Aviso erschien 2011 bei RBA Libros, Barcelona
Vollständige deutsche Erstausgabe 03/2013Copyright © 2011 by Paul PenCopyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.Redaktion: Kristof KurzUmschlagmotiv: Büro ÜberlandSatz: C. Schaber Datentechnik, WelsISBN: 978-3-641-08722-7V002www.heyne.de
PROLOG
Dienstag, 12. September 2006
An seinem ersten Schultag verließ Leo mit gesenktem Blick das Klassenzimmer. Umgeben von kreischender, ausgelassener Heiterkeit trieb er im Strom seiner Mitschüler nach draußen und näherte sich, immer einige Schritte hinter seinen Klassenkameraden, der Hauptstraße. Die Septembersonne brannte so heiß auf den Asphalt, dass sich überall auf der Straße imaginäre Pfützen bildeten. Ein Zebrastreifen führte direkt zu dem Laden des Amerikaners, der für die Schulkinder am Nachmittag zum gelobten Land süßer Zerstreuung wurde. Dem Open. Eigentlich hieß der Tankstellenshop anders, doch das Neonschild über der Tür, das nach Einbruch der Dunkelheit violett und gelb leuchtete, hatte ihm letztlich seinen Namen gegeben. Manche glaubten zu wissen, Señor Palmer, dem der Laden gehörte, habe das Schild aus Amerika mitgebracht.
Als die Kinderschar am Straßenrand anhielt, blieb auch Leo stehen. Ohne den Kopf zu heben, sah er nach oben. Die Fußgängerampel stand auf Rot.
»Seht ihr die Narbe hier?«, rief ein Schüler und zeigte auf sein Kinn. »Die musste mit vier Stichen genäht werden.«
Er plusterte sich auf und spannte den Bizeps an.
»Darum nennen mich alle Schramme.«
Ein Raunen ging durch die Menge. Schramme empfing die Bewunderung mit erhobenen Armen. Über ihm schaltete die Ampel auf Grün.
»Alle Mann ins Open!«, schrie er.
Der soeben gewählte Anführer spazierte an der Spitze seiner neuen Kameraden über die Straße. Für die Klasse, die Alma Blanco gerade erst unter ihre Fittiche genommen hatte, war es die erste Pilgerschaft ins Open, die zum täglichen Ritual werden sollte. Die Kinder liefen Schramme eifrig hinterher. Ein Junge packte ihn an der Schulter. »Ich bin Edgar.« Trotz seiner gerade einmal sechs Jahre schien er genau zu wissen, an wen er sich halten musste. Zwei Mädchen sahen sich fragend an, unsicher, wie sie sich verhalten sollten. Ängstlich nahmen sie sich an den Händen. Dann folgten sie den anderen über die Straße.
Leo bemerkte, dass sich die Gruppe um ihn herum auflöste.
Er spürte auch den Druck seiner Füße gegen den Asphalt. Sein Oberkörper neigte sich leicht nach vorn, so als wollte er jeden Moment losgehen, doch die Zehen krallten sich in den Boden. Er war wie festgewurzelt. Während der Rumpf wieder in die Senkrechte zurückwippte, zweifelte Leo ein letztes Mal, ob er seiner Mutter gehorchen oder doch lieber die Straße überqueren und mit seinen neuen Klassenkameraden ins Open gehen sollte. Noch am Morgen hatte seine Mutter ihm eingeschärft, genau hier auf ihn zu warten, bevor sie ihm den ersten wichtigen Abschiedskuss im Leben eines Kindes gegeben hatte. Er schielte noch einmal verstohlen zu der Schülerschar, die jetzt geschlossen auf die andere Straßenseite hinüberging.
Leos zweifelte nur ein paar Sekunden.
Aber diese Sekunden sollten entscheidend sein.
Der Junge, der Schramme an der Schulter gepackt hatte, blickte zurück auf seine Gefolgschaft, die er sich mit einer einfachen Geste untertan gemacht hatte, und lächelte zufrieden. Doch dann fiel sein Blick auf Leo, der reglos und mit gesenktem Haupt auf der anderen Straßenseite verharrte. Er klopfte seinem Anführer auf die Schulter. Als Schramme sah, worum es ging, lief er wieder zurück über die Straße auf Leo zu. Die anderen Kinder kehrten ebenfalls um und versammelten sich im Kreis um die beiden.
»Was ist? Bist du taub oder was?«, fragte er.
Leo antwortete nicht. Er starrte nur weiter vor sich auf den Boden.
»He, ich rede mit dir«, sagte Schramme. »Bist du taub?«
Leo schüttelte den Kopf. Dann erwiderte er:
»Wenn ich taub wäre, könnte ich dir ja gar nicht antworten, oder?«
Die anderen Kinder begannen zu tuscheln. Schramme hob den Arm, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Aha, der Klugscheißer der Klasse«, sagte er. »Darum hast du wahrscheinlich auch dieses komische Pflaster auf dem Auge, was?«
»Das ist wegen meinem ›trägen Auge‹«, versuchte Leo sich zu verteidigen. »In einem Monat kommt es ab.«
»Das ist wegen meinem ›trägen Auge‹«, äffte Schramme ihn mit Fistelstimme nach. »Willst du deshalb nicht mit in den Laden kommen, weil du nicht gut siehst?«
Leo schüttelte wieder den Kopf.
»Na, dann weiß ich schon, was mit dir los ist.« Schramme machte eine bedeutungsvolle Pause. Er wartete kurz und sagte dann: »Du hast Angst, ins Open zu gehen. Du hast Angst, du könntest eine Kugel abkriegen.«
Das Getuschel verstummte. Die Köpfe drehten sich, die Münder klappten auf. Alle Blicke richteten sich erst auf Schramme, dann auf Leo. Der zuckte nur mit den Schultern. Schließlich hob er den Kopf und blickte in die Runde. Auf Schramme. Er führte eine Hand an die Stirn, um sein offenes Auge abzuschirmen.
Schramme versuchte, dem Blick standzuhalten, aber er musste zur Seite sehen, um sich zu vergewissern, welchen Eindruck seine Worte bei den anderen hinterlassen hatten. Denn was er gesagt hatte, war nicht nur irgendein dummer Spruch. Er hatte das unaussprechliche Geheimnis des Open in aller Öffentlichkeit herausgeschrien. Das Geheimnis, das den Laden des Amerikaners für die Kinder von Arenas zum perfekten Gruselort machte, zu einem Ort, um den sich ihre schaurigsten Geschichten rankten. Über die Schießerei vor ein paar Jahren. Und den jungen Mann, der dort sein Leben verloren hatte. Natürlich hatten die Kinder ihre Eltern oder großen Geschwister schon einmal darüber reden hören. Oder an der Supermarktkasse die eine oder andere Unterhaltung belauscht. Aber der Blick, den man ihnen gleich darauf zuwarf, und der abrupte Themenwechsel, zu dem sich die Erwachsenen jedes Mal zwangen, hatte allen Kindern der Stadt zu verstehen gegeben, dass es tabu war, darüber zu sprechen. So wie auch niemand über die schemenhafte Gestalt sprach, die man nur noch selten hinter den Wohnzimmervorhängen des Hauses am Ende des Feldwegs auftauchen sah. Das Open barg ein Geheimnis, das man mit niemandem teilen durfte. Schon gar nicht am helllichten Tag und auf offener Straße.
Vielleicht, um das Schweigen zu brechen, vor allem aber, weil er nicht die geringste Spur von Unsicherheit oder Schwäche zeigen wollte, plusterte sich Schramme zum zweiten Mal an diesem Nachmittag auf und starrte Leo durchdringend an. Dann sagte er zu ihm: »Du bist ein Angsthase.« Und aus vollem Halse schrie er: »Angsthase!«
Schramme wandte sich zu Edgar um, seinem neuen Freund. Mit einem Kopfnicken deutete er auf Leo. Edgar verstand die Anweisung.
»Angsthase!«, stimmte er in Schrammes Schmählied ein. »Angsthase! Angsthase!«
Zu zweit wiederholten sie das Wort im Chor. Eine dritte Stimme schloss sich an. Dann eine vierte. Auch die beiden ängstlichen Mädchen, die sich zuvor bei den Händen gefasst hatten, machten mit. Und schon war die ganze Klasse gegen Leo. Dann rief jemand »Feigling«, und das neue Wort wurde nach und nach von den anderen Stimmen aufgegriffen, bis der Chor geschlossen die neue Parole brüllte.
Da drang das Hupen eines Autos durch das Geschrei der wild gewordenen Meute. Obwohl die Ampel auf Rot gesprungen war, standen die Kinder noch mitten auf der Straße. Die Frau am Steuer trat mehrere Male kurz hintereinander aufs Gaspedal. Außerdem schnippte sie nervös mit den Fingernägeln, indem sie den Daumennagel und den Zeigefingernagel immer wieder miteinander verhakte und löste. Dann schlug sie noch einmal, diesmal mit voller Wucht, auf das Lenkrad ein. Sie hielt die Hupe gedrückt, um den Lärm der Kinder zu übertönen. Das Geschrei verstummte, und als Schramme nun beschloss, die Straße in Richtung des Ladens zu überqueren, folgten ihm die anderen auf dem Fuß. Leo blieb allein vor dem Schultor zurück, während die Schar von Kindern, die noch am Morgen seine Freunde hätten werden können, sich für immer von ihm entfernte und im Flüsterton falsche oder wahre Geschichten – das spielte keine Rolle – über die legendäre Schießerei im Open austauschte.
Die Frau nahm die Hand von der Hupe und versuchte weiterzufahren. Sie musste mehrmals bremsen, um die letzten Nachzügler über die Straße zu lassen. Dabei zog sie unwillkürlich die Oberlippe hoch, sodass man ihr Zahnfleisch sehen konnte. Als sie endlich bis auf Höhe der Ampel vorgerückt war, hielt sie an und warf Leo einen auffordernden Blick zu.
Der Junge kletterte auf den Beifahrersitz.
»Mama, versprich mir, dass du mich jeden Tag abholst«, bat er.
Victoria bemerkte den traurigen Blick ihres Sohnes. Derselbe Junge hatte sie am Morgen in aller Frühe geweckt, weil er seinen ersten Schultag kaum erwarten konnte. Ihr entging auch nicht, wie sich auf der anderen Straßenseite eine Gruppe von Kindern auf der kleinen Grünfläche vor dem Laden des Amerikaners balgte. Da spürte sie zum ersten Mal jenes Stechen in der Magengegend, das sie in Zukunft noch so oft quälen sollte. Sie beugte sich zu Leo und umarmte ihn.
»Versprochen«, sagte sie.
Leo blickte über die Schulter der Mutter hinweg aus dem Fahrerfenster und sah, wie Schramme die Kinder mit ausladenden Gesten, die an einen Verkehrspolizisten erinnerten, zur Ladentür lotste.
Dann wandte Schramme den Kopf. Als er Leo entdeckte, der ihn aus dem Wageninneren anstarrte, kniff er die Augen zusammen und zeigte auf ihn. Mit Daumen und Zeigefinger formte er eine imaginäre Pistole. Er hob sie sich an die Schläfe und drückte ab.
1
AARÓN
Freitag, 12. Mai 2000
Mit einer für sie typischen Handbewegung wischte sich Andrea auf dem Beifahrersitz eine Strähne aus dem Gesicht. Dann streckte sie den Arm aus und verschloss ihm mit dem Finger die Lippen.
»Sag es nicht.«
Aarón zuckte mit den Schultern. Er sog den Duft nach Kamille ein, der das Auto erfüllte. Als er sah, wie ihre Augen zu glänzen begannen, musste er den Blick abwenden.
»Sag es nicht«, wiederholte sie. »Es ist nicht wahr.«
Andrea blickte eine Weile starr geradeaus durch die Scheibe und unter dem Mond hindurch, der hell über Arenas leuchtete. Arenas war nicht mehr als ein überdimensionales Dorf, das im Grunde nur aus Neubauten bestand. Eine Oase ruhiger Wohnanlagen.
Andrea biss die Zähne zusammen, um den Schwall von Wörtern zurückzuhalten. Dann öffnete sie die Faust und zeigte ihm den Stein.
»Nein …«, sagte Aarón, »bitte nicht.«
»Es ist deine Entscheidung«, erwiderte Andrea. »Du kannst ihn mir jederzeit zurückgeben.«
Sie legte den Stein aufs Armaturenbrett. Dann tätschelte sie seine Hand, die auf dem Schalthebel ruhte, und stieg aus dem Wagen.
Aarón hörte, wie Andrea die Tür zuschlug. Er vergrub das Gesicht in den Händen und wartete, bis sie in ihr Auto gestiegen war. Als sie losfuhr, knirschte der Sand unter den Rädern.
Er lauschte dem Motorengeräusch, das sich allmählich in der Ferne verlor.
Dann stützte er die Stirn auf das Lenkrad und ließ die Schultern hängen. Er seufzte. Da fiel es ihm plötzlich wieder ein. Er hatte dem alten Palmer versprochen, ihm gleich nach der Arbeit die Medikamente in den Tankstellenshop zu bringen. Schnell richtete er sich auf und sah auf die Uhr. Es war schon nach neun.
Er biss sich auf die Unterlippe und überlegte. Dann nahm er das Handy vom Armaturenbrett und wählte Davids Nummer.
»Hey, Mann, wie ist es gelaufen?«, meldete sich die Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Gut«, sagte Aarón, korrigierte sich aber gleich. »Nee, es war scheiße.«
»Hast du’s ihr gesagt?«, fragte David, obwohl er die Antwort bereits wusste.
Er hörte es an Aaróns Stimme, dass es endlich raus war.
David Mirabal hatte eine Begabung dafür, die Gedanken seines besten Freundes zu lesen. So wie seine Mutter Ruth die Gedanken von Ana, Aaróns Mutter, lesen konnte. Die beiden Frauen hatten sich an der Uni kennengelernt, als sie gemeinsam in der Schlange gestanden hatten, um sich für ein BWL-Studium einzuschreiben. Am Ende hatten beide die Uni ohne Abschluss verlassen, drei Jahre bevor sie am selben Tag ihre Kinder zur Welt brachten. Der Zufall wollte es, dass die beiden jungen Frauen am selben Mittwoch in den Wehen lagen. Einem einzigartigen Mittwoch Anfang der Siebziger, an dem die Provinz Madrid von einem spektakulären Wintereinbruch heimgesucht wurde, an den man sich noch Jahre später erinnerte.
»Ich glaube, es hat sie ziemlich mitgenommen.« Aarón öffnete die Tür und streckte die Beine aus dem Wagen. Den Arm, mit dem er das Telefon hielt, stützte er auf dem Lenkrad ab, so wie er sich früher immer auf Davids Schulter abgestützt hatte, um mit einem Stöckchen die Tiefe einer Pfütze zu überprüfen, bevor sie darübersprangen. »Sie ist gleich weggefahren. Wir haben eigentlich gar nicht gesprochen. Du weißt ja, wie sie ist. Wenn Andrea nichts mehr hören will …«
»Weißt du was, ich komm vorbei. Dann kannst du mir alles in Ruhe erzählen.« Ein leises Stöhnen war zu hören, als sich David von einem Platz aufrappelte, an dem er es sich offenbar gemütlich gemacht hatte. »Bist du noch am Aussichtspunkt?«
»Warte, darum ruf ich dich an. Ich würde am liebsten gleich nach Hause fahren. Mir eine riesige Pizza bestellen und mich vor die Glotze legen.« Er machte eine kurze Pause, dann schob er nach: »Das Dumme ist nur, dass ich dem Amerikaner versprochen habe, ihm die Medikamente vorbeizubringen.«
Señor Palmer, ein Amerikaner aus Kansas, der mit dem Schiff nach Europa gekommen war, stand schon sein halbes Leben lang hinter der Ladentheke. Er hatte die alte Tankstelle von Arenas zum Spottpreis gekauft und über die Tür das Neonschild gehängt, das er seinem despotischen Chef geklaut hatte, damals in Galena, seiner Heimatstadt. Als er Mitte der Siebziger nach Arenas gekommen war, gab es in dem Ort nur eine einzige Straße und ein paar erste Planungen für künftige Neubauten. Die Uhrenfabrik, die sich einige Jahre zuvor etwa fünfzehn Kilometer außerhalb von Arenas niedergelassen hatte, brachte die ersten Arbeiter ins Dorf, doch die Verkehrsanbindung an Madrid war noch zu schlecht, um weitere Menschen anzulocken. Später wurde die A6 ausgebaut, und Arenas begann sich zu entwickeln. Von da an bediente Palmer auch immer häufiger junge Ehepaare in seinem Tankstellenshop. An die Männer verkaufte er an Fußballsamstagen Pipas und Bier. Es waren meist junge Väter, die in seinen Laden kamen, mit dem Schal ihrer Mannschaft um den Hals, einem Kofferradio am Ohr und dem kleinen Sohn auf den Schultern. An den darauffolgenden Paellasonntagen machte ihm dann die ganze Familie ihre Aufwartung, wenn die Väter wegen der Reportagen über das Fußballspiel die Zeitung kauften, die Mütter Palmer beauftragten, ihnen das knusprigste Baguette herauszusuchen, die Kinder quengelnd nach Stickertütchen verlangten, um ihr Fußball-Sammelalbum zu ergänzen, und der eine oder andere reizbare Großvater misstrauisch jenen jungen Ausländer beäugte, der noch immer nicht mit den Peseten zurechtkam. Von dieser Ladentheke aus – hinter der es ihm auch irgendwann gelang, sich an die viel zu bunten Geldscheine mit den viel zu hohen Zahlen, ja, an Hunderter-, Tausender- und sogar Fünftausenderscheine zu gewöhnen –, von dieser Ladentheke aus sah Señor Palmer, wie Arenas immer weiter wuchs, wie man im Ort eine Privathochschule, einen Wasserpark und so viele Reihenhäuschen baute wie Señora Palmer Tränen vergoss. Sie vermisste Kansas so über alle Maßen, dass man fast glauben konnte, sie und ihr Mann seien nach Oz ausgewandert und nicht nach Europa.
»Ich versteh nicht, warum du dem Amerikaner immer seine Medizin bringst«, meinte David. »Soll er doch in die Apotheke gehen wie alle anderen auch. Wir sind doch kein Lieferservice.«
Aarón blickte zu dem Stein auf dem Armaturenbrett.
Er musste an den Tag denken, als ihm Palmer sein erstes Bier verkauft hatte. Er hatte Andrea damit beeindrucken wollen. Das war ewig her. Sie waren noch nicht einmal zusammen gewesen. Als Aarón damals in den Tankstellenshop kam, war er siebzehn, was Palmer auch genau wusste, denn er kannte seine Eltern und hatte ihn aufwachsen sehen. Aber er ließ sich trotzdem breitschlagen. Er reichte Aarón die Bierflaschen über den Ladentisch und verlangte von ihm, dass er sich kurz zu ihm beugte, damit er ihm etwas ins Ohr flüstern konnte. Andrea stand lachend daneben und drehte eine blonde Haarsträhne zwischen den Fingern. »Kämpfe um dieses Mädchen«, hatte ihm Palmer damals zugeflüstert. Und Aarón folgte seinem Rat. Zwei Jahre später waren sie zusammen. Und zehn Jahre später, heute, hatte er sich entschlossen, die Beziehung zu beenden.
In diesem Moment erinnerte er sich plötzlich wieder an Andreas Lachen nach dem zweiten Bier.
»… dich um die Probleme anderer zu kümmern«, sprach David weiter.
»Was? Was hast du gesagt?« Aarón war so in Gedanken versunken gewesen, dass er David gar nicht mehr zugehört hatte.
»Dass du schon genug um die Ohren hast und dich nicht auch noch um die Probleme anderer Leute kümmern kannst. Du hättest gar nicht erst damit anfangen dürfen.«
»Aber es kostet mich doch nichts. Der Alte hockt den ganzen Tag in seinem Tankstellenshop. Wann soll er denn die Medikamente holen?« Aarón sah wieder zu dem Stein. »Und dass er mich umsonst volltanken lässt, kommt natürlich auch nicht von ungefähr.«
»Was? Das darfst du?«
»Ja, manchmal«, antwortete Aarón.
»Ich wusste doch, dass da was faul ist.«
»Und heute Morgen hab ich ihm noch gesagt, dass ich die Medikamente gleich nach der Arbeit vorbeibringe. Aber dann … durch die Sache mit Andrea …« – Aarón schloss die Augen, als er sich so reden hörte – »… hab ich’s einfach vergessen. Ich hab die Tabletten in der Apotheke liegen gelassen, ich hab nicht mal dran gedacht, sie mitzunehmen.«
»Gut, dann bringst du sie ihm eben morgen vorbei, oder?«
»Es sind Antihypertonika und Vasodilatatoren.«
»Hat er Herzprobleme?«
»Hohen Blutdruck«, antwortete Aarón. »Er sollte die Tabletten auf jeden Fall heute noch nehmen. Aber ich kann jetzt nicht mehr in die Apotheke zurück, und danach noch in den Laden …« Er ließ den Satz unvollendet.
»Heißt das, ich soll das für dich machen? Ist es das, was du mich fragen willst?«
»Könntest du?«
Aarón hörte ein Seufzen am anderen Ende der Leitung.
»Können schon. Klar kann ich. An meinem freien Tag. Einen Service leisten, für den wir überhaupt nicht zuständig sind. Am Ende soll ich ihm wahrscheinlich noch die Füße massieren«, sagte David. »Also gut, ich mach’s, verdammt. Aber ich mach’s für dich, weil ich mir vorstellen kann, wie’s dir geht.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Ist der Chef noch in der Apotheke?«
»Ach, was! Der ist heute schon früh raus. Als ich zugesperrt habe, war er längst weg. Palmers Medikamente müssen irgendwo auf der Theke liegen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt noch dem Chef über den Weg zu laufen, nicht an meinem freien Tag …«
»Als du neulich mit Sandra in der Apotheke warst, hast du dir darüber wohl weniger Sorgen gemacht«, zog Aarón ihn auf.
»Klappe!« David musste lachen. »Also ich versteh ja nicht, was daran so schlimm sein soll. Stell dir vor, das war das erste Mal in neunundzwanzig Jahren, dass mir eine mittendrin abgehauen ist. Ich wette, mein Bruder kriegt nicht so einen Ärger, wenn er seine Mädels auf Streife mitnimmt.«
»Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Héctor schon mal eine in seinem Streifenwagen mitgenommen hat. Das würde ein Polizist doch nie machen …«
»Ach ja? Da wäre ich mir nicht so sicher. Für ein bisschen Abwechslung machen die Brüder Mirabal doch fast alles.«
An Davids Stimme merkte Aarón, dass sein Freund in Gedanken gerade mit etwas anderem beschäftigt war.
»Was machst du?«, fragte er.
»Ich suche den Apothekenschlüssel. Ein freier Tag, und schon ist der Schlüssel weg.«
Aarón hörte, wie auf der anderen Seite Türen und Schubladen aufgerissen und wieder geschlossen wurden.
»Ich hab ihn«, sagte er schließlich. »Ich hab den Schlüssel. Mann, du glaubst nicht, was ich gerade in einer Schublade gefunden habe: die Fotos von unserem ersten Besäufnis. Kannst du mir erklären, was wir splitternackt auf der alten Weide am See gemacht haben?«
»Dein Bruder musste uns mit dem Streifenwagen abholen.« Aarón war überrascht, sich kichern zu hören. »Mensch, das ist ja echt ewig her« – er rechnete kurz nach, und das Lächeln gefror ihm auf dem Gesicht – »da war ich schon mit Drea zusammen.«
»Okay, du musst jetzt echt nach Hause«, beschloss David, dem nun auch die Lust auf Scherze vergangen war. »Muss ich die Medikamente gleich holen, oder reicht es auch noch später?«
»Je früher desto besser. Wie gesagt, ich habe ihm versprochen, dass ich gleich nach der Arbeit vorbeikomme, aber wenn …«
»Schon gut«, schnitt David ihm das Wort ab. »Ich bin schon unterwegs. Dann sag ich ihm also, dass er mir den Tank für lau auffüllen soll?«
»He!«, rief Aarón. »Das ist geheim.«
»Ja ja, war ja nur ein Scherz. Und danach komm ich mit ein paar Bier bei dir vorbei, und du erzählst mir alles in Ruhe?«
»Nee, lass mal. Ich geh lieber gleich schlafen. Wir reden morgen.«
»Wie du willst. Das Bier hol ich mir sowieso. Für die Reise können wir auch noch später anfangen zu sparen.«
Der Gedanke an die Reise versetzte Aarón einen Stich. Gewissensbisse. Weil er Andrea noch nichts davon erzählt hatte. Er würde sich erst daran gewöhnen müssen, nicht mehr alles mit ihr zu teilen.
Er schüttelte den Kopf. »Danke, dass du das für mich machst. Ich glaube, ich …«
Er verstummte. Der Kloß in seinem Hals war zu groß, als dass er den Satz vernünftig hätte zu Ende bringen können.
»Hey«, sagte David, als er das Zittern in seiner Stimme bemerkte. »Sei ein Mann, okay? Und jetzt leg auf.«
Aarón senkte den Blick und musste wieder lächeln. Er blinzelte angestrengt. Dann legte er das Handy zurück auf das Armaturenbrett.
Er blickte auf Arenas hinunter, das sich wie ein Spielzeugdorf unter ihm ausbreitete. Seine Augen suchten das Aquatopia, den Wasserpark von Arenas mit der angeblich größten Wasserrutsche Europas, die von jedem beliebigen Standort aus zu sehen war. Die Umrisse des Giga Splash und der vielen anderen Rutschen gehörten zum gewohnten Stadtbild von Arenas. So wie die unzähligen Einfamilienhäuser, die Arenas auch nach außen hin als eine ideale Kleinstadt für Familien erscheinen ließen. Die Gründung der Universität des Nordostens, die Señor Palmer schon Mitte der Achtziger besucht hatte, hatte zunächst die Studenten angezogen. Mit ihnen kamen ihre Familien. Und dann noch mehr Familien. Der private Bausektor ließ es sich nicht nehmen, diese Goldgrube zu erschließen. Eine Siedlung nach der anderen schoss aus dem Boden, immer weiter entfernt vom eigentlichen historischen Kern des Dorfes, der völlig an Bedeutung verlor. Wie auch sein ursprünglicher Name: Arenas de la Despernada (den die Bewohner einfach abkürzten, aus Bequemlichkeit oder vielleicht auch, um den Bezug auf die Adlige zu unterschlagen, die der Legende nach bei der Gründung des Dorfes beide Beine verlor). Die neuen Dorfbewohner zogen in die kleinen Häuschen mit den gepflegten Vorgärten, Gartenzäunen und eigenen Swimmingpools hinter dem Haus. Die Brüder Moreno verdienten sich mit ihrer Firma eine goldene Nase. Ihr Slogan »Pool ist cool« war ein voller Erfolg. Auch die Gemeindeverwaltung wusste die Situation für sich zu nutzen, indem sie allen Kindern, die in der Dorfschule ihr Abitur machten, ein kostenloses Universitätsstudium garantierte. Diese Maßnahme sorgte endgültig dafür, dass Arenas, vierzig Kilometer nordwestlich von Madrid, eine junge, attraktive Einwohnerschaft bekam, wohlhabende Ehepaare, die aus der Großstadt aufs Land zogen, wo sie ihren Sprösslingen vom Kindergarten bis zum Hochschulabschluss alles bieten konnten, ohne dass diese dafür die Stadt verlassen mussten. Sprösslingen, denen Arenas außerdem eine besonders glückliche Kindheit versprach, sei es am See, dem zweiten großen Wahrzeichen der Stadt, oder auf den Riesenrutschen des Aquatopia.
Nicht weit von den Umrissen des Schwimmbads entfernt erkannte Aarón das Haus, in dem er wohnte. Und er entdeckte auch das grüne Leuchtschild der Apotheke, in der er im letzten Studienjahr sein Praktikum absolviert hatte und in der er seither arbeitete.
Er umschloss das Lenkrad fest mit beiden Händen. Das Plastik knarzte zwischen seinen Fingern und störte die unendliche Stille dieser Nacht, in der er allen Mut zusammengenommen und seine Freundin, die Frau mit dem herzerwärmenden Lachen und dem magischen Hüftschwung, einfach so aus seinem Leben geworfen hatte. Die Frau, die ihm sogar den Seitensprung mit Rebeca Blanco verziehen hatte, einer Studentin, die in der Apotheke ihr praktisches Jahr absolviert und bei der Aarón das Abenteuerfeeling gesucht hatte, das ihm in seinem Leben schon länger fehlte. Ein Ausrutscher, den er ihr schließlich gestanden hatte. Und Andrea hatte ihm verziehen, weil sie den Schmerz des Verrats dem des Verlusts vorzog. Ein Liebesbeweis, der Aarón offenbar nicht reichte. Er wollte immer noch ausprobieren, wie sich ein Leben ohne Andrea anfühlte. Er musste sich erst einmal von ihr trennen, um herauszufinden, ob er sie wirklich so sehr liebte, wie er glaubte. Sich vergewissern, bevor sie eine Familie gründeten und nie mehr die Möglichkeit hätten, die Wahrheit zu erfahren. »Jetzt sag’s ihr doch endlich«, hatte David ihn schon vor Wochen ermuntert. »Erklär es ihr so, wie du es mir erklärt hast. Dass die Sache mit Rebeca ein Symptom sein könnte. Dass du das Gefühl hast, in den letzten zehn Jahren eurer Beziehung etwas verpasst zu haben. Und dass du noch nicht bereit bist, Vater zu werden. Wenn es so ist, dann ist es so. Da kann man nichts erzwingen«, lauteten seine Worte. Und dann hatte er, um ihn ein bisschen aufzumuntern, vorgeschlagen, eine Reise zu machen. »Wir nehmen uns eine Woche frei und fliegen irgendwohin. Was weiß ich … nach Kuba«, hatte er mit einer ausschweifenden Handbewegung verkündet, als befände sich diese Insel auf dem Mond. »Nur du und ich. Um dein neues Leben zu feiern. Oder zusammen zu weinen. Wonach dir gerade ist.«
Wie hypnotisiert von dem grünen Licht in der Ferne schloss Aarón die Augen und hoffte, die Erinnerungen vertreiben zu können. Doch sein Blick schweifte unwillkürlich wieder zum Armaturenbrett. Da lag der Stein, den sie an jenem Abend, als alles anfing, im See gefunden hatten. An dem Abend, als er Andrea zum ersten Mal gesagt hatte, dass er sie liebte. Aarón hatte alles so geplant, dass der Moment mit der Sommersonnenwende zusammenfiel, der den ersten Sommer der Neunziger einläutete. Gemeinsam hatten sie auf der Decke gesessen, die er am Ufer des Sees ausgebreitet hatte. Nicht geplant hatte er den unaufhaltsamen Drang, sich voll bekleidet ins Wasser zu stürzen, um Andrea etwas zu sagen, das sie eigentlich schon wusste. Tropfnass und mit ausgebreiteten Armen hatte er gerufen: »Komm ins Wasser.« Eine Einladung, die zwischen den beiden für immer die herkömmlichen drei Worte ersetzen sollte. Seit jener Nacht, der kürzesten des Jahres, hatten sie immer nur »komm ins Wasser« zueinander gesagt.
Wie vom Blitz getroffen setzte er sich auf. Er drehte den Schlüssel in der Zündung und fuhr die Landstraße hinunter in die Stadt. Er kurvte durch die ruhigen Seitenstraßen von Arenas, um den unzähligen Kreisverkehren auszuweichen. Dann bog er in die Hauptstraße ein. In der Ferne sah er das Neonschild des Open und die Umrisse der Zapfsäulen. Wieder musste er an die ersten Biere denken, die er für Andrea gekauft hatte.
»Danke, Davo«, murmelte er vor sich hin. »Ich muss echt dringend nach Hause.«
Als er das Radio einschaltete, um auf andere Gedanken zu kommen, spielte der Sender ausgerechnet Smells like teen spirit, eines der Lieder, die sie in ihrer gemeinsamen Studienzeit am häufigsten zusammen gehört hatten, während sie in dem Auto, in dem er jetzt alleine saß, die Vorlesungen geschwänzt hatten. »Dieser Carlos hat einen guten Geschmack«, hatte Andrea festgestellt, wenn Carlos, ein Kommilitone der beiden, eines ihrer Lieblingslieder im lokalen Radiosender brachte. Wie auch den Song von Nirvana, mit dem sie immer ein Spielchen begannen, dessen Ausgang sie beide nur allzu gut kannten. »Was hat der Text wohl zu bedeuten?«, fragte Aarón mit einem Lächeln auf den Lippen. »Was hat ein Moskito mit der Libido zu tun?« »Der Moskito … keine Ahnung«, antwortete Andrea gemäß den Spielregeln und unterdrückte jedes Mal ein Lachen, »aber die Libido …« Dann kletterte sie über den Schaltknüppel auf Aaróns Schoß, wobei sie sich jedes Mal fast den Kopf an der Wagendecke stieß. Sie streckte ihm die Brüste ins Gesicht, und ihr langes blondes Haar fiel ihm in Wellen über das Haupt. So tanzte sie zur Musik und presste ihren Körper immer enger an Aaróns, bis eine vertraute Härte zwischen seinen Beinen gegen ihre Schenkel drückte. Und während sie miteinander schliefen, bewegte sie sich weiter im Rhythmus zur Musik, schüttelte ihre blonde Mähne und hüllte sie beide in einen Duft nach Sex und Kamille.
Das Lied wurde jetzt in einer Klassikersendung gespielt. Aarón drehte die Musik leiser. Dann änderte er seine Meinung und drehte sie voll auf. Durch die Übersättigung wurde das Lied bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, doch Aarón brüllte hartnäckig jede einzelne Zeile mit. Dass er sich dabei fast die Stimmbänder ruinierte, kümmerte ihn nicht. Es war nur ein weiterer unerwarteter Schmerz.
Von der Pizza brachte er kaum zwei kleine Stücke herunter. Da er sich nicht aufraffen konnte, ins Bett zu gehen, legte er sich aufs Sofa und legte den linken Unterarm über seine Augen. Er roch noch den Duft nach Kamille, der Andrea auf rätselhafte Weise immer anhaftete.
Das erste Klingeln des Telefons drang wie aus weiter Ferne zu ihm, wie im Traum.
Das zweite Klingeln aber ließ keinen Zweifel zu, dass es echt war.
Aarón blinzelte. Langsam fiel ihm wieder ein, dass er sich zu Hause aufs Sofa gelegt hatte, den Unterarm über den Augen, während eine beinahe unberührte Pizza auf dem Tisch kalt wurde. Und das Telefon neben der Wohnungstür klingelte jetzt schon zum zweiten, nein, zum dritten Mal. Ohne zu wissen warum – manchmal konnte er problemlos warten, bis der Anrufer beim zehnten erfolglosen Klingeln endlich aufgab –, stand er auf, rannte zum Telefon und hob ab.
»Drea?«
Du wusstest genau, warum du aufstehst, dachte er. Mit der linken Faust umschloss er den Stein so fest er konnte.
»Aarón, oh mein Gott, oh mein Gott.«
Andreas Stimme klang entsetzt. Aarón glaubte nicht die nötige Kraft zu haben, um jetzt mit Andrea über alles zu sprechen.
»Drea«, unterbrach er sie, »Drea, bitte.«
»Es geht um David.«
Aarón sagte nichts mehr.
»Jemand hat auf ihn geschossen.« Sie wollte weitersprechen, verschluckte sich aber. »Im Laden von dem Amerikaner.«
2
LEO
Montag, 21. Juli 2008
Ein Moskito zerplatzte im mörderischen Licht der Leuchtstoffröhre, die neben den Neonlettern über dem Laden des Amerikaners hing. Das bläuliche Licht flimmerte kurz, bevor es zu seiner tödlichen Gleichmäßigkeit zurückkehrte. Leo blickte auf, als das Insekt und sein praller, mit dem Blut eines unbekannten Stadtbewohners gefüllter Hinterleib knisternd verglühten. Der gelbe Schein des Schriftzugs spiegelte sich in Leos Gesicht, bevor der aufblinkende Rahmen es in ein sanftes Violett tauchte. Die Lichtschranke witterte seine Anwesenheit, und die Schiebetür ging nach beiden Seiten auf, um ihn durchzulassen. Ein eisiger Luftzug wehte ihm entgegen und half ihm, den Blick vom hypnotischen Glanz der Lampe loszureißen.
Er spähte ins Innere des Tankstellenshops.
Dann wich er zurück, damit sich die Türen wieder schlossen.
Er hielt die Träger seines neuen Astronautenrucksacks mit beiden Händen fest umklammert.
Wie angewurzelt stand er vor dem Laden, unsicher, was er tun sollte. Drinnen streckte Amador den Arm aus, um seinen achtjährigen Jungen bei der Hand zu nehmen. Er hatte noch nicht bemerkt, dass Leo draußen stehen geblieben war. Die Tür ächzte empört, als sich der Vater umwandte und wieder zurück zum Ausgang ging.
»Leo, was ist los?« Er nahm die Hand seines Sohnes und spürte, dass sie feucht war. »Was hast du denn? Komm, drinnen ist es besser. Da gibt es eine Klimaanlage«, sagte er, als wäre die schwüle Sommernacht schuld an Leos Schweißausbruch.
Dann zog er den Jungen mit sich in den Laden. Die Türen schlossen sich wieder.
Für Leo war es der erste Besuch im Open. Seit dem Tag, als ihn seine neuen Mitschüler im Chor gedemütigt und alleine vor dem Schultor hatten stehen lassen, waren zwei ganze Schuljahre vergangen. Obwohl das Open für alle geöffnet war, so viel entnahm er dem Schild, kam es Leo jeden Tag nach der Schule wieder so vor, als wäre der Tankstellenshop für ihn geschlossen, mit Brettern verbarrikadiert, unter Quarantäne gestellt. Hier versammelten sich jeden Nachmittag nach der Schule seine Klassenkameraden. Dieselben, die ihn zwangen, sich in die erste Reihe zu setzen. Die ihn mit Papierkügelchen bewarfen. Manchmal mit kleinen Steinchen darin. Die Kinder, deren Gelächter immer auf seine Kosten ging. Sobald die Schulglocke das Ende des Schultages verkündete, stürmten Schramme und die anderen über die Straße in den Laden des Amerikaners, um sich Coca-Cola zu kaufen, in die sie manchmal Mentos warfen, um fasziniert die Riesenschaumfontänen zu beobachten. Sie wetteiferten darum, wer das tollste Fahrrad hatte, oder spielten auf dem Rasen neben den Zapfsäulen die Kämpfe aus dem neuesten Computerspiel nach.
Manchmal machten sie sich auch über Leo lustig. Dann zeigten sie auf ihn, und von der anderen Straßenseite aus, die Lichtjahre entfernt war, sah Leo, wie sie ihn auslachten und nachäfften. Er wusste, dass der Spott ihm galt, wenn sie die Fersen aneinanderstellten und mit den Zehenspitzen nach außen kleine Schritte machten wie ein Pinguin, auch wenn das gar nicht seine Art zu gehen war. Nachmittag für Nachmittag stand er alleine an der Ampel und wartete auf seine Mutter, die das Versprechen einhielt, das sie ihm an jenem ersten Schultag gegeben hatte, und ihn jeden Tag abholte, auch wenn sie ihn manchmal nur zu Hause bei Linda absetzte, um sofort wieder in die Kanzlei zurückzufahren.
»Ground control to major Leo«, riss Amador ihn aus seinen Gedanken. Er war wie versteinert unter dem kalten Luftstrom der konstant übersteuerten Klimaanlage des Open stehen geblieben.
Leo betrachtete das mit Neonröhren grell ausgeleuchtete Ladeninnere wie ein Kind, das sich heimlich in die Erwachsenenabteilung einer Videothek geschlichen hat. Seine Hand glitt aus der seines Vaters. Zu seiner Linken erregte das Süßwarenregal gleich neben dem Eingang seine Aufmerksamkeit. Die verschiedenen Behälter mit Bonbons und Gummibärchen waren wie transparente Ziegel zu einer bunten Mauer aufgestapelt. Er ging einen Schritt auf das Regal zu. Von hier aus starrten ihn die anderen immer an. Er drehte den Kopf und betrachtete den Zebrastreifen vor dem Eingang der Schule, wie es seine Mitschüler schon so viele Male getan hatten. Von dort folgte er den weißen Streifen, die in der Dunkelheit leuchteten, bis zu der Stelle neben der Ampel, wo »Leo, der Spinner« immer stand, der »Idiot«. In der Glastür des Ladens erblickte er seine eigene Gestalt, die sich auf dem leeren Bürgersteig abzeichnete. Eine gespenstische Spiegelung. Dieser Anblick bot sich also Edgar, Schramme und den anderen, die für ihn nie mehr sein würden als eine Horde Kinder, die ihn vom ersten Schultag an ausgeschlossen hatten. Einen Moment lang glaubte er ihre Gegenwart zu spüren. Er sah förmlich, wie sie sich auf die Süßigkeiten stürzten und den komischen Mitschüler auslachten, der sie von der anderen Straßenseite aus beobachtete, Lichtjahre von ihnen entfernt. Unwillkürlich griff er nach einer Schaumzucker-Erdbeere. Er konnte nicht widerstehen. Er wollte wissen, wie es sich anfühlte dazuzugehören, einer von ihnen zu sein. Als er sich die Erdbeere in den Mund steckte und hineinbiss, schmeckte er die ganze Bitterkeit des Verrats an sich selbst. Mit zusammengekniffenen Augen schluckte er die klebrige Masse hinunter. Er schüttelte den Kopf. Plötzlich war er wieder allein vor dem Regal mit den Bergen von Süßigkeiten. Auch die Umrisse seiner eigenen Gestalt auf dem Bürgersteig lösten sich auf. Sein Vater und er waren die einzigen Kunden im Laden. Im Sommer ließ sich kaum ein Student in Arenas blicken.
»Heute Abend ist es schon zu spät für Süßigkeiten. Aber wenn du möchtest, kannst du dir morgen ein paar davon kaufen.« Amador musste gegen den Fernseher anbrüllen, der den ganzen Laden beschallte.
»Ist egal, Papa«, antwortete Leo, als er zu seinem Vater zurückkehrte. »Die schmecken eh nicht.«
»Du hast dir eins genommen? Einfach so, ohne zu bezahlen?«, schimpfte er. »Kaum zu fassen, was haben wir dir denn beigebracht …?«
Er kniete sich vor Leo hin und säuberte mit dem Daumen den Mund des Kindes.
Señor Palmer, der hinter der Ladentheke stand, bemerkte die Geste. Sie setzte etwas in seinem Kopf in Bewegung, sie schien ihm irgendwie vertraut. Wie das fluoreszierende Licht draußen vor dem Tankstellenshop flackerte eine Erinnerung in ihm auf. Doch der Funke erlosch wieder, bevor er überhaupt richtig aufgeleuchtet war. Das schwache Herz des Alten setzte das Frühwarnsystem außer Kraft, das soeben in Gang gekommen war.
»Für so was habe ich dich nicht mitgenommen«, sagte Amador missbilligend, bevor er sich wieder aufrichtete.
Diesmal streckte er seinem Sohn nicht die Hand hin, als er weiter zu den Verkaufsregalen ging. Leo folgte seinem Vater in gebührendem Abstand. Sie kamen am Zeitschriftenregal vorbei, vor dem ein paar letzte Exemplare der Tageszeitung zerfleddert auf dem Boden lagen. Daneben stand ein großes Kühlregal mit Erfrischungsgetränken und Fertiggerichten. Weiter hinten waren mehrere Gefriertruhen mit Pizzas, Speiseeis und anderen Tiefkühlprodukten. Anfangs wurde in dem Tankstellenshop ausschließlich Autozubehör verkauft. Irgendwann kamen dann Backwaren und Zeitschriften hinzu. Erst einige Zeit später schwappten nordamerikanische Ladenketten nach Spanien herüber, die Tankstelle und Supermarkt miteinander vereinten und vierundzwanzig Stunden geöffnet hatten, alte Bekannte Señor Palmers wie etwa die 7-Eleven-Shops, die es in den Staaten schon gegeben hatte, bevor er ausgewandert war. Um mit der Zeit zu gehen, baute Palmer sein Angebot weiter aus, so wie er auch die Öffnungszeiten verlängerte, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Er war schon vor längerer Zeit dazu übergegangen, Studenten in Teilzeit zu beschäftigen, sodass der Laden, in dem es mittlerweile fast alles zu kaufen gab, bis Mitternacht geöffnet hatte. Der alte Palmer erzählte nicht ohne Stolz, dass er schon Millionenangebote von Shell und Repsol ausgeschlagen hatte.
Leo folgte seinem Vater durch die erste Regalschlucht, wo es ausschließlich Autozubehör zu kaufen gab. Leo betrachtete die Ölkanister, Frostschutzmittel und Duftbäume. Im zweiten Gang hatte er kaum Zeit genug, die Inhalte der unzähligen Konservenbüchsen zu erkennen. Amador bog in den dritten Gang ein.
»Weißt du, welche Sorte wir immer kaufen?«, fragte er, als sein Sohn neben ihm stehen blieb.
Amador befand sich vor dem Regal mit den Milchprodukten und Zerealien auf der einen und den Keksen auf der anderen Seite und blickte verwirrt drein.
»Ich glaube, die in dem rosa Karton«, sagte Leo. »Mit der Kuh drauf.«
Amador musste lachen, weil er nicht wusste, ob sie zu Hause fettarme oder Vollmilch konsumierten. Da wurde wieder deutlich, wie selten er einkaufen ging, und dass, wie sein Vater immer zu sagen pflegte, »der größte Erfolg im Leben darin besteht, jemanden zu finden, der es einem abnimmt«. Noch unterwürfiger als die Haltung der Bediensteten, die ihm Zeit seines Lebens die Milch gekauft und die Garage aufgeräumt hatten, war seine eigene, nämlich genau das Leben zu leben, das sein Vater für ihn vorgesehen hatte. Trotzdem musste Amador jetzt lächeln. Leo tat es ihm gleich. Papa war schon nicht mehr böse wegen dem Diebstahl.
»Wir nehmen vorsichtshalber auch noch Vollmilch mit«, lautete Amadors endgültiger Beschluss. »Wird unsere Rakete so viel Gewicht aushalten? Bei dem weiten Weg bis zur Erde bleiben wir am Ende noch in der Umlaufbahn hängen und kreisen auf ewig um unseren Planeten, ohne dass wir jemals wieder landen können«, sagte er und wog die beiden Packungen in den Händen.
»Die Schwerkraft ist auf diesem Planeten geringer als auf der Erde«, sagte Leo mit verstellter Stimme. »Es dürfte keine Probleme geben.«
Seit dem Tag, als Amador seinem Sohn eine Packung Leuchtsterne zum Aufkleben geschenkt hatte, die schlagartig Leos Interesse für die Astronomie geweckt hatten, sprachen Vater und Sohn im Astronautenjargon miteinander. Sie hatten die Sterne vor einiger Zeit gemeinsam an Leos Zimmerdecke geklebt, obwohl sich Victoria schon über die Spuren beschwert hatte, die sie auf der weißen Farbe hinterlassen würden. Mit einer Himmelskarte in den Händen hatte Leo die Operation geleitet. Er kannte die Konstellationen, wusste, wo jeder einzelne Stern hingehörte. Amador hätte die Aufkleber einfach wahllos verteilt, aber Leo bestand darauf, dass der künstliche Himmel über seinem Bett genauso aussehen sollte wie der Himmel, den seine Altersgenossen – alle außer ihm – im Sommercamp betrachteten, während sie gemeinsam ums Lagerfeuer herumsaßen und eifrig diskutierten, wer von den zehn Aliens, in die sich Ben 10 mit dem Omnitrix verwandeln konnte, der Beste war. Schade nur, dass die Packung, die Amador im Laden des Amerikaners gekauft hatte, nicht genug Sterne enthielt, um die Himmelskarte zu vervollständigen. »Das ist ein schwarzes Loch«, hatte der Vater schnell erfunden, als er das Gesicht seines Sohnes sah, nachdem sie den letzten Stern einer halb fertigen Kassiopeia aufgeklebt hatten.
Mit den Milchtüten gingen sie zum Ladentisch. Darauf stand eine altmodische Kasse, die seit zwanzig Jahren nicht ausgewechselt worden war.
Der Inhaber des Ladens, der Amador als Señor Palmer oder »der Amerikaner« bekannt war, stand mit dem Rücken zu ihnen. Er kramte in ein paar Schubladen, aus denen vereinzelte Zettel und bunte Kabel heraushingen. Dann beugte er sich nach vorne, sodass der Hemdkragen beinahe sein weißes Haar berührte, das ihm fein säuberlich gekämmt vom Scheitel in den Nacken fiel. Unterhalb der Ladentheke stand ein Fernseher, der so laut eingestellt war, dass es in den Ohren wehtat.
Amador bemerkte ein kleines Gerät an Palmers linkem Ohr. Er ließ die beiden Milchpackungen mit einem lauten Plumps auf den Ladentisch fallen. Der alte Mann zuckte zusammen und schloss die Schublade, in der er das, was er suchte, offensichtlich nicht gefunden hatte. Einige Zettel fielen zu Boden. Er drehte sich um und kräuselte die buschigen weißen Augenbrauen. Das wabbelige Doppelkinn, das unter seinem Kinnbart hing, schaukelte hin und her.
»Entschuldigung«, versuchte Amador ihn zu beschwichtigen.
Unwillkürlich formte er dabei die Worte in übertriebener Weise mit den Lippen und deutete mit beiden Händen auf seine Ohren.
Der Alte kam zum Ladentisch. Der Fernseher verstummte. Seine runden Wangen plusterten sich noch mehr auf, wenn er lachte.
»Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Sie stören ja nicht.« Señor Palmer sprach kaum noch mit Akzent, abgesehen von dem sonderbaren Vibrieren des R und der ein oder anderen verräterischen Satzkonstruktion. »Dieser verflixte Apparat ist schuld«, erklärte er und zeigte auf das Hörgerät. »Er funktioniert einfach nicht so, wie man mir versprochen hat. Ich höre nicht mal die Tür, wenn jemand in den Shop kommt. Erst vor Kurzem habe ich mich fast zu Tode erschreckt, als wie aus heiterem Himmel Gloria vor dem Tresen auftauchte, Sie wissen schon, die aus der Bibliothek. Ausgerechnet diese Riesenfrau! Sie können sich nicht vorstellen, wie verdattert ich war, als sie da plötzlich vor mir stand …«
»Señor Palmer«, schnitt Amador ihm das Wort ab, »immer mit der Ruhe. Ich kann warten, bis Sie fertig sind.«
»Ach, das ist auch so eine Geschichte. Das verdammte Herz bleibt ja doch irgendwann stehen. Es hat einfach schon zu viel mitgemacht.« Er klopfte sich auf die linke Brustseite, eine halb militärische und halb sportliche Geste. »Kein Tabak, kein Alkohol. Ein Jammer! Das ist noch schlimmer, als das ganze Leben meine geliebte Frau auszuhalten.« Er besiegelte den Witz mit einem markerschütternden Husten. »Wenn ich nur wüsste, wo ich diese verdammten Tabletten hingetan habe! Dammit.« Flüche, Lautmalereien und Zahlen entschlüpften dem alten Palmer manchmal noch auf Englisch. »Eines Tages wird meine Frau herkommen und den Shop zumachen müssen, weil ich hinter dem Tresen zusammengeklappt bin.«
Er widmete sich wieder einer der Schubladen.
»So wie es dem Barmann da vorne an der Ecke ergangen ist, dem Bruder des Inhabers. Haben Sie davon gehört? Er soll gestorben sein, während er gerade die Abrechnung gemacht hat. Sie haben ihn bei dem Spielautomaten gefunden. Anscheinend ist er noch ein paar Meter auf den Ellenbogen vorwärtsgekrochen.«
Amador war sich nicht sicher, ob der alte Mann mit ihm oder mit sich selbst sprach.
Leo hatte sich mit dem Rücken zur Kasse an den Ladentisch gelehnt, sodass ihn Señor Palmer nicht sehen konnte. Er zupfte seinen Vater am Ärmel und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. Dann drehte er sich herum und lugte zwischen acht Fingern hindurch über den Ladentisch. Amador räusperte sich, um den Alten an seine Anwesenheit zu erinnern. Wieder zuckte er zusammen.
Palmers Blick, der zuvor fest auf Amador gerichtet war, fiel jetzt auf den Jungen. Leo hatte sich auf die Zehenspitzen gestellt und betrachtete den Ladenbesitzer. Die kindliche Neugier schlug in Erstaunen um, als er den unergründlichen Gesichtsausdruck des Mannes sah. Ja, der Mann starrte ihn an, als hätten sie sich irgendwo schon einmal gesehen.
Das Herz des Alten machte einen Sprung, als der Funke der Erinnerung, der eben nach kurzem Aufflackern wieder erloschen war, in diesem Augenblick hell zu leuchten begann.
Und als der Junge nun die Stirn runzelte, wobei er ein Auge etwas weiter öffnete als das andere, schien ihm die Geste unverwechselbar zu sein.
Das war der Junge. Er stand direkt vor ihm.
Ein Schauer überlief ihn. Ihm war, als zöge jemand sein weitverzweigtes Nervenkostüm zu einem einzigen Knoten zwischen den Schultern zusammen. Einen Moment lang verschleierte sich sein Blick. Er fürchtete, ohnmächtig zu werden, doch dann kam der Alte wieder zu sich. Wieder traf ihn der Anblick des Jungen wie ein Blitz. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er konnte seinen Herzschlag hören. Sein Puls beschleunigte sich in einer Weise, die der Doktor strengstens verboten hatte.
»Ist Ihnen nicht gut?«, erkundigte sich Amador. »Vielleicht sollten Sie jetzt gleich diese Tabletten einnehmen.«
Neben ihm stand Leo, der nicht minder überrascht, wenn auch außerstande war, die Bedeutung des Vorfalls zu begreifen, wie angewurzelt auf den Zehenspitzen und fühlte sich auf sonderbare Weise erkannt. Amadors Stimme holte den Alten wieder in die Gegenwart zurück.
»Die Tabletten, ja«, stammelte Palmer. »Die Tabletten.«
Er öffnete wieder eine Schublade, diesmal deutlich entschlossener als zuvor, und begann darin zu kramen, wobei wieder einige Zettel zu Boden fielen. Womöglich war es sein Unterbewusstsein, das ihm nun, da es immer dringender wurde, verriet, wo er sein Medikament zum letzten Mal gesehen hatte. Schließlich holte er aus der Schublade eine Folie mit fünf Kapseln hervor. Er nahm zwei heraus und steckte sie sich in den Mund. Mühsam schluckte er sie hinunter. Durch den Mangel an Speichelflüssigkeit konnte er spüren, wie die Kapseln an der Speiseröhrenwand entlang langsam nach unten glitten. Wenn auch kein medizinischer Grund für eine unmittelbare Besserung bestand, so war die Placebowirkung enorm. Der Zustand der Beklemmung verflog, und Palmer fühlte sich nun in der Lage, die Anspannung zu überspielen, die der Anblick des Jungen in ihm hervorgerufen hatte. Dann erst wandte er sich wieder zu den beiden um.
»Wow. So ist es besser.« Es gelang ihm, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. »Das macht …« – die Kopfrechnung führte er auf Englisch durch – »drei Euro fünfzig.«
»Berechnen Sie bitte auch eins von den Bonbons da«, sagte Amador und deutete mit dem Kopf in Richtung des Süßwarenregals am Eingang. »Mein Sohn … er hat sich einfach eins genommen.«
Palmer reagierte kaum auf die Worte des Vaters. Sein Blick ruhte weiterhin auf Leo, während er eine grüne Plastiktüte unter der Ladenkasse hervorzog und die Milchpackungen nacheinander hineinstellte. Die Milch war definitiv zu schwer für die dünnen Tüten, die die Studenten in wilden Partynächten an Stöcken befestigten und anzündeten, um zu beobachten, wie das flüssige Plastik auf die eine oder andere herumstreunende Katze tropfte.
Amador suchte in seinem Portemonnaie nach einem Fünfeuroschein und reichte ihn über den Ladentisch. Er nahm das Wechselgeld entgegen, wünschte dem alten Palmer einen guten Abend und ging auf den Ausgang zu.
»Komm, Leo!«, rief er über die Schulter, als er merkte, dass sein Sohn ihm nicht folgte. »Wir müssen nach Hause. Sonst wird Mama noch sauer. Und Pi wartet bestimmt auch schon auf dich.«
Leo machte auf dem Absatz kehrt und trottete hinter seinem Vater her.
»Hey, Kleiner!«, hörte er plötzlich die Stimme des Alten hinter sich. »Dein Vater hat das Wechselgeld vergessen.«
Leo blieb ein paar Sekunden wie angewurzelt stehen. Dann drehte er sich um, ging die drei Schritte wieder zurück und legte die offene Hand auf den Ladentisch, um die Münzen entgegenzunehmen, die Palmer ihm hinhielt. Nach einem letzten sonderbaren Blickwechsel mit dem Alten wandte er sich zum Gehen.
Dabei schlug sein Astronautenrucksack gegen den Ladentisch.
Draußen schlenderte Leo zu dem Aston Martin, in dem sein Vater wartete und gerade zum zweiten Mal auf die Hupe drückte.
»Warum bist du denn noch mal zurückgegangen?«, erkundigte sich Amador, als Leo neben ihn auf den Beifahrersitz kletterte und den Rucksack zwischen seinen Beinen verstaute.
»Du hast das Wechselgeld liegen gelassen.«
Er hob die Münzen hoch, damit sein Vater sie sehen konnte.
Amador dachte kurz nach, dann schüttelte er den Kopf. »Komisch. Der Alte wollte dich wohl unbedingt auf das Bonbon einladen. Aber das war das allerletzte Mal, dass du etwas geklaut hast. Verstanden, Commander? Over.«
»Verstanden. Over and out.«
Leo prustete los.
Ein Handschlag zwischen Vater und Sohn in Höhe des Rückspiegels war das Letzte, was Señor Palmer von der Ladentür aus sehen konnte.
Als das Neonschild über ihm die Farbe wechselte, erfüllte ein violetter Glanz sein bleiches, schattenhaftes Gesicht.
3
AARÓN
Freitag, 12. Mai 2000
Das Wasser spritzte den Spiegel und den Fußboden nass, als Aarón sich das Gesicht erfrischen wollte. Das unkontrollierte Zittern seiner Hände machte es ihm unmöglich. Er sah hinunter auf seine Füße und die Pfützen auf dem Marmorboden.
»Davo, nein!«, flüsterte er. Als er den Blick wieder hob, war sein Spiegelbild durch die Tropfen entstellt.
Er versuchte noch einmal, sich das Gesicht mit Wasser zu benetzen. Vergeblich. Er wandte sich vom Waschbecken ab und musste sich an der Türklinke festhalten, um nicht auszurutschen.
Er verließ die Wohnung, während sein Freund, der mit ihm auf Bäume geklettert war und hinter dem Rücken der Eltern gezündelt hatte, auf einem Krankenbett von mehreren Ärzten durch die breiten Flure der Uniklinik von Arenas geschoben wurde.
Aarón setzte sich hinters Steuer und fuhr auf eine der großen Avenidas, die abends unter der Woche immer wie ausgestorben waren. Still und friedsam wie ein am Straßenrand geparktes Familienauto. Leblos wie das Betonskelett einer im Rohbau befindlichen Wohnsiedlung. In den Straßen abseits vom Zentrum waren die erleuchteten Küchen- und Schlafzimmerfenster der von Thujen abgeschirmten Einfamilienhäuser das einzige Lebenszeichen. Hier und da ein nächtlicher Jogger. Das Klirren von Glasflaschen, die in einen grünen Recyclingcontainer geworfen wurden. Sonst Stille.
Andrea wartete unten vor der Haustür. Aarón konnte ihre zierliche Gestalt schon von Weitem ausmachen. Ihr Gesicht war hinter einer zerzausten Mähne verborgen, was nur in ihren allerschlimmsten Momenten vorkam.
»Fahren wir«, sagte sie, als sie auf den Beifahrersitz kletterte. In der Hand hielt sie ein zusammengeknülltes Taschentuch. Aarón wartete darauf, dass sie ihn ansah. Er hörte sie durch die Nase ausatmen. Ihr Blick war starr nach vorn gerichtet. »Lass uns fahren«, sagte sie noch einmal.
Dann schüttelte sie sich die Mähne aus dem Gesicht und sah ihn an. Das sonst so wache Grün ihrer Augen wirkte erloschen, fast braun. Ihre kleine runde Mädchennase war vom vielen Schnäuzen gerötet. Sie rieb die Lippen aneinander, dieselben Lippen, die sonst immer so breit lächelten, dass sie dabei die Augen fast vollständig zukniff. Auf ihren feuchten Wangen spiegelte sich das orangefarbene Licht der Straßenlaternen. Aarón verspürte den Wunsch, sie in den Arm zu nehmen. Der Motor heulte auf, als er sich mit dem rechten Fuß auf dem Gaspedal abstützte und sich zu ihr beugte. Er ließ den Motor brüllen, während Andrea, deren schmaler Körper von einem heftigen Schluchzen erschüttert wurde, seinen Hals mit Tränen benetzte.
»Sag mir, dass du wegen dem, was ich dir heute am Aussichtspunkt gesagt habe, weinst«, bat er.
Aber sie schüttelte den Kopf, die Stirn an seine Schulter gelehnt. Bis die Bewegung plötzlich ihre Richtung änderte und sich die Verneinung in Zustimmung verwandelte. Aarón seufzte laut. Er riss die Augen so weit auf, wie er konnte, in der Hoffnung, die Luft würde sie wieder trocknen. Dann drehte er sich weg, sodass sie gezwungen war, sich von seiner Schulter zu lösen. Die Handbremse bohrte sich in Aaróns rechten Oberschenkel. Er kehrte auf den Fahrersitz zurück, und der Motor beruhigte sich wieder.
»Jetzt bleiben wir erst mal ganz ruhig, okay?«, sagte er.
Er ergriff ihre freie Hand, während sie sich mit der anderen die Nase putzte. Sie nickte und rieb wieder die Lippen aneinander.
Aáron schaltete den Warnblinker aus und fuhr los.
»Alles wird gut«, murmelte er vor sich hin.
Da kam ihm zum ersten Mal der eine, alles entscheidende Gedanke.
Es ist meine Schuld.
Beinahe zeitgleich lag der Junge, der ihm gezeigt hatte, wie man ein Mädchen küsst und eine Fledermaus betrunken macht, der Freund, der ihm vor ein paar Stunden angeboten hatte, die Medikamente in den Laden des Amerikaners zu bringen, auf einem Krankenbett. Das klaffende Loch in seiner Brust, durch das eine Kugel von links hinten in seinen Körper eingetreten und vorne wieder ausgetreten war, zog ihn hinab in die Tiefe des Komas.
Sie schwiegen, während sie durch den für Arenas ungewöhnlich warmen Maiabend fuhren und die zahlreichen Kreisverkehre umkurvten. Als Aarón wie gewohnt in die Straße zum Open einbog, wollte Andrea ihn noch warnen, aber es war zu spät.
»Nimm doch lieber die Straße zum Aqua, die hier ist wahrscheinlich …« – Aarón drosselte die Geschwindigkeit, bis der Wagen zum Stehen kam – »gesperrt.«
In der Ferne sahen sie die Blaulichter der Polizeiautos. Aarón konnte den Wagen ausmachen, den Héctor immer fuhr. Seit mehr als zehn Jahren drehte er damit seine Runden durch die Stadt. Bestimmt hatte Héctor nie an die Möglichkeit gedacht, dass eines Tages sein eigener Bruder Opfer eines Verbrechens sein würde, dass er sich an dem Schauplatz dieses Verbrechens einfinden musste, nachdem ihm am Telefon die Stimme eines Mannes, der kaum imstande war zu sprechen, mitgeteilt hatte: »Der junge Mann, ich glaube, sie haben ihn umgebracht.«
Der blaue Schein der Blinklichter spiegelte sich in den Schaufenstern des Open. In den beiden Zapfsäulen neben dem kleinen Parkplatz. In den Fenstern der Schule auf der anderen Straßenseite. Und in den Pupillen von Andrea, die Aarón anstarrte, als hätte ihr erst der Anblick dieser Szene etwas Wichtiges in Erinnerung gerufen, das ihr vorübergehend entfallen war.
»Bitte nicht!«, entfuhr es Aarón, als ihn das Szenario am Ende der Straße zwang, das Geschehen in seiner ganzen Tragweite zu erfassen.
Im Krankenhaus liefen sie zuerst Héctor in die Arme, der offenbar im Krankenwagen mitgefahren war und als Polizist und Bruder des Opfers eine unklare Position einnahm. Jedenfalls schien er über Davids Zustand informiert zu sein. Er umarmte zuerst Aarón. Dann nahm er Andreas Gesicht in beide Hände und küsste sie auf die Stirn. Zum Schluss breitete er die Arme um sie beide und drückte sie fest. Aarón und Andrea verschränkten die Hände ineinander. Héctor schüttelte langsam den Kopf.
Nein.
»Er liegt im Koma«, sagte er, nun ganz in der Rolle des Polizisten, der die Aufgabe hat, den Angehörigen eine schlechte Nachricht zu überbringen. »Ein Koma vierten Grades. Was das auf der Glasgow-Koma-Skala bedeutet … weiß ich nicht. Sie haben gesagt: Nein, sie glauben nicht …« – und jetzt sprach er mit der Stimme des Bruders – »… dass er wieder aufwachen wird.«
Aarón schrie in sich hinein, ohne die Lippen zu bewegen.





























