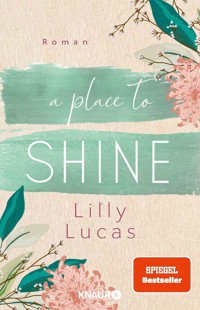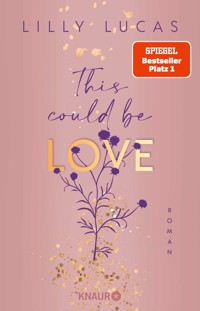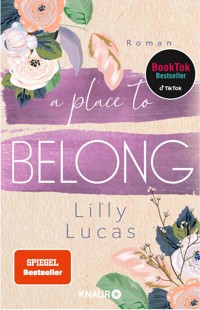
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cherry Hill
- Sprache: Deutsch
Wohin dein Herz gehört: In »A Place to Belong«, dem dritten Band der New-Adult-Reihe »Cherry Hill« von Bestseller-Autorin Lilly Lucas, wirbeln eine unerwartete Heimkehr und eine neue Liebe das Leben auf der wunderschönen Obstfarm der McCarthys ganz schön durcheinander. Als die Journalistin Maggy Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen: Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaus-Hotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggy bald zu knistern. Ehe sie es sich versieht, fühlt sich Maggy auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch die Wahrheit sagen: warum sie wirklich hergekommen ist … Wie die Liebesromane ihrer Green-Valley-Reihe sind die Cherry-Hill-Romane von Bestseller-Autorin Lilly Lucas zum Träumen, Wohlfühlen und Mitfiebern – mit Herzklopfen und einem Lächeln auf den Lippen. Die New-Adult-Reihe »Cherry Hill« ist in folgender Reihenfolge erschienen: - A Place to Love (June & Henry) - A Place to Grow (Lilac & Bo) - A Place to Belong (Maggy & Flynn) - A Place to Shine (Poppy & Trace) Lust auf noch mehr New Adult von Lilly Lucas? Dann entdecke auch die Liebesromane der Hawaii Love-Reihe! Der erste Band ist »This could be love«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Lilly Lucas
A Place to Belong
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als die Journalistin Maggy Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen: Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaus-Hotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen.
Obwohl Flynn Journalisten nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggy bald zu knistern. Ehe sie es sich versieht, fühlt sich Maggy auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch die Wahrheit sagen: warum sie wirklich hergekommen ist …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Danksagung
Für Steffi
Ich seh die Welt so gern durch deine Augen
Sisters are like different branches on a tree.
They may grow in different ways
and yet still know where they belong.
Kapitel 1
Drei Meilen. Eine unangenehme Mischung aus Angespanntheit, Nervosität und Erleichterung machte sich in mir breit, als der Wegweiser die Stadt Palisade ankündigte. Dazu gesellte sich eine bleierne Müdigkeit. Eigentlich betrug die Fahrtzeit von Denver nach Palisade nur etwas über vier Stunden. Dank der morgendlichen Rushhour und einem Stau auf der Interstate hatte ich sieben gebraucht. Sieben Stunden, in denen meine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen waren und sich pausenlos um dieselben Fragen gedreht hatten. In denen ich immer und immer wieder die letzten Tage rekapituliert und darüber nachgedacht hatte, wie sich mein Leben von einem Moment auf den anderen verändert hatte. Auch darüber, ob ich drauf und dran war, einen Riesenfehler zu begehen. Was Letzteres betraf, war ich noch zu keiner Entscheidung gelangt. Aber ich hatte ja noch drei Meilen.
Das Klingeln meines Smartphones beendete mein Grübeln. Auf dem Display des Armaturenbretts blinkte die Nummer der Lokalredaktion. Neben meinem Journalistik-Studium an der Denver University arbeitete ich als freie Mitarbeiterin bei der Denver Post, der größten Tageszeitung in Colorado. Auch wenn ich mies bezahlt wurde und die langweiligsten Storys abbekam, erhöhte der Job meine Chancen auf eine Festanstellung nach dem Abschluss, und nur das zählte. Den Blick auf die Straße gerichtet, nahm ich den Anruf entgegen.
»Hey Maggy, hier ist Jules«, meldete sich meine Ressortleiterin durch die Freisprechanlage. »Ich wollte nur fragen, wann du mir den Artikel schickst.«
»Den Artikel?«
»Über die Eichhörnchen im City Park?«, erwiderte sie mit einem lauernden Unterton.
Ich erstarrte. Der Artikel! Den hatte ich völlig vergessen. In den letzten Tagen hatte ich wie in einer Blase gelebt, ununterbrochen am Computer gehangen und recherchiert. Alles war in den Hintergrund gerückt, als könnte sich meine Wahrnehmung nur noch auf diese eine Sache konzentrieren – die rein gar nichts mit Eichhörnchen im City Park zu tun hatte.
»Maggy? Bist du noch da?«
»Äh, ja. Sorry, ich sitz im Auto.« Panik jagte durch meine Venen. »Der Artikel ist so gut wie fertig«, log ich und hatte sofort ein schlechtes Gewissen. Ich kniff die Augen zusammen und betete, dass sie es mir abkaufte.
»Aber du kriegst es hin bis 15 Uhr?«, versicherte sie sich mit einem Hauch Unruhe in der Stimme. »Wir haben doch heute vorgezogenen Redaktionsschluss, und dein Artikel ist der Aufmacher im Lokalen geworden.«
Ich schluckte. Weil es bereits nach ein Uhr war. Und weil ich noch nie einen so prominenten Platz für einen Artikel ergattert hatte. Der Aufmacher! Im Lokalen! Über … Eichhörnchen. Fast hätte ich gelacht, aber das wäre in meiner Situation mehr als unangemessen gewesen. Ich musste eine Entscheidung treffen. Schnell. Musste abwägen, ob ich das irgendwie hinbekommen konnte. Aber eigentlich hatte ich keine Wahl. Zuzugeben, dass ich noch keine Zeile geschrieben und die Deadline verbummelt hatte, würde mich meilenweit zurückwerfen, vielleicht sogar den Job kosten. Das durfte ich nicht zulassen. Nicht nachdem ich so hart dafür gekämpft hatte, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
»Du kriegst ihn in einer Stunde.« Noch ehe ich den Satz beendet hatte, schlug mein Puls Kapriolen.
»Super.« Jules klang erleichtert. »Ich hatte schon befürchtet, du hättest uns vergessen.«
»Nein, nein!« Mein Lachen kam eine Spur zu hell aus meinem Mund.
Wir legten auf, und mir brach endgültig der Schweiß aus. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich musste umdenken. Umplanen. Brauchte sofort ein Café und eine stabile WLAN-Verbindung und konnte nur hoffen, dass es beides in Palisade gab. Viel wusste ich nicht über diesen Ort. Nur, dass er keine 3000 Einwohner hatte und berühmt für seine Pfirsiche war. Eine Sorte war sogar nach ihm benannt worden. Der Palisade Peach. Es überraschte mich daher nicht, dass mich wenig später ein Ortsschild begrüßte, das die Form eines Obstkorbs hatte. Welcome to Palisade – Where life tastes good all year long. Ich folgte der Straße bis ins Zentrum, sofern man hier von einem Zentrum sprechen konnte. Die Stadt war überraschend hübsch, fast idyllisch. Backsteinhäuser mit geschnitzten Ladenschildern und bunten Markisen säumten die Main Street. Wuchtige Blumentöpfe mit Chrysanthemen, Petunien und Astern standen neben den Türen, und schmale, hohe Bäume bildeten zu beiden Seiten eine Allee. Auf den Gehwegen war erstaunlich viel los. Die Leute genossen das schöne Wetter, schlenderten mit Eis und Kaffeebechern in der Hand an den Geschäften vorbei. Ein junger Vater schob einen Kinderwagen, und ein paar Frauen mit Einkaufskörben standen zusammen und plauderten. Im Gegensatz zu mir schien es niemand eilig zu haben. Alle wirkten entspannt. Es war faszinierend und befremdlich zugleich, schließlich hatte ich mein bisheriges Leben in Denver verbracht, einer Metropole mit über 700.000 Einwohnern. Auch wenn die Hauptstadt Colorados am Fuß der Rocky Mountains lag und über zahlreiche Parks und Grünflächen verfügte, war man dort der charakteristischen Hektik von Großstädten ausgesetzt.
Ich parkte meinen Wagen – streng genommen war es der SUV meiner Eltern – vor einem kleinen Lebensmittelgeschäft namens Archie’s Groceries und sah mich um, entdeckte einen Friseursalon und eine Apotheke, eine Bäckerei und … ein Café? Ich blinzelte gegen die Sonne. Doch, ja, da saßen Leute an Bistrotischen. Erleichtert steuerte ich auf die rote Backsteinfassade zu. Very Berry hieß der Laden. Von außen warf ich einen Blick durch das bodentiefe Fenster, konnte aber nicht viel erkennen. Der Duft von frisch gepressten Zitrusfrüchten stieg mir in die Nase, als ich das Café betrat, und ein Mixer zermalmte lautstark Obst. Hoffentlich würde ich mich hier konzentrieren können. Ich ließ die Augen durch den Raum schweifen, vorbei an mintgrün gestrichenen Wänden mit gerahmten Prints. Be a fruit loop in a world of cheerios, stand auf einem davon. Ein Schmunzeln auf den Lippen, bewegte ich mich auf den nächsten freien Tisch zu, setzte mich und holte mein MacBook aus dem Case. Noch 51 Minuten, stellte ich mit Blick auf meine Uhr fest. Ich zwang mich zur Ruhe und rang die Panik nieder.
»Hey! Was kann ich dir bringen?«
Ich sah auf und blickte in das lächelnde Gesicht einer jungen Frau. Spontan schätzte ich sie auf 17 oder 18. Ein paar Jahre jünger als ich. Sie hatte schulterlanges braunes Haar und eine helle, sommersprossige Haut. Auf der Suche nach einer Getränkekarte schielte ich in Richtung Tresen, aber die Wandtafel dahinter offerierte nur Säfte. Erst jetzt dämmerte es mir. Das hier war eine Saftbar, kein Café.
»Auch auf die Gefahr hin, hochkant rauszufliegen, aber habt ihr zufällig Kaffee?« Verlegen kniff ich die Augen zusammen.
»Klar. Wir haben Flat White, Cappuccino, Espresso, Latte …«
Ein erleichterter Laut kam über meine Lippen. »Dann bitte einen Flat White.«
»Geht klar«, erwiderte sie mit einem netten Lächeln. »Wo kommst du her?« Sie schien mir anzusehen, dass mich ihre Frage irritierte. »Nur weil ich dich hier noch nie gesehen habe. Die Einheimischen kennen unsere Karte auswendig.« Ein Schmunzeln hob ihre Mundwinkel.
»Aus Denver.«
»Oh, wie cool!« Schlagartig hellte sich ihr Gesicht auf. »Ich will mich an der DU bewerben.«
»Gute Entscheidung. Da studiere ich auch.«
Jetzt hatte ich endgültig ihr Interesse geweckt. »Was studierst du, wenn ich fragen darf?«
»Journalistik.«
Wie gewohnt erntete ich imponiertes Nicken. Noch immer haftete dem Berufsfeld etwas Aufregendes, fast Glamouröses an. Die Leute dachten an investigativen Journalismus, an Skandale und Enthüllungen, Reportagen aus Krisen- und Kriegsgebieten. Dabei sah der Alltag vieler Journalisten deutlich unspektakulärer aus – und mitunter kamen auch Eichhörnchen darin vor.
»Und was willst du studieren?«, fragte ich eher aus Höflichkeit, weil mein Blick zwischenzeitlich an ihrem Handgelenk kleben geblieben war. Ihrer Fitbit, die mich daran erinnerte, dass ich absolut keine Zeit für Small Talk hatte. 48 Minuten.
»Archäologie.«
»Wow«, stieß ich überrascht aus.
»Ich möchte unbedingt im Mesa Verde Nationalpark arbeiten. Die archäologischen Stätten dort sind der Wahnsinn. Falls du länger in der Gegend bist, solltest du da unbedingt mal hin.«
Ehe ich etwas erwidern konnte, schob eine Frau mit Babytrage ihren Kopf durch die Ladentür und rief: »Olive, können wir zahlen?«
»Klar«, erwiderte sie freundlich und sagte im Gehen zu mir: »Dein Flat White kommt gleich.«
»Kein Stress, ich hab Zeit.«
Das war gelogen. So was von. Ich hatte noch 47 Minuten, um den Artikel zu schreiben und an Jules zu schicken. Warum hatte ich so lange gequasselt? Ich atmete einmal tief durch, klappte das Notebook auf und suchte die Datei mit meinen Notizen auf dem Desktop, dankte meinem Vergangenheits-Ich indessen für die Voraussicht, alle Interviews direkt transkribiert zu haben. Als ich den Ordner gefunden hatte, leuchtete die Akkuanzeige auf. Seufzend griff ich in mein Case und tastete nach dem Netzteil. Aber es war nicht da. Mein Puls beschleunigte. Wo …? Oh, verdammt! Es musste noch in der Steckdose neben meinem Bett stecken. Mit einem Stöhnen ließ ich den Kopf auf die Tischplatte sinken. Das durfte doch alles nicht wahr sein.
»Kann ich dir helfen?«
Olive stellte meinen Flat White vorsichtig auf dem Tisch ab.
»Nur wenn du ein Ladegerät für ein MacBook hast«, kam es hoffnungslos aus meinem Mund.
»Äh … nein.« Bedauernd rümpfte sie die Nase. »Aber er vielleicht.« Sie deutete auf einen Tisch im hinteren Bereich, an dem ein Kerl saß und konzentriert in sein Notebook stierte, und wäre ich eine Comicfigur gewesen, hätten jetzt garantiert Sterne in meinen Augen geblinkt. Denn er arbeitete tatsächlich mit einem MacBook. Und da führte eindeutig ein Ladekabel zu einer Steckdose in der Wand. Mit einem Zwinkern entfernte sich Olive von meinem Tisch. Ich versuchte, Augenkontakt herzustellen, aber der Typ schien ziemlich vertieft in seine Arbeit. Da ich keine Wahl hatte, stand ich auf, lief zu ihm hinüber und tippte ihm auf die Schulter. Er zuckte zusammen, als hätte ich ihn aus einem tiefen Traum gerissen, und blickte zu mir auf. Whoa. Er sah gut aus. Ziemlich gut, um genau zu sein. Sein Haar war blond und ein wenig zerzaust, und er hatte unverschämt blaue Augen. Seine Haut besaß eine gesunde Bräune, als würde er viel Zeit in der Natur verbringen. Oder am Strand. Ja, wenn ich es mir genau überlegte, hätte er gut auf ein Surfbrett gepasst. Oder in einen dieser Werbespots für Beachwear. Während mein Kopfkino vollends mit mir durchging, nahm er einen In-Ear-Kopfhörer aus seinem Ohr. Und dann tat er etwas, das mich noch mehr aus der Bahn warf: Er lächelte. Ein warmes, sympathisches Lächeln, das perfekte Grübchen in seine Wangen zauberte.
»Hey«, sagte er.
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich ihn nach wie vor anstarrte.
»Hey.« Ich räusperte mich und spürte, wie mir eine leichte Röte in die Wangen kroch. »Sorry, dass ich dich störe, aber könnte ich mir dein Netzteil leihen? Mein MacBook geht gleich aus, und ich hab meins zu Hause vergessen.« Hoffentlich klang das nicht wie die mieseste Anmache auf der ganzen Welt.
»Klar«, erwiderte er völlig entspannt. »Ich brauch’s gerade eh nicht. Aber du musst hierher kommen.« Mit dem Daumen zeigte er auf den freien Tisch neben sich. »Da vorne sind keine Steckdosen.«
»Oh. Okay.«
Im Nu packte ich meine Sachen zusammen und gab Olive ein Zeichen, dass ich umsiedeln würde. Mit meiner Tasse in der Hand und meinem Notebook unterm Arm lief ich zurück an seinen Tisch. Er stöpselte gerade das Netzteil ab und reichte es mir – mit einem weiteren Lächeln, das mindestens einen eigenen Song verdient hatte. Als ich es entgegennahm, berührten sich unsere Hände. Es war nur ein flüchtiges Streifen, aber ich spürte, wie rau seine Fingerkuppen waren. Ob er Gitarre spielte? Einen albernen Moment lang sah ich ihn mit einer Ukulele an irgendeinem Strand sitzen.
»Danke«, sagte ich und hoffte, dass meine Wangen nicht so rot waren, wie sie sich anfühlten. Erleichtert ließ ich mich auf den Stuhl sinken. »Du rettest mir das Leben.«
»Mit einem Netzteil? Wow. MacGyver ist ein Loser im Vergleich zu mir.« Er grinste spitzbübisch.
»Ist das dieser Kerl, der sich aus Salatöl und Seifenblasen ein Flugzeug baut?«
»Genau der. Obwohl ihm vermutlich eine Büroklammer reichen würde.« Er grinste erneut, und seine Grübchen wurden so tief, dass man darin versinken wollte.
»Ich hab die Serie nie gesehen«, gestand ich. »War vor meiner Zeit.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich kenne auch nur die Memes.«
»Wenn du so weitermachst, wirst du noch eins.« Schmunzelnd wedelte ich mit dem Netzteil, bevor ich es mit meinem Notebook koppelte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass auch er sich wieder seiner Arbeit widmete, und ein merkwürdiger Anflug von Bedauern machte sich in mir breit. Irgendwie hätte ich mich gerne länger mit ihm unterhalten. Ihn nach seinem Namen gefragt und woran er arbeitete. Ob er von hier stammte. Warum er so verdammt schöne Augen hatte. (Okay, Letzteres wahrscheinlich nicht.) Aber ich hatte nur noch 43 – 42! – Minuten, um diesen verflixten Artikel zu schreiben. Und absolut keinen Platz in meinem Leben für cute Surferboys, die 250 Meilen entfernt wohnten. Mit einem Hauch Wehmut widmete ich mich meinen Notizen. Für den Artikel hatte ich nicht nur Stimmen im City Park eingefangen, sondern auch mit der zuständigen Stelle im Denver City Council Kontakt aufgenommen. Die Kaffeetasse an den Lippen, überflog ich meine Stichpunkte und verschaffte mir einen Überblick. Dann haute ich in die Tasten. Mit Zeitdruck konnte ich gut umgehen, was im Journalismus unabdingbar war. Er blockierte oder hemmte mich nicht. Manchmal mochte ich es sogar, wie er mein Adrenalin in Wallung brachte, mich pushte. Das war zwar heute nicht der Fall, aber dreißig Minuten später hatte ich tatsächlich einen vorzeigbaren Artikel geschrieben. Es war nicht der beste, den ich je fabriziert hatte, aber er würde Jules zufriedenstellen und dafür sorgen, dass ich meinen Job behielt. Erleichtert setzte ich einen Schlusspunkt hinter den letzten Satz, darunter mein Kürzel »mag«. Nachdem ich meinen Text noch einmal überflogen hatte, öffnete ich mein Mailprogramm, verfasste eine Nachricht an Jules und hing das Dokument an. Ich wollte die Mail gerade abschicken, als mir einfiel, dass ich ein witziges Foto von einem Eichhörnchen gemacht hatte, als ich Besucher im City Park interviewt hatte. Ob die Redaktion Verwendung dafür hatte, wusste ich nicht, aber wenn es abgedruckt wurde, bekam ich noch ein paar Dollar obendrauf, also warum nicht. Via AirDrop schickte ich das Foto von meinem Smartphone auf meinen Laptop und dankte Steve Jobs ein weiteres Mal dafür, dass er diese einfache Art der Datenübertragung möglich gemacht hatte. Nachdem ich die Mail abgeschickt hatte, stieß ich erleichtert die Luft aus. Punktlandung. Die Anspannung in meinen Schultern löste sich. Ich schloss die Augen, um sie im selben Moment wieder zu öffnen, weil mein Handy auf der Tischplatte vibrierte und den Eingang einer AirDrop-Datei meldete. Hatte ich irgendetwas falsch gemacht? Mir die Datei versehentlich selbst geschickt? Aber sie stammte nicht von mir, stellte ich mit Blick aufs Display fest. Sondern von »MacGyver«.
»Sorry, ich hab versehentlich eine Grafik an dich geschickt.«
Ich sah auf und blickte wieder in diese unfassbar blauen Augen.
»Dein MacBook heißt MacGyver?«, folgerte ich belustigt.
»Und deins MagBook.«
»Ja. Das ist mein Spitzname. Ich heiße Maggy.« Verlegen verdrehte ich die Augen. »Deswegen … MagBook.« Ich legte den Kopf schief und deutete mit dem Zeigefinger auf seine Brust. »So viel zu: Ich kenne nur die Memes. Gib’s zu, du bist ein Fanboy.«
In einer verlegenen Geste fuhr er sich mit der Hand in den Nacken und murmelte: »Keep calm and ask yourself: What would MacGyver do?«
Ich musste lachen. »Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was du mir da geschickt hast, MacGyver. Eine Bastelanleitung für Wasserstoffbomben?« Ich klickte die Datei an. Ein buntes Balkendiagramm füllte mein Display aus. »Holzbauquote in den USA, 1980 bis 2020«.
»Nur eine langweilige Statistik für meine langweilige Masterarbeit.« Übertrieben bedauernd zuckte er mit den Schultern.
»Was studierst du?«
»Architektur.«
»Oh«, stieß ich überrascht aus.
Er lachte. »Ist das so abwegig?«
»Ich weiß nicht, in meiner Vorstellung tragen Architekten Nerdbrillen und schwarze Rollkragenpullover.« Meine Augen huschten zu der Dose Cherry Coke auf seinem Tisch. »Und sie trinken Kaffee.«
»Na ja, ich bin ja auch noch keiner«, bemerkte er schmunzelnd.
»Darf ich euch noch was bringen?«
Ohne dass ich es bemerkt hatte, war Olive an unsere Tische herangetreten. Ihr Blick huschte interessiert zwischen mir und MacGyver hin und her, und mir fiel auf, dass ich ihn gar nicht nach seinem Namen gefragt hatte.
»Für mich nicht, ich muss los«, sagte er zu meinem Bedauern und zog einen abgewetzten Ledergeldbeutel aus seiner Hosentasche. Seine grauen Baumwollshorts rutschten ein Stück hoch und lenkten meinen Blick auf einen gebräunten Oberschenkel. Die feinen goldenen Härchen darauf.
»Das war nur die Coke bei dir, oder?«, versicherte sich Olive, woraufhin er nickte.
»Die geht auf mich«, sagte ich rasch.
Er wollte protestieren, aber ich ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Das ist das Mindeste.« Ich stöpselte das Netzteil ab und reichte es ihm, und für den Bruchteil einer Sekunde keimte der absurde Wunsch in mir auf, unsere Hände würden sich noch einmal berühren. Aber diesmal taten sie es nicht.
»Danke. Wäre aber echt nicht nötig.«
Er verstaute Notebook und Ladegerät in einem Case und erhob sich. Ein Teil von mir wollte ihn aufhalten. Ihn daran hindern zu gehen. Frag ihn nach seinem Namen, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Frag ihn nach seiner Nummer! Frag! Ihn! Irgendwas! Jetzt!
»Bye, MagBook.«
Unsere Blicke trafen sich. Eine Sekunde. Zwei Sekunden. Zu lange. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Das war mir noch nie passiert. Schon gar nicht bei einem Kerl, den ich gefühlt seit einer Minute kannte. Es kostete mich meine gesamte Willenskraft, »Bye, MacGyver« zu erwidern.
Kurz glaubte ich, er würde noch etwas sagen, aber seine Lippen blieben verschlossen. Mit einem unergründlichen Lächeln wandte er sich ab, und mich durchzuckte die alberne Erkenntnis, dass er sogar von hinten gut aussah. Seine Shorts saßen perfekt, und das schmal geschnittene Shirt brachte wohlgeformte Arme zum Vorschein.
Auf dem Weg zur Tür verabschiedete er sich von Olive, die gerade zwei Gläser mit grünem Saft füllte. Kurz bevor er die Tür erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um. Sah mich so intensiv an, als wollte er sich mein Gesicht einprägen. Mein Atem stockte, als er lächelte. Ein wenig nachdenklich, ein wenig wehmütig. Dann war er weg. Ließ mich zurück mit einem wild klopfenden Herzen und der Frage, was hätte sein können. An einem anderen Tag. Unter anderen Umständen.
»Sind dann vier Dollar neunzig«, sagte Olive, als ich kurz darauf ebenfalls zahlte.
»Seine Coke hast du vergessen.«
Sie schüttelte den Kopf, und ich runzelte die Stirn.
»Die Preise hier sind wohl ein bisschen anders als in Denver?«, bemerkte sie amüsiert.
»Ein bisschen, ja«, murmelte ich ungläubig und gab ihr meine Kreditkarte.
»Bleibst du eigentlich länger in Palisade?«
Mein Magen verkrampfte sich bei ihrer Frage. »Wahrscheinlich nicht«, antwortete ich ausweichend.
»Schade. Aber vielleicht läuft man sich ja mal in Denver über den Weg«, sagte sie breit lächelnd und fügte »Falls das mit der DU klappt« hinzu.
»Das wäre schön, ja. Ich drück dir die Daumen.«
Sie reichte mir die Karte. »Hat mich gefreut …?«
»Maggy«, sagte ich lächelnd. »Mich auch.«
Ich klappte mein MacBook zu und verstaute es im Case. Als ich mich erhob, glitten meine Augen für den Bruchteil einer Sekunde zu dem leeren Tisch neben mir, und irgendwie wurmte es mich, dass ich nie erfahren würde, wie der Kerl mit den blauen Augen hieß. Unter dem lautstarken Brummen des Mixers verließ ich das Very Berry. Als ich in meinem Wagen saß, versuchte ich, mich zu sammeln. Mich wieder darauf zu besinnen, warum ich eigentlich hier war. Nicht, um mich Hals über Kopf in irgendeinen Fremden zu verknallen. Mit zittrigen Fingern gab ich das nächste Ziel ins Navi ein: Cherry Hill.
Kapitel 2
Fünf Tage zuvor
Es war zwei Uhr morgens, als ich aus dem Schlaf schreckte und mir den Kopf anstieß, weil mein Smartphone lautstark »Bad Guy« abspielte. Auch ohne den Schmerz wäre ich sofort hellwach gewesen. Wenn Telefone zu diesen Uhrzeiten klingelten, bedeutete das nie etwas Gutes. Als ich einen Blick aufs Display warf, zögerte ich. Es war eine Nummer aus dem Ausland. Meine Eltern! Der Schock der Erkenntnis vertrieb das letzte bisschen Müdigkeit.
»Ja?«, meldete ich mich mit alarmierter Stimme und wappnete mich für das Schlimmste.
Ihre Mutter hatte einen Unfall … Ihr Vater ist im Krankenhaus … Ihre Mutter ist …
»Maggy? Na endlich! Ich dachte schon, du gehst gar nicht mehr ran!«
… quietschfidel.
»Ich hab geschlafen«, erwiderte ich erleichtert und verwirrt zugleich. »Was ist denn los?«
»Oh. Bei dir ist ja noch Nacht. Das hab ich ganz vergessen.« Ihr schlechtes Gewissen hielt ganze drei Sekunden lang an. »Könntest du mir einen Gefallen tun und mein Impfbuch suchen? Es müsste in der Kommode im Schlafzimmer sein.«
»Dein Impfbuch?«
»Ich bin mit der Hand an einem rostigen Nagel hängen geblieben. Nicht weiter schlimm, aber dein Vater hat darauf bestanden, dass ich zur Schiffsärztin gehe. Und die will jetzt wissen, wann ich das letzte Mal gegen Tetanus geimpft wurde.«
»Okay«, seufzte ich, tastete nach meiner Nachttischlampe und knipste das Licht an. Meine Augen brauchten einen Moment, bis sie sich an die Helligkeit gewöhnt hatten. »Wo seid ihr denn gerade?«, fragte ich und schwang die Beine aus dem Bett.
»Wir haben heute in Livorno angelegt und einen Ausflug nach Pisa gemacht. Der Turm ist wirklich genauso schief wie auf den Bildern. Dein Vater hat eins dieser albernen Fotos gemacht. Du weißt schon, wo es so aussieht, als würde man den Turm mit einer Hand stützen.«
»Hm«, raunte ich auf dem Weg ins Schlafzimmer meiner Eltern.
»Morgen geht es weiter nach Sizilien. Erst Neapel, dann Palermo. Oder erst Palermo und dann Neapel? Ich weiß es gar nicht.«
Während meine Mutter munter vor sich hin blubberte, vom Pooldeck, ihrer Kabine und dem Captain’s Dinner schwärmte, schaltete ich das Licht in ihrem Schlafzimmer an. Das Bett war ordentlich gemacht, die Tagesdecke glatt gezogen, und die Zimmerpflanze auf dem Fenstersims ließ ihre Blätter hängen. Für einen Außenstehenden musste es so aussehen, als wären meine Eltern bereits seit Wochen auf ihrer Kreuzfahrt, und nicht erst seit ein paar Tagen.
»Ist zu Hause alles okay?«, erkundigte sie sich. »Denkst du dran, die Blumen regelmäßig zu gießen?«
Unbehaglich schielte ich zur Zimmerdecke, als würde ich dort eine Kamera vorfinden.
»Hm«, raunte ich und steuerte auf die Kommode neben dem Bett zu.
»Was hast du heute Schönes gemacht? Genießt du deine Semesterferien?«
Ich verkniff mir den Hinweis, dass ihr Heute mein Gestern war.
»Ich war mit Zoe beim Yoga, und nachmittags hab ich Besucher im City Park interviewt. Für einen Artikel.« Das Handy zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt, zog ich die oberste Schublade auf und stieß auf ein heilloses Chaos. Moms Schmuckkästchen, verschiedene Nagellacke, eine Digitalkamera, ein ausrangiertes Smartphone, eine Santa Biblia, die fast auseinanderfiel. »Also wo genau soll dein Impfbuch sein?«
»In der obersten Schublade müsste so eine Blechdose sein.«
Blechdose? Meine Augen scannten das Durcheinander und wurden fündig.
»Hab’s.« Ich griff nach dem kleinen Büchlein, das schon bessere Tage gesehen hatte. »Du solltest dir echt mal einen digitalen Impfpass zulegen, mamá.«
»Jaja, ich weiß.« Ihrem leicht genervten Tonfall entnahm ich, dass sie das heute nicht zum ersten Mal hörte.
»Also«, sagte ich gedehnt und blätterte, bis ich die entsprechende Seite gefunden hatte. »Wenn ich das hier richtig verstehe, war die letzte Auffrischungsimpfung … 2016. Oder 2014. Kann die Schrift nicht entziffern.« Mein Satz ging in ein Gähnen über. »Soll ich dir ein Foto davon machen?«
Sie wechselte vom Spanischen ins Englische und sprach mit einer Frau im Hintergrund.
»Nein, die Ärztin sagt, das wäre beides okay. Danke!«
»Gut, dann geh ich jetzt«, erneut schluckte ein Gähnen meine Worte, »wieder ins Bett.«
»Mach das. Und danke für deine Hilfe.«
»Nacht, mamá.«
»Schlaf schön, mi vida.«
Ich wollte das Impfbuch zurück in die Blechdose legen, als mir ein Zeitungsausschnitt mit einem Foto von mir ins Gesicht sprang. Magnolia Rios ist die neue Buchstabierkönigin der D’Evelyn Junior High, prangte darüber. Meine Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln, als ich mein elfjähriges Ich betrachtete. Die Brille, die Zahnspange, die Zöpfe. In der Dose befanden sich noch weitere Artikel, die Mom fein säuberlich ausgeschnitten hatte. Magnolia Rios setzt sich im County durch. Und ein neuerer Artikel. State Champion Magnolia Gardner hält Abschlussrede. Selbst um zwei Uhr morgens rührte es mich, dass meine Mutter all diese Artikel aufbewahrt hatte. Ich wollte sie zurück in die Blechdose legen, als mir etwas ins Auge stach. Eine Todesanzeige aus dem Internet, ausgedruckt in schlechter Qualität.
Gerald McCarthy
*1965 †2018
Let me dry your tears.
Let me calm your fears.
Even if you cannot see me,
I am here.
I am in the sunlight
and in the stars at night.
I am in the rain,
in your joy, your pain.
I will always be there.
In Liebe
Deine Frau Carol
Deine Töchter Juniper, Lilac und Poppy
»Gerald McCarthy«, murmelte ich nachdenklich. »Gerald.«
Der Name löste etwas in mir aus. Eine vage Erinnerung an eine Unterhaltung, die ich vor sehr langer Zeit mit meiner Mutter geführt hatte, blitzte auf. Ich musste acht oder neun gewesen sein. Wir hatten in der Schule unseren Familienstammbaum zeichnen sollen, und ich war mit meiner besten Freundin in Streit geraten.
»Zoe hat behauptet, dass Randall nicht mein richtiger Dad ist, weil er schwarz ist und ich nicht.«
»Unsinn. Natürlich ist Randall dein richtiger Dad.«
»Zoe sagt aber, er ist nicht mein bilogischer Dad.«
»Biologisch heißt das, mi vida.«
»Und was bedeutet das?«
»Es bedeutet, dass Randall und du … nicht blutsverwandt seid. Aber er ist trotzdem dein Dad.«
»Aber wenn Randall nicht mein bi…olog…ischer Vater ist, wer dann?«
»Sein Name ist Gerald, aber er spielt keine Rolle in unserem Leben.«
»Warum nicht?«
»Weil er bereits eine andere Familie hat.«
»Können wir ihn mal besuchen?«
»Nein, mi vida, das können wir nicht.«
»Wieso?«
»Er würde uns nicht sehen wollen.«
»Warum weinst du, mamá?«
»Weil ich sehr traurig bin.«
Die Stimmen in meinem Kopf verklangen, und meine Augen huschten zurück zur Todesanzeige. Zu diesem Namen. Konnte das sein? War dieser Mann jener Gerald, den meine Mutter damals erwähnt hatte? Mein leiblicher Vater? Gerald war kein allzu häufiger Name in den USA. Außer unserem ehemaligen Präsidenten Gerald Ford fiel mir niemand ein, der so hieß. Ich ließ mich auf die Bettkante sinken und stierte auf das Papier in meiner Hand, suchte nach weiteren Anhaltspunkten. Dabei hätten sie mir ohnehin nichts gebracht. Ich wusste nahezu nichts über meinen Erzeuger. Nachdem meine Mutter damals in Tränen ausgebrochen war, hatte ich mich eine ganze Weile lang nicht mehr getraut, das Thema anzusprechen. Als Teenager hatte ich es noch ein paar Mal versucht, aber Mom hatte immer abgeblockt, und irgendwann hatte ich akzeptiert, dass sie über diesen Teil ihrer Vergangenheit nicht sprechen wollte. Es war auch nicht so, dass ich meinen Erzeuger in irgendeiner Weise vermisst hatte. Ich hatte einen großartigen Vater. Einen, der mir nicht nur seinen Nachnamen geschenkt hatte, sondern auch Liebe. Der mir Geschichten vorgelesen und mich ins Bett gebracht hatte. Mit mir in den Zoo gegangen war und zum Entenfüttern in den Park. Der mir Fahrrad- und Skifahren beigebracht und an Weihnachten für mich Santa gespielt hatte. Da war nur diese eine Sache gewesen, die ich als Kind schmerzlich vermisst hatte: Geschwister. Mom und Dad hatten es jahrelang versucht und schließlich herausgefunden, dass Dad zeugungsunfähig war.
Ich schielte auf die Namen unter der Todesanzeige. Die Namen der Töchter. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Juniper, Lilac, Poppy. Wacholder, Flieder, Mohn. War es ein Zufall, dass sie alle botanische Namen trugen? Dass auch ich einen hatte? Magnolia. Ich hatte mich immer mal wieder gefragt, warum meine Mutter mir keinen mexikanischen Namen gegeben hatte, und es darauf zurückgeführt, dass sie mir den bestmöglichen Start in einem Land ermöglichen wollte, in dem nach wie vor keine Chancengleichheit herrschte. Was, wenn es einen ganz anderen Grund dafür gegeben hatte? Mein Puls beschleunigte. Es gab nur eine Person, die mir diese Frage beantworten konnte. Von einem plötzlichen Aktionismus getrieben, wählte ich Moms Nummer.
»Hieß mein Vater Gerald McCarthy?«, fiel ich mit der Tür ins Haus, als sie den Anruf entgegennahm.
Sekundenlang war es still am anderen Ende der Leitung, und in meinem Magen sammelte sich eine unangenehme Anspannung.
»Mom«, sagte ich eindringlich. »War Gerald McCarthy mein Vater?«
»Darüber sollten wir nicht am Telefon sprechen«, kam es stockend zurück.
»Also stimmt es. Dieser Mann … war mein leiblicher Vater?«
»Woher weißt du das?«
»Du hast seine Todesanzeige aufgehoben.«
Sie schwieg.
»Warum hast du mir das nicht erzählt? Dass er gestorben ist?«
»Ich hab erst letztes Jahr davon erfahren.«
»Wie?«
Sie zögerte. »In der Post war ein Artikel über dieses Festival in Palisade. Eine seiner Töchter organisiert es offenbar, und in dem Interview hat sie erwähnt, dass ihr Vater verstorben ist. Da hab ich zu googeln begonnen.«
»Du hättest es mir sagen müssen«, fuhr ich sie an, während in meinem Kopf »Palisade« nachhallte. War das der Ort, an dem er gelebt hatte?
»Du kanntest ihn doch gar nicht«, sagte sie sanft.
»Ja, und wessen Schuld ist das?«, kam es bitter aus meinem Mund.
»Maggy …«
»Er war mein Vater!«
»Nein, das war er nicht. Ein Vater ist da, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Er ist da, wenn es nicht schlafen kann, wenn es Albträume hat.« Meine Mutter sprach schneller. Wie immer, wenn sie emotional war. »Er ist da, wenn man vor Schmerzen nicht schlafen kann, weil man eine Brustentzündung hat. Wenn man nicht weiß, wie man die Miete bezahlen soll. Wenn man Angst hat, krank zu werden.« Sie atmete hörbar durch. »Gerald war nie für uns da, Maggy. Nicht für dich. Und nicht für mich. Es spielt keine Rolle, wer er war. Und es spielt keine, ob er noch lebt.«
Ich schluckte, nahm mir einen Moment, um ihre Worte sacken zu lassen.
»Was, wenn es für mich eine Rolle spielt? Du hättest diese Entscheidung nicht ohne mich treffen dürfen.«
»Ich wollte dir nur Kummer ersparen.«
Ich glaubte ihr, dass sie mich hatte schützen wollen. Vermutlich hätte ich dasselbe getan an ihrer Stelle. Und trotzdem war da dieses hässliche Gefühl, betrogen worden zu sein. Ich stierte auf die Todesanzeige in meiner Hand. Achtzig Gramm Papier, die sich plötzlich dreimal so schwer anfühlten.
»Ich habe drei Schwestern.« Schwestern. Wie fremd sich dieses Wort auf meiner Zunge anfühlte. »Wusstest du das?«
»Ja«, räumte sie ein. »Wobei … Damals hatte er erst zwei Töchter.«
Mir fiel auf, dass ich zitterte, und das lag nicht an den kalten Dielen oder der Tatsache, dass ich nur ein Trägertop trug.
»Denkst du … denkst du, sie wissen von mir?«
»Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich nicht.«
Ich hielt den Atem an und rang um Fassung, während die Tragweite der Ereignisse immer stärker in mein Bewusstsein drängte. Und dann nahm ich all meinen Mut zusammen und stellte die alles entscheidende Frage: »Was ist damals passiert, Mom?«
Ich rechnete fest damit, dass sie abblocken würde. Stattdessen stieß sie lautstark Luft aus und sagte zittrig: »Okay. Dann führen wir jetzt dieses Gespräch.«
Ich hielt den Atem an und wartete darauf, dass sie weitersprach.
»Du weißt ja, dass ich als Erntehelferin gearbeitet habe, bevor du geboren wurdest.«
»Ja«, sagte ich mit dünner Stimme.
»Eigentlich wollte ich damals nach Kalifornien. Ein entfernter Verwandter meiner Mutter arbeitete auf den Melonenfeldern im Central Valley und meinte, dort gäbe es Arbeit. Aber ich konnte kaum Englisch und bin versehentlich in den falschen Bus gestiegen. So bin ich in Colorado gelandet.«
Diese Geschichte wiederum kannte ich noch nicht.
»Ich hatte nicht genug Geld, um mir ein zweites Busticket zu kaufen, also musste ich mir vor Ort eine Arbeit suchen. Aber das war schwerer als erwartet. Ich war eine junge Frau ohne Papiere, klein und nicht sonderlich kräftig. Außerdem war ich zu früh dran. Die Erntesaison hatte noch nicht mal begonnen.« Sie stockte. »Die Farmer haben mich der Reihe nach weggeschickt. Ich war völlig verzweifelt, hatte kein Geld, kein Essen, kein Dach über dem Kopf.«
Ihre Stimme brach, und mein Herz zog sich zusammen.
»Cherry Hill war meine letzte Anlaufstelle. Meine letzte Hoffnung.«
Cherry Hill, wiederholte ich in Gedanken. Was für ein klangvoller Name. Bilder von sattgrünen Wiesen und voll behangenen Obstbäumen taten sich vor mir auf.
»Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich dort keine Arbeit gefunden hätte.«
Ihr Tonfall ließ mich frösteln. Vielleicht beeilte ich mich deswegen zu sagen: »Aber du hast Arbeit gefunden.«
»Ja. Gerald … dein … Vater … hatte Mitleid mit mir, glaube ich.« Ein geseufztes Lächeln drang durchs Telefon an mein Ohr. »Rückblickend muss ich sagen, dass er wohl der erste freundliche Mensch war, der mir in den USA begegnet ist. Der Erste, der mich nicht angesehen hat, als wäre ich … Dreck unter den Fingernägeln.«
Ich schluckte schwer.
»Bis zum Beginn der Erntesaison durfte ich in einem der Trailer hinter dem Farmhaus wohnen. Es war eine einfache Unterbringung, aber ich hatte seit Langem wieder ein Gefühl von … Sicherheit. Und da waren diese wunderschönen Magnolienbäume, wenn ich aus dem Fenster gesehen habe.« Ihre Stimme wurde melancholisch. »Sie haben mich an mein Zuhause erinnert. An den Garten deiner Großmutter.« Meine Mutter machte eine Pause, als müsste sie sich sammeln. »Ich hab den ganzen Sommer auf Cherry Hill verbracht. Bei der Ernte geholfen und auf der Farm. Die Arbeit hat mich an meine körperlichen Grenzen gebracht, und es war so unerträglich heiß«, seufzte sie. »Eines Tages bin ich in der Mittagshitze zusammengeklappt. Einfach von der Leiter gefallen.«
Meine Hand griff fester um mein Smartphone.
»Gerald war in der Nähe und hat mich zu einem Arzt gebracht. Ich war nicht versichert und wollte das nicht, aber er hat so getan, als würde er mich nicht verstehen. Auf der Autofahrt hab ich dann herausgefunden, dass er eigentlich gut Spanisch sprach.« Ein schwaches Schmunzeln drang an mein Ohr. »Wir haben uns unterhalten. Er hat mich nach meiner Heimat gefragt, nach … meiner Familie und … ich bin in Tränen ausgebrochen. Damals war ich etwa sechs Wochen von zu Hause weg gewesen. Ich hatte meine Familie in Mexiko schrecklich vermisst. Mein Zuhause. Mein Leben.« Kurz war es still am anderen Ende der Leitung. »Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat sich für mich leider … sehr begrenzt angefühlt.« Ihre Stimme brach, und ich hörte, dass sie gegen die Tränen kämpfte. Am liebsten hätte ich mich zu ihr gebeamt und sie umarmt.
»Er hat mich getröstet«, fuhr sie leise fort und schob rasch nach: »Auf eine rein freundschaftliche Art. Er war einfach … da. Hat mir zugehört.« Sie klang nachdenklicher, als sie sagte: »Aber ich glaube, das war der Moment, in dem sich etwas verändert hat. In dem ich ihn zum ersten Mal nicht als Chef gesehen habe, sondern als Mann. Ich wusste, dass das falsch war. Er war verheiratet, hatte Kinder. Und ich hätte niemals etwas in diese Richtung unternommen, wenn …« Sie brach ab, und es wurde still.
»Wenn?«, flüsterte ich vorsichtig.
Sie zögerte. »Wenn da nicht dieser eine Abend gewesen wäre.«
Kapitel 3
Ich hatte mir Cherry Hill bei Google Earth angesehen und wusste, dass die Farm etwas außerhalb von Palisade lag, weshalb es mich nicht wunderte, dass mich mein Navi wieder aus der Stadt hinauslotste. Ich passierte eine Brücke und folgte eine Weile der Straße, die sich idyllisch durch die Landschaft schlängelte. Zu meiner Rechten und Linken markierten Verkaufsstände den Eingang zu anderen Farmen. In Schubkarren, Kisten und Scheffeln wurden Obst, Gemüse und regionale Produkte angeboten. Ich hatte gelesen, dass die Menschen hier hauptsächlich vom Obst- und Weinbau lebten, was ungewöhnlich für Colorado war. Eigentlich lag unser Staat zu hoch, aber die vielen Sonnentage und der mineralhaltige Boden begünstigten die landwirtschaftliche Nutzung.
»In 200 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Das Ziel liegt links«, meldete sich die sonore Frauenstimme und trieb meinen Puls in die Höhe. Meine Hände griffen so fest ums Lenkrad, dass meine Knöchel weiß wurden. In den letzten Tagen und während der gesamten Autofahrt hatte ich diesen Moment in Gedanken durchgespielt, versucht, mich darauf vorzubereiten. Aber jetzt, wo es so weit war, fühlte ich nichts als Zweifel. Die Vorstellung, dass niemand mit mir rechnete, mich niemand erwartete oder in Empfang nehmen würde, machte mir Angst. Niemand dich hier haben will, ergänzte eine Stimme in meinem Kopf. Denn ich reiste mit einer Bombe im Gepäck und musste mir überlegen, wie und wann ich sie zündete.
Ein verbeulter Briefkasten auf einem Holzpflock schob sich in mein Blickfeld. Dahinter ein Schild mit der Aufschrift »McCarthy Family Orchard«. Ein Familienbetrieb. In meinem Magen verkrampfte etwas. Ich setzte den Blinker und bog auf einen lang gezogenen Schotterweg. Zu beiden Seiten erstreckten sich Obstwiesen, und in der Ferne entdeckte ich eine Ansammlung von Gebäuden. Ein großes Farmhaus und ein kleineres, versetzt daneben. Außerdem ein paar Schuppen und Scheunen. Direkt dahinter ragte eine sandsteinfarbene Bergkette in den Himmel. Das mussten die Book Cliffs sein, die sich von Colorado nach Utah erstreckten. Alles sah genauso aus wie auf den Fotos, die ich im Internet gefunden hatte. Nur noch schöner. Lediglich der Schotter, der unsanft gegen den Unterboden des Autos knallte, trübte die Idylle. Ich drosselte das Tempo und wünschte mir, ich könnte dasselbe mit meinem Puls machen. Zum Farmhaus waren es jetzt vielleicht noch hundert Meter. Hundert Meter, die mich von meinen Halbschwestern trennten. Juniper, Lilac und Poppy. Ihre Namen hatten sich unauslöschlich in mein Gedächtnis gebrannt. Sie waren der Grund, warum ich hergekommen war. Warum ich die Vergangenheit nicht Vergangenheit sein lassen konnte, wie meine Mutter es mir geraten hatte. Weil da diese unfassbare Sehnsucht in mir war. Sehnsucht, gepaart mit Neugier.
Ich parkte den Wagen neben einem rostroten Pick-up, der schon bessere Tage gesehen hatte, und stieg aus. Der Duft reifer Pfirsiche drang an meine Nase. Vielleicht bildete ich mir das auch nur ein, weil ich gelesen hatte, dass die Erntesaison bevorstand. Nervös befeuchtete ich meine Lippen und sah mich um. Das Farmhaus der McCarthys war riesig, strahlte mit seiner roten Holzverkleidung und den weißen Sprossenfenstern aber etwas überraschend Gemütliches aus. Mit Sicherheit lag das auch an der gepflegten Veranda, die an der Vorderseite entlanglief und einen riesigen Tisch und eine Hängeschaukel beherbergte. Blumenkübel und ein Windspiel baumelten von der Decke, und vor der Tür entdeckte ich einen Hundekorb. Der dazugehörige Hund fehlte allerdings. Überhaupt wirkte die Farm verlassener als erwartet. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich mir herumfahrende Traktoren und Pritschenwagen vorgestellt, Arbeiter in Canvasjacken, die Obstkisten durch die Gegend schleppten, Erntehelfer mit Tragekörben, die auf Leitern standen. Aber nichts dergleichen war zu sehen. Mit einem mulmigen Gefühl betrat ich die Veranda. Mein zittriger Zeigefinger näherte sich der Klingel, aber im letzten Moment zog ich die Hand wieder zurück und atmete tief durch. Vielleicht hätte ich doch lieber eine Mail schreiben oder anrufen sollen. Aber führte man solche Gespräche nicht besser persönlich? Von Angesicht zu Angesicht? Die Wahrheit war: Ich wusste es nicht. Es gab kein Handbuch für solche Fälle. Kein Regelwerk, das einem sagte, wie man vorgehen sollte, wenn man mit 22 Jahren herausfand, dass man drei Halbschwestern hatte. Ich drückte auf die Klingel und wartete. Nichts passierte. Kein Hund bellte, keine Schritte näherten sich. Ich versuchte es ein zweites Mal. Wieder blieb es ruhig. Vielleicht waren sie bei der Arbeit? Irgendwo … draußen? Auf dem … Feld? Nannte man das so auf einer Obstfarm? Unschlüssig lief ich zum äußeren Ende der Veranda und hielt Ausschau, aber ich sah keine Menschenseele. Zögerlich lief ich ein Stück ums Haus herum und entdeckte einen Mann, der mit dem Rücken zu mir vor einem Baum kniete.
»Entschuldigen Sie?«, rief ich ihm zu.
Er blickte über seine Schulter und blinzelte. Einmal, zweimal.
»Ich wollte nur fragen, ob Sie mir vielleicht sagen können, wo ich jemanden von der Familie McCarthy finde. Ich hab geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht.«
Er antwortete nicht sofort, und einen Moment lang glaubte ich, er hätte mich nicht verstanden. Seiner Hautfarbe und seinem Aussehen nach war er Latino. Anfang 50, schätzte ich. Vielleicht auch etwas jünger, aber sein schwarzes Haar und der Bart waren größtenteils ergraut. Er trug keine Arbeitskleidung, sondern eine dunkle Jeans und ein weißes Leinenhemd.
»Die sind wahrscheinlich noch oben auf dem Cherry Hill«, erwiderte er und deutete vage in die Ferne.
Sein Englisch war nahezu akzentfrei, hatte nur noch einen minimalen hispanischen Einschlag.
»Oh, ich dachte …« Irritiert sah ich mich um. »Ist das hier nicht alles Cherry Hill?«
»Doch, doch. Die Farm ist nach dem Hügel benannt.«
»Verstehe«, raunte ich.
Er musterte mich. Mein dezent geschminktes Gesicht, mein weißes T-Shirt und die dunkle Paperbag-Hose. »Wollten Sie zur Gedenkfeier? Die ist nämlich schon vorbei.«
»Gedenkfeier?«
Schlagartig machte sich ein flaues Gefühl in mir breit.
Er nickte. »Heute ist der fünfte Todestag von Mr. McCarthy.«
Der Schock fuhr mir wie ein Hieb in den Magen. »Das … wusste ich nicht.« Überfordert senkte ich den Blick, während sich die Gedanken in meinem Kopf überschlugen. Das Wort »Todestag« wie ein Ball auf und ab sprang.
»Miss?«
Seine Stimme drang nur gedämpft zu mir hindurch.
»Alles okay, Miss?«
Ich nickte, dabei war nichts okay. Ich musste hier weg. Auf der Stelle. Hätte nicht herkommen dürfen. Nicht heute. Nicht an diesem Tag. Vielleicht gar nicht.
»Miss?«
Verspätet, aber umso heftiger setzte mein Fluchtreflex ein.
»Ich muss los«, nuschelte ich und wandte mich von ihm ab.
Er sagte noch etwas, aber ich hörte es nicht mehr, weil sich meine Beine in Bewegung gesetzt hatten. Wie in Trance taumelte ich zurück zu meinem Wagen, kopflos und unkoordiniert. Ich stolperte über eine Wurzel und fing mich unelegant ab, aber es kümmerte mich nicht. Als ich um die Ecke bog und der SUV in Sichtweite war, strömte Erleichterung durch mich hindurch. Aber da hatte ich die Frau mit dem Cowboyhut noch nicht gesehen, die ihre Nase gegen die Fensterscheibe drückte.
Kapitel 4
Fünf Tage zuvor
Hältst du das echt für eine gute Idee?«
Ich löste meinen Blick von den Pfirsichbäumen und sah meine Freundin Zoe über den Rand meines Notebooks an. »Ich kann doch nicht einfach ignorieren, dass es sie gibt.«
»Na ja, sie haben bisher auch ignoriert, dass es dich gibt.«
»Vermutlich wissen sie gar nichts von mir.«
»Und was, wenn doch?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, oder?«
Sie beäugte mich skeptisch. »Ich hab kein gutes Gefühl, dich da hinfahren zu lassen, Mag.«
Ich rollte mit den Augen. »Du tust ja so, als würde ich in ein Krisengebiet reisen.«
»Könnte eins werden, wenn du ihnen sagst, wer du bist«, entgegnete sie trocken.
»Ich muss das tun, Zoe. Es lässt mir sonst keine Ruhe.«
Ein resoluter Ausdruck trat auf ihr Gesicht. »Okay, dann komme ich mit.«
»Nach Palisade?«, erwiderte ich ungläubig.
»Warum nicht?«
»Weil das die Sache nur noch komplizierter machen würde. Ich meine, wie soll ich das erklären? Hallo, ich bin Maggy, die Folge eines Seitensprungs Ihres verstorbenen Mannes. Und das ist meine beste Freundin Zoe, die Angst hat, Sie sperren mich in Ihren Keller?«
»Ich könnte im Auto warten.«
»Und dein Praktikum?«
Ab übermorgen würde Zoe ein sechswöchiges Praktikum bei IBM in Denver antreten. Sie hatte sich unter 50 überwiegend männlichen Bewerbern durchgesetzt und redete seit Wochen von nichts anderem.
»Dann bin ich eben einen Tag krank.«
»Gleich zu Beginn?«, zweifelte ich. »Und was ist, wenn ich länger bleiben will?«
Zoe schenkte mir einen weiteren sorgenvollen Blick. »Du solltest dir echt nicht zu viel erhoffen, Mag.«
Dass sie immer freiheraus sagte, was sie dachte, schätzte ich am meisten an meiner besten Freundin, aber in diesem Moment hätte ich mich über ihren Zuspruch gefreut. Zumal ich selbst wusste, dass mein Plan alle möglichen Lücken und Schwächen beinhaltete.
»Du weißt nicht, wie das ist, wenn man immer allein ist. Du bist mit vier Brüdern aufgewachsen«, erinnerte ich sie.
»Yep. Und ich hab dich jedes Mal beneidet, wenn mich einer von denen mit seinen Stinkesocken beworfen hat.«
»Ich wäre gerne von jemandem mit Stinkesocken beworfen worden.«
Sie schüttelte so rigoros den Kopf, dass die Perlen in ihren langen Braids klimperten. »Nicht, wenn sie wie die von Wes riechen.«
Wir lachten.
Eine Spur ernster sagte sie: »Ich hab einfach Angst, dass sie dir wehtun.«
»Das Risiko muss ich eingehen, fürchte ich.« Ich drehte den Laptop in ihre Richtung und zeigte ihr ein Foto meiner Halbschwestern, das ich auf der Website ihrer Obstfarm gefunden hatte. »Findest du, ich sehe ihnen ähnlich?«
Zoe rümpfte die Nase. »Deine Augenringe haben sie jedenfalls nicht.«
»Haha.«
»Wie lange hängst du jetzt am Laptop? Du solltest echt mal eine Pause machen und ein bisschen pennen. Duschen wäre auch eine Idee.«
»Ich finde, ich sehe der Ältesten ein bisschen ähnlich«, überging ich ihren Kommentar, wohl wissend, dass sie recht hatte. Seit dem Telefonat mit meiner Mom durchforstete ich pausenlos das Internet nach Infos über meinen Vater und seine Familie. Ich sah aus wie eine Teilnehmerin von Squid Game, trug noch meinen Pyjama, war ungekämmt, hatte nicht Zähne geputzt und mein Zimmer nur verlassen, um Zoe die Haustür zu öffnen. Nachdem ich ihr heute Nacht eine aufgelöste Sprachnachricht geschickt hatte, war sie um kurz nach acht mit Kaffee und Muffins vorbeigekommen. Ich hatte ihr eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs mit meiner Mom gegeben. Ihr alles erzählt, was ich wusste. Dass mein Vater Farmer gewesen war und in Palisade, Colorado, gelebt hatte. Dass die Familie eine Obstfarm namens Cherry Hill besaß. Dass Mom dort eine Saison gearbeitet hatte – ohne Papiere, aber mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Dass sie eine Nacht mit Gerald McCarthy verbracht hatte. Dass er sie danach weggeschickt hatte. Nun saßen wir hier gemeinsam auf meinem Bett und tüftelten an einem Plan, wie ich weiter vorgehen konnte.
»Ich finde, du siehst hauptsächlich deiner Mom ähnlich«, bemerkte Zoe nüchtern. »Und natürlich Ana de Armas.«