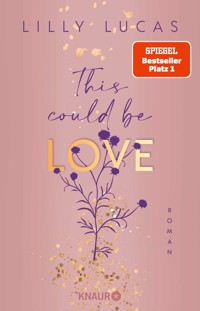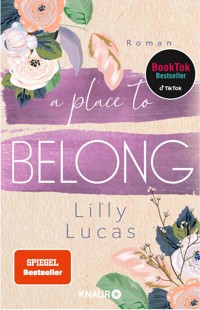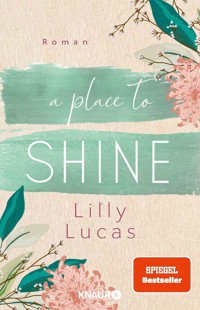
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Cherry Hill
- Sprache: Deutsch
Poppy McCarthy liebt viele Dinge. Country-Star Trace Bradley gehört nicht dazu. In »A Place to Shine«, dem 4. Band der New-Adult-Reihe »Cherry Hill« von Bestseller-Autorin Lilly Lucas, bekommt es Poppy aber ausgerechnet mit ihm zu tun … Poppy McCarthy ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. So auch eines Nachts, als sie Country-Star Trace Bradley bei einem Autounfall Erste Hilfe leistet und für seine Freundin gehalten wird. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit der vor fünf Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Die Nachricht breitet sich schnell aus, und Poppy und Trace geraten durch die aufdringliche Presse in Bedrängnis. Trace' Manager entwickelt eilig eine Story für die Medien, mit der sie den Trubel für sich nutzen können: Trace und seine Jugendliebe Poppy haben endlich zueinander gefunden. Jetzt müssen sie nur noch so tun, als wären sie verliebt … Bestseller-Autorin Lilly Lucas steht für Liebesromane zum Wohlfühlen mit traumhaft schönem Setting: Auf der zauberhaften Obstfarm »Cherry Hill« kann man sich wie in den Büchern ihrer New-Adult-Liebesroman-Reihe »Green Valley« ganz zu Hause fühlen. »Ich liebe die Dynamik, das Prickeln, die Atmosphäre - aber besonders die kleinen Lilly-Lucas-typischen Herz-setzt-einen-Schlag-aus-Momente.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Kathinka Engel Die New-Adult-Reihe »Cherry Hill« besteht aus den folgenden Liebesromanen: - A Place to Love (June & Henry) - A Place to Grow (Lilac & Bo) - A Place to Belong (Maggy & Flynn) - A Place to Shine (Poppy & Trace) Lust auf noch mehr New Adult von Lilly Lucas? Dann entdecke auch die Liebesromane der Hawaii Love-Reihe! Der erste Band ist »This could be love«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Lilly Lucas
A Place to Shine
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Poppy McCarthy ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. So auch eines Nachts, als sie Countrystar Trace Bradley bei einem Autounfall Erste Hilfe leistet und für seine Freundin gehalten wird. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit der vor fünf Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Die Nachricht breitet sich schnell aus, und Poppy und Trace geraten durch die aufdringliche Presse in Bedrängnis. Trace‘ Manager entwickelt eilig eine Story für die Medien, mit der sie den Trubel für sich nutzen können: Trace und seine Jugendliebe Poppy haben endlich zueinander gefunden. Jetzt müssen sie nur noch so tun, als wären sie verliebt …
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Country Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Epilog
Small Town Love
Danksagung
Für Kathinka
Cole wäre so eifersüchtig, wenn er wüsste,
dass du Songs für Trace schreibst.
Aber wir sagen es ihm einfach nicht.
I wasn’t looking for someone like you, yet there you were
Even though in reality moments like this never occur
When my lips touched yours time stopped
And in these seconds of eternity my heart dropped
I never wanted to let you go again
But in that kiss we both knew there and then
I had to
(Aus Small Town Love)
Country Playlist
Ingrid Andress feat. Sam Hunt – Wishful Drinking
Zach Bryan – Something in the Orange
Kameron Marlowe – Burn ’Em All
Nate Smith – Whiskey On You
Kane Brown – Thank God
LANCO – Born to Love You
Kelsea Ballerini – If You Go Down
Jimmie Allen – Best Shot
Luke Combs – Doin’ This
Cody Johnson – Til You Can’t
Cole Swindell – She Had Me At Heads Carolina
Kapitel 1
Es gab weitaus Schlimmeres im Leben als ein mieses Date. Tampons von Billigmarken, zum Beispiel. Minzschokolade. Die Herr-der-Ringe-Serie. Harte Avocados. Fettreduzierter Käse und die ungerecht kurze Lebenserwartung von Rotkehlchen (ein Jahr!). Schlechtes WLAN. Republikaner. Zweilagiges Toilettenpapier. Ja, es gab wirklich Schlimmeres, und trotzdem sah ich keinen Sinn darin, auch nur eine weitere Sekunde meines Lebens damit zu verschwenden, einem Kerl gegenüberzusitzen, der mich mit den Worten »Irgendwie dachte ich, du wärst kleiner« begrüßt hatte. Mit dem sich Gespräche anfühlten, als würde man durch zähen Schlamm waten. Der mich zwischenzeitlich Polly genannt und mir angeboten hatte, die Rechnung zu übernehmen, wenn ich auf ein Dessert verzichten würde.
»Ich muss leider gehen«, sagte ich, als ich von der Toilette zurückkehrte. »Meine Schwester hat gerade angerufen, dass ihr Freund Schluss gemacht hat. Sie ist total fertig.«
Parkers Augen huschten zu meinem Smartphone, das die ganze Zeit über auf dem Tisch gelegen hatte. Ups. Mein schlechtes Gewissen hielt ganze drei Sekunden lang an.
»Meine Nudeln und die Cola bezahl ich selbst.«
Ich zog ein paar Dollarscheine aus dem Geldbeutel und klemmte sie unter die Weinflasche mit den Wachstropfen, die als Kerzenhalter diente.
»Äh … ich glaube, das ist zu viel«, bemerkte er stirnrunzelnd.
»Der Rest ist für dein Dessert. Lass es dir schmecken.« Ich zwinkerte, und sein Mund klappte auf und zu wie bei einem dieser Nussknacker. Ehe er noch etwas sagen konnte, fischte ich meine Tasche von der Stuhllehne und steuerte den Ausgang des italienischen Restaurants an. Auf dem Weg zu meinem Wagen tippte ich eine Nachricht an meine Schwester Lilac.
Sorry.
Obwohl sie im Urlaub war – oder vielleicht deswegen – antwortete sie prompt.
Für was?
Hab dich und Bo gerade missbraucht, um Parker loszuwerden.
Als ich die Fahrertür aufzog, ging eine weitere Nachricht auf meinem Smartphone ein.
Wer ist Parker???
Niemand, den du jemals kennenlernen wirst …
So schlimm?
Schlimmer!
Auch wenn ich ein lachendes Emoji hinterherschickte, verspürte ich einen winzigen Stich im Herzen. Nicht, dass ich damit gerechnet hatte, in Parker, 24, Personalsachbearbeiter, die große Liebe zu finden. Dass er in die Top 3 meiner Dating Fails aufsteigen würde, war allerdings auch nicht geplant gewesen. Immerhin hatte er Oliver, 25, Sportlehrer, nicht vom Thron gestoßen. Der hatte mir erst meine Spaghetti ausreden wollen (»Du isst abends Kohlenhydrate? Mutig!«) und mir dann Tipps gegen Winkearme gegeben (»Noch hast du keine, aber sie werden kommen.«).
Ich ließ mein Handy in der Handtasche verschwinden und warf sie zu schwungvoll auf den Beifahrersitz, sodass sich ihr kompletter Inhalt im Fußraum verteilte. Ein genervtes Stöhnen entwich mir. Ich beugte mich über die Mittelkonsole und sammelte meinen Geldbeutel, ein paar Tampons und die Rechnung ein, die ich auf dem Weg zu meinem Date mit Parker aus unserem Briefkasten gefischt hatte. Mein Magen krampfte, als ich an die fünftausendsechshundert Dollar dachte, die ich unserem Installateur Hutch für die Solarheizungen schuldete. Ich würde ihn um etwas Aufschub bitten müssen. Und um Diskretion. Denn es kratzte nicht nur an meinem Kontostand, sondern auch an meinem Ego, dass ich die Rechnung nicht begleichen konnte.
Ich schob meine finanziellen Sorgen beiseite, schnallte mich an und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Der Motor begrüßte mich mit einem altersschwachen Zuckeln, das Radio mit Country-Gedudel. Sofort wechselte ich den Sender. Im Gegensatz zu Lilac konnte ich mit dieser Musikrichtung überhaupt nichts anfangen. Zu den Klängen von Good 4 u von Olivia Rodrigo bog ich aus der Parklücke und fuhr über die Patterson Road in Richtung Interstate. Um diese Uhrzeit waren es nur etwa fünfundzwanzig Minuten von Grand Junction nach Palisade, ein kleiner Ort in Westcolorado, den ich mein Zuhause nannte. Gemeinsam mit meiner ältesten Schwester June, ihrem Mann Henry, meiner Schwester Lilac und unserer Mom lebte ich dort auf einer Obstfarm namens Cherry Hill. Nachdem mein Vater vor fünf Jahren völlig unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben war, führten wir die Farm gemeinsam.
Ich ließ das Fenster einen Spalt runter und sog die milde Herbstluft ein, den Duft der letzten reifen Obstbäume, die hier im Mesa County gediehen. Auf Cherry Hill stand nur noch die Ernte der Stanleys aus, eine Pflaumensorte, die Ende September vom Baum musste. Für uns bedeutete das zwei bis drei Großkampftage, an denen jeder mitanpacken musste. Eventuell würde sogar meine Halbschwester Maggy aus Denver anreisen, um uns zu unterstützen. Gemischte Gefühle überkamen mich, als ihr Gesicht vor meinem inneren Auge aufblitzte. Wir hatten erst dieses Jahr von ihrer Existenz erfahren, und es hatte eine Weile gedauert, bis wir verarbeitet hatten, dass unser Vater ein Kind mit einer anderen Frau gehabt hatte. Aber das war nicht der Hauptgrund für mein Gefühlschaos. Maggy und ich hatten letzten Sommer beide Gefühle für Flynn entwickelt, meinen besten Freund. Auch wenn ich inzwischen begriffen hatte, dass Flynn und ich besser als Freunde funktionierten und er und Maggy ein Traumpaar abgaben, war die Situation noch ungewohnt. Unser Umgang miteinander glich derzeit einem Eiertanz, und ich fragte mich, wie es sein würde, wenn Maggy zum ersten Mal wieder zurück auf die Farm kam.
Ich verließ die Interstate und schlängelte die Landstraße entlang, die um diese Uhrzeit nahezu verlassen wirkte. Auf den ersten fünf Meilen kam mir nur ein einziges Auto entgegen – und ein Reh am Straßenrand, das glücklicherweise den Rückzug ins Gebüsch antrat, als meine Scheinwerfer es blendeten. Auch wenn in regelmäßigen Abständen Schilder vor Wildwechsel warnten, kam es auf dieser Strecke immer wieder zu Verkehrsunfällen.
Ich wollte gerade den Song lauter stellen, als etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Rücklichter, die als rote Punkte in der Dunkelheit aufleuchteten. Fünfzig, vielleicht hundert Meter entfernt. Erst mit zwei Sekunden Verspätung begriff ich, warum mich dieser Anblick so irritierte. Warum ich intuitiv vom Gas gegangen war. Warum mein Puls beschleunigte. Sie befanden sich abseits der Straße. Weit abseits der Straße.
»Bitte nicht«, flehte ich, obwohl ich ahnte, dass sich einer meiner schlimmsten Albträume bewahrheiten würde. An eine Unfallstelle zu gelangen. Nachts. Allein. Mit pochendem Herzen näherte ich mich den roten Lichtern, bis die Scheinwerfer meines Wagens das Ausmaß der Katastrophe offenbarten. Ein SUV war von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht.
»Fuck!«, stieß ich aus und tastete nach dem Warnblinker. In meiner Hektik erwischte ich den Scheibenwischer und zuckte zusammen, als er lautstark über die Frontscheibe quietschte. Ruhig, Poppy, ganz ruhig!, ermahnte ich mich und fuhr rechts ran. Tausend Gedanken schossen durch meinen Kopf, als ich die Fahrertür aufstieß und aus dem Auto stieg. Dass mein Erste-Hilfe-Kurs viel zu lange her war. Dass ich mein gesamtes medizinisches Wissen aus Arztserien hatte. Dass … ich auch die eine oder andere Crime-Serie gesehen hatte. Schlagartig blieb ich stehen. Verdammt! Ich war ganz allein hier draußen! Hatte keine Ahnung, wer in diesem Wagen saß. Ob jemand in diesem Wagen saß. Was, wenn das Ganze nur ein Trick war, um …? Ich wollte den Gedanken gar nicht zu Ende denken. Unsicherheit überfiel mich. Lähmte mich. Ich setzte mich wieder in meinen Wagen und fischte mein Smartphone vom Beifahrersitz. Mit zittrigen Fingern wählte ich 911 und schilderte die Situation. Ich klang aufgebracht, ganz anders als die Frau in der Notrufzentrale, die sich sachlich nach meinem Namen und Standort erkundigte.
»Können Sie erkennen, wie viele Personen im Fahrzeug sitzen, Miss McCarthy?«
»Nein, von hier aus sehe ich leider gar nichts. Es ist zu dunkel. Soll ich … Ich meine, muss ich … nachsehen?«
»Nicht, wenn Sie sich nicht sicher fühlen.«
»Aber was ist, wenn … Ich meine, was, wenn es um Minuten geht und jemand stirbt, weil ich … weil …« Meine Stimme überschlug sich fast. »Da könnte ein Kind …«
»Miss! Beruhigen Sie sich«, unterbrach sie mich sanft, aber bestimmt. »Sie haben allesrichtig gemacht. Hilfe ist unterwegs.«
»Und wie lange dauert das? Sie brauchen doch mindestens eine Viertelstunde hierher. Was, wenn jemand … wiederbelebt werden muss?«
Nicht, dass ich das könnte. Oder doch? Wie oft musste man noch mal pumpen, bevor man beatmete? 30 zu 2?
»Wir geben alles, um so schnell wie möglich bei Ihnen am Unfallort zu sein«, erwiderte sie und klang immer noch verdammt ruhig dabei. Aber ihre Ruhe übertrug sich nicht mal ansatzweise auf mich. Stattdessen hatte ich plötzlich Bilder von sterbenden Kindern vor Augen, von Menschen, die schreckliche Qualen litten. Und das nur, weil ich hier tatenlos herumsaß. Nein, das konnte ich wirklich nicht mit mir vereinbaren.
»Würden Sie vielleicht am Telefon bleiben, wenn ich nachsehen gehe?«
»Selbstverständlich. Wir können das zusammen machen.«
»Okay«, murmelte ich und atmete tief durch.
Das Handy am Ohr, stieß ich die Fahrzeugtür auf. Der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi schoss mir in die Nase, als ich aus dem Auto stieg. Hatte es vorhin auch schon so gestunken? Hatte das etwas zu bedeuten? Vielleicht, dass … nein. Autos explodieren nur in Hollywoodfilmen, Poppy, das weiß jedes Kind. Mit zögerlichen Schritten lief ich die Böschung hinab, auf die Scheinwerfer zu, die immerhin ein wenig Licht spendeten. Unter meinen Schuhen knirschten Glasscherben, aber da war noch ein anderes Geräusch. Ein Stöhnen. Mein Puls beschleunigte.
»Ich höre jemanden«, teilte ich der Frau am Telefon mit und beschleunigte meinen Schritt.
Ihre Antwort entging mir, weil ich das Smartphone vom Ohr nahm, um die Taschenlampe zu aktivieren. Soweit ich es erkennen konnte, war es ein dunkler SUV. Er musste die Böschung hinabgerutscht und gegen einen Baum geprallt sein. Die Kühlerhaube war eingedrückt und klebte regelrecht am Stamm. Die Fahrertür stand offen, das Glas war zersplittert.
Ein zittriges »Hallo?« verließ meinen Mund. »Kann mich jemand hören?«
Das Stöhnen verebbte schlagartig.
»Ich hab Hilfe gerufen. Der Krankenwagen ist schon unterwegs.«
»Poppy?!«, drang es aus dem Wagen. »Bist du das?«
Ich erstarrte. Denn ich kannte diese Stimme. Ich kannte diese Stimme, obwohl ich den Sender wechselte, sobald sie im Radio lief. Ja, es gab weitaus Schlimmeres als miese Dates. Auch weitaus Schlimmeres, als an eine Unfallstelle zu gelangen. Nämlich an eine Unfallstelle zu gelangen und Trace Bradley vorzufinden.
Kapitel 2
Was machst du denn hier?!«, platzte es aus mir heraus, nachdem ich das Innenlicht angestellt und mich versichert hatte, dass ich keine Halluzinationen hatte. Dass die Stimme wirklich zu Trace Bradley gehörte. Ausgerechnet Trace Bradley. Wobei ich mir einen Moment lang nicht sicher gewesen war. Mit seiner blutigen Nase und den Schrammen im Gesicht erinnerte er mich eher an einen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer als an einen umschwärmten Countrystar. Aber seine Stimme hätte ich aus Tausenden herausgehört. Dieses dunkle Timbre, das einem direkt in den Magen fuhr.
»Solltest du mich nicht so was fragen wie: Geht es dir gut?«, ächzte er und hob eine Braue.
»Miss? Ist alles okay bei Ihnen? Sind Sie noch dran?«, drang es besorgt aus meinem Smartphone.
Ich war so perplex, dass es mehrere Sekunden dauerte, bis ich ihr antworten konnte.
»Ja, ich bin noch dran. Alles okay.« Ich schüttelte den Kopf, so absurd war diese Situation. »Es ist nur eine Person im Wagen«, stakste ich. »Ein Mann.«
»Und er ist ansprechbar?«
Es klang eher nach einer Feststellung, trotzdem antwortete ich: »Ja, er«, mein Blick schweifte zu Trace, »ist ansprechbar.«
»Das ist gut. Ist er verletzt?«
Ich gab die Frage an ihn weiter.
»Meine Hand tut höllisch weh«, presste er hervor. »Und irgendwas stimmt nicht mit meinem Bein.«
»Haben Sie das gehört?«, fragte ich die Frau von der Rettungsleitstelle.
»Ja. Sagen Sie ihm, er soll sich so wenig wie möglich bewegen. Bleiben Sie bei ihm, bis der Rettungswagen da ist. Reden Sie mit ihm. Sorgen Sie dafür, dass ihm warm ist. Vielleicht gibt es eine Decke im Wagen.«
»Okay«, murmelte ich in der Hoffnung, mir alles merken zu können. Nicht bewegen … reden … Decke. »Danke, dass Sie drangeblieben sind.«
»Das ist mein Job«, sagte sie freundlich.
»Trotzdem danke.«
»Alles Gute Ihnen beiden.«
Ich legte auf, aber ihr letzter Satz hallte noch in meinem Kopf nach. Auch wenn ich wusste, was sie hatte ausdrücken wollen, hörte es sich falsch an. Als wären wir ein Brautpaar auf dem Standesamt.
»Hast du eine Decke im Auto?«, fragte ich Trace.
Er dachte nach. »Nur Brodys Hundedecke. Liegt im Kofferraum.«
»Perfekt.«
Er zog eine Braue hoch. »Dass es eine Decke gibt oder dass sie voller Sabber und Hundehaare ist?«
»Kann mich gerade nicht entscheiden«, murmelte ich und lief um den Wagen herum.
Der Kofferraum war verzogen und ließ sich nur mit viel Kraft öffnen. Zum Vorschein kamen ein Handgepäck-Trolley, ein Gitarrenkoffer, ein paar Bikerboots und eine zusammengelegte Decke, die tatsächlich mit Hundehaaren übersät war.
»Ich wusste nicht, dass du einen Hund hast«, sagte ich, als ich die Decke über ihn breitete. Ein strenger Geruch stieg mir in die Nase und lenkte mich davon ab, wie nah sich unsere Gesichter für einen Augenblick waren.
»Einen Bernhardiner. Erst seit ein paar Monaten.«
Seine Stimme klang nasal, und mir fiel auf, dass Blut aus seiner Nase tropfte.
»Airbags sind auch nicht mehr das, was sie mal waren«, fing er meinen Blick auf und rang sich ein angestrengtes Lächeln ab. Meine Augen glitten zum Lenkrad, das von einem erschlafften Luftsack überdeckt wurde.
»Ich müsste noch irgendwo ein Taschentuch haben.« Ich fuhr mit beiden Händen in meine Jackentaschen.
»Wenn es benutzt ist, zieh ich die Decke vor.«
Mit hochgezogenen Brauen sah ich ihn an und reichte ihm das angerissene Päckchen Taschentücher. Als er die Hand danach ausstrecken wollte, huschte ein schmerzerfülltes Zucken über sein Gesicht.
»Warte.« Ich zog ein Taschentuch heraus, hielt es ihm unter die Nase und sah zu, wie es sich binnen Sekunden rot färbte. Aber das Blut war nicht der Grund, warum ich schlucken musste. Es war der Geruch, der mir jetzt in die Nase stieg. Ein Männerparfüm. Zitronig. Vielleicht Bergamotte. Dezent, aber vertraut. Konnte das sein? Benutzte er immer noch denselben Duft wie damals?
»Ah!«, stöhnte er, weil ich versehentlich seine Nase berührt hatte.
»Sorry«, murmelte ich, immer noch geflasht von der Tatsache, dass ich mich nach all den Jahren an seinen Geruch erinnern konnte.
»Wie ist das passiert?«, fragte ich, um die Stille mit Worten zu füllen. »Bist du am Steuer eingeschlafen?«
»Was!? Nein!« Er klang fast empört. »Da war ein Reh. Ich hab es zu spät gesehen und bin von der Straße abgekommen.«
»Hast du es erwischt?«
Bei der Vorstellung, dass ein totes oder leidendes Reh oben auf der Straße lag, drehte sich mir der Magen um. Trace schüttelte den Kopf. Ich tauschte das vollgeblutete Taschentuch gegen ein frisches aus.
»Dein Nasenbluten lässt nach«, sagte ich, nachdem wir uns eine Weile angeschwiegen hatten.
Er nickte kaum merklich.
»Hör zu, du musst hier nicht mit mir warten, bis der Krankenwagen kommt. Die sind sicher gleich da, und es geht mir ja gut.«
Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Denkst du ernsthaft, ich fahr jetzt nach Hause?«
»Du siehst aus, als hättest du noch was vor.« Für den Bruchteil einer Sekunde glitten seine Augen über mein Kleid, das unter der Jacke hervorspitzte. »Ich will dir deinen Abend nicht versauen.«
»Das hat Parker, 24, Personalsachbearbeiter, schon übernommen«, erwiderte ich nüchtern.
»Wer ist das?«
»So ein Typ, mit dem ich essen war.«
»Du kommst von einem Date?«
»Yep.«
»Was hat der arme Kerl denn verbrochen? Den Nachtisch nicht bezahlt?«
»Tsss«, stieß ich aus, während mir Wärme in die Wangen stieg.
»Oh mein Gott, es war wirklich der Nachtisch!« Sein Brustkorb vibrierte vor Lachen.
»Quatsch!«, protestierte ich und spürte, wie die Wärme zu Hitze wurde. »Er war einfach nicht mein Typ.«
»Hätte ich dir vorher sagen können. Ein Personalsachbearbeiter? Worüber habt ihr gesprochen? Deinen Lebenslauf?«
Ich boxte ihn in den Oberarm, und er stöhnte theatralisch auf. »Hey, ich bin verletzt!«
»Wie schade, dass es nicht deine Zunge erwischt hat.«
»Würden viele Frauen anders sehen …«
Ich imitierte einen Würgereiz.
»Weil ich sie zum Singen brauche«, ergänzte er augenrollend. »Ich bin Sänger, falls du das vergessen hast.«
»Als ob ich das jemals vergessen könnte«, schnaubte ich und spürte, wie die Unverfänglichkeit, die für ein paar Sekunden zwischen uns aufgeblüht war, jämmerlich verkümmerte.
»Du bist immer noch sauer deswegen, hm?«
»Ich werde noch sauer sein, wenn ich vor deinem Grabstein stehe.«
Sein Lachen ging in ein Stöhnen über. »Wusste gar nicht, dass es so schlecht um mich steht. Übrigens gefällt mir der Gedanke, dass du mir Blumen ans Grab bringst.«
»Ich hatte an faule Eier gedacht.«
Er lachte wieder, aber diesmal wirkte es angestrengt. Ein Schauer rieselte sichtbar durch seinen Körper, und ich schob meinen Groll beiseite. Den Ärger darüber, dass Trace seinen einzigen Hit ausgerechnet über mich geschrieben hatte. Über das, was zwischen uns passiert war. An diesem einen Abend.
»Alles okay?«, fragte ich.
Er nickte kaum merklich. »Mir ist nur kalt.«
Eine leichte Unruhe machte sich in mir breit. Für einen Herbstabend war es mild. Ich trug sogar meine Jacke offen.
»Der Krankenwagen müsste doch längst hier sein«, presste er hervor, als ich mich über ihn beugte, um die Decke bis zu seinem Kinn hochzuziehen. Sein warmer Atem streifte meine Wange und sandte einen Schauer über meinen Rücken, den ich zu gern auf die Außentemperaturen geschoben hätte.
»Es ist noch keine zehn Minuten her, dass ich den Notruf abgesetzt habe«, bemerkte ich mit Blick auf mein Smartphone. Mir kam ein flüchtiger Gedanke. »Hey, soll ich vielleicht deine Eltern anrufen?«
»Nein«, antwortete er eine Spur zu schnell.
»Bist du sicher? Sie machen sich doch bestimmt Sorgen, wenn du nicht kommst.«
»Nein«, wiederholte er entschieden. Mit etwas Abstand fügte er hinzu: »Meine Mom schläft um diese Zeit längst.«
Mir entging nicht, dass seine Stimme zitterte. Und dass sich seine Antwort nur auf einen Elternteil bezog. Dass Trace im Dauerstreit mit seinem Vater lag, war kein Geheimnis. Die beiden hatten sich darüber entzweit, dass Trace Musiker geworden und nach Nashville gezogen war, statt die Ranch seiner Familie in Palisade zu übernehmen.
»Okay«, murmelte ich und ließ das Smartphone wieder in die Jackentasche gleiten.
Eine seltsame Stille entstand. Nur unser Atem und das Rascheln der Blätter in den Ästen über uns waren zu hören.
»Wie geht’s deiner Familie?«, fragte er.
»Oh, wir smalltalken jetzt?«
»Meine Mom hat mir von der Sache mit eurer Halbschwester erzählt.«
»Ich glaube nicht, dass das als Small Talk durchgeht.«
Wieder überging er meine Bemerkung. »Das muss hart gewesen sein.«
»War es«, antwortete ich und korrigierte es in Gedanken zu »Ist es«.
»Wohnt sie jetzt bei euch auf Cherry Hill?«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie lebt in Denver.«
»Hm«, raunte er und nickte.
»Sie ist mit Flynn zusammen.«
Keine Ahnung, warum ich es ihm gegenüber erwähnte. Er kannte ihn kaum. Als Flynn vor ein paar Jahren zu uns auf die Farm gezogen war, hatte Trace bereits in Nashville gewohnt.
»Das ist der Kerl, der deine Baumhäuser baut, oder?«
Kurz war ich überrascht, dass er von den Baumhäusern wusste. Aber wahrscheinlich hatte seine Mom auch das erwähnt.
»Läuft es gut? Mit den Baumhäusern? Mom meinte, du hättest so eine Art … Hotel daraus gemacht.«
Im letzten Moment entschied ich mich dagegen, es zu beschönigen. Vielleicht weil die unbezahlte Rechnung noch sehr präsent in meinem Kopf war. »Geht so.«
Er wollte etwas erwidern, als uns das Heulen einer Sirene aufhorchen ließ. Es drang nur gedämpft zu uns, als wäre der Krankenwagen noch eine gute Meile entfernt.
»Das müssen sie sein.«
Kurz darauf flackerte Blaulicht in der Dunkelheit auf. Ich hörte, wie die Flügeltüren eines Krankenwagens aufgerissen wurden und drei dunkle Schemen auf uns zueilten.
»Wir sind hier unten«, rief ich.
Da das Innenlicht des SUV brannte, war ich mir sicher, dass sie uns längst gesehen hatten. Trotzdem verspürte ich den Drang, etwas zu tun. Als uns die Sanitäter erreichten, passierte so viel gleichzeitig, dass ich völlig den Überblick verlor. Während sich zwei Männer um Trace kümmerten, stellte mir eine Frau im Alter meiner Mutter alle möglichen Fragen. Ob ich verletzt war, wie ich hieß, wie alt ich war, wo ich herkam, ob mir kalt war. Wie ein Roboter beantwortete ich sie, während meine Augen immer wieder zu Trace huschten.
»Sein Puls sackt ab«, hörte ich jemanden sagen.
Ich riss die Augen auf und versuchte, etwas zu erkennen, aber die Sanitäter nahmen mir die Sicht.
»Was ist mit ihm?«, fragte ich.
»Machen Sie sich keine Sorgen, meine Kollegen kümmern sich um Ihren Freund«, redete sie mir gut zu.
»Er ist nicht«, setzte ich an, brach aber ab, als ich glaubte, das Wort »Schock« zu hören.
Beunruhigt schielte ich an ihr vorbei, musste mich aber damit begnügen, Vertrauen in die Fähigkeiten der Sanitäter zu haben.
»Wir bringen ihn jetzt ins St. Mary’s«, sagte die Sanitäterin irgendwann zu mir. »Sie können mitfahren, wenn Sie möchten. Oder Sie warten hier auf die Polizei. Die müsste jeden Moment da sein.«
»Äh … ich …«, überfordert sah ich zu der Trage, auf die Trace in diesem Moment geschnallt wurde, »komme mit. Aber ich fahr selbst. Mein Wagen steht oben an der Straße.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja.«
»Was ist mit meinen Sachen?«, hörte ich Trace krächzen. »Meine Gitarre …«
»Die Kollegen von der Polizei kümmern sich darum«, antwortete einer der Sanitäter.
»Aber ich brauch mein Smartphone«, sagte Trace angestrengt. »Ich muss Tanner anrufen … den Termin verschieben … Jemand muss sich um Brody kümmern und …«
»Beruhigen Sie sich. Wir bringen Sie jetzt erst mal ins Krankenhaus.«
»Aber ich brauch meine Sachen!«, protestierte er und wollte sich aufrichten.
»Ich kümmer mich darum«, platzte es aus mir heraus.
»Okay«, seufzte er.
Mein Herz zog sich ein bisschen zusammen, weil er so schwach klang. So anders, als ich ihn kannte. Kennengelernt hatte. Vor fünf Jahren. An diesem Abend auf dem Parkplatz. Bilder drangen an die Oberfläche. Erinnerungen buhlten um Aufmerksamkeit. Aber selbst die guten waren mir zu viel in diesem Moment.
Mit den Augen folgte ich der Trage bis hoch zum Krankenwagen, hörte kurz darauf, wie sich die Türen schlossen. Ich wertete es als positives Zeichen, dass keine Sirene ertönte, als der Wagen losfuhr. Kein Blaulicht aufleuchtete. Und trotzdem empfand ich ein gewisses Unbehagen, weil ich jetzt allein hier draußen war. Ich verlor keine Zeit, kletterte in den SUV und sah mich nach dem Smartphone um. Ich fand es im Fußraum des Beifahrersitzes und steckte es in meine Tasche. Seinen Geldbeutel entdeckte ich in der Mittelkonsole und nahm ihn ebenfalls an mich. Danach holte ich seine Sachen aus dem Kofferraum, lud sie in mein Auto und machte mich auf den Weg ins Krankenhaus.
Kapitel 3
Halloween vor fünf Jahren, Parkplatz vor dem Grill
»Cheers, Dad«, sagte ich mit Blick zum Nachthimmel, setzte die Whiskeyflasche an und nahm einen Schluck. Ich verzog das Gesicht, als die Flüssigkeit meine Kehle hinabrann. Bitter. Brennend.
»Bist du sicher, dass du das trinken willst?«
Ich sah auf. Vom Auto gegenüber kam ein Kerl auf mich zugelaufen. Der Parkplatz war zu schlecht beleuchtet, um sein Gesicht zu erkennen, aber seine Stimme kam mir vage bekannt vor.
»Bist du sicher, dass dich das was angeht?«, entgegnete ich und setzte die Flasche wieder an die Lippen.
Er kam noch näher, bis der Schein der Straßenlaterne auf sein Gesicht fiel.
»Soll ich jemanden für dich anrufen? Deine Schwestern vielleicht?«
Aus schmalen Augen betrachtete ich ihn. Die schwarze Hose, das schwarze Hemd, die Haartolle. »Wer bist du?«
»Äh … Trace«, antwortete er ein wenig überrascht. »Trace Bradley. Ich war mit Lilac in der …«
»Ich weiß, wer du bist. Aber was soll das darstellen?«
Er blickte an sich hinab und zuckte mit den Schultern. »Johnny Cash.«
Ich runzelte die Stirn.
»Ein Countrysänger«, erklärte er.
»Ich weiß, wer Johnny Cash ist«, schnaubte ich und verdrehte die Augen. »Du siehst nur nicht aus wie er.«
Er zog die Brauen hoch. »Wenigstens bin ich verkleidet.«
Ein Zwinkern schwang in seiner Stimme mit.
»Ich bin auch verkleidet.« Lustlos wedelte ich mit der lilafarbenen Perücke, die neben mir auf der Ladefläche meines Pick-ups lag. Ich nahm noch einen kräftigen Schluck Jack Daniel’s.
Er streckte die Hand nach der Flasche aus, und einen Moment lang dachte ich, er wollte sie mir abnehmen. »Darf ich?«
Nach kurzem Zögern reichte ich ihm den Whiskey. Er nippte und schüttelte sich. »Das schmeckt grauenhaft.«
»Es muss nicht gut schmecken.«
»Auch wieder wahr.« Er nahm noch einen Schluck und legte den Kopf schief. »Warum bist du nicht da drinnen?« Mit dem Daumen deutete er hinter sich auf den Grill, wo die alljährliche Halloween-Party in vollem Gang war.
»Ich bin siebzehn. Die schenken mir nur Cola aus.«
»Vielleicht hättest du das mit dem Verkleiden ein bisschen ernster nehmen müssen«, bemerkte er mit Blick auf die Perücke.
»Na ja, ich hätte wohl eher meinen Ausweis verkleiden müssen.«
Seine Mundwinkel zuckten, und aus irgendeinem Grund gefiel mir das.
»Wo sind deine Schwestern?«
»Zu Hause.«
»Wissen die, dass du hier bist?«
»Nein.«
Er nickte kaum merklich.
»Rufst du sie jetzt an?«, fragte ich ein wenig spöttisch.
»Soll ich?«
»Hast du mich vorhin schon gefragt.«
»Ja, aber du hast mir keine Antwort gegeben.«
»Ich war zu abgelenkt von der Tatsache, Johnny Cash gegenüberzustehen.«
Er schmunzelte. Eine Spur ernster sagte er: »June und Lilac würden sich vermutlich Sorgen machen, wenn sie wüssten, dass ihre kleine Schwester allein auf einem Parkplatz sitzt und sich betrinkt.«
Ich hielt mir die Hand vor den Mund und flüsterte verschwörerisch: »Deswegen sagen wir es ihnen ja nicht.« Ich nahm einen Schluck. »Außerdem bin ich nicht allein.«
»Ich werd nicht den ganzen Abend hier sein.«
Ich hielt die Flasche hoch. »Jack schon.«
In seinem Blick lag Belustigung, aber auch noch etwas anderes.
»Wie wär’s, wenn ich da reingehe und dir was anderes hole?« Mit dem Kinn wies er in Richtung Grill.
Ich schüttelte den Kopf. »Jack und ich freunden uns gerade an.«
»Komm schon, Poppy. Das Zeug ist saustark, und es schmeckt dir nicht mal.«
Einen Moment lang war ich überrascht, dass er meinen Namen kannte. Wie rau er aus seinem Mund klang. Überhaupt hatte er eine interessante Stimme. Tief. Dunkel. Ein bisschen heiser. Als hätte jemand mit einer Feile über seine Stimmbänder gerieben.
»Ich hol dir einen Cider«, sagte er und machte Anstalten, mir die Flasche abzunehmen.
»Der gehörte meinem Dad.«
Trace hielt in seiner Bewegung inne. Über den Parkplatz senkte sich Stille, nur unterbrochen von der Musik, die gedämpft aus dem Grill drang, dem Gelächter der Raucher, die sich vor der Tür trafen.
»Er hat ihn immer für besondere Anlässe rausgeholt«, fuhr ich leise fort und senkte den Blick auf die Flasche in meiner Hand.
»Und das heute ist einer?«
Ich antwortete nicht sofort. »Vielleicht.«
Er nickte. Respektierte meine vage Antwort. Vielleicht gab ich ihm deswegen mehr.
»Es ist das erste Mal seit seinem Tod, dass ich … na ja, unter Leute gehe. Zumindest hatte ich das vor.« Der letzte Satz kam nur gemurmelt aus meinem Mund. »Ich bin ja nur bis hierher gekommen.«
»Warum?«
Ratlos zuckte ich mit den Schultern. »Schätze, es hat sich in der Theorie einfacher angefühlt.«
Er nickte. »Kenn ich.«
Zu meiner Überraschung kam er näher und zog sich auf die Ladefläche hoch. Er ließ sich direkt neben mir nieder, gerade so, dass sich unsere Oberschenkel nicht berührten, aber nahe genug, um seinen Duft einzuatmen. Frisch und herb. Zitrone oder Bergamotte.
»Ich wollte heute ein Gespräch führen. Ein wichtiges. Aber im letzten Moment«, er seufzte, »hab ich wieder gekniffen.«
»Wieder?«
Er sagte nichts weiter. Ich hielt ihm die Flasche hin, und er nahm sie. Unsere Hände berührten sich dabei. Es war nur ein flüchtiges Streifen, aber ich spürte, wie rau seine Fingerkuppen waren. Er spielte Gitarre, soweit ich wusste.
»Ich hab das Gefühl, meinen Dad zu verraten, wenn ich da reingehe. Wenn ich nicht zu Hause sitze und trauere, sondern lache und tanze. Klingt das bescheuert?«
»Nein, überhaupt nicht.«
Ich hob die Brauen. »Willst du mir jetzt nicht sagen, dass mein Dad nicht gewollt hätte, dass ich aufhöre, mein Leben zu leben?« Es kam bitter und zynisch über meine Lippen.
»Ich kannte deinen Dad nicht wirklich. Keine Ahnung, was er gewollt hätte und was nicht. Aber ich glaube nicht, dass man weniger um einen Menschen trauert, nur weil man einen Abend lang Spaß hat.«
»Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt wie Spaß anfühlen würde.«
Meine Augen schweiften zum Grill. Zu den Lichtern und der Musik.
»Das findest du nur auf eine Weise heraus.« Er beugte sich über mich und griff nach der Perücke, und ich ertappte mich dabei, seinen Duft noch tiefer einzuatmen. Verdammt, er roch wirklich gut.
Mit beiden Händen zog er mir die Perücke auf und rückte sie zurecht, wobei er mir für einen winzigen Moment so nah kam, dass sich unsere Nasenspitzen fast berührten. Aber im Gegensatz zu mir schien er es nicht zu bemerken. »Was bist du eigentlich?«
»Keine Ahnung. Ein Einhorn? Ein Pokémon? Nicki Minaj?« Ich zuckte mit den Schultern. »War die einzige Perücke, die es noch gab. Wobei … da war noch eine grüne, aber ich dachte, lila passt besser zu meinen Augen«, bemerkte ich mit einem Zwinkern. Er legte den Kopf schief und betrachtete mich eingehend, und ich kämpfte gegen den Drang, auf meinem Hintern hin- und herzurutschen.
»Stimmt.«
Hitze kroch meinen Rücken hinauf. »Flirtest du gerade mit mir?«
»Wäre das schlimm?«, erwiderte er mit einem spitzbübischen Grinsen.
Ich gab vor nachzudenken. »Du bist ein bisschen zu alt für mich, Johnny. Und dein Klamottenstil überzeugt mich auch nicht.«
Seine Mundwinkel zuckten. Er senkte den Blick und räusperte sich. Und dann begann er auf einmal zu singen.
»I’d love to wear a rainbow every day. And tell the world that everything’s okay.«
Seine Singstimme war wie seine Sprechstimme. Tief. Dunkel. Rau. Von Silbe zu Silbe wurde sie kräftiger und intensiver. Er sah auf, und mein Nacken begann zu kribbeln.
»But I’ll try to carry off a little darkness on my back. Til things are brighter, I’m the man in black.«
Seine Stimme verklang und ließ mich mit Gänsehaut zurück. Herzklopfen. Verwirrung.
»Das war …«, setzte ich an, aber das Klingeln seines Smartphones kam mir zuvor.
Trace griff in seine Hemdtasche, warf einen Blick aufs Display und zog die Luft durch die Zähne.
»Hey«, meldete er sich in einem entschuldigenden Tonfall, und ich konnte mich nicht davon abhalten, die Ohren zu spitzen. »Äh … doch, aber wird ein bisschen später bei mir, sorry.« Seine Augen huschten erst zum Grill und dann zu mir, und ich sah ertappt weg. »Ja, bis dann!« Er legte auf und aktivierte die Displaysperre.
»Geh ruhig rein.«
Sein Knopf schnellte zu mir.
»Du bist verabredet, und ich komm auch allein klar«, sagte ich gleichgültiger, als ich war.
Er zögerte. »Du könntest mitkommen …«
Ich schüttelte den Kopf und lächelte schwach. »Ich glaub, meine Tanzfläche ist heute hier draußen.«
»Sicher?«
Ich nickte.
»Okay«, raunte er.
Ein merkwürdiges Gefühl von Bedauern machte sich in mir breit, als er sich mit den Handflächen vom Truck schob. Ich wollte nicht, dass er ging. Dass diese unerwartete Begegnung hier zu Ende war. Aber zu meiner Irritation machte er keine Anstalten zu gehen. Stattdessen hielt er mir seine Hand hin. Verwirrt blickte ich ihm entgegen.
»Wenn deine Tanzfläche hier draußen ist … tanzen wir hier draußen.«
Ungläubig kniff ich die Augen zusammen. »Du willst tanzen? Mit mir? Hier?«
»Warum nicht?«
»Weil … ähm … wir keine Musik haben«, kam es stockend aus meinem Mund.
»Wir haben Musik.« Er hielt sein Smartphone hoch.
»Das …« Ein nervöses Lächeln zupfte an meinen Mundwinkeln. »Nein!«
»Warum nicht?«, fragte er erneut. »Außer uns ist hier niemand.« Er wischte auf seinem Smartphone herum.
»Was machst du da?«
»Ich such uns einen Song.«
»Nein!«, platzte es fast panisch aus mir heraus.
»Was Langsames oder was Schnelles?«, überging er meinen Einwand.
»Ich tanz nicht mit dir!«
Die ersten Akkorde von Shut Up and Dance ertönten.
Ungläubig sah ich ihn an.
»Okay, anderer Song«, murmelte er grinsend und tippte etwas ins Smartphone. Kurz darauf drangen die sanften Klänge von The Night We Met von Lord Huron aus dem Lautsprecher.
Ich schluckte. Das war einer meiner absoluten Lieblingssongs, und das zufriedene Lächeln auf seinem Gesicht verriet mir, dass er es mir ansah. Wieder hielt er mir seine Hand hin. Ich zögerte. Spürte, wie meine Abwehr bröckelte. Von Sekunde zu Sekunde ein bisschen mehr.
»Na, schön«, seufzte ich und ergriff seine Hand. Sie war warm und rau, der Druck fest. Meine Finger begannen zu kribbeln, mein Herz zu pochen. Ohne seine Hand loszulassen, schob ich mich von der Ladefläche. Eine Spur zu schwungvoll, sodass ich leicht gegen ihn prallte. Wir waren fast gleich groß. Interessant, wisperte eine Stimme in meinem Kopf. Schön. Ich löste meinen Blick von seinem Oberkörper und sah ihm ins Gesicht, schluckte schwer, als ich den Ausdruck in seinen Augen sah. Im Gegensatz zu meinen schienen sie nicht »Und jetzt?« zu sagen, sondern … »Geht doch«. Meine Knie zitterten, als er nach meinen Händen griff, sie sich langsam um den Hals legte und mich ein ganzes Stück näher an sich heranzog. Noch näher. Obwohl es mich völlig aus dem Konzept brachte, verschränkte ich die Finger in seinem Nacken. Er begann, sich zu bewegen, uns zu bewegen, und mir blieb nichts anderes übrig, als mich von ihm führen zu lassen. Es war neu für mich, auf diese Weise mit jemandem zu tanzen. So fixiert aufeinander. Ich betrachtete sein Gesicht. Die braunen Augen, die hohen Wangenknochen, die gerade Nase, den starken Kiefer. Er war einer der attraktivsten Typen, die mir je begegnet waren, und ich fragte mich, warum mir das erst jetzt auffiel.
»Soll ich dir was verraten?«, raunte er, während wir uns langsam hin und her wiegten. Sein warmer Atem strich über mein Ohr, und ein Hauch Whiskey drang an meine Nase. Die Härchen auf meinen Armen stellten sich auf, aber ich schaffte es, zu nicken.
»Ich hab noch nie mit einer Frau mit lilafarbenen Haaren getanzt.«
Ich musste lachen, und meine Anspannung löste sich ein wenig.
»Und? Wie fühlt sich das an?«
Er nahm einen tiefen Atemzug. »Wie eine verdammt gute Entscheidung.«
Kapitel 4
Zum ersten Mal in meinem Leben saß ich im Wartezimmer eines Krankenhauses. Seit meiner Ankunft mussten zwei oder drei Stunden vergangen sein. Vielleicht auch mehr. Mein Zeitgefühl ließ mich völlig im Stich. Selbiges galt leider nicht für mein Hungergefühl. Mein Magen knurrte in regelmäßigen Abständen so laut, dass es mir teils mitleidige, teils vorwurfsvolle Blicke der zwei Frauen einbrachte, die mit mir warteten. Der Teller Ravioli war einfach zu klein gewesen, und ich hätte definitiv ein Dessert essen sollen. Danke, Parker! Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und machte mich auf die Suche nach einem Snackautomaten. Auf dem Flur begegnete ich einer Krankenschwester und nutzte die Gelegenheit, mich nach Trace zu erkundigen.
»Sind Sie eine Angehörige von Mr. Bradley?« Sie hörte sich genauso müde an, wie sie aussah.
»Äh … nein.«
Noch im selben Moment bereute ich meine Antwort.
»Dann darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben.« Sie schenkte mir einen bedauernden Blick.
»Und wenn ich seine Freundin wäre?«, platzte es aus mir heraus, als sie ihren Weg fortsetzen wollte.
»Sind Sie denn seine Freundin?«, erwiderte sie mit einer Mischung aus Skepsis und Überraschung.
Ich zögerte eine Sekunde, bevor sich ein »Ja« aus meinem Mund stahl, das sich eher wie eine Frage anhörte. »Ich war bei ihm«, schob ich nach und hielt ihr den Ärmel meiner Jacke hin, auf dem etwas getrocknetes Blut klebte.
Okay, das war ein bisschen too much, Poppy.
Unbeeindruckt schüttelte die Krankenschwester den Kopf. »Ich darf Ihnen trotzdem nichts sagen.«
»Ich will doch nur wissen, ob es ihm gut geht«, brach ein Hauch Frustration aus mir heraus. Auch wenn ich wusste, dass sie nur ihren Job machte und sich an die Schweigepflicht halten musste.
Ein kurzes Zögern huschte über ihr Gesicht. »Ich sehe mal, was ich tun kann«, versprach sie mir und eilte davon.
Nachdem sie in ein Zimmer am Ende des Flurs verschwunden war, griff ich in meine Handtasche und suchte meinen Geldbeutel, stieß dabei jedoch auf ein Smartphone, das sich nicht wie meins anfühlte. Richtig, ich hatte Trace’ Handy eingesteckt. Sollte ich nicht vielleicht doch seine Eltern informieren? Auch wenn es mitten in der Nacht war, wollten die Bradleys sicher wissen, dass ihr Sohn im Krankenhaus lag. Zumal sie ihn garantiert erwarteten und spätestens morgen früh seine Abwesenheit bemerken würden. Ich zog sein Smartphone aus der Handtasche, erinnerte mich aber noch im selben Moment daran, dass ich den Code nicht kannte. Kurzerhand griff ich zu meinem eigenen Handy und googelte die Telefonnummer der Bradley Ranch. Nach dem vierten Freizeichen meldete sich eine verschlafene Männerstimme am anderen Ende der Leitung.
»Mr. Bradley? Hier ist Poppy. Poppy McCarthy.«
»Poppy … McCarthy?«, wiederholte er hörbar verwirrt.
»Es geht um Ihren Sohn«, fuhr ich unbeirrt fort. »Trace. Er … liegt im Krankenhaus.«
Ein, zwei Sekunden war es still am anderen Ende der Leitung.
»Mr. Bradley? Sind Sie noch dran?«
»Ja«, murmelte er fahrig.
»Er hatte einen Autounfall.« Ich schob hastig »Aber es geht ihm gut« hinterher. »Glaube ich zumindest. Genaueres weiß ich nicht. Mir sagt hier niemand was. Ich wollte nur, dass Sie Bescheid wissen und sich nicht wundern, wenn er morgen früh nicht da ist.«
»Morgen früh?«
»Er … war doch auf dem Weg zu Ihnen.« Das Oder am Ende meines Satzes war nicht zu überhören. Wieder war es still.
»Trace ist nicht in Nashville?«, fragte Mr. Bradley.
»Äh nein.« Ich runzelte die Stirn. »Er liegt im St. Mary’s. In Grand Junction.«
Meine Stimme war zum Ende hin leiser geworden, weil ich zunehmend irritierter war. Hatte Trace sich nicht angekündigt? Hatte er seine Eltern überraschen wollen? Mr. Bradley setzte an, etwas zu sagen, aber im selben Moment tauchte die Krankenschwester, mit der ich zuvor gesprochen hatte, neben mir auf.
»Ihr Freund ist noch im Aufwachraum, kommt aber demnächst auf sein Zimmer.« Ihr Tonfall war gedämpft. »Dann können Sie zu ihm.«
Ich bedankte mich und wandte mich wieder an Mr. Bradley.
»Haben Sie das gehört?«
»Ja. Ich wecke meine Frau, und dann machen wir uns sofort auf den Weg.«
»Okay. Wiedersehen, Mr. Bradley.«
Trace schlief, als ich wenig später das Einzelzimmer betrat, in dem er untergebracht worden war. Entweder hatte er eine gute Krankenversicherung oder einen Promibonus. Vermutlich beides.
Leise zog ich die Tür hinter mir zu und näherte mich seinem Bett. Er trug eins dieser hellblauen Krankenhaushemden und sah ramponierter aus als in meiner Erinnerung. Vielleicht war es auch dem grellen Neonlicht geschuldet. Sein Gesicht war blass, seine Nase geschwollen. Er hatte ein Klammerpflaster über der Braue, und sein rechter Arm steckte bis knapp unter dem Ellbogen in einem Gips.
»Dich hat es ja ganz schön erwischt«, murmelte ich und betrachtete seinen schlafenden Körper. »Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden«, fuhr ich leise fort. »Deine Eltern hab ich informiert. Sie müssten bald da sein.«
Ich wollte mich gerade abwenden, als ich einen Laut vernahm. Ein Seufzen oder Ächzen. Seine Lider flatterten, und seine Lippen bewegten sich kaum merklich. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass er nach Wasser verlangte. Ich sah mich um und entdeckte einen Becher auf seinem Nachttisch. Behutsam führte ich ihn an Trace’ Lippen. Sie waren spröde und in den Mundwinkeln aufgesprungen. Ich musste daran denken, wie weich sie sich vor sehr langer Zeit auf meinen angefühlt hatten, und wehrte mich gegen die Wärme, die sich in meinem Bauch ausbreitete.
Trace schlürfte das Wasser eher, aber es schien ihm gutzutun. Seine Gesichtszüge entspannten sich. Mit einem Nicken gab er mir zu verstehen, dass er fertig war.
»Brauchst du sonst noch was? Soll ich jemanden holen? Eine Schwester?«
Ihm gelang nur ein schwaches Kopfschütteln.
»Okay«, flüsterte ich. »Dann geh ich jetzt …«
»Bleib.«
Einen Moment dachte ich, ich hätte mich verhört. Aber dann unternahm er einen Versuch, seine Hand nach mir auszustrecken, und wisperte: »Nur ein bisschen.«
Unschlüssig betrachtete ich ihn. Seine Hand. Rang mit mir. Ein Teil von mir wollte nichts mehr, als dieses Zimmer verlassen, mich in mein Auto setzen und nach Hause fahren. Der Teil, der wusste, dass ich genug für ihn getan hatte. Der sich daran erinnerte, was er getan hatte. Und dennoch setzte sich ein anderer durch.
»Okay«, sagte ich leise und zog mir einen Stuhl heran. »Ein bisschen.«
Kapitel 5
Eine sanfte Berührung an der Schulter weckte mich. Ich blinzelte und blickte in Trace’ braune Augen. Trace’ Augen in einem Frauengesicht.
»Mrs. Bradley«, murmelte ich schlaftrunken und hob den Kopf. Mein Nacken fühlte sich steif an, und mein Rücken beschwerte sich darüber, dass ich zwar auf einem Stuhl saß, mit dem Oberkörper aber auf einem Bett lag. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mein Geist wach genug war, um zu verstehen, wessen Bett es war. Als hätte ich mich verbrannt, fuhr ich hoch.
»Ich wollte dich nicht erschrecken.« Sie lächelte entschuldigend. Ihre Augen schimmerten feucht, als hätte sie geweint. Leicht versetzt hinter ihr stand Mr. Bradley. Ich hatte ihn schon länger nicht mehr gesehen und dachte spontan, dass er älter aussah als in meiner Erinnerung. Irgendwie müde und abgekämpft. Aber gut, es war auch mitten in der Nacht, und er sorgte sich um seinen Sohn.
»Wir sind gleich losgefahren«, sagte Mrs. Bradley und gab mir einen Anhaltspunkt, wie spät es war. Länger als eine halbe Stunde konnte ich nicht geschlafen haben. »Wir haben eben mit der Ärztin gesprochen. Es geht ihm so weit gut.« Erleichterung schwang in ihrer Stimme mit. Und ein Rest mütterlicher Sorge. »Er hat sich die Mittelhand gebrochen. Und eine Kniedis-«, sie versuchte, sich zu erinnern, »-torsion.« Bestätigung suchend blickte sie zu ihrem Mann, der nickte. Zu meiner Irritation nahm sie meine Hand und drückte sie. »Ich bin so froh, dass er nicht allein war. Und dass es dir gut geht.«
Ich stutzte. Dass es mir gut ging?
»Wie ist das denn überhaupt passiert?«
»Da war ein Reh auf der Straße«, antwortete ich.
»Ist Trace gefahren? Oder …?«
»Erin, das spielt doch keine Rolle«, wies Mr. Bradley seine Frau auf sanfte Weise zurecht.
»Ich mach ihr doch keine Vorwürfe«, verteidigte sie sich. »Auf dieser Strecke passieren ständig Unfälle. Mir ist auch schon mal ein Reh vors Auto gesprungen, erinnerst du dich?«
Endlich konnte mein schlaftrunkenes Hirn folgen. Aus irgendeinem Grund schienen die Bradleys davon auszugehen, dass Trace und ich zusammen im Unfallwagen gesessen hatten. Vielleicht weil die Krankenschwester Trace »meinen Freund« genannt hatte, als ich am Telefon mit Mr. Bradley gewesen war. Weil du dich ihr gegenüber als seine Freundin ausgegeben hast, erinnerte mich eine Stimme in meinem Hinterkopf.
»Ich glaube, das ist ein Missverständnis.« Meine Augen glitten von Mrs. zu Mr. Bradley. »Ich bin nur zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen und hab den Notruf abgesetzt.«
Ein verwirrter Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Aber ich dachte …« Sie tauschte einen Blick mit ihrem Mann, der die Achseln zuckte.
»Ich hab mich vor der Krankenschwester als seine Freundin ausgegeben, weil mir niemand sagen wollte, wie es ihm geht«, gestand ich.
Ihre Augen wurden groß, und ihr Mund formte ein O.
»Ja«, murmelte ich und beschloss, dass jetzt ein guter Moment war, um die Biege zu machen. Trace war nicht mehr allein und meine Anwesenheit nicht länger nötig. »Ich …«
»Er wacht auf«, kam mir Mrs. Bradley zuvor.
Alle drei blickten wir zu Trace, dessen Lider kaum merklich flatterten.
Mrs. Bradley trat näher an sein Bett heran, strich sanft über den Handrücken ihres Sohns und raunte etwas, das wie »Wir sind da« klang. Es war ein intimer, familiärer Moment, der mich endgültig daran erinnerte, dass ich nicht zu diesem »Wir« gehörte.
»Ich geh dann mal nach Hause«, sagte ich.
Mrs. Bradley bekam es gar nicht richtig mit, weil Trace ein Stöhnen von sich gab. Nur Mr. Bradley nickte mir zu und formte ein stummes »Danke« mit seinen Lippen. Erst jetzt fiel mir auf, dass er sich keinen Zentimeter von der Stelle bewegt hatte, seit er das Krankenhauszimmer betreten hatte. Man hätte es für emotionslos oder gefühlskalt halten können, aber ein Blick in seine Augen genügte, um zu erkennen, dass es Hilflosigkeit war.
Ich sah ein letztes Mal zu Trace, der immer noch im Aufwach-Modus war, bevor ich mich auf die Tür zubewegte und hinaus auf den Flur trat. Wie ein Ballon, aus dem schlagartig die Luft entwich, sackte ich innerlich zusammen. Als wären da nur noch Müdigkeit und Erschöpfung in mir.
Ich beeilte mich, zum Ausgang zu gelangen, und holte tief Luft, als ich ins Freie trat. Mein Atem wurde zu kleinen Wölkchen. Es war kalt geworden. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und lief geradewegs zu meinem Wagen, der mich hoffentlich ganz schnell an den einzigen Ort brachte, an dem ich heute noch sein wollte: in mein Bett.
Kapitel 6
Halloween vor fünf Jahren, Parkplatz vor dem Grill
»Wie geht es deiner Familie?«, fragte Trace, als wir wieder nebeneinander auf dem Truck saßen und die Beine von der Ladefläche baumeln ließen. Ein sanfter Folksong drang aus dem Lautsprecher seines Smartphones. Er hatte die Musik weiterlaufen lassen, nachdem wir miteinander getanzt hatten.
»Mom weint viel. June redet wenig. Lilac backt«, antwortete ich monoton.
»Schätze, jeder geht anders mit so was um.«
»Ja.«
»Wer kümmert sich momentan um eure Farm?«
»June. Sie ist wieder nach Hause gezogen.«
»Sie hat in Portland studiert, oder?«
Ich nickte. »Sie hat ihren Abschluss gemacht, kurz bevor Dad …« Ich brach ab und senkte den Blick.
»War das ihr Plan? Die Farm zu übernehmen?«
»Keine Ahnung. Ich glaube nicht.«
Mir fiel auf, dass ich sie nie danach gefragt hatte. Überhaupt hatten wir nicht viel geredet in den letzten Monaten.
»Was ist mit dir? Gehst du aufs College?«, fragte er mich.
Ich schüttelte den Kopf. »Erst mal nicht.«
Mein Stipendium für die Columbia hatte ich zurückgegeben nach Dads Tod. Die Vorstellung, quer durchs Land zu ziehen, hatte sich nicht mehr richtig angefühlt. Vielleicht würde ich mich nächstes Jahr an der Mesa in Grand Junction einschreiben. Vielleicht nicht. Es war nicht die richtige Zeit für Pläne.
»Du?«, stellte ich die Gegenfrage.
Er wirkte ein wenig überrascht.
»Nein, ich arbeite bei uns auf der Ranch.«
Whispering Oaks, erinnerte ich mich, sprach es aber nicht aus. Die Ranch lag etwas außerhalb von Palisade, zwei, drei Meilen von Cherry Hill entfernt.
»Übernimmst du sie irgendwann?«
»Wenn es nach meinen Dad geht schon.«
»Und wenn es nach dir geht?«
Er zögerte. Dann schüttelte er den Kopf.
»Was willst du stattdessen machen?«
Wieder antwortete er nicht sofort. »Musik.«
»Was für Musik?«
»Country.«
In einer spontanen Reaktion verzog ich das Gesicht.
»Kein Fan?«, fragte er schmunzelnd.
»Nope«, erwiderte ich ehrlich.
»Warum?«
»Ich weiß nicht. Es geht immer um die gleichen Themen. Einsame Männer in Bars, gebrochene Herzen, Heimweh, staubige Straßen … Bier.«
Er deutete mit dem Zeigefinger nach unten. »Du hast die Trucks vergessen.«
»Oh, ja, der berühmte Chevy!«, spottete ich. »Und was soll eigentlich dieses ständige Hey Girl!« Ich verdrehte die Augen. »Wir haben Vornamen!«
Trace lachte. »Dafür, dass du Country nicht magst, kennst du dich aber ziemlich gut aus.«
»Meine Schwester hört nichts anderes«, seufzte ich.
»June?«
»Lilac. Ich hab mein Zimmer neben ihr.«
»Wenigstens eine McCarthy, bei der ich Chancen hätte.« Grinsend schielte er zu mir. »Mit meiner Musik.«
Wärme stieg mir in die Wangen, und ich war froh, dass der Parkplatz so schwach beleuchtet war.
»Weiß dein Vater davon?«, überging ich den Moment. »Dass du Musiker werden willst?«
»Er weiß, wie viel mir die Musik bedeutet, aber nicht, dass ich vorhabe, davon zu leben.«
»Warum sagst du’s ihm nicht?«
Sein Mund öffnete und schloss sich wieder. »Das ist nicht so leicht. Die Ranch ist sein Lebenswerk. Sie ist seit Generationen im Besitz unserer Familie. Es würde ihm das Herz brechen.«
»Würde es auch, wenn du unglücklich bist, oder?«
Er wich meinem Blick aus und starrte ins Leere.
»Es geht mich nichts an, aber zöger das Gespräch nicht unnötig raus. Manchmal … ist es dann zu spät.«
Er kniff die Augen zusammen und musterte mich. »Seit wann bist du hier für die schlauen Sprüche zuständig?«
Ich grinste. »Seit du mir gesagt hast, dass du Country magst. Da hab ich den Respekt vor dir verloren.«
»Hey!« Er kickte mich sanft in die Seite, und ich wich aus, wobei meine Perücke verrutschte.
Ich zog sie mir vom Kopf und legte sie in meinen Schoß, wickelte gedankenverloren eine lilafarbene Strähne um meinen Zeigefinger.
»Schade«, sagte er.
»Was?«
»Ich wollte heute noch ein Mädchen mit lila Haaren küssen.«
Ich sah auf und begegnete seinem Blick. Rechnete damit, dass er ein Grinsen nachschieben würde. Einen Witz. Aber das tat er nicht. Ich schluckte schwer, und er sah es.
»Du kannst sie mitnehmen, wenn du reingehst. Vielleicht findest du ja eine, die sie aufsetzen will.«
Mein Spruch war lahm, aber er lächelte.
»Eigentlich hab ich schon jemanden gefunden.«