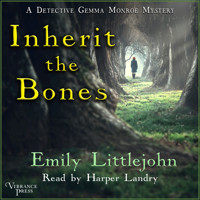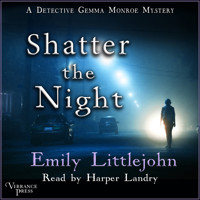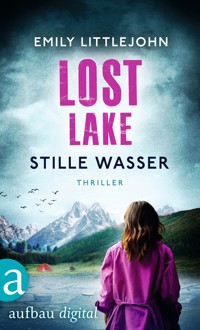9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gemma Monroe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Das ist erst der Anfang.«
Gemma Monroe kehrt nach der Geburt ihrer Tochter in den Polizeidienst zurück, wo sie gleich an ihrem ersten Tag zu einem schaurigen Tatort gerufen wird: Vor einer Privatschule wurde der bekannte Autor Delaware Fuente erstochen, seine Leiche mitten in einem heftigen Schneesturm zur Schau gestellt. Bei dem Toten entdecken Gemma und ihr Kollege Finn eine beunruhigende Nachricht: »Das ist erst der Anfang.« Von einem Studenten erhalten sie den Hinweis, dass ein Unbekannter die Schüler drangsaliert. Als einer der Lehrer verschwindet, ahnt Gemma, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt, um den Mörder zu finden ...
Ein packender Kriminalroman mit einer einfühlsamen und starken Heldin.
Dieses E-Book erschien ursprünglich unter dem Titel "Die Totensucherin".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Über Emily Littlejohn
Emily Littlejohn wurde in Southern California geboren und wohnt nun in Colorado. Sie lebt dort mit ihrem Mann und ihrem betagten Hund.
Über Kathrin Bielfeldt
Kathrin Bielfeldt ist Texterin und Übersetzerin und spricht fünf Sprachen. Sie hat unter anderem Romane von Elisabeth Elo, Pete Dexter und James Sallis ins Deutsche übertragen.
Informationen zum Buch
»Das ist erst der Anfang.«
Gemma Monroe kehrt nach der Geburt ihrer Tochter in den Polizeidienst zurück, wo sie gleich an ihrem ersten Tag zu einem schaurigen Tatort gerufen wird: Vor einer Privatschule wurde der bekannte Autor Delaware Fuente erstochen, seine Leiche mitten in einem heftigen Schneesturm zur Schau gestellt. Bei dem Toten entdecken Gemma und ihr Kollege Finn eine beunruhigende Nachricht: »Das ist erst der Anfang.« Von einem Studenten erhalten sie den Hinweis, dass ein Unbekannter die Schüler drangsaliert. Als einer der Lehrer verschwindet, ahnt Gemma, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt, um den Mörder zu finden.
Ein packender Kriminalroman mit einer einfühlsamen und starken Heldin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Emily Littlejohn
A Season to Lie - Falsche Spuren
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt
Inhaltsübersicht
Über Emily Littlejohn
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Danksagungen
Impressum
Für die Lieben meines Lebens, Chris und Claire
Prolog
In einer bitterkalten Nacht im Februar, zwölf Wochen nach der Geburt meiner Tochter, kehrte ich zu dem zurück, was ich am besten kenne: dem Tod.
Ich folge dem Tod in dunkle Wälder. Ich jage ihm über einsame Wiesen hinterher. Ich suche den Tod in den Gesichtern von Fremden.
Der Tod ist ein mieses Stück Dreck, und ich erforsche seine ausgeklügelten Methoden und seine Hinterlist, die Art, wie er sich hereinschleicht und zuschlägt, wenn man es am wenigsten erwartet. Als Polizistin sage ich mir, dass ich die Jägerin bin und der Tod meine Beute.
Doch langsam glaube ich, das ist eine Lüge.
Die Wahrheit ist, dass der Tod mir folgt.
Er verfolgt mich schon mein ganzes Leben.
Der Tod hat mir nachgestellt wie ein Sommergewitter in Colorado – am Nachmittag, immer präsent, hinter dem Horizont, noch eine Stunde außer Sichtweite. Ich kann die bleiernen Wolken noch nicht sehen, die sich hinter den Bergen auftürmen, oder den Regen in der Luft riechen, und doch gewittert es.
Der Tod kommt, und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann.
1. Kapitel
Ich betrat den Mannschaftsraum des Polizeireviers von Cedar Valley, blieb einen Augenblick stehen und genoss den vertrauten Anblick und die Gerüche. Im Gegensatz zu draußen, wo ein heftiger, eisiger Sturm wütete, war es in diesem Raum warm und ruhig.
Weihnachten war seit einem Monat vorbei, und trotzdem hingen an den Wänden noch Lametta und künstliche Tannenzweige. Ich habe schon lange genug bei verschiedenen Polizeibehörden gearbeitet, um zu wissen, dass das normal ist. Wenn es um den Kampf gegen das Verbrechen geht, zieht das Aufräumen nach den Feiertagen immer den Kürzeren.
Der Raum duftete so, wie ich ihn in Erinnerung hatte: nach frischem Kaffee, verbranntem Mikrowellenessen und Papier, bergeweise Papier. Auf den Schreibtischen stapelten sich Mappen und Aktenordner. Post-it-Zettel in allen Farben des Regenbogens klebten an den Ecken der Computerbildschirme, an den Telefonhörern und überall auf der Pinnwand, die die komplette hintere Wand einnahm. Ein Großteil der täglichen Arbeit wurde inzwischen auf elektronischem Weg erledigt, doch von alten Gewohnheiten trennt man sich schwer.
Von derselben Pinnwand starrten gesuchte und heimgesuchte Männer und Frauen auf mich herunter. Irgendwann einmal mag ihre Geschichte einzigartig gewesen sein, doch in dem Augenblick, in dem ihr Bild auf dieser Pinnwand landete, waren sie alle nur noch eines: Kriminelle, Verbrecher, Gesuchte.
Vor mir hing die Puppe eines Weihnachtselfen von der Decke, aufgeknüpft an einem Strick aus einem dreckigen Schnürsenkel, die kleinen Arme nach oben gedreht, als wäre sie über ihr Schicksal in Schockstarre verfallen. Ich gab ihrem Fuß einen kleinen Stups, und sie schaukelte in der Luft hin und her, das kokette Grinsen selbst im Tod unverändert.
Im Radio in der Ecke lief ein Oldies-Sender. Elvis Presley sang leise über einen Jungen, der während eines Schneesturms geboren wurde, von einer Mutter, die sich nur allzu bewusst darüber war, dass sein Leben in den Ghettos von Chicago hart und kurz sein würde. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, bricht es mir das Herz.
»Well, the world turns«, stimmte eine tiefe Stimme in den Gesang des Kings ein. Ich drehte mich um und sah Finn Nowlin, meistens ein feiner Cop, aber manchmal eine echte Nervensäge, wie er eine klassische Elvis-Pose einnahm. Er kreiste die Hüften, schwang dann seinen Arm hoch und hielt in der Bewegung inne.
Ich verdrehte die Augen und wandte mich ab, bevor er mich schmunzeln sah.
Ich war wieder zu Hause.
Mit einem Grinsen im Gesicht ging ich zu meinem Schreibtisch, wo ich eine leere Arbeitsplatte erwartete. Bevor ich in den Mutterschutz gegangen war, hatte ich gründlich aufgeräumt. Verfärbte Becher und ein paar längst vergessene Löffel hatte ich mit nach Hause genommen, wo sie einer Tiefenreinigung unterzogen worden waren. Akten waren zurück ins Archiv gewandert, offene Fälle hatte ich an meine Kollegen weitergereicht, und alle Stifte sollten in meiner Schublade überwintern.
Zu meiner Überraschung wartete auf dem Schreibtisch ein ordentlich gestapelter Haufen Aktenmappen auf mich. Auf der obersten Mappe klebte ein lilafarbener Notizzettel mit den Worten: Frag Finn. Die Akten waren mit dem Kürzel für lokale Vergehen jüngeren Datums versehen und gehörten ins Archiv, nicht auf meinen Schreibtisch.
Ich ließ meine Tasche auf ein Stück freie Fläche zwischen den Stapeln fallen und zog meinen schweren Parka aus.
»Warm hier drinnen, stimmt’s?«
Finn zuckte die Achseln. Er rieb seine Hände gegeneinander. »Fühlt sich angenehm an. Das Thermostat war die ganze Woche kaputt. Gestern haben sie endlich jemanden geschickt, der es repariert hat. Wir haben uns hier die Eier abgefroren.«
Ich schnaubte. »Muss man nicht zuerst welche haben, bevor sie einem abfrieren können?«
Finn grinste. »Tu nicht so, als hättest du uns nicht vermisst, Gemma. Dein Baby ist wirklich süß, aber du bist nicht gerade die typische Hausfrau. Gib zu, dass du so langsam hibbelig geworden bist.«
»Klar, ich habe euch Jungs mindestens genauso vermisst wie eine Magen-Darm-Erkrankung.« Ich tippte auf die Akten auf meinem Tisch. »Was ist das hier? Ich hoffe, ich habe mich nicht in Schale geworfen, nur um dir zuzusehen, wie du den Elvis gibst und dazu alte Akten zu lesen.«
»Chavez will, dass du auf dem aktuellen Stand bist, was der Rest von uns hier die ganze Zeit gemacht hat, während du zu Hause herumgesessen und Betty Crocker gespielt hast«, sagte Finn, und sein wölfisches Grinsen blitzte wieder auf, verblasste jedoch, als er sich den obersten Ordner schnappte und kurz durchblätterte.
»Was ist?«
Er verzog das Gesicht. »Hast du schon mal von der Black Hound Construction gehört?«
Ich dachte angestrengt nach. »Ich denke nicht. Sollte ich sie kennen? Sind sie aus der Gegend?«
»Nein. Sie sind neu in der Stadt, vor ein paar Monaten aus New York eingetroffen. Alistair Campbell und seine sieben Zwerge. Wohl eher: sieben Arschlöcher. Sie sind eine ganz heiße Bau-Truppe. Campbell hat etwas für Ex-Knackis übrig, die meisten seiner Crew haben ein sattes Vorstrafenregister. Ich habe die Truppe schon eine Weile auf den Schirm.«
»Warum? Wir haben doch noch andere Leute mit Vorstrafen hier in der Stadt, vermutlich mehr, als wir ahnen. Die meisten von ihnen sind harmlos.«
»Ich weiß nicht«, sagte Finn, »nenn es eine Vorahnung. Sie haben so etwas an sich, tauchen immer im Rudel auf wie die Wölfe; siehst du einen, ist der nächste direkt um die Ecke. Egal, ansonsten war es in den letzten Monaten das Übliche. Ein paar Raubüberfälle, geplünderte Hotelzimmer, meist hat es Touristen erwischt. Armstrong und Moriarty glauben, es sei eine Gang aus Angestellten verschiedener Hotels, die zusammenarbeiten. Irgendwann schnappen sie sie. Weihnachten verlief ruhig, Silvester war, wie üblich, eine Katastrophe. Die ganze Stadt voller Besoffener, auf den Straßen, in den Bars. Irgendein Clown hielt es für eine tolle Idee, mit einer Flasche Sekt intus auf den alten Wasserturm zu klettern. Er hat es bis zur Spitze geschafft und dann Panik bekommen. Die Feuerwehr musste hochklettern. Sie haben ihn heruntergeholt, und seine Freundin, ein heißer Skihase aus Denver, hat die Nacht mit dem stellvertretenden Chef der Feuerwehr beendet.«
»Hört sich aufregend an. Was habe ich noch verpasst?«
Finn zuckte die Achseln. »Wie ich schon sagte, das Übliche. Wir haben unseren eigenen kleinen Banksy oben an der Valley Academy. Jemand sprüht nach dem Unterricht auf dem Campus Graffiti an die Wände. Bisher hat ihn oder sie noch niemand erwischt. Der kleine Pisser sprüht überall den Sensenmann hin. Genau genommen ist er sogar ziemlich talentiert. Hey, kennst du den Witz von dem Priester, dem Rabbi und dem Sensenmann in Las Vegas? Sie gehen also in eine Bar …«
Ich blendete den Rest aus, starrte hinunter auf meinen Schreibtisch, fuhr mit einer Hand darüber und spürte die Kühle des alten Holzes, die Dellen und Kratzer, wo unzählige Polizeibeamte vor mir mit ihren Stiften und Büroklammern über die Oberfläche geschrammt waren. Ich konnte die Zitronen-Politur riechen, mit der der Hausmeisterservice die Möbel behandelte.
Es tat gut, wieder zurück zu sein.
Vor der Geburt von Grace hatte ich die Tagschicht, was oft dazu führte, dass ich bis spätabends oder am Wochenende irgendwelchen Hinweisen nachjagte. Es waren lange Tage und viel zu viele Nächte, die ich nicht zu Hause, nicht mit Brody verbrachte. Besonders die Abende, die sich bis in die frühen Morgenstunden hinziehen, wirken sich auf den Rhythmus deines Lebens und auf deine Beziehung aus. Wie die Gezeiten auf eine Sandburg, sie ziehen dir das Fundament all dessen, was wichtig ist, unter den Füßen weg.
Ich war auf Teilzeitbasis wieder zurück, doch ich war lange genug Polizistin, um zu wissen, dass aus einer Teilzeitstelle früher oder später Vollzeit wird, und dann kommen die Überstunden, und plötzlich wird dir klar, dass du seit Tagen an nichts anderes mehr gedacht hast als an den Fall, an dem du gerade sitzt. Die heutige Abendschicht würde nur ein paar Stunden dauern – von neunzehn Uhr bis Mitternacht. Noch nicht die Nachtschicht, aber nahe dran.
In diesen Stunden herrscht immer eine gewisse Anspannung, das Warten auf das Ende des einen und den Anbruch des neuen Tages. Doch mir war das gleichgültig. In den letzten paar Monaten war ich rund um die Uhr wach gewesen. Wenn ich nicht gerade Grace stillte, lag ich im Bett und machte mir Gedanken über all die Dinge, die sich außerhalb meiner Kontrolle befanden. Würde sie zu einem guten, starken und freundlichen Menschen heranwachsen? Würde meine Kleine ihren Weg durch diese Welt finden, die einen schneller niederschmetterte, durchkaute und wieder ausspuckte, als man hallo sagen konnte?
Ich lehnte mich gerade zurück, als ein Song von Tina Turner ausklang und die Werbung einsetzte. Es war ruhig, besonders für einen Freitagabend. Der eisige Schneesturm hatte vielleicht doch sein Gutes, wenn die Leute dadurch zu Hause blieben und er sie von den Straßen fernhielt. Ich hätte es besser wissen sollen, denn schon im nächsten Moment steckte unsere Einsatzleiterin den Kopf zur Tür herein.
Chloe Parker winkte mir zu. »Willkommen zurück, Gemma. Jungs, ich habe einen Anruf über einen verdächtigen Mann hereinbekommen, der sich in der Valley Academy herumtreibt. Der Anrufer wollte seinen Namen nicht nennen, und es war eine Nummer aus dem Bezirk New York – muss wohl ein Handy sein. Wollt ihr zwei euch mal darum kümmern? Ich wette zwanzig Mäuse, dass es sich um einen blöden Streich handelt. Ich kann auch die Streife rufen, wenn ihr lieber hierbleiben wollt. Das Wetter ist scheußlich.«
Ich schaute Finn an, stand auf und schlüpfte wieder in meinen dicken Parka. »Nein, überlassen wir die Streife den Straßen. Sie werden sich sicher noch um ein paar Unfälle kümmern müssen, bevor die Nacht zu Ende ist. Vielleicht ist es dein Sensenmann-Künstler, Finn.«
»Ich rufe den Sicherheitsdienst des Campus an«, sagte Chloe, »damit euch jemand an der Schule in Empfang nimmt. Sie müssen das Eingangstor öffnen, wenn ihr auf das Gelände wollt.«
Auf der anderen Seite des Mittelgangs stand auch Finn auf und griff nach seiner Jacke. Im Radio endete ein Spot für Aknecreme, und die Temptations setzten mit Wish it would rain ein. Finn tanzte mit einer unsichtbaren Partnerin durch den Raum. Chloe kicherte und zog sich in das winzige Zimmer zurück, das unsere telefonische Einsatzzentrale beherbergte.
»Oh, but I wish it would stop snowing«, sang Finn leise.
Ich stimmte ein: »But everyone knows that a man ain’t supposed to cry.«
Finn verdrehte die Augen und gab ein Röcheln von sich. Klar, ich werde nie den American Idol gewinnen, aber so mies singe ich nun auch wieder nicht. Da habe ich schon Schlimmeres gehört.
Ich setzte meine Mütze auf, zog Handschuhe an, nahm mir die Taschenlampe und folgte Finn in den kurzen Flur, der vom Mannschaftsraum zur Eingangstür führte. Er blieb kurz stehen, damit ich meinen Parka zuknöpfen konnte, und öffnete dann die Tür. Der Sturm hatte an Stärke zugenommen, und der kreischende Wind schien den Sauerstoff aus der Luft zu ziehen.
»Himmel«, murmelte ich. Niemand, der ganz richtig im Kopf war, ging bei einem Schneesturm wie diesem nach draußen. Ich bedauerte bereits, dass ich ausgerechnet heute Abend wieder zur Arbeit zurückgekehrt war. Ich sollte zu Hause sein, bei Grace und Brody, vor einem lodernden Kaminfeuer mit einer Tasse Kakao und einem Klatschblatt in der Hand.
Ich hatte gedacht, ich wäre bereit, wieder zurückzukehren, aber plötzlich war ich mir nicht mehr so sicher.
2. Kapitel
Anfang Februar, im tiefsten Winter, wird es in den Rocky Mountains schon früh dunkel, und eine ganz besondere Kälte breitet sich aus. Der Wind bläst eisiger und nimmt an Fahrt auf, während er von den hohen Gipfeln herunterdonnert und die Ebenen überquert, bevor er auf die Great Plains trifft und seine Energie sich zerstreut wie die Saat aus der Hand eines Bauern.
Und genau in diesen eisigen, tobenden Wind, der mit dem Schneesturm zusammenfiel, gerieten wir. Durch Schneegestöber, über glatte Straßen und fast ohne Sicht fuhren wir zur Valley Academy. Die Luft roch nach nassem Stahl. Die halbrunde Narbe in meinem Nacken fühlte sich hart an, als wäre sie aus gespanntem Draht.
Manche Menschen spüren das Wetter in ihren Knochen oder in alten Verletzungen. Ich spüre es in dem einen körperlichen Merkmal, das ich von dem Autounfall zurückbehalten habe, in dem meine Eltern starben.
Finn fuhr schweigend.
Er war über das Lenkrad gebeugt und linste durch die Windschutzscheibe, während ich die Heizung regulierte, den Scheibenenteiser eine Weile laufen ließ und dann zurückdrehte, damit unsere Hände und Füße gewärmt wurden. Wir saßen in seinem Privatwagen, einem schweren Chevi Suburban. Der große Wagen kroch vorwärts wie ein Panzer, und ich fühlte mich deutlich sicherer als in einem der Jeeps oder Limousinen, die uns als Dienstwagen zur Verfügung standen.
Finn murmelte irgendetwas.
Ich zog die Kapuze meines Parkas zur Seite. »Was hast du gesagt?«
»Wer zum Teufel ist in einer Nacht wie dieser draußen und kann einen Herumtreiber überhaupt sehen?«, fragte er, wurde langsamer und umrundete vorsichtig einen dicken Ast, der mitten auf der Straße lag. »Lass uns das Ding auf dem Rückweg von der Straße ziehen.«
Ich nickte geistesabwesend. »Ich wette, einer dieser Wichtigtuer, die in dem Mini-Trailer-Park gegenüber der Schule wohnen, Shady Acres.«
Finn lachte bellend und fluchte, als durch seinen Atem die Scheibe beschlug.
Ich seufzte und lenkte die Heizung wieder zurück auf die Scheibe. Dann lehnte ich mich vor und wischte die Windschutzscheibe mit dem Ärmel meines Parkas ab. »Heißt der so? Irgendwie klingt das nicht richtig …«
»Shaded Acres«, sagte Finn. »Shady Acres wäre ein zwielichtiger Trailer-Park aus einem Comic, so wie die Vorstadt von Gotham.«
»Es ist der perfekte Name für das Landgut eines Schurken«, sagte ich und summte die Titelmelodie einer amerikanischen Sitcom.
Finn verzog das Gesicht und boxte gegen meine Schulter. »Du hast wirklich die schrecklichste Singstimme, die ich kenne. Damit könntest du einer Katze das Fell abziehen.«
Ich verdrehte die Augen und rieb mir den Oberarm. Leider fiel mir kein passender Spruch ein. Ich beobachtete ihn aus dem Augenwinkel und erinnerte mich daran, wie wütend er mich machen konnte.
Er bemerkte es und schaute zu mir herüber. »Was ist?«
»Nichts. Wir sind da.«
Finn bog auf den Privatparkplatz der Schule ein und hielt vor dem schweren, verschlossenen Eingangstor. Unter der Straßenlaterne wirbelte der Schnee durch den Lichtkegel, und ich schaute fasziniert zu, wie der Wind die dichten Flocken zur Seite blies.
Finn schaltete den Motor ab, ließ jedoch die Heizung laufen. Fast sofort sammelte sich Schnee auf der Windschutzscheibe und bedeckte sie immer mehr. Wir starrten hinaus, um uns ein Bild von der Situation zu machen.
Der Parkplatz lag verlassen da.
Die Schule lag verlassen da.
Ich spürte, wie meine Nackenhaare sich aufstellten. Urplötzlich krampfte sich mein Magen zusammen, und Unruhe überkam mich.
Finn sprach zuerst. »Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist zu … ruhig.«
Ruhig war eine merkwürdige Wortwahl angesichts des heulenden Sturms, doch ich wusste, was Finn meinte.
Irgendetwas stimmte nicht.
Trübes Scheinwerferlicht zog über uns hinweg. Finn und ich sahen zu, wie ein großer Pick-up mit der Aufschrift KASPERSKY SECURITY auf der Seite langsam an uns vorbeifuhr. Er parkte ein paar Meter vor unserem Wagen, seine roten Rücklichter schimmerten wie die Augen eines prähistorischen Tieres.
Ich hob mein Kinn in Richtung des Pick-ups. »Kennst du die? Kaspersky?«
Finn nickte. »Ich habe den Eigentümer mal kennengelernt, Dan oder Daryl oder so. Vielleicht Devon. Ich glaube, er hat fünf oder sechs verschiedene Jungs, die er als Sicherheitsleute einsetzt.«
Kurz darauf schaltete der Fahrer den Motor des Pick-ups aus und rutschte vom Fahrersitz. Er kam langsam zu unserem Wagen herüber, und Finn ließ sein Seitenfenster herunter.
»Sir, Ma’am«, sagte der Mann, als er sich in das offene Fenster lehnte. »Ich bin Bowie Childs. Ich bin für die Sicherheit des Campus zuständig.«
Er war blond, hatte einen dichten Bart, helle, durchdringende Augen, und an einem seiner Schneidezähne fehlte eine Ecke. Wir stellten uns vor, und er schüttelte Finns Hand. Dann schaute er mich eingehend an und sagte nach einer Weile: »Das ist eine schöne Jacke. Die gefällt mir.«
»Ähm, danke«, sagte ich. »Wir würden gern über den Campus fahren. Unsere Einsatzzentrale hat Ihnen wahrscheinlich mitgeteilt, dass wir einen Anruf bekommen haben, weil sich hier eine verdächtige Person herumtreiben soll, oder?«
Childs nickte. »Ja, eine verdächtige Person. Es ist vermutlich einer dieser verdammten Jugendlichen. Ich öffne Ihnen das Tor und warte dann hier. Gebe Ihnen sozusagen Rückendeckung. Stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 2 und lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Sie müssen allerdings laufen. Ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter, die Wege sind noch nicht geräumt.«
Childs lehnte sich zurück und bedeutete Finn, er solle seine Scheibe hochkurbeln. Er ging hinüber zum Tor, gab auf einer Tastatur einen Code ein, und das Tor schwang langsam auf.
»Macht der Witze? Ich will nicht aussteigen. Und damit meine ich: Ich will wirklich nicht aus diesem Wagen raus.«
Finn schüttelte den Kopf, fuhr sich mit den Händen über die Wangen und schien sich selbst zu überreden. »Du kannst hier warten, wenn du willst. Ich bin sicher, dass Childs ein wenig Unterhaltung gebrauchen könnte. Der Campus ist nicht so groß. Bist du hier nicht eine Weile zur Schule gegangen?«
»Nur ein Jahr«, sagte ich und starrte aus dem Fenster. Der Wind wirbelte die Schneeflocken wild umher. »Es war das zweitschlimmste Jahr meines Lebens.«
»Also, du kannst ja hier warten, aber ich gehe jetzt.«
Finn legte eine Hand an den Türgriff und schenkte mir ein unbekümmertes Grinsen.
Ach, zum Teufel auch. Ich wusste, was das Grinsen bedeutete. Ich stöhnte und öffnete die Beifahrertür.
»Komm, bringen wir es hinter uns«, sagte er. »Du nimmst die rechte Seite und ich die linke. Wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Lass dein Funkgerät eingeschaltet. Es dauert nicht länger als zehn Minuten. Willkommen zurück, Baby, willkommen zurück.«
Willkommen zurück, von wegen. Es hätte mich nicht im Geringsten überrascht, wenn Finn die ganze Sache als einen miesen kleinen Streich arrangiert hätte.
Ich holte tief Luft und schob mich aus dem Wagen hinein in den wütenden Schneesturm, dessen Schneetreiben wie ein Schleier vor meiner Nase hing und bei dessen eisiger Luft meine Zähne schmerzten, wenn ich einatmete. Die Narbe in meinem Nacken fühlte sich an, als würde sie gleich reißen.
Ich ging nach rechts, während Finn sich nach links wandte. Nach ein paar Schritten drehte ich mich um und warf einen Blick über den Parkplatz. Ich konnte den weinroten Suburban kaum sehen, von Finn oder dem Sicherheitsdienst ganz zu schweigen.
Sie waren in der Dunkelheit verschwunden. Ich war allein.
Mein Herz machte einen Satz, und es kostete mich Mühe weiterzugehen. Meine Beine, normalerweise stark und muskulös, fühlten sich schwach an, als würden sie nicht zu mir gehören.
»Reiß dich zusammen«, flüsterte ich mir zu. »Du bist das hier einfach nur nicht mehr gewohnt, Gemma.«
Überall um mich herum spielte sich ein rasendes Spektakel ab. Der Wind heulte, als er durch die Baumwipfel fegte, und ließ die Äste und die wenigen verbleibenden Blätter tanzen wie Marionetten.
In einer solchen Nacht war alles möglich.
Das behielt ich im Kopf, während ich über das Gelände der Schule stapfte und an den anonymen Anrufer dachte, der die Meldung gemacht hatte. Anrufer bleiben aus vier Gründen anonym: Sie haben Angst, weil sie den Täter kennen oder weil sie selbst ein Vorstrafenregister haben; sie wollen sich nicht mit den mühseligen Formularen einer offiziellen Anzeige herumschlagen; oder es sind irgendwelche Vollpfosten, die sich einen Scherz erlauben und es besteht gar keine Gefahr.
»Scheiße!«
Ich stolperte in eine kniehohe Schneewehe und konnte gerade noch verhindern, dass ich hinfiel. Ich fand mein Gleichgewicht wieder und fluchte erneut, wütend über meine Tollpatschigkeit. Ich war das erste Mal seit Jahren nicht mehr in Form. Alles schien durcheinander: mein Gleichgewichtsgefühl und mein Orientierungssinn. Selbst mein Hörvermögen schien gedämpft zu sein. Zwölf Wochen zu Hause mit einem Neugeborenen, in denen ich kaum etwas anderes getan hatte als stillen, schlafen und essen, hatten mich aus der Übung gebracht, mich weich gemacht.
Ich atmete durch, ging weiter und versuchte, alle meine Sinne in Alarmbereitschaft zu halten, mir wohl darüber bewusst, dass bei diesem Wetter und dem Wind, der jedes Geräusch verschluckte, sich jederzeit jemand von hinten dicht an mich heranschleichen konnte, bevor ich überhaupt merkte, dass da jemand war.
Ich ging weiter, doch die Valley Academy schlief. Auf dem Campus schien alles in Ordnung zu sein; allmählich hatte ich keine weichen Knie mehr und wurde wieder ruhiger.
Die Privatschule hatte sich seit meiner Zeit nicht sehr verändert. Das Hauptgebäude auf dem Campus, die McKinley Hall, war ein zweistöckiges Gebäude mit einem geneigten Dach und einer schlichten Ziegelsteinverkleidung. Die Schüler gingen die fünf Stufen zur Eingangstür hoch und kämpften dann mit den beiden schweren, überdimensionalen Türflügeln, die berüchtigt dafür waren, dass man sich in ihnen die Finger klemmte oder blaue Flecken an den Schultern bekam. Parallel zu den Stufen verlief eine Rollstuhlrampe, die zu einer kleineren Flügeltür führte. Die McKinley Hall hatte im Erdgeschoss umlaufende Fenster sowie Klassenraumtüren, die ins Freie führten, und einige Notausgänge.
Die McKinley Hall war von einer Handvoll kleinerer Gebäude umgeben wie von Blütenblättern. Ich erkannte die Bibliothek und das Wissenschaftslabor, aber die restlichen Gebäude waren neu, und ich wusste nicht, was darin unterrichtet wurde. Während ich vorbeiging, rüttelte ich an jeder Tür, prüfte die Schlösser und stellte sicher, dass die verdächtige Person, falls es sie gab, nicht ins Schulgebäude gelangt war. Die Türen waren alle verschlossen, und durch die Bewegung wurde mir warm. Ich schwang meine Arme und machte weiter, ausladende Schritte, damit das Blut bis in meine äußeren Extremitäten zirkulierte.
An dem Gebäude, das zu meiner Zeit der Matheraum gewesen war, blieb ich stehen; der Lehrer hatte Mr. Turpin geheißen. Wir hatten ihn Turnip genannt, Steckrübe. Er starb vor ein paar Jahren beim Bergsteigen in Kalifornien. Er hatte bis zur Pensionierung gewartet, um die Pläne, die er sich für sein Leben gemacht hatte, in die Tat umzusetzen, ohne zu wissen, dass er direkt beim Versuch, das erste Ziel zu erreichen, sterben würde.
Manchmal dachte ich darüber nach. Ich hatte keine Liste von Dingen, die ich in meinem Leben noch erreichen wollte. Das schien etwas für Träumer zu sein, vielleicht bin ich zu sehr Realistin. In meinem Beruf lernt man recht schnell, wie kurz und kostbar das Leben ist, wie kein einziger Tag als selbstverständlich angesehen werden darf. Die Zukunft muss man sich hart erkämpfen, und sie ist nicht jedem gegönnt.
Zum Teufel, jeder Tag sollte irgendwie ein besonderer Tag sein.
Turpins altes Fenster war von Schnee zugeweht. Ich fegte ihn beiseite und legte meine Hände um die Augen, doch es war zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich wusste jedoch, was hinter den verschlossenen Türen lag: pinkfarbene und rote Papierherzen, sorgsam mit Kinderscheren ausgeschnitten. Die Schwestern im St. Agatha Krankenhaus bastelten sie jedes Jahr mit den kranken Kindern und schenkten sie dann den Schulen.
Bald war Valentinstag. Ich dachte an den gehängten Elfen in unserem Mannschaftsraum und die Weihnachtsdeko bei uns zu Hause, die ihren Weg vom Wohnzimmer auf den Dachboden immer noch vor sich hatte. Die Tage vergingen so schnell, ich kam kaum hinterher.
Ich konnte täglich dabei zusehen, wie Grace sich veränderte. Nach der Geburt, als man sie mir in den Arm legte, hätte ich sie den Ärzten am liebsten direkt wieder zurückgegeben. Das klingt wahrscheinlich ziemlich hart, aber sie sah aus wie jedes andere schreiende Neugeborene mit rotem Gesicht, das ich je gesehen hatte. Ich konnte rein gar nichts an ihr finden, was mir vertraut vorkam.
Inzwischen, nur vierundachtzig Tage später, erkannte ich Züge von mir und von Brody in ihrem Gesicht, und etwas, das ganz allein Grace war. In Zukunft, so hoffte ich, würde der Grace-Anteil mehr werden, bis er stärker war als die Teile von Brody und Gemma. Wir beide hatten dunkle Seiten an uns, und für Grace wünschte ich mir mehr Licht als Dunkelheit.
Doch in meinem Herzen wusste ich nur zu gut, dass Licht ohne Dunkelheit auch nur eine Illusion ist. Es ist der Kontrast, der Farbe und Fülle ins Leben bringt.
Die Kälte kroch mir wieder in die Knochen, und ich wandte mich vom Fenster ab und ging weiter. Ich dachte an Bowie Childs, den Mann vom Sicherheitsdienst, der auf dem Parkplatz in seinem warmen Pick-up saß. Zumindest hoffte ich, dass er immer noch dort war. Der Gedanke, um eine Ecke zu biegen und ihm in die Arme zu laufen, jagte mir neue Schauer über den Rücken.
Plötzlich schreckten mich Geräusche aus meinen Gedanken. Finns Stimme drang aus dem Walkie-Talkie. »Zehnneun, Finn, bitte kommen.«
»Nord- und West-Seiten sind in Ordnung. Noch nicht einmal Fußabdrücke, aber bei diesem Wind war das nicht anders zu erwarten. Wie sieht’s bei dir aus?«
Seine Stimme hörte sich über Funk an wie das Knacken im Kaminfeuer, dann ertönte ein Rauschen und danach nichts mehr.
»Zehn-vier. Die Südseite ist auch okay. Ich gehe jetzt zur Ostseite«, antwortete ich.
Seine zerhackte Antwort war nicht zu verstehen. Ich legte meine Hand schützend um das Walkie-Talkie und hielt es wieder an meinen Mund. »Finn?«
Keine Reaktion. Ich stopfte das Funkgerät zurück in meine Jackentasche. Wir würden uns irgendwo auf dem Rundweg treffen, genau wie er mir im Auto versprochen hatte.
Ich ging weiter, bis ich zu dem alten Weg kam, der zwischen der Schule und dem Wald verläuft. Espen und Kiefern säumten den Pfad. Der heulende Wind ebbte ab, die Schneeflocken schienen mitten im Fall zu verharren, und es wirkte so, als bräuchte selbst der Schneesturm mal eine Pause.
Fast dachte ich, ich hätte mir den kurzen ruhigen Moment nur eingebildet, doch dann sah ich, was ein paar Meter entfernt an einer verrotteten Espe lehnte.
Ich blieb wie angewurzelt stehen und starrte den Mann an.
Er war groß und für das Wetter unzureichend gekleidet. Keine Mütze auf dem runden Kopf, keine Handschuhe, noch nicht einmal ein Schal um seinen pummeligen, bleichen Hals.
Er starrte mich aus trüben Augen an, an deren Wimpern zarte Schneeflocken hingen.
Ich schluckte und ging zaghaft einen Schritt auf ihn zu, dann noch einen. Dann blieb ich stehen. Ich holte das Walkie-Talkie aus der Tasche und drückte, ohne den Mann aus den Augen zu lassen, den größten Knopf. Ich schirmte es mit meiner Hand vom Wind ab und sprach hinein.
»Finn? Ich habe hier was. Wir sind auf der Ostseite, irgendwo zwischen der Sporthalle und der Bibliothek.«
Keine Antwort von meinem Partner.
Ich wusste, dass ich mich jetzt zurückziehen sollte, an irgendeinem Gebäude in Deckung gehen und den Tatort im Auge behalten. Doch stattdessen steckte ich das Funkgerät weg, zog meine Dienstwaffe aus dem Hüftholster, entsicherte sie und hielt sie in der rechten Hand, möglichst locker und entspannt. Ich drehte mich einmal langsam im Kreis und suchte mit den Augen die Dunkelheit am Waldrand nach Lichtern oder Bewegungen ab, die dort nicht hingehörten. Hier war jedoch nichts, nur eine nervöse Polizistin und ein toter Mann, der sitzend an einer alten Espe lehnte. Ein großes Jagdmesser ragte aus seinem Bauch.
Wir reden uns immer ein, dass wir als Polizisten den Tatort unter Kontrolle haben. Wir übernehmen die Verantwortung, wenn wir ankommen. Wir bringen Ordnung ins Chaos und legen Regeln fest, um die Verwüstung in den Griff zu bekommen. Auf diese Weise enthüllen wir Geheimnisse, finden Beweise und verfolgen die Schuldigen.
In Wahrheit ist das alles nur ein Haufen Lügen.
Ich wusste, dass hier etwas am Werk war, was mächtiger war als ich, und das würde unsere nächsten Schritte bestimmen, hier an dieser privaten Eliteschule und während der nächsten Tage.
Jetzt regierte der Tod diese Nacht, der Tod und der Schneesturm.
3. Kapitel
Ich musste mich immer wieder umdrehen, schauen, die Gegend absuchen. Der Wind preschte weiter durch den Wald, schlug die Wipfel aneinander, rüttelte an den Stämmen, fegte gewaltsam hindurch und kehrte unbarmherzig wieder zurück.
Irgendwo dort draußen in diesen Wäldern war ein Mensch, der jemandem das Leben genommen hatte. Vielleicht rannte er gerade so schnell er konnte fort, bahnte sich einen Weg durch den knietiefen Schnee. Außer Atem, stolpernd, krallte er sich an schneebeladene Äste, die in Augenhöhe hingen.
Sein Gesicht. Ihr Gesicht? Die Augen leuchteten vom Adrenalinschub, der Mund stand offen, die Nase rot von der bitteren Kälte. Sein erster Mord. Angeekelt darüber, zu was er fähig war, schockiert, dass er eine solch widerwärtige Tat hatte durchführen können. Er hatte ein Leben geraubt, die Zeit für jemanden angehalten.
Ich stellte mir lieber vor, dass er gerade auf der Flucht war. Die Alternative wäre viel schlimmer; dass er vielleicht still irgendwo stand, direkt hinter den Kiefern und Espen, mich beobachtete und abwartete, sich fragte, ob er in dieser Nacht erneut töten müsste. Wachsam, ruhig, bereit. An dem einen Mord war er nicht zerbrochen. Und an einem zweiten würde er das sicher auch nicht.
Ich schnellte wieder herum, merkte, wie hastig mein Atem ging und versuchte, mit meinem Herzschlag Schritt zu halten. Trotz der eisigen Kälte hatte ich Schweißausbrüche, und ich merkte, dass ich langsam die Kontrolle verlor.
Atme, Gemma …
Ich war einmal in Mexiko tauchen gewesen. Zehn Meter tief, Auge in Auge mit einem Papageienfisch, als ich eine Panikattacke bekam. Es fühlte sich so an, als gäbe es auf der ganzen Welt plötzlich keinen Sauerstoff mehr. Ich wäre so schnell wie möglich hoch an die Oberfläche geschossen, wenn meine Tauchlehrerin nicht so professionell gewesen wäre. Sie beruhigte mich, hielt mich förmlich unten fest und hat mir damit sehr wahrscheinlich das Leben gerettet.
Ich hatte weder vorher noch irgendwann später je eine solche Panikattacke gehabt.
In dieser Nacht jedoch fühlte ich mich, als wäre ich wieder zehn Meter unter Wasser und würde den Verstand verlieren.
Mein erster Tag wieder zurück im Job, und schon war ich verloren.
»Schluss damit!«, flüsterte ich mir selbst zu. Ich hörte auf, mich im Kreis zu drehen und zwang mich dazu, ruhig stehen zu bleiben. »Da draußen ist niemand.«
Ich holte tief Luft, dann noch einmal. »Schluss damit.«
Ich ballte die linke Hand zur Faust und schlug mir zweimal gegen den Oberschenkel. Ein stumpfer Schmerz zog durch mein Bein und holte mich aus meiner Panik.
Dann war Finn an meiner Seite. Er beugte sich vor und sagte laut, über den Wind hinweg: »Warst du schon näher dran?«
Sein dunkler, dick gefütterter Parka und die Wintermütze mit der breiten Krempe wirkten vertraut und ließen mich direkt ruhiger werden. Ich griff nach seiner Schulter und legte meinen Mund an sein Ohr. Einen kurzen Augenblick berührten meine Lippen seine Haut, und die Wärme reichte aus, um Hitze in meine Wangen steigen zu lassen und mein Gesicht aufzutauen.
»Nein, ich habe auf dich gewartet.«
Finn ging ein paar Schritte auf die Leiche zu, und ich folgte ihm. Ich würde es ihm nie erklären können, doch er entfachte einen Mut in mir, der nicht selbstverständlich für mich war. Dafür sind Partner da, um zu zweit stärker zu sein als allein. Eingebildeter Esel oder nicht, ich hatte nie daran gezweifelt, dass Finn mir Rückendeckung gab.
Wir standen vor dem toten Mann und brauchten eine Weile, um unsere Gedanken zu sammeln. Im Schutz der Bäume war es ruhiger. In der grimmigen Anwesenheit des Todes huschte ein Flüstern von etwas Gespenstischem an uns vorbei. Der Tod will jemanden letztendlich ganz. Das ist eine ernste Sache, wenn man ihm so direkt in die Augen sieht wie wir.
Finn zog sein Handy heraus und machte ein paar Fotos. »Mann, was für eine Art zu sterben.«
Der Mann war glattrasiert und konnte gerade noch als ein Mann mittleren Alters gelten. Sein Mund war leicht geöffnet, und wir konnten seine Zunge sehen. Sein linkes Auge war aus Glas. Das rechte Auge starrte uns an, doch sah nichts mehr. Seine nackten, blutigen Hände waren um das Messer gelegt, das aus einer Wunde in seinem Bauch hervorragte.
Ich schloss die Augen, doch die Bilder blieben, schnelle Schnappschüsse einer scheußlichen Szene: offene Augen, die nichts mehr sahen. Weißer Schnee, blutgetränkt. Der Holzgriff des Jagdmessers, mit kunstvoller Schnitzerei verziert und knotig wie der Finger eines alten Menschen.
Ich kannte den Mann nicht, und dafür war ich dankbar. In einer kleinen Stadt wie Cedar Valley ist das nicht immer der Fall. Ich öffnete meine Augen und sah, wie Finn das Blut fotografierte, sowie all die anderen Flüssigkeiten, die in einem schmierigen, halbgefrorenen Rinnsal aus dem Bauch des Mannes gesickert waren und sich unter ihm in einer Pfütze gesammelt hatten.
Finn murmelte: »Sieht aus, als hätte er versucht, das Messer herauszuziehen, oder?«
Ich stimmte zu. »Der Griff … siehst du die Schnitzereien, das Muster? Es sieht aus wie ein Unikat, vielleicht ein Erbstück.«
Finn nickte, beugte sich vor und machte einige Nahaufnahmen von dem Messer und dem geschnitzten Griff.
Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Das ist noch nicht lange her. So, wie der Schnee fällt, ist das erst vor kurzem passiert, Finn.«
Finn zog seinen Handschuh aus und legte den Handrücken an den Nacken des Mannes. »Ist nicht mehr warm. Wir haben zwanzig Minuten hierher gebraucht, nachdem der Anruf reinkam. War es ein Mann oder eine Frau?«
»Wer?«
»Der anonyme Anrufer.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wir haben nicht gefragt. Das war dumm von uns.«
»Manchmal spielt das auch keine Rolle«, sagte Finn und zog seinen Handschuh wieder an. »Aber in diesem Fall wüsste ich gern: War der Kerl hier die verdächtige Person oder der anonyme Anrufer?«
»Nun, auf jeden Fall haben wir außer ihm noch einen Mörder hier draußen. Und wenn er der Anrufer war – was zum Teufel hat er dann in diesen Klamotten hier draußen gemacht? Er wäre auch ohne, dass ihn jemand umgebracht hätte, an Unterkühlung gestorben. Lass uns Meldung machen, in diesem Sturm verlieren wir mit jeder Minute weitere Indizien.«
Finn machte einen weiteren Schritt nach vorn und beugte sich hinunter. Er war weniger als zwanzig Zentimeter von dem Mann entfernt und musterte sein Gesicht. Dann wich er ein Stück zurück.
»Was ist los?«, fragte ich.
Finn verschränkte seine Hände und legte sie sich auf den Kopf. Er atmete tief und lange aus. »Die Scheiße fliegt uns hier gleich um die Ohren, Gemma. Ich hoffe, du bist darauf gefasst.«
»Wovon redest du da?«
»Erkennst du ihn nicht?«
Ich schaute die Leiche noch einmal genauer an, ohne mich ihm so weit zu nähern, wie Finn es getan hatte. Der Mann hatte einen dunklen Teint. Seine Schuhe, der Pullover und die Jeans wirkten teuer, waren jedoch keine Luxusartikel. Er war eher kräftiger gebaut als der Durchschnitt.
»Naja, irgendwie kommt er mir schon bekannt vor …«
Finn lehnte sich vor und hielt seine Hand über das tote Glasauge des Mannes. »Stell dir eine schwarze Augenbinde vor, und einen dichten, leicht angegrauten Bart. Die Haare noch ein paar Zentimeter länger, so dass sie die Stirn und die Ohren bedecken.«
Ich tat es, und dann wurde mir alles klar.
Ich schnappte nach Luft. »Nein! Was macht der hier in Cedar Valley?«
Finn schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Delaware Fuente. Was für ein Verlust. Das ist das Deprimierendste, was ich je gesehen habe.«
»Ich wusste gar nicht, dass du so ein Fan bist. Finn, wir müssen Meldung machen. Wir müssen so viele Indizien erhalten, wie es nur geht. Besonders jetzt, wo wir wissen, wer unser Opfer ist.«
»Den Kampf können wir nur verlieren, Gemma, und das weißt du. Hier?« Er deutete düster auf den Wind und den Schnee. »Dieser Kram zerstört einen Tatort wie nichts sonst.«
Mir fiel etwas ein. »Hast du eine Plane im Auto?«
Finn schüttelte den Kopf. »Nein, sie ist in der Garage bei meiner Campingausrüstung.«
»Ich wusste es, wir hätten den Dienstwagen nehmen sollen. Wir hätten Plane, Seil, Absperrband …«
Ich verstummte und zeigte auf eine Mülltonne neben einem verschlossenen Klassenraum. »Lass uns nachsehen, ob noch eine zweite Tüte als Reserve darin liegt. Wir könnten ihn zumindest abdecken, vielleicht noch etwas retten.«
Finn lief hinüber zu der Tonne und zog eine halbvolle Mülltüte heraus, die er direkt zur Seite warf. Ich sah zu, wie er sich in die Tonne beugte, umhertastete und dann lächelte, als er eine große schwarze, gefaltete Tüte herauszog. Mit einem Taschenmesser schlitzte er sie der Länge nach auf und fertigte ein Leichentuch an, das den Kopf und die Wunde des Mannes bedeckte.
Vorher hatte Finn Fuentes Taschen geleert. Eine Brieftasche und ein paar kleinere Dinge waren alles, was in dem Beweismittelbeutel lag, den Finn aus seiner eigenen Jackentasche gezogen hatte.
»Er hatte kein Handy bei sich. Und er ist nicht für dieses Wetter angezogen. Wo ist seine Mütze, sein Schal? Keine Handschuhe … auf dem Parkplatz standen keine anderen Autos. Wie ist er hierhergekommen? Nicht zu Fuß aus der Stadt, unmöglich, nicht in diesem Aufzug.«
Finn wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. »Jemand hat ihn hergefahren und dann umgebracht. Nichts hiervon sieht wie ein Zufall aus.«
»Oder er hat seinen Mörder hergefahren, und der hat dann das Auto genommen. Schlimme Sache. Bestsellerautor wird mitten im Schneesturm, mitten auf dem Gelände einer Privatschule, mitten im Nirgendwo tot aufgefunden.«
»Ich würde nicht sagen, dass wir mitten im Nirgendwo sind.«
»Naja, Cedar Valley steht nicht gerade im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Nach heute Abend könnte sich das allerdings ändern … Was hat ein Mann getan, um auf diese Art erstochen zu werden? Warum hier, an der Academy? Das Messer, die verrottete Espe … Es ist wie ein krankes Kunstwerk.«
Finn zuckte die Achseln. »Bei einem Mord wie diesem gibt es nur Fragen über Fragen.«
Er schaute dem Mann noch einmal ins Gesicht und leuchtete ihm mit dem Licht seines Handys in den Mund. »Da steckt was drin.«
»Was?«
Finn schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht sagen. Sieht aus wie ein Stück Papier. Ein zerknülltes Stück Papier.«
»In seinem Mund?«, fragte ich und kam dichter heran. »Nicht anfassen. Es könnten Fingerabdrücke drauf sein.«
Wir stopften die schwarze Tüte rund um Fuente fest, so gut wir konnten. Es war nicht ideal, aber es würde ausreichen, bis die Kriminaltechniker kamen. Dann sahen wir zu, wie das Plastikleichentuch wild im Wind flatterte. »Was für ein scheußlicher erster Arbeitstag.«
»Du liebst es«, sagte Finn. »Gib’s doch zu. Natürlich nicht die Tatsache, dass jemand gestorben ist, aber du liebst es, wieder dabei zu sein. Ich habe es gesehen, Gemma, wie du ihn beobachtet hast, und den Wald. Das Beobachten liegt dir im Blut. Es ist dein Ding.«
»Klar habe ich es vermisst«, sagte ich und machte mir nicht die Mühe klarzustellen, dass ich nicht beobachtet hatte, sondern panisch gewesen war. »Es ist gut zu wissen, dass ich beides sein kann, Mutter und Cop. Ich muss mich nicht dazwischen entscheiden.«
»Naja, noch nicht«, murmelte Finn. »Mach Meldung, ja? Mein Akku ist gleich leer.«
Chloe Parker, dieselbe Frau, die uns von der Einsatzzentrale aus losgeschickt hatte, war am Apparat. Ich wusste, dass sie die üblichen Protagonisten eines Tatorts benachrichtigen würde: die Kriminaltechnik, die Gerichtsmedizinerin und Chief Angel Chavez. Das Standard-Protokoll war, ihn in einem Todesfall unter verdächtigen Umständen unmittelbar zu alarmieren. Ich bat Chloe, Fuentes Namen aus der öffentlichen Kommunikation herauszuhalten und ihn nur gegenüber Chavez und der Gerichtsmedizinerin zu erwähnen.
Als ich mit dem Telefonat fast fertig war, winkte mir Finn zu, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Was?«, sagte ich tonlos.
Er machte eine Telefonhörer-Geste. »Der Anrufer.«
»Oh, Chloe, eine Sache noch«, sagte ich. »Der anonyme Anrufer, der den Notruf abgesetzt hat, war das ein Mann oder eine Frau?«
»Da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube eine Frau, aber das war schwer zu sagen. Sie hatte eine sehr tiefe Stimme, wie die einer Raucherin«, antwortete Chloe. »Ich spule das Band zurück und lege es dir auf den Schreibtisch, dann kannst du es dir anhören, wenn du zurück bist. Weißt du, jetzt, wo du fragst, bin ich wirklich nicht mehr sicher. Könnte auch ein Mann gewesen sein. Und diese Vorwahl von New York … Harter erster Tag, hm? Ich wette, du musst bald abpumpen.«
Oh, verdammt!
Noch während ich auf dem Display meines Handys die Uhrzeit prüfte, fingen meine Brüste wie auf ein Stichwort an zu pochen. Ich beendete das Gespräch. Das würde jetzt peinlich werden.
»Finn? Ich muss zurück aufs Revier, sobald die Spurensicherung hier eintrifft.«
Er sah mich komisch an. »Musst du pinkeln? Geh um die Ecke. Himmel, Gemma, du weißt doch, wie so ein Tatort funktioniert. Geh und tu, was du tun musst. Ich guck auch nicht hin.«
Ich seufzte und schüttelte den Kopf. »Ich muss abpumpen, Finn. Wegen der Milch. Ich muss es alle paar Stunden machen. Nur deshalb kann ich wieder arbeiten, da ich Grace ja stille. Chavez hat mir auf dem Revier ein kleines leeres Büro zur Verfügung gestellt. Ich hatte nicht erwartet, dass ich die halbe Nacht draußen bin.«
Finns Blick glitt zur Seite. »Oh. Ja, okay, wir fahren, wenn sie eintreffen. Kein Problem«, antwortete er. »Tut das …«
»Was?«
Er schüttelte den Kopf. »Vergiss es, ich will es gar nicht wissen.«
Wir ließen den toten Mann zurück und warteten im Schutz eines niedrigen Vordaches, das über das Schulgebäude hinausragte wie der Bug eines Schiffes. Von dort, wo wir standen, konnten wir Fuente im Auge behalten und waren vor dem Schneesturm etwas abgeschirmt. Vernünftig unterhalten konnte man sich trotzdem nicht. Wir standen schweigend da, jeder verloren in seinen eigenen Gedanken.
Delaware Fuente.
Ich flüsterte den Namen des Mannes noch zweimal leise, fast wie ein Mantra.
Delaware Fuente.
Delaware Fuente.
Genau wie meine unzähligen Mitschüler hatte ich Fuente das erste Mal im Englischunterricht in der Neunten gelesen. Er schrieb sein bekanntestes Buch Der Sohn des Sklavenhändlers mit Anfang zwanzig. Dafür wurde ihm der Pulitzerpreis verliehen und es machte ihn über Nacht zum Liebling der Literaturszene. Sein zweiter Roman Ruf die Heuschrecken wurde ein noch größerer Erfolg. Er war eine dieser Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die jeder mochte, mit seinem Weihnachtsmannbart und der Weigerung, sich in irgendeine Schublade stecken zu lassen. Nach seinen ersten beiden Romanen wandte er sich eine Weile dem Schreiben von Horrorgeschichten zu und versuchte sich dann an einer historischen Roman-Trilogie. Alle wurden Bestseller.
Mir wurde klar, dass das alles war, was ich über den Mann wusste. Hatte er eine Familie und Kinder? Gab es irgendwo eine Ehefrau oder einen Ehemann, der oder die ihn zurückerwartete? Was zum Teufel machte er in Cedar Valley?
Und, am wichtigsten, was hatte Delaware Fuente in seinen fünfzig Lebensjahren gemacht, um das hier auszulösen?
»Er wurde geboren, er lebte, und irgendwo auf dem Weg hat er etwas getan, das das hier ausgelöst hat.«
Ich hatte es leise gesagt und gedacht, der Wind würde meine Worte forttragen, doch Finn hörte sie. Er streckte den Arm aus und klopfte mir auf den Rücken. »Wir werden herausfinden, was passiert ist, das tun wir immer.«
Ich nickte. Das tun wir immer, doch zu welchem Preis? Mein letzter Fall hatte mich fast den Verstand gekostet. Ein junger Kollege hatte dabei ein Bein verloren, und ein dunkles Geheimnis war zutage gefördert worden, das über dreißig Jahre in dieser Stadt vergraben gelegen hatte.
Ich fragte mich, welche Geheimnisse mit Delaware Fuentes Tod an die Oberfläche treiben würden.
Der Himmel über den Bäumen wurde von einem gespenstischen blauen Licht erfüllt, und wie stark der Wind war, merkte ich daran, dass ich die Sirenen erst hörte, als die Crew schon fast bei uns war. Sie kamen in einer langen Reihe, einer hinter dem anderen, und bewegten sich langsam über den breiten Weg. Ihre Fahrzeuge waren auf demselben Parkplatz geparkt, auf dem wir den Suburban stehen gelassen hatten.
Ich sah, dass Bowie Childs, der Mann vom Sicherheitsdienst, die Gruppe anführte. Er beleuchtete den Weg mit einer starken Taschenlampe, deren Strahl er langsam über den Weg vor- und zurückgleiten ließ, als suche er nach Hinweisen.
Ganz am Schluss nach den Leuten von der Kriminaltechnik kam Dr. Ravi Hussen in Begleitung ihrer eigenen Mitarbeiter, zwei Brüder namens Lars und Jeff, die sich so bewegten wie immer: ein schweigendes Tandem. Ravi war der einzige Mensch, den ich kannte, der auch an einem Tatort mitten in einem Schneesturm glamourös aussehen konnte. Ihr hellblauer Parka war tailliert und sah teuer aus, mit Fellbesatz und schicken silbernen Accessoires.
»Doc, du siehst aus wie ein Bond Girl«, sagte Finn, pfiff anerkennend durch die Zähne und schüttelte den Kopf. »Du weißt genau, wie man die alten Knochen wieder warm bekommt.«
Ravi lächelte süß und zitierte: »›Denn Zeit, nie rastend, führt den Sommer fort, zum finstern Winter, und verdirbt ihn da, es stocken Säfte, Blatt auf Blatt verdorrt, verschneit liegt Schönheit, Wüste fern und nah.‹«
Finn stöhnte. »Ich hatte ganz vergessen, dass du so ein Nerd bist. Ich hebe mir die Bond-Girl-Vergleiche für die auf, die sie wirklich verdienen.«
»Macbeth?«, fragte ich Ravi.
Die Gerichtsmedizinerin schüttelte den Kopf. »Kein schlechter Versuch, aber nein. Die Sonette. Ist das wirklich Delaware Fuente?«
Ich nickte. »Leider ja.«
»Hör zu«, sagte Finn, »ich muss die Mommy hier zurück aufs Revier bringen. Die Milchmaschine platzt sonst gleich. Ich habe Bilder von Fuente gemacht, bevor wir ihn abgedeckt haben, und seine Taschen geleert. Lass die Jungs sichern, so viel sie können. Wir wissen, dass das hier draußen ein Kampf gegen Windmühlen ist. Die Todesursache scheint offensichtlich zu sein, aber ihr seid die Experten, vielleicht war da noch etwas anderes.«
Finn ging, um mit den Leuten von der Spurensicherung zu sprechen. Ravi grinste mich an. »Milchmaschine? Liebes, die Dinger sind fantastisch. Du siehst großartig aus. Willkommen zurück! Ich weiß, es muss schrecklich sein, sie allein zu lassen.«
Ich nickte langsam. »Ja … aber weißt du, genau genommen … Ganz ehrlich, es ist gar nicht so schwer. Ich habe das Gefühl, ich weiß die Hälfte der Zeit, wenn ich mit Grace zusammen bin, überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache. Ich meine, ich halte sie im Arm, ich stille sie, ich habe sie lieb, aber ansonsten passiert nicht viel. Manchmal bin ich so gelangweilt, dass ich schreien könnte.«
Finn kam wieder zurück. Ich wollte nicht, dass er von unserer Unterhaltung etwas mitbekam, also fügte ich schnell hinzu: »Mit geht’s gut, ehrlich. Es ist nur … niemand bereitet einen darauf vor.«
Ich dachte, Ravi würde mit einem weiteren weisen Zitat antworten, doch zu meiner Überraschung umarmte sie mich und raunte mir ins Ohr: »Halt durch. Es wird alles besser. Zumindest sagen das alle meine Freundinnen. Grace wird in euer gemeinsames Leben hineinwachsen, genau wie du.«
Ich bedankte mich gerade bei Ravi, als Finn sagte: »Doc, bevor wir gehen … kannst du dir das mal ansehen?«
Wir folgten Finn zurück zur Leiche, und er lieh sich von einem der Kriminaltechniker eine starke Taschenlampe. Die schwarze Plastikfolie war entfernt worden, und Lars – oder vielleicht war es Jeff – faltete sie sorgsam und steckte sie in einen Beweismittelbeutel. Finn richtete den Strahl auf Fuentes Mund.
»Siehst du das?«
Ravi nickte. »Jepp. Einen Augenblick.«
Sie zog ihre dicken Skihandschuhe aus, ersetzte sie durch ein Paar Latexhandschuhe und zog Fuentes Mund dann vorsichtig auf. Sein Unterkiefer hing herunter wie der einer offenen Nussknacker-Figur.
Ravi griff hinein und zog das Objekt heraus, das jemand in Fuentes Mund gestopft hatte. Oder hatte er es vielleicht selbst hineingestopft? Hatte er vielleicht versucht, etwas vor seinem Mörder zu verstecken?
Ravi faltete den Papierball vorsichtig auseinander und hielt ihn in den Schein von Finns Taschenlampe. Er war liniert, wie aus einem kleinformatigen Notizbuch oder Tagebuch. Jemand hatte quer über die Seite einen Satz geschrieben, mit einem Stift, der aussah wie schwarzer Edding.
»›Das ist erst der Anfang‹«, las ich laut vor.
Ein Schauer, der nichts mit dem Schneesturm zu tun hatte, lief mir über den Rücken. Ich dachte an die Minuten, die ich dort gestanden hatte, bevor Finn eintraf, und mich fragte, ob der Mörder vom Tatort weglief oder irgendwo im Wald stand und mich beobachtete.
Finn, Ravi und ich sahen uns schweigend an. Ich wusste, dass jedem von uns dieselbe Frage durch den Kopf ging.
Der Anfang von was?
»Oh Mann, was für ein Schlamassel«, sagte Childs. »Den Zettel da, haben Sie den in seinem Mund gefunden? Das ist ja total wie in diesem Schweigen-der-Lämmer-Scheiß. Ist da Blut drauf?«
Der Mann vom Sicherheitsdienst stand hinter mir, atmete schwer und rieb sich mit seiner behandschuhten Hand den dichten blonden Bart.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Mr. Childs, auf dem Zettel ist kein Blut. Hören Sie, das hier ist ein Tatort, und es ist wohl das Beste für alle Beteiligten, wenn Sie dort drüben bei dem Gebäude warten und unsere Jungs ihren Job erledigen lassen.«
Childs hörte auf, sich den Bart zu reiben. »Wo haben Sie diese Jacke gekauft? Die sieht teuer aus. Als Cop verdient man heutzutage sicher viel mehr als zu der Zeit, als mein Daddy ein Cop war.«
Ich zuckte die Achseln. »Dazu kann ich nichts sagen. Da drüben, bei dem Mülleimer … bitte halten Sie mindestens diesen Abstand zum Tatort.«
Childs wirkte gedankenverloren, bis er Ravi bemerkte. Er starrte sie schweigend an.
Sie stellte sich vor, fühlte sich jedoch unter Childs Blicken unbehaglich und wandte sich ab. Ich hasste es, sie zurückzulassen, doch das Ziehen in meinen Brüsten war kaum noch auszuhalten.
Ich bat Finn zu warten, bis Childs sich umgedreht und den Tatort verlassen hatte.
Vor der Schule wirkte Finns Suburban wie ein lauernder Dinosaurier. Ich begann mit meinem Jackenärmel den Schnee von der Windschutzscheibe zu wischen. Finn schloss den Wagen auf, beugte sich hinein, um den Motor anzuwerfen, und brüllte mir dann etwas über den heulenden Sturm hinweg zu.
»Was?«, rief ich zurück.
Er fuchtelte dramatisch mit den Armen. »Steig in den verdammten Wagen, Gemma. Wirf die Heizung an.«
»Bist du sicher? Ich kann helfen!«
Finn schüttelte den Kopf. »Steig ein. Deine Wangen werden schon blau.«
Das ließ ich mir kein drittes Mal sagen. Ich kletterte in den Wagen und drehte die Heizung so hoch, wie es ging. Obwohl nun warme Luft durch den Suburban gepustet wurde, half das wenig, um die Eiseskälte abzutauen, die sich in meinem Innersten ausgebreitet hatte. Ich dachte über den Zettel in Fuentes Mund nach; war es das Versprechen eines Mörders oder eine Nachricht von Fuente?
Das ist erst der Anfang …
Finn sprang in den Wagen. Seine Hände zitterten, als er den Rückwärtsgang einlegte und zurück zum Revier fuhr. Ich fühlte mich, als würde mir nie wieder warm werden, und ständig ging mir ein Gedanke durch den Kopf: Es war eine verdammt kalte Nacht, um zu morden.
4. Kapitel
Zurück auf dem Revier zog ich den Parka und die Handschuhe aus und kochte dann Wasser für einen heißen Tee. Meine Arme und Beine waren eiskalt, und meine Nase fühlte sich geschwollen an. Meine Stiefel einschließlich der Socken waren durchnässt, also stellte ich sie neben die knackende Heizung an der Nordwand. In der untersten Schublade meines Schreibtisches fand ich ein altes Paar Wollsocken. Sie waren fadenscheinig und hatten Löcher, doch es war besser als nichts. Als ich sie anziehen wollte, musste ich feststellen, dass meine letzte Pediküre Monate her war. Meine Nägel waren kurz geschnitten, doch die kläglichen Reste des Nagellacks sahen aus wie violette Sommersprossen.
Ich erschauderte und hoffte, dass meine Mutterrolle nicht dazu führen würde, dass ich aufhörte, mich um mich selbst zu kümmern, nur um einen winzigen Menschen großzuziehen. Ich zog schnell die Wollsocken über, bevor irgendwer meine Füße sah. Auf der anderen Seite des Ganges zog auch Finn seine nassen Socken aus und schlüpfte in fellgefütterte Hausschuhe. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie er zehn Mini-Marshmallows abzählte und in seine Tasse Kakao fallen ließ.
Als ich langsam wieder Gefühl in meinen Zehen und Fingern hatte, griff ich mir meine Tasche und schloss mich in dem freien Büro ein, dass Chavez mir zur Verfügung gestellt hatte. Ich hatte ihm gesagt, dass ich auch in den Umkleideraum im Keller gehen könnte, doch davon wollte er nichts hören. Chavez hat vier Kinder und eine starke Frau, und er ist stolz darauf, ein moderner Mann zu sein.
»Hier kommt Futter von der Mutter«, sagte er, ehe er entsetzt realisierte, was er gerade gesagt hatte, und sich entschuldigte. »Himmel, hör sich das einer an, ich weiß auch nicht, woher das gerade kam. Gemma, tut mir leid, ich wollte nicht … also, ich meine, ich …«
Als ich die Tür hinter mir abgeschlossen und mich gesetzt hatte, sah ich, wie viel Mühe er sich gegeben hatte. Auf dem Tisch lagen ein Stapel Zeitschriften, eine ungeöffnete Flasche Perrier und ein gerahmtes Foto von Grace, als sie sechs Wochen alt war, das ich an die Crew gemailt hatte. Auf dem Bilderrahmen klebte ein gelber Post-it-Zettel, auf dem stand: »Füttere mich, Mommy, füttere mich.«
Der Mann kannte echt keine Grenzen. Ich blätterte durch eine Ausgabe von People, war jedoch nicht in Stimmung für Hollywood-Tratsch. Ich bekam Delaware Fuentes erfrorenes Starren nicht aus dem Kopf.