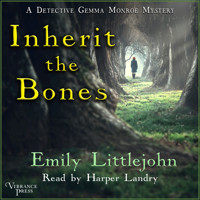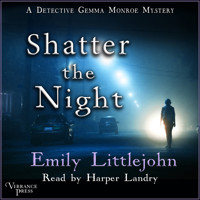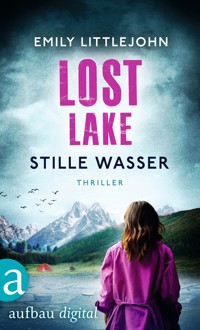9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gemma Monroe
- Sprache: Deutsch
Der Tote von Cedar Valley.
Cedar Valley, Colorado, ist ein kleiner idyllischer Skiort. Ausgerechnet hier wird in einem Wanderzirkus ein Clown ermordet. Die schwangere Polizistin Gemma Monroe nimmt sich der Sache an, die gleich eine unerhörte Wendung erfährt: Der Tote ist der Sohn des Bürgermeisters, der vor drei Jahren in einen reißenden Fluss stürzte und für tot erklärt worden war. Je intensiver Gemma ermittelt, desto rätselhafter wird diese Angelegenheit. Bis sie erfährt, dass der Tote sich vor seinem Verschwinden mit einem dreißig Jahre alten Mordfall beschäftigt hat ...
Eine Heldin wie aus dem Film „Fargo“ – menschlich und hochintelligent.
Dieses E-Book erschien ursprünglich unter dem Titel "Die Totenflüsterin".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Emily Littlejohn
Emily Littlejohn wurde in Southern California geboren und wohnt nun in Colorado. Sie lebt dort mit ihrem Mann und ihrem betagten Hund.
Über Kathrin Bielfeldt
Kathrin Bielfeldt ist Texterin und Übersetzerin und spricht fünf Sprachen. Sie hat unter anderem Romane von Elisabeth Elo, Pete Dexter und James Sallis ins Deutsche übertragen.
Informationen zum Buch
Der tote Clown von Cedar Valley
Cedar Valley, Colorado, ist ein kleiner idyllischer Skiort. Ausgerechnet hier wird in einem Wanderzirkus ein Clown ermordet. Die schwangere Polizistin Gemma Monroe nimmt sich der Sache an, die gleich eine unerhörte Wendung erfährt: Der Tote ist der Sohn des Bürgermeisters, der vor drei Jahren in einen reißenden Fluss stürzte und für tot erklärt worden war. Je intensiver Gemma ermittelt, desto rätselhafter wird die Angelegenheit. Bis sie erfährt, dass der Tote sich vor seinem Verschwinden mit einem dreißig Jahre alten Mordfall beschäftigt hat.
Eine Heldin wie aus dem Film »Fargo« – menschlich und hochintelligent
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Emily Littlejohn
Inherit the Bones - Böse Lügen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt
Inhaltsübersicht
Über Emily Littlejohn
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Danksagungen
Impressum
Für meine Eltern,
die überhaupt erst alles möglich gemacht haben.
1. Kapitel
In meinen Träumen können die Toten reden. Sie sprechen zu mir, flüsternd, murmelnd, und ich begrüße sie mit Namen, wie alte Freunde. Tommy und der kleine Andrew. Sie scheinen mit einem Lächeln zu antworten, doch nur in meiner Phantasie, denn ich kann gar nicht wissen, wie ihr Lächeln aussieht. Ich habe Fotos gesehen, vergilbte Schwarz-Weiß-Bilder, doch sie sind unscharf, und ihr Lächeln ist kaum mehr als die flüchtige Begegnung von Lippen und Zähnen.
Lächeln ist ein Tanz in den Augen, Glück im Gesicht.
Wenn ich aufwache, überfällt mich eine besondere Trauer um diese zwei Seelen, deren Leben vor dreißig Jahren gewaltsam ein Ende gesetzt wurde. Ich stehe auf und beginne meinen Tag, und doch höre ich sie immer noch flüstern.
Wir sind die Toten, sprechen sie im Chor. Vergiss uns nicht.
2. Kapitel
Ich ging neben dem Kopf des Clowns in die Hocke. Sein Grinsen, ein verschmiertes Scharlachrot, zog sich über die fettige Theaterschminke hoch bis zu seiner knallorange, krausen Perücke. Er lag auf dem Rücken, die Hände an den Seiten, mit geöffneten Handflächen. Unter dem tragbaren LED-Scheinwerfer, den wir aufgestellt hatten, nahmen die Gelb- und Rottöne seines karierten Anzuges einen glühenden Schimmer an, als würde der Stoff von irgendwo tief im Inneren der Brust des jungen Mannes beleuchtet werden.
Drinnen im Zelt regte sich kein Luftzug, und es roch nach altbackenem Popcorn, Dung und Blut. Die Bereiche, die von den LED-Strahlern nicht erreicht wurden, ohne einen kraftvollen Generator auch gar nicht erreicht werden konnten, waren ausgefüllt von Düsternis und dunklen Schatten.
Draußen vor dem Zelt herrschte die trockene Hitze eines Augusttages. Noch vor zwölf Uhr mittags würde das Thermometer auf über fünfunddreißig Grad klettern. Wattebällchen zierten den blauen Himmel über den Rockys, cremefarbene Dampfwolken, die unsere ausgedörrten Wälder neckten. Einige Kilometer von der Festwiese entfernt, quollen die beliebten Wanderwege vor Ausflüglern und Hunden über, deren enthusiastisches Tempo nur durch Kleinkinder und überaus nachsichtige Eltern gebremst wurde, die allesamt nichts vom neuesten Spektakel des Fellini Brother’s Circus ahnten.
Draußen Himmel.
Drinnen Hölle.
»Coulrophobie.«
Ich blinzelte nach oben. Der Chief of Police, Angel Chavez, stand knapp einen Meter von der Leiche entfernt, wobei er darauf achtgab, mit seinen Schuhen nicht in das gerinnende Blut zu treten, das sich unter dem Clown gesammelt hatte. Es waren italienische Slipper, die zwischen Pferdeäpfeln und Staub vollkommen fehl am Platze wirkten.
Der Chief sah auf mich herab und seufzte.
»Angst vor Clowns. Coulrophobie. Dieses Wort hat Lisa ihren Buchstabierpreis in der vierten Klasse gekostet. Ich musste es hinterher noch wochenlang über mich ergehen lassen: C-O-U-L-R-O-P-H-O-B-I-E«, sagte Chavez.
Ich lächelte. »Wie hat sie es buchstabiert?«
»Zwei o’s statt o und u. Wer ist dieser Clown, Gemma?«
»Er heißt Reed Tolliver. Der Geschäftsführer des Fellini’s, ein Kerl namens Joseph Fatone, hat ihn für uns identifiziert. Männlicher Weißer, neunzehn Jahre alt. Die Verletzung beginnt hier«, sagte ich und richtete das Licht meiner Stablampe auf die klaffende Wunde unter dem linken Ohr des Clowns.
Sie zog sich über die gesamte Kehle des armen Jungen und schnitt eine rissige Schlucht in das, was einst eine weiche, glatte Hautoberfläche gewesen war. Reed Tollivers Augen waren offen, und als der Lichtstrahl meiner Taschenlampe auf sie traf, war ich erneut von ihrer eisblauen Farbe überrascht. Ein so helles, arktisches Blau, dass es fast unwirklich erschien, wie diese Kontaktlinsen, die Leute an Halloween tragen.
Chavez seufzte wieder. »Ist, abgesehen von der Frau, die ihn gefunden hat, sonst noch jemand hier drinnen gewesen?«
Ich stand auf, drehte mich zur Seite, bis meine Wirbelsäule knackte und schüttelte den Kopf.
Eine Zirkusangestellte hatte die Leiche zwei Stunden zuvor entdeckt. Sie betrat auf der Suche nach einer Schachtel Lotterielose das Lagerzelt und kramte sich durch ein schlechtbeleuchtetes Durcheinander an Krimskrams und Müll: Seile und Zeltplanen, Schilder, leere Kisten, zusammengeknüllte Fast-Food-Behälter, zerdrückte Mineralwasser- und Bierdosen. Sie fand die Lose, wollte wieder gehen und sah die Leiche.
Zehn Minuten nachdem der Notruf eingegangen war, traf ich ein, die Techniker von der Spurensicherung eine Viertelstunde später.
Chavez rieb sich sein stoppeliges Kinn. Seit einiger Zeit waren die winzigen Haare eher grau als schwarz. »Was wissen wir noch?«
Fatone, der Geschäftsführer, hatte mir nur wenige Informationen gegeben. Nachdem er die Leiche identifiziert hatte, war ihm schlecht geworden, und er hatte sich vorn auf sein Polohemd gekotzt. Ich konnte den Geruch von Erbrochenem nicht ertragen und hatte ihn ohne eine umfassende Vernehmung aus dem Zelt entlassen.
»Tolliver ist vor zwei Jahren in Cincinnati aufgetaucht, hat um einen Job gebettelt und gesagt, er habe Theatererfahrung. Fatone behauptet, er nähme niemals Minderjährige auf, aber Tolliver hätte einen Ausweis gehabt und wäre in wenigen Monaten achtzehn geworden, und da gerade ein Clown gekündigt hätte …«
»Blödsinn. Die Hälfte aller Mitarbeiter ist wahrscheinlich minderjährig«, entgegnete Chavez.
Ich dachte an die jungen Männer und Frauen, die draußen auf der Festwiese herumliefen, und kam zu dem Schluss, dass der Chief wahrscheinlich recht hatte. Die meisten von ihnen sahen aus, als wären sie noch keine achtzehn. Es wäre einfach für ein Straßenkind, sich der Truppe anzuschließen und sich seinen Platz darin zu suchen. Und es wäre für den Zirkus einfacher, einem Minderjährigen noch weniger zu zahlen als einem Gastarbeiter.
So etwas nannte man eine Win-win-Situation.
»Irgendwelche Angehörigen?«, fragte Chavez.
Ich zuckte die Achseln. »Fatone hatte den Eindruck, Tolliver sei ein Pflegekind gewesen. Zumindest, so sagte er, sei nie die Rede von einer Familie gewesen.«
Der Chief ging an den Füßen des Clowns in die Hocke und musterte die Leiche. Als er wieder aufstand, knackten seine Knie. »Heiliger Himmel. Warten Sie, bis die Presse davon Wind bekommt. Und der Bürgermeister … er wird mir Feuer unterm Hintern machen, heißer als ein glühendes Brenneisen.«
Bei dieser Vorstellung zuckte ich zusammen.
»Hat Bellington nicht genug um die Ohren, auch ohne uns hierbei in die Quere zu kommen? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass er zwischen seinen Chemos, der Stadtverwaltung und seinen Ambitionen Richtung Washington noch Luft hat, oder? Himmel, er hat vor zwei Monaten den gesamten Einsatz in diesem Fall von Hausfriedensbruch quasi im Alleingang geleitet. Und das war, noch bevor er krank wurde.«
Chavez richtete seinen Zeigefinger auf mein Gesicht und sah mich scharf an. »Dieser Mann hat seine Augen und Ohren überall in diesem Tal, denken Sie daran. Der Mord eines jungen Mannes, hier auf unserer Festwiese? Er ist gerade zu Ihrer ersten Priorität geworden. Solche Sachen passieren hier nicht.«
»Zumindest nicht in letzter Zeit«, sagte ich leise.
Ich war sehr erfreut darüber, die Leitung in diesem Fall innezuhaben, doch die Vorstellung, dass mir der Bürgermeister dabei die ganze Zeit im Nacken saß, passte mir gar nicht. Terence Bellingtons Wahlkampagne hatte auf einer Form der idealisierten Rückkehr in die 1950er basiert, in denen es die Norm war, dass Familien gemeinsam zu Abend aßen und Nachbarn aufeinander achtgaben. Er war der Ansicht, dass intakte Familien sich positiv auf die Gemeinde auswirkten.
Die Familie bedeutete ihm alles. Es war wie bei den Sopranos oder den Medici, nur ohne das Blut und die Kunst. In meinen Augen hatte der Mann den Bezug zur Realität verloren. Die Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise waren immer noch zu spüren, und Familien konnten sich glücklich schätzen, wenn in den Häusern nebenan überhaupt noch Nachbarn wohnten und sie immer noch ein Abendbrot auftischen konnten.
Doch ich hielt meinen Mund. Chavez und der Bürgermeister konnten auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurückblicken, über die ich gerade mal so viel wusste, dass es reichte, um nicht noch mehr wissen zu wollen.
Außerdem war mir klar, dass Bellington ein Mann war, der immer noch um den Verlust seines einzigen Sohnes Nicholas trauerte. Auf einer Wandertour mit Freunden war der damals sechzehnjährige Nicky hoch über dem brausenden Arkansas-River ausgerutscht und von einer Klippe gestürzt. Seine Leiche war nie gefunden worden, und dem Bürgermeister und seiner Frau war nichts anderes übriggeblieben, als auf der Grabstelle, die sie eigentlich für sich gekauft hatten, einen leeren Sarg zu beerdigen.
Sich von einem solchen Verlust zu erholen, war schwer. Wahrscheinlich begleitete einen diese Art von Trauer ein Leben lang.
Der Chief of Police senkte seinen Finger herunter auf meinen Bauch. »Wie fühlen Sie sich?«
Ich sah an mir hinab und spürte erneut den Funken der Überraschung, der mich jedes Mal traf, wenn ich die zunehmende Wölbung unter meinen Brüsten sah. Ich war im sechsten Monat schwanger. Ein Mädchen, wenn der Ultraschall nicht versagt hatte und sich im schattigen Grau kein winziger Penis versteckte.
Wir hatten sie Erdnuss getauft.
»Ich weiß immer noch nicht, warum sie es morgendliche Übelkeit nennen, wenn man quasi stündlich kotzt, doch ich scheine das Schlimmste hinter mir zu haben. Jetzt habe ich nur noch diese Rückenschmerzen, die mich nachts wachhalten.«
Wenn ich ehrlich war, hätte ich das Gekotze gern gegen die Kreuzschmerzen eingetauscht. Mit Schmerzen konnte ich umgehen; ständig ins Badezimmer zu rennen … oder zum nächstgelegenen Waschbecken … oder zu welchem Behälter auch immer, das war nicht mein Ding.
Chavez zog eine Grimasse und berührte mit einem Fingerknöchel sein Kreuzbein. Er hatte das Ganze mehrfach mit seiner Frau durchgemacht, einer drallen Jamaikanerin, die in den letzten zehn Jahren zu Hause, auf natürliche Weise, vier Kinder zur Welt gebracht hatte. Es gab das Gerücht, dass sie weitere Kinder wollte, doch Angel Chavez hatte sich dem widersetzt und gejammert, er würde keine weiteren Wehen überleben.
»Sind Sie der Sache gewachsen, Gemma? Ich kann mit Finn sprechen. Sie könnten es locker angehen und stattdessen ein paar der Verkehrsdelikte bearbeiten …« Er verstummte langsam.
Ich wusste, dass er meine Fähigkeiten gegen den politischen Shitstorm abwog, dem wir ausgesetzt sein würden, wenn wir den Fall nicht hübsch ordentlich für Bürgermeister Bellington abschlossen. In dreißig Jahren hatte es keinen unaufgeklärten Mord in Cedar Valley gegeben. Bellingtons Kumpel im Stadtrat würden schon einen Weg finden, die Sache zu drehen. Reisender Zirkus, heruntergekommener Jahrmarkt. Das hier war nicht Cedar Valley, das hier war die böse Außenwelt.
Ich nahm die Herausforderung gerne an. Der Schauplatz war schmutzig, doch die Motive konnten vielfältig sein. Ich wettete, es war Liebe im Spiel, eine Dreierbeziehung – der Zirkus schien voller junger Leute zu sein, die das harte Leben gewöhnt waren.
»Kommt nicht in Frage. Mein Notruf, mein Fall«, sagte ich. »Ich komme klar.«
Chavez nickte und ging. Er verließ das Zelt am anderen Ende durch eine Stoffklappe. Ein brüchiger, abblätternder Lederriemen hielt das derbe Zelttuch zurück und machte einem langen Dreieck aus Sonnenlicht den Weg frei. Staub wirbelte im Licht auf, funkelnd und schön.
Ich sehnte mich danach, die sieben bis zehn Meter hinüberzugehen und an die frische Luft hinauszutreten, doch ich war mit Reed Tolliver noch nicht fertig. Ich griff mir mein Funksprechgerät und rief die Gerichtsmedizinerin herein.
Dr. Ravi Hussen hatte geduldig draußen gewartet, während wir den Tatort abriegelten und den Boden mit Dutzenden kleiner farbiger Flaggen und Stäben markierten. Das Team der Spurensicherung würde noch weiterarbeiten, nachdem die Gerichtsmedizinerin die Leiche schon längst mitgenommen hatte. Die Jungs fürs Detail kümmerten sich um die Einzelheiten, während Dr. Death dem Toten die Geheimnisse entlockte. Ich versuchte, einfach nur alles zusammenzusetzen und den Mörder zu fangen.
Sie kam geduckt durch den Zelteingang, makellos in ihrer blitzsauberen Hose, Bluse und den hochhackigen Schuhen, eine schwarze Arzttasche in der Armbeuge. Hinter ihr gingen zwei Mitarbeiter, Lars und Jeff. Sie waren Brüder und trugen hellblaue Overalls, auf die in roten, feinen Kursivbuchstaben »Gerichtsmedizin« auf die Brust gestickt war. Sie bewegten sich wie ein schweigendes Tandem, zwischen sich eine Bahre.
Beim Näherkommen zog Ravi ein Paar Latexhandschuhe heraus und ließ sie mit einer Effizienz an die Finger flitschen, die andeutete, dass sie es in einer solchen Situation schon unzählige Male getan hatte. Zu oft, wie es schien; sie fluchte, als sie das Blut und die Leiche sah.
»Er ist doch noch ein Junge«, sagte Ravi. »Wie alt ist er, sechzehn? Siebzehn?«
Ich tätschelte ihre Schulter. »Neunzehn. Sein Name lautet Reed Tolliver. Ich komme gleich noch ins Leichenschauhaus. Vorher fahre ich noch kurz im Revier vorbei, lasse eine Abfrage laufen und hole mir ein Sandwich. Möchtest du auch etwas?«
Ravi Hussen schüttelte den Kopf. Sie gab Lars und Jeff ein Zeichen. Schweigend bereitete Lars die Tragbahre vor, während Jeff den schwarzen Leichensack auseinanderfaltete. Er machte eine Pause, um sich einen Pfefferminzbonbon in den Mund zu stecken und ihn dann mit einem stetigen, schmatzenden Geräusch zu lutschen.
Ravi ging in die Knie und zog eine riesige Taschenlampe aus ihrer Arzttasche. Sie sagte: »Ich habe gerade gegessen. Einer der Budenbesitzer da draußen hat mir einen Hot Dog geschenkt. Allerdings ohne Senf. Heiliger Bimbam, es sieht so aus, als hätte unser Mörder ein Buttermesser benutzt. Das ist ein unglaublich rissiger Schnitt, Gemma, hast du gesehen?«
Ich hockte mich neben sie und gesellte den schwachen, schmalen Lichtstrahl meiner Stablampe zu ihrer viel kräftigeren Taschenlampe. Ich schaute genau hin und versuchte dabei, das geronnene Blut zu ignorieren und mich auf die Ränder der Wunde zu konzentrieren. Ich hatte genug Messerwunden gesehen, um der Gerichtsmedizinerin recht zu geben – die Haut wirkte zerrissen, nicht durchgeschnitten.
»Ich weiß mehr, wenn ich ihn im Labor habe, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass das hier keine glatte Klinge war. Ich glaube, noch nicht einmal ein Jagdmesser würde eine solche Wunde verursachen«, sagte Ravi. Sie berührte vorsichtig die scharlachrote Pfütze unter der Leiche, ihre behandschuhte Fingerspitze versank in Blut, Erde und Staub. »Dein Mörder müsste theoretisch von dem Blut des Jungen regelrecht durchtränkt sein.«
»Wie kann er dann geflohen sein, ohne dass ihn jemand gesehen hat? Verdammt, es ist mitten am Tag. Da draußen sind mindestens hundert Leute«, sagte ich. Meine Knie kreischten, als ich aufstand.
Auch Ravi erhob sich, sie zuckte die Achseln. »Das ist dein Fachgebiet, nicht meines.«
»So viel kann ich dir sagen: Das viele Blut, die Zerstörung eines anderen Menschen, das riecht nach Wut. Und trotzdem hat niemand etwas gesehen. Das setzt kühl kalkulierte Planung voraus. Unser Kerl hat Reed Tolliver allein erwischt. Er hatte einen Fluchtweg. Wahrscheinlich hat er die Mordwaffe mitgebracht, was immer es auch war. Was kann dieser arme Junge in seinen neunzehn Lebensjahren getan haben, wofür ihn jemand umbringen will?«, fragte ich.
»Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio«, zitierte Ravi mit einem Grinsen. »Shakespeare hat zwar nicht über Mord gesprochen, aber ich denke, er wusste das eine oder andere über die Mysterien unserer Motivationen.«
Ihr Zitat hing über Tollivers Leiche im Raum wie ein unsichtbares Totenhemd. Es enthielt meine Frage und die Antworten eines Mörders, all die Gedanken, Gefühle und finalen Handlungen, die dazu führten, dass ein Mensch einem anderen Menschen das Leben nahm.
3. Kapitel
Zurück im Revier machte ich mir einen frischen Becher entkoffeinierten Kaffee und zwei Truthahnsandwiches mit Roggenbrot, Mayo, Senf, Schweizer Käse, Salat, Tomaten und roten Zwiebeln. Als Zugabe packte ich ein paar eingelegte Gürkchen daneben und nahm mir noch einen muffig wirkenden Schokokeks, den ich in der Speisekammer hinter einigen Suppendosen gefunden hatte. Dann balancierte ich den vollbeladenen Teller und den Becher Kaffee langsam zu meinem Schreibtisch in der hinteren Ecke. Ein leises Pfeifen ging durch den Raum, und als ich mich umdrehte, sah ich eine Handvoll Cops, die mich beobachteten.
Phineas Nowlin lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. »Heilige Scheiße, Gemma. Brütest du da drinnen einen Grizzly aus?«
»Schnauze, Finn. Ich habe echt Kohldampf.«
Er grinste, und mit seiner Art, wie er den Unterkiefer vorschob, zusammen mit den blendend weißen Eckzähnen, hatte er eindeutig etwas von einem Wolf. Ich konnte das, was ich über Finn wusste, in drei wichtigen Punkten zusammenfassen: erfahrener Cop, mieser Freund und nervige Landplage. Wir hatten nie ein Verhältnis miteinander, doch ich hatte genügend Trümmer gesehen, die er üblicherweise zurückließ, um einen guten Eindruck seines Liebeslebens zu haben, ausreichend, um »mieser Freund« in die Liste aufzunehmen.
Ich zeigte ihm den Mittelfinger und ignorierte das Gelächter der anderen Cops, als ich das erste Sandwich verschlang. Beim zweiten wurde ich etwas langsamer und kaute jeden Bissen gründlich durch, doch als ich mit den Gürkchen fertig war, herrschte absolute Stille im Raum.
Ich lächelte, als ich sah, wie die vier mich mit offenem Mund anstarrten.
»Könnte mir vielleicht einer von euch eine Tüte Chips aus dem Automaten holen?«, fragte ich süß. Sam Birdshead, das neueste und jüngste Mitglied unserer kleinen Polizeitruppe, schluckte und nickte. Er war fast aus der Tür, als ich ihm nachrief: »Sam? Nicht die Doritos.«
»Himmel. Dein Arsch wird breiter sein als ein Haus, bis das Baby geboren ist«, sagte Finn. »Willst du nicht auf deine Figur achten? Und Brody dazu kriegen, dass er dir vielleicht doch noch einen Ring ansteckt?«
Sein schlaksiger Körper glitt aus dem Stuhl, und er kam zu meinem Schreibtisch herüber. Er setzte sich auf eine Ecke, und als ich seine makellosen schwarzen Augenbrauen sah, die seine babyblauen Augen einrahmten, so sorgfältig und obsessiv gepflegt wie die einer Frau, spürte ich die ersten Anzeichen von Sodbrennen in meiner Brust.
»Weißt du, solche Worte würden an vielen Arbeitsplätzen schon als sexuelle Belästigung gelten«, erklärte ich ihm. »Aber ich verzeihe dir. Ich weiß ja, dass du schon seit wie viel Monaten nicht mehr flachgelegt worden bist? Sechs? Sieben?«
Ich nahm das letzte Gürkchen und zerbiss es in zwei Teile, als ihm das Grinsen aus dem Gesicht fiel. Er marschierte zurück zu seinem Schreibtisch. Jemandem einen Schlag unter die Gürtellinie zu versetzen war nicht meine Art, doch Finn weckte in mir meine schlimmsten Seiten. Teilweise hatte es damit zu tun, dass Finn genau genommen in seinem Innersten ein mehr als anständiger Cop war. Er war verdammt gut. Doch er wusste nicht, wann er den Mund zu halten hatte, und seine Vorstellung von Moral war mir ein wenig zu schwankend. Ich sah in ihm ein riesiges Talent, das langsam, aber sicher verschwendet wurde.
Wenn ich jedoch ehrlich mir selbst gegenüber war, was ich immer versuche, so störte mich am meisten die Macht, die Finn über meine Zukunft hatte.
Vor einigen Monaten hätte er mich fast meinen Job gekostet.
Wir waren Partner in einem Fall von Hausfriedensbruch, hoch oben in den Bergen über Cedar Valley, in einem Vorort, in dem die Preise für Häuser im unteren siebenstelligen Bereich anfingen und es keine Ausnahme, sondern die Regel war, vier bis fünf Garagen zu besitzen. Es war ein Einbruch, der aus dem Ruder lief, als der Hauseigentümer ein Messer hervorzog – keine gute Idee, wenn die Einbrecher Schusswaffen dabeihaben. Die Frau und der Sohn schafften es zu fliehen, doch die sechs Jahre alte Tochter wurde von einem Irrläufer getroffen und starb. Die Einbrecher waren nicht besonders helle und wurden einige Tage später gefasst.
Der Fall bereitete allerdings von Anfang an Probleme. Zum einen war da die Frage des Zuständigkeitsbereiches, da das Grundstück an das Avondale County grenzte, in dem die Cops ziemlich heiß auf Action sind. Sie waren die Ersten am Tatort, und einer von ihnen, ein echtes Herzchen aus Butte, Montana, fand Kokain im Schlafzimmer. Er rief seinen Bruder an, einen Ermittler bei der Drogenbehörde, und als Finn und ich am Tatort eintrudelten, herrschte bereits Chaos. Es war auch nicht sonderlich hilfreich, dass der Hausbesitzer ein ehemaliges Mitglied des Stadtrates von Cedar Valley war und gute Verbindungen zu Bürgermeister Bellington hatte. Die Frau schob das Kokain auf eine ausländische Haushaltshilfe, die längst gefeuert war. Dann wurden andere, wichtige Dinge unter den Teppich gekehrt.
Es herrschte ein enormer Druck, den Fall abzuschließen. Im allgemeinen Chaos war die Aufnahme an Beweisen jedoch unzureichend gewesen, was nicht die Schuld eines Einzelnen war, sondern das Ergebnis davon, wenn sich drei Ermittler an einem Tatort in die Quere kommen. Gerade als es so aussah, als würde das Verfahren eingestellt werden, tauchten neue Beweise auf. Ich konnte es nicht nachweisen, doch ich war mir sicher, dass der Staatsanwalt und Finn heimlich zusammenarbeiteten, um eine Verurteilung sicherzustellen. Finn war ein enormes Risiko eingegangen, für sich selbst, aber auch für mich; hätte man ihn dafür drangekriegt, dass er Beweise fingierte, wäre ich als seine Partnerin mit ihm untergegangen.
Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, doch das Gesetz wurde dabei verdreht, und ich erinnerte mich an eine wichtige Lehre, die ich immer mal wieder mitbekommen hatte, für die ich jedoch noch nie meine eigene Karriere aufs Spiel gesetzt hatte: Am Ende des Tages ist es allen egal, wie du die Verbrecher hinter Gitter bringst, solange du es schaffst.
Ich hasste die Erkenntnis, dass Finns Handeln uns in jedem unserer gemeinsamen Fälle um die Ohren fliegen konnte. Denn so ist es eben mit Partnern: Man hat das Leben des anderen ständig in der Hand.
Ich schaltete meinen PC ein und wartete darauf, dass er startete. Bevor ich ins Leichenschauhaus fuhr, um bei der Obduktion dabei zu sein, wollte ich mir ein paar Notizen machen, solange die Erinnerungen an den Tatort noch frisch waren.
Sam Birdshead kehrte mit den Chips zurück und warf sie mir zu, dann setzte er sich hin und nahm sich seinen Stenoblock. Sam war erst seit einigen Wochen bei uns, Frischfleisch, ein Neuling aus Denver. Er war besser als ein Praktikant, da wir nichts vor ihm zurückhalten mussten und er bereit war, die Knechtsarbeit zu erledigen, die eintönigen Aufgaben und die Drecksarbeit. Wir wechselten uns beim Babysitten ab. Dieses erste Jahr war kritisch im Hinblick darauf, ob er als Cop erfolgreich sein würde oder ein Versager. Sam war ein heller Kopf. Wenn ich die Zeit verringern könnte, die er mit Finn Nowlin zusammen war, könnte aus ihm ein halbwegs anständiger Polizist werden.
Ich loggte mich ein und wartete darauf, dass ein halbes Dutzend Programme aufgingen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Sam das Holzregal an der Wand hinter meinem Schreibtisch beäugte. Es bog sich unter dem Gewicht sechs dicker Ordner, die bis zum Anschlag mit Dokumenten, Fotos und Landkarten gefüllt waren, und ich wusste auch schon, welche Worte als Nächstes aus seinem Mund kommen würden.
»Sind das die Woodsman-Akten?«, fragte er.
Ich nickte, öffnete das Schreibprogramm und legte einen neuen Ordner an. Ich nannte ihn »RTolliver« und fügte eine Unterzeile mit Datum und Zeit hinzu. Das Dokument, das sich öffnete, starrte mich an, weiß und leer, und wartete darauf, dass ich es mit den traurigen Details von Reed Tollivers letzten Lebensmomenten füllte.
»Was dagegen, wenn ich mal reinschaue?«, sagte Sam. Ohne auf die Antwort zu warten, griff er um mich herum und nahm den ersten Aktenordner heraus, dick und schwarz wie all die anderen Fall-Akten, die wir von einem Großhändler im Westen bezogen. Das Polizeirevier kaufte sie schon seit Jahren dort. Seit Jahrzehnten.
Ich nahm Sam seine Neugier nicht übel, er war nicht in dieser Gegend aufgewachsen.
Wenn eine Kleinstadt von einer Tragödie heimgesucht wird, hinterlässt sie eine Narbe, die niemals heilt. Monate und Jahre vergehen, und die Narbe mag vielleicht verblassen, doch sie verschwindet nie. Sie wird zu einem Teil der Stadt, zeichnet sie, eine ständige Mahnung daran, was hätte sein können, was hätte werden können.
Die Woodsman-Morde waren genauso ein Teil von Cedar Valley wie die Skihütten und die Wanderwege. Man konnte keine paar Schritte durch die Stadt gehen, ohne irgendwo die zerfledderten Reste von Plakaten zu sehen, zerfetzt durch all die Jahre, Wind und Regen, Schnee und Zeit. In erster Linie Zeit.
Ein paar Plakate waren immer noch intakt, die schwarze Überschrift »Vermisst« war zu einem Hellgrau ausgeblichen, die Bilder der Kinder so verschwommen, dass man nicht mehr sagen konnte, um welches Kind es sich jeweils handelte. Sie waren einfach nur die McKenzie-Jungs, was nach einer Band aus den 1950ern klang, was sie natürlich nicht waren.
Sie waren Tommy und Andrew McKenzie.
Sie waren Cousins, zwei Jahre auseinander, mit hellblonden Haaren. Sie mochten Schokoladeneis und Matchbox-Autos. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern am Fluss entlang und jagten Kaninchen mit ihren Luftgewehren. Im Sommer 1985 verschwanden sie.
Das meiste, was von den Postern übrig war, waren kleine Ecken und schmale Streifen Papier, dessen Kleber so fest an die Telefonmasten und Schaufenster gepresst worden war, dass man die Panik und die Dringlichkeit spüren konnte, mit der sie aufgehängt worden waren.
Das Verschwinden und der Mord an den McKenzie-Jungs definierte Cedar Valley auf eine Art, die für Außenstehende schwer zu beschreiben ist. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass es sich um Kinder handelte; vielleicht war es die Tatsache, dass die Morde nie aufgeklärt worden waren. Unbeantwortete Fragen schlagen Wurzeln in den Herzen der Menschen, vergraben sich darin, und ab und zu strecken sie ihren Kopf daraus hervor.
Man macht weiter, aber man vergisst nie. Niemals.
Es passierte mit den McKenzie-Jungs, und es passierte dann ein weiteres Mal, siebenundzwanzig Jahre später, mit dem Tod von Nicky Bellington. Bei Nicky war es ein wenig anders, es handelte sich nicht um ein Verbrechen, man konnte niemandem die Schuld geben. In der einen Minute war er noch da, in der nächsten war er verschwunden, ein kurzer Ausrutscher, gefolgt von einem langen Fall. Doch für den Bürgermeister und seine Familie war es eine Tatsache, mit der sie jeden einzelnen Tag lebten; sie und unzählige andere, deren Leben von der einen Minute auf die nächste in Stücke gerissen wurde.
4. Kapitel
Ich tippte meine Notizen und beschrieb die scheußliche Szene im Zirkuszelt. Ich ließ die Bilder des Staubs und des Drecks am Boden durch meinen Kopf streichen, wie sie den Clown umgeben hatten, ähnlich Bildern mit Fingerfarbe. Der beißende Gestank von frischem Pferdemist und starkem Schweiß, der nur eines bedeutete: Nutztiere.
Wie die Luft beim Einatmen nach Kupfer roch.
In neun von zehn Fällen spielen solche sensorischen Details keine Rolle. Doch im zehnten Fall, wenn in deinen Aufzeichnungen etwas von einem leichten Mandelgeruch steht, der in der Luft lag, oder von der Tatsache, dass einem ein Paar glänzende, ölig-wirkende Schuhe aufgefallen waren, die auf einem Haufen abgetragener Paare lagen … man wusste einfach nie, was einige Tage oder Wochen später plötzlich den Durchbruch in einem Fall brachte.
Und deswegen schreibt man alles auf, was man bemerkt hat.
Sam Birdshead schwieg neben mir. Er hing noch auf der ersten Seite der Woodsman-Akte. Nach vier Jahren, die ich mit den Aktenordnern, Heftern und Faltmappen zugebracht hatte, kannte ich sie in- und auswendig.
Ich wusste, was seine Aufmerksamkeit erregt hatte: ein altes Polaroid-Foto.
Obwohl es ein Schnellschuss war, war es in seiner Komposition dennoch bemerkenswert. Das Objekt im Vordergrund ist klein und wiegt weniger als ein Kilo. Im Hintergrund sieht man Schnee, Wald und Felsbrocken. Der Schnee ist so strahlend weiß, dass die Grün- und Brauntöne des Hintergrundes verblassen und eigenartig zu verschwimmen scheinen und nur von den gefleckten Felsbrocken durchbrochen werden, die dort wie Wachposten stehen, und von dem kleinen Schädel, dessen Kiefer zu einem obszönen Grinsen geöffnet ist.
An diesem Tag war es eisig gewesen.
Brody und ich hatten Fleecejacken und Thermoskannen mit heißem Kaffee in unsere Rucksäcke gestopft. Im letzten Moment warf ich noch einen Flachmann Whiskey und meine alte Polaroid-Kamera dazu. Der Himmel war blau, das Blau eines sonnigen Wintertages in Colorado, klar und ohne die Wolkendecke, die uns gewarnt haben könnte.
Wir luden unsere Ausrüstung und die Skier ein und waren innerhalb einer halben Stunde am Ausgangspunkt der Skiwanderroute. Es war unser zweites Date, und Brody führte mich abseits der Strecke in eine Gegend mit tiefem, frischem Pulverschnee.
Nach einer Stunde anstrengendem Skifahren zogen wir unsere oberste Schicht aus und kletterten auf einen großen Felsen, wo wir uns auf unsere ausgebreiteten Jacken setzten, damit die Kälte des Steines nicht durch unsere Skihosen drang. Er küsste mich, sehr zärtlich, und sagte mir, dass er damit monatelang weitermachen könnte. Sein Mund war warm, und ich erwiderte seinen Kuss mit einer Dringlichkeit, die mich selbst erstaunte. Zwischen den Küssen unterhielten wir uns, und er zog mich wegen meiner alten Polaroid-Kamera auf.
Ich habe immer noch ein Foto von ihm, das ich an diesem Tag gemacht habe, seine dunklen Haare verschwitzt und lockig, und die haselnussbraunen Augen von einer Sonnenbrille verdeckt. Er posiert neben dem Felsbrocken, ein Ellenbogen auf dem Knie, das Kinn auf die Faust gestützt. Dann machte er noch ein Bild von uns gemeinsam, wobei er seinen langen Arm so weit ausstreckte wie möglich.
Wir sehen glücklich aus, so wie Paare es tun, wenn sie noch glauben, ihrem Geliebten würden keine Fehler unterlaufen.
Nach einer Weile ließ ich ihn am Felsbrocken zurück und ging ein Stück in den Wald hinein, um mir einen Ort zum Pinkeln zu suchen. Auf einer Anhöhe, die sanft abfiel, griff ich mir einen Kiefernzweig, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und erledigte mein Geschäft. Als ich fertig war, richtete ich mich wieder auf und kämpfte einen Moment mit dem Reißverschluss meiner Skihose. Der kleine Schieber hatte sich verfangen, und es brauchte ein paar Flüche und etwas Gezerre, bis die Krampen wieder ineinanderfassten.
Bis heute weiß ich nicht, was mich dazu bewogen hat, nach rechts zu schauen.
Im Wald herrschte diese Stille, die sich nach einem heftigen Schneefall über eine Lichtung legt. Es gab nichts, was die Aufmerksamkeit meiner Augen oder Ohren auf sich ziehen könnte: kein braunes Aufblitzen eines Rehs, kein hexenartiges Krähengeschnatter.
Ich hatte es eilig, zurück zu Brody zu kommen, damit wir noch vor Einbruch der Dunkelheit wieder auf den Skiwanderweg kamen, doch ich drehte mich nach rechts, und mein Leben veränderte sich für immer.
Es hätte ohne weiteres der Knochen eines Elches oder Rehs sein können. Ich hatte über die Jahre hunderte davon gesehen, über die Wiesen verstreut und halb unter den Teppichen aus Rankgewächsen und Kiefernnadeln vergraben, die es überall verstreut in den Rocky Mountains gab. Doch dieser Knochen hatte einen Winkel und eine Rundung, die in mir einen Urinstinkt weckten.
Ich machte einen Schritt darauf zu, dann noch einen. Als ich nur noch anderthalb Meter entfernt war, hielt ich an und zog meine Trillerpfeife heraus, die wir beide für den Notfall um den Hals trugen, wenn wir abseits der Route unterwegs sein sollten – darauf hatte Brody bestanden. Ich blies einmal, dann noch zweimal.
Dann stand ich dort, wartete und starrte auf den menschlichen Schädel, bis Brody mich erreichte.
»Also hast du dieses Foto gemacht?«, fragte Sam Birdshead und drehte das Notizbuch herum, um mir das Bild zu zeigen, ein Bild, das ich bis ins Detail beschreiben kann, solange ich lebe.
Ich nickte. Wir hatten die Aufnahme gemacht und Brodys GPS benutzt, um unseren Standort zu bestimmen. Dann fuhren wir auf unseren Skiern zurück zu unserem Wagen, als wäre der Teufel hinter uns her, und mit dem Auto direkt zum Polizeirevier. Ich war erst ein Jahr dabei, doch Chief Chavez war kein Dummkopf. Er nahm unsere Geschichte ernst. Es könnte ein alter Jäger sein, ein Betrunkener, der auf der Pirsch nach Rehen gestürzt war, sagte er.
Ich wusste, dass ein Teil von ihm nicht daran glaubte, dass es sich um einen Jäger handelte.
Sam blätterte durch das Album. Ich wollte ihm sagen, er solle dabei langsamer vorgehen, die Details und Einzelheiten genauer betrachten, doch ich hielt meinen Mund. Entweder begriff er es oder eben nicht. Wie wir auf dem Revier immer sagten: Man wird zum Cop geboren, nicht gemacht.
Ich warf einen Blick auf die Uhr und fluchte. Meine Notizen würden warten müssen; ich musste ins Leichenschauhaus, um die ersten Schritte der Obduktion zu bezeugen. Das war im Bundesstaat zwar keine Standardprozedur, aber in Mordfällen bestand Ravi Hussen auf der Anwesenheit der Polizei. Sie sagte, es sei einfacher, sich währenddessen über die Autopsie zu unterhalten, anstatt danach der Polizeibehörde einen formellen Bericht vorzulegen.
Im Cedar Valley gab es so wenige Morde, dass es niemandem von uns etwas ausmachte, bei einer Obduktion dabei zu sein.
»Hör mal, Sam. Begleite mich ins Leichenschauhaus, und ich erzähle dir auf dem Weg Genaueres über die Woodsman-Morde«, sagte ich.
Ich griff mir meine Tasche und nahm Sam die Fall-Akte aus der Hand, bevor er etwas erwidern konnte.
Sam schluckte. Er hatte das Kabinett des Todes bisher noch nicht betreten.
»Na komm, es tut nicht weh. Ich versprech’s. Davon abgesehen kannst du eine schwangere Dame doch nicht allein gehen lassen, oder? Was soll denn der Rest der Jungs denken?«, sagte ich.
Sam blickte auf die anderen Polizisten um uns herum, die plötzlich alle in etwas Wichtiges an ihren Computern oder Telefonen vertieft zu sein schienen. Er seufzte und knallte sich seine Dienstmütze auf den Kopf.
»In Ordnung, Ma’am. Nach Ihnen.«
5. Kapitel
Der Name Cedar Valley ist ein wenig irreführend. Wir haben zwar Zedern, und es gibt auch ein Tal, doch die beiden treffen erst dort aufeinander, wo das Tal sich seinen Weg trichterförmig in den Sockel des Mount James bahnt, fünf Meilen außerhalb der Stadt. Dort haben sich die Zedern in jenem Teil breitgemacht, der einst indianisches Prärieland war. In der Stadt besteht die Vegetation in erster Linie aus Kiefern, Espen und Birken. Mount James ist knapp 14000 Fuß hoch, sprich, gut viertausend Meter. Im Bundesstaat gibt es dreiundfünfzig Vierzehntausender, und wir haben die Marke nur um sechzig Meter verfehlt. Mount James thront jedenfalls über dem Tal und der Stadt. Der Gipfel wirft einen langen Schatten, der irgendwann alles in der Stadt berührt, fast genauso wie Stanley James Wanamaker es tat, nach dem er benannt ist, als er um 1800 den Abbau von Silber in diesen Bergen leitete.
Es war später Nachmittag. Im Jeep war es heiß, und wir kurbelten schleunigst die Scheiben herunter. Ich war in Cedar Valley geboren, und neunundzwanzig Sommer in Colorado hatten mich gelehrt, dass es bis ungefähr neunzehn Uhr warm bleiben werde. Danach würde eine Brise aus den Bergen durch das Tal gleiten und schnell für Abkühlung sorgen.
Schweiß lief mir den Nacken herunter, und ich verfluchte das County. Sie hatten unsere Einsatzwagen seit zehn Jahren nicht ausgetauscht. Ich fummelte am Knopf der Klimaanlage herum, doch das Flüstern, das durch die verstaubten Lüftungsschlitze sickerte, war genauso warm wie die Luft draußen, also lenkte ich den Wagen mit meinen Knien und band mein dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz.
Das Leichenschauhaus lag mit dem Wagen zehn Minuten vom Polizeirevier entfernt. Ich fuhr langsam und redete schnell. »Sam, was weißt du über die Woodsman-Morde?«
Er fummelte an seinem Notizbuch auf seinem Schoß herum. Dabei glänzte der schwere Silberring an seiner rechten Hand in der Sonne und blinzelte mir zu. »Also, lass mal sehen. Sie liegen wie viel … so ungefähr dreißig Jahre zurück?«
Ich nickte.
»Und, ähm, okay, also vor dreißig Jahren verschwanden zwei Kinder, zwei Jungs, richtig? Cousins?«
Ich nickte wieder. Cedar Valley war schon immer eine kleine Stadt in den Bergen gewesen. Bis Mitte der Neunziger trennte eine Bahnlinie die Stadt sprichwörtlich in zwei Teile. Tommy McKenzie lebte mit seinen Eltern in einem großzügigen Landhaus. Der Bruder seines Vaters hatte geschäftlich ein weniger glückliches Händchen gehabt; Andrew und seine Eltern lebten in einem Haus auf der anderen Seite der Bahngleise. Es war heruntergekommen, schlecht isoliert und stand gelegentlich unter Wasser.
»Genau. Also, die Kinder wurden vermisst, und niemand hat je herausgefunden, was ihnen zugestoßen ist. Es war der heißeste Sommer in der Geschichte«, fuhr Sam fort und gewann an Selbstvertrauen. »Die Leute suchten wochenlang Tag und Nacht nach ihnen, legten Teiche trocken und kontrollierten jeden Minenschacht und jede Ferienhütte im Umkreis von hundert Meilen.«
»Die Zeitungen nannten sie die McKenzie-Jungs. Sie verschwanden am 3.Juli1985, irgendwann zwischen Schulschluss und Abendessen. Sie stiegen zusammen in Parker and Tremont aus dem Bus, und das war das letzte Mal, dass jemand sie gesehen hat. Einige meinten, dass sie vielleicht weggelaufen seien, doch ich denke, dass die meisten Leute tief in ihrem Innersten geglaubt haben, sie seien entführt worden. Ich wurde übrigens ein Jahr später geboren, genau dort, im Memorial General«, sagte ich und zeigte im Vorbeifahren auf das Krankenhaus. »Der Fall ging groß durch die Presse, selbst nationale Zeitungen griffen ihn auf. Im Großen und Ganzen war es ein mieser Sommer. Im August wurde flussabwärts die Leiche einer Frau gefunden, die sich im Schilfrohr verfangen hatte. Sie war erwürgt worden. Und einige Wochen später starb der damalige Bürgermeister, Silas Nyquist, an einem Herzinfarkt.«
Sam drehte den Ring an seinem Finger. »Mhm, und man hat nie eine Verbindung zwischen der Frau im Fluss und den vermissten Jungen hergestellt?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Sie haben es versucht. Die Frau war angegriffen und erwürgt worden. Die Jungen verschwanden einfach so spurlos. Und mit einfach so meine ich natürlich nicht einfach so. Ich meine, es war schwer, eine Verbindung zwischen den vermissten Kindern und dem Mord an einer jungen Frau herzustellen. Du hattest an der Akademie doch auch Psychologie, oder? Die beiden Fälle repräsentierten verschiedene Modi operandi, verschiedene Stile, Verhaltensweisen. Entführungen bedeuten eine Menge Arbeit. Der Mörder hat sich große Mühe gegeben, die Leichen der Jungs gut zu verstecken. Rose hingegen – die Frau im Fluss – war einfach dort abgeladen worden, nachdem man mit ihr fertig war. Wenn es derselbe Kerl war, warum hat er sie dann nicht dort vergraben, wo er auch die beiden Jungs vergraben hat?«
Sam sann eine Weile über diese Frage nach. »Vielleicht hat der Straftäter mit den Jungs klein angefangen und ist dann zu Mord übergegangen? Gar nicht so weit hergeholt, wenn man bedenkt, was wir inzwischen darüber wissen, was aus den McKenzie-Jungs geworden ist.«
Ich lächelte bei dem Ausdruck »Straftäter«. Er passte sich direkt an.
»Und wenn man bedenkt«, fuhr er fort, »dass die Leichen die ganze Zeit nur wenige Meilen entfernt waren.«
Ich nickte. »Zunächst war der Schädel das Einzige, was wir fanden, doch später, nachdem das andere Skelett entdeckt worden war, gestanden Brody und ich uns ein, dass wir sofort gedacht hatten, der Schädel könnte zu einem der Jungen gehören. Die Knochen waren alt, aber auch nicht so alt. Und dieser Schädel, nun, der Schädel war klein, zu klein für einen Erwachsenen.«
Sam nickte tief in Gedanken versunken. Seine Hände bewegten sich inzwischen nicht mehr, waren von der Neugier ruhiggestellt. Ich bremste den Jeep ab, um einer jungen Frau mit kupferroten Dreadlocks Zeit zu geben, ihren Kinderwagen den Bürgersteig hochzuwuchten. Als ich die Main Street weiter hinunterfuhr, sah ich im Rückspiegel, wie sie anhielt, um ein Rad ihres Kinderwagens zu richten, wobei ihre kupferfarbenen Haarstränge den Boden berührten, als sie den Kopf hierhin und dorthin wandte.
»Wann wurden die anderen Knochen gefunden?«, fragte Sam.
»Am nächsten Morgen sind Brody und ich gemeinsam mit dem Chief und zwei Leuten von der Spurensicherung auf Skiern wieder hingefahren. Sie hatten Hunde mitgebracht, die das Grab des anderen Jungen direkt aufspürten. Die Kinder waren tief vergraben worden, aber nicht tief genug. Chavez hatte immer Tiere in Verdacht, vielleicht einen Kojoten, der den ersten Schädel ausgegraben hat, und danach, nun, da war es nur eine Frage der Zeit.«
Vier Jahre war das her. Es kam mir vor wie gestern.
»Es war mein erster großer Fall als Polizistin. Genau genommen ist es immer noch mein größter Fall.«
Sam warf mir einen Blick zu, den ich nicht einordnen konnte. Ich dachte zuerst, es wäre Mitgefühl, doch als er sprach, erkannte ich, dass ich ihm leidtat, und ich dachte darüber nach, dass Tragödien wie Steine sind, die man in einen See wirft und die Wellen verursachen, welche sich fortsetzen, aber nie das Land erreichen.
»Einige unserer Jungs behaupten, dass du von ihnen träumst? Von den Kindern?«, sagte Sam.
In einem schwachen Moment, ungefähr vor zwei Jahren, hatte ich Chief Angel Chavez von meinen Träumen erzählt. Besser gesagt von meinen Alpträumen. Er bestand darauf, dass ich zu einem Therapeuten ginge, was ich auch tat, und nach ein paar intensiven Monaten mit wöchentlichen Treffen und detaillierten Tagebuchaufzeichnungen hatten die Träume aufgehört.
Ich fragte mich, was der gute Dr. Pabst sagen würde, wenn er erführe, dass die Träume wieder eingesetzt hatten.
»Ja«, sagte ich, »ich träume von ihnen. Sie waren noch Kinder. Sie haben es nicht verdient, was mit ihnen passiert ist. Und seit dreißig Jahren warten sie auf Gerechtigkeit.«
Sam Birdshead schaute aus dem Beifahrerfenster auf die alten viktorianischen Häuser, die in einer Reihe am Straßenrand standen, jedes einzelne verziert wie eine Hochzeitstorte, mit extravagant gedrechselten Locken und schicken kleinen Dachvorsprüngen und Erkern. Die Veranden quollen über vor Blumenkästen, in denen kräftige Farbtupfer zu explodieren schienen; in den Vorgärten war das Gras ordentlich gemäht, und es gab nur wenig Unkraut, wenn überhaupt. Wir waren am Nordende der Stadt, dem reichen Ende.
Die Seite der Stadt, auf der Tommy vor dreißig Jahren zu Hause gewesen war.
»Wir haben ein altes Stammessprichwort«, sagte Sam, »ungefähr wie: ›Alle Träume entspinnen sich aus demselben Netz.‹«
Ich wartete darauf, dass er fortfuhr, doch als er weiterredete, war es eine Frage. »Glaubst du, er ist immer noch da draußen?«
»Wer? Der Woodsman?«
Sam nickte.
»Ich weiß nicht. Nachdem wir die Leichen gefunden hatten, ließen wir jeden Experten kommen, den man sich denken kann. Es gibt ein paar Dinge, in denen sich alle einig waren. Der Woodsman muss groß und kräftig gewesen sein. Tommy war ein großer Junge, und wer immer ihn geschnappt hat, muss größer gewesen ein. Der Woodsman war vermutlich nicht jünger als sechzehn und nicht älter als fünfzig Jahre. Die Gegend in den Wäldern ist rau. Es gibt keine Zufahrt. Er muss fit genug gewesen sein, um die Leichen dorthin zu tragen oder zu schleifen. Wenn er immer noch am Leben ist, liegt sein Alter irgendwo zwischen Mitte vierzig und achtzig. Aber er könnte auch schon tot sein.«
Die Sonne duckte sich hinter eine einzelne Wolke am Himmel, und einen Augenblick lang erwischte mich der Schatten genau im richtigen Winkel und verdunkelte meine Sicht. Ich nahm die Sonnenbrille ab, blinzelte und fuhr weiter. Die Straßen waren frei, wir hatten genau den richtigen Zeitpunkt zwischen Schulschluss und Feierabendverkehr getroffen.
»Warum wird er der Woodsman, also Waldarbeiter, genannt? Die Leichen waren doch nicht, ähm, zerhackt oder so was, oder?«
Ich schüttelte den Kopf. »Gibst du mir mal bitte die Wasserflasche? Hinter meinem Sitz? Danke. Irgendeine Tusse von der Presse hat ihn Woodsman genannt, und der Name blieb kleben. Ich vermute, sie hielt sich für oberschlau, wegen der Legende, und weil die Jungs im Wald gefunden wurden.«
»Was für eine Legende?«
»Du kennst die Geschichte von dem Waldarbeiter und dem Bären nicht? Der Woodsman war ein Jäger, ein Holzfäller, ein Mann der Wälder. Er lebte in einer bescheidenen Hütte, zusammen mit seiner hübschen jungen Frau, der es egal war, dass ihr bärtiger Mann stank und womöglich Mundgeruch hatte. Alles, was sie wollte, war ein Baby. Aber soviel sie auch vögelten, es passierte nichts. Seine Frau so traurig zu sehen, brach dem Mann das Herz. Dann sah er eines Tages in der Stadt, wie ein süßes, kleines Mädchen heftig von seiner Mutter beschimpft wurde. Der Woodsman ging nach Hause, besprach sich mit seiner Frau, kehrte am nächsten Tag in die Stadt zurück und schnappte sich das Mädchen. Der Frau wuchs das Kind ans Herz, doch das kleine Mädchen war bösartig. Ein paar Monate später fand der Mann bei seiner Heimkehr seine wunderschöne Frau tot auf. Das Kind hatte sie in einem Anfall von Eifersucht umgebracht. Von Trauer und Wut übermannt, nahm er das Mädchen mit in den tiefen Wald, wo er sie als Bärenköder festband. Der Bär war über die unverhoffte Mahlzeit so erfreut, dass er sich mit dem Woodsman anfreundete.«
Entsetzt starrte Sam mich an. »Das ist eine grässliche Legende.«
Ich zuckte die Achseln. »Die meisten Märchen sind so. Lies gelegentlich mal ein paar der europäischen Märchen. Wie auch immer, die Legende besagt, dass, wenn du ungezogen bist, der Woodsman kommt, dich aus deinem Zuhause stiehlt, dich in den Wald bringt und an den Bären verfüttert. Es gibt da oben einige alte Hütten abseits der Wanderwege und ausreichend Finsternis in diesen Wäldern, um dieser Geschichte Gewicht zu verleihen. Zumindest, wenn du ein Kind bist.«
»Unheimlich«, sagte Sam. »Und ich dachte schon, unsere Stammesgeschichten seien verstörend. Aber was ist mit dem echten Woodsman – dem Mörder –, gab es da nie irgendwelche Fährten?«
»Wir nehmen an, dass es ein Einheimischer war, einer der Minenarbeiter oder ein Tagelöhner in den Obstplantagen. Körperlich kräftig, jemand, der sich auskannte und der die Möglichkeit hatte, die Kinder zu beobachten und sie am helllichten Tag allein zu erwischen. Sie sind einfach verschwunden, Sam. Niemand hat irgendetwas gesehen.«
Er schwieg einen Augenblick, und dann sagte er genau das, was ich selbst dachte, Tag für Tag. »Dreißig Jahre ist noch nicht so lange her, Gemma. Der Woodsman könnte nicht nur am Leben sein, er könnte hier in der Stadt leben. Vielleicht ist er nie weggezogen.«
Ich bog mit dem Jeep auf den Parkplatz der Gerichtsmedizin ein, ein kleines Gebäude, das an das neue Krankenhaus Saint Thomas angrenzte, und schaltete den Motor aus. Die alte Maschine grummelte einen Moment, ehe sie verstummte, und ich blickte Sam an. Er war wirklich ein heller Kopf und würde es als Polizist weit bringen.
»Jetzt weißt du, warum ich von ihnen träume. Und nun lass uns hineingehen und den toten Clown ansehen.«
6. Kapitel
Dr. Ravi Hussen war ungeduldig. Sie begrüßte uns vor der Tür des Leichenschauhauses mit einem ostentativen Blick auf ihre Armbanduhr und einem gepressten Lächeln.
»Meine Schuld, Ravi. Das Baby hatte Kohldampf, und ich kann momentan keinen klaren Gedanken fassen, wenn ich nichts gegessen habe«, sagte ich und rieb meinen Bauch. Ihr Gesicht wurde weicher, und sie zeigte mit dem Daumen auf Sam.
»Wer ist das Kerlchen?«
»Sam Birdshead, darf ich vorstellen: Dr. Ravi Hussen. Sam ist seit ein paar Wochen bei uns in der Abteilung«, erklärte ich.
Sam streckte eine Hand aus, und Ravi schüttelte sie mit einem amüsierten Ausdruck auf ihren iranischen Gesichtszügen.
»Er ist hier, um zuzusehen«, fügte ich hinzu und schob ihn in Richtung der Männerumkleide. »Zieh dir einen der blauen Overalls an, die du in dem Schrank mit der Aufschrift ›Besucher‹ findest«, sagte ich.
Ravi lächelte, als sie mich in den Umkleideraum der Damen führte. »Süß.«
»Jung.«
Sie half mir, einen extragroßen Overall zu finden, den ich über meinen Bauch ziehen konnte, und zog sich dann selbst um. Wir setzten uns Hauben und Masken auf, zogen Handschuhe und Stiefel an und gingen wieder hinaus auf den Flur zu Sam. Er folgte uns ins Labor.
Nach der Wärme der Augusthitze draußen war es im Kabinett des Todes recht frostig. Aus Stahlschächten in der Decke strömte eisige Luft herein, und ich erschauerte, als ich unter einem der Belüftungslöcher hindurchging. Ein Assistent wartete schweigend an dem langen, schmalen Spülbecken, das sich an der gesamten Wand entlangzog. Sein Gesicht war so bleich und hager wie das des Farmers in dem Bild American Gothic von Grant Wood.
Der Boden war durchzogen mit diskreten Abflüssen, die jede erdenkliche Flüssigkeit sofort auffangen konnten.
Mitten im Labor auf einem Metalltisch lag Reed Tollivers Leiche. Unter dem fluoreszierenden Licht hatte die weiße Theaterschminke auf seinem Gesicht einen widerlich grünen Farbton angenommen. Das schwarze Blut an seiner Kehle glänzte, als wäre es immer noch feucht, was gar nicht möglich war. Sein fröhliches Clownskostüm, komplett mit Hosenträgern und Spritzblume, gab der Szene etwas Makabres, als wären wir durch eine Tür im Gruselkabinett in eine Art ekelhaft verdrehte Karnevalszenerie gestolpert.
Sam schluckte schwer. Ich klopfte ihm auf den Rücken.
»Bitte, Sam, wenn Ihnen übel wird, dann benutzen Sie das Waschbecken in der Ecke«, instruierte Ravi.
Sie zog Reed Tolliver die orangefarbene Perücke vom Kopf, legte dadurch ein üppiges Gewusel dunkler Strähnen frei, und steckte die Perücke in einen Beweismittelbeutel, den sie direkt versiegelte. Die Spurensicherung würde sich die Perücke und seine Kleidung sehr gründlich vornehmen; Ravis Job war es, ihn auszuziehen und seine molekularen Geheimnisse zu entlarven.
Ravi lehnte sich dicht über Tollivers Kopfhaut, musterte die dunklen Strähnen, zog dann an einigen und setzte hellgelbe Haarwurzeln frei. Sie nickte.
»Er ist ein Flachskopf. Dachte ich mir doch, als ich die blauen Augen sah. Man sieht selten solch blaue Augen bei Menschen mit brünettem Haar. Seine Haare wurden wiederholt gefärbt. Als Resultat sind sie ziemlich kaputt, und die Follikel haben fast keine Elastizität mehr.«
Ravi tunkte einen Schwamm in einen kleinen gelben Wassereimer und begann, Tollivers Gesicht abzuwaschen. Die Schminke blieb als fettige Schicht an dem Schwamm hängen, genauso, wie sie an Tollivers Gesicht kleben geblieben war, und Ravi musste den Schwamm wiederholt auswaschen, bevor sie weitermachen konnte.
Nach zehn Minuten war Tollivers Gesicht sauber, jedoch nicht farblos.
Die rechte Seite seines Gesichts war mit Tattoos überzogen. Sie sahen aus wie heidnische und keltische Symbole, die in Blau und Schwarz über seine Wange, die Augenbraue und die Hälfte der Stirn tanzten, selbst bis in den Mundwinkel hinein. Eine Anordnung tintenblauer Knoten und Kreise webte sich hierhin und dorthin und zog sich an manchen Stellen bis hoch in den Haaransatz. Im Kontrast dazu war die linke Seite von Tollivers Gesicht von Piercings durchstochen: Ein halbes Dutzend winziger Gold- und Silberstifte und -ringe verliefen kreuz und quer über seine Haut wie Fahnen auf einer Landkarte.
»Himmel«, stöhnte ich. »Sind die echt?«
Ravi zupfte vorsichtig an einigen Ringen. Sie ließen sich mit der Haut herausziehen und sackten dann langsam wieder zurück an ihren Platz, da die Elastizität der Haut durch die Leichenstarre langsam nachließ. Ravi untersuchte eingehend die Tattoos und Piercings, trat dann von der Leiche zurück und zog mit einem flitschenden Geräusch ihre Handschuhe aus. Am Waschbecken schrubbte sie sich gründlich die Hände und zog die Maske herunter, um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen. Dann trocknete sie sich mit einem Papierhandtuch und setzte zu einer Erklärung an.
»Viele von denen sind von einem Amateur gestochen worden, vielleicht sogar von Tolliver selbst. Narben und kürzlich verheilte Infektionen legen nahe, dass sie schnell gemacht wurden und ohne saubere Instrumente. In der heutigen Zeit sind die Profis schnell weg vom Fenster, wenn sie nicht auf anständige Hygiene achten.«
»Sie wollen uns auf den Arm nehmen. Er hat sich das selbst angetan?«, keuchte Sam. »Meine Fresse.«
Ich trat ihm auf den Zeh, flüsterte »Aufzeichnung« und zeigte auf den Voicerecorder, der an der Decke befestigt war.
»Tschuldigung«, nuschelte er. »Aber, im Ernst?«
Ravi nickte und zog sich ein frisches Paar Handschuhe an. »Das, oder ein Kumpel hat es für ihn gemacht.«
»Schöner Kumpel«, murmelte ich.
Ravi schnitt vorsichtig den Rest von Tollivers Kostüm auf und steckte die Kleidung in einen weiteren, größeren Beweismittelbeutel. Ohne das übergroße Kostüm wirkte er schmal und klein, viel mehr ein Junge als ein Mann. Seine Brust war glatt, und die Haare an den Armen, Beinen und im Schambereich hatten dasselbe Blond wie seine Haarwurzeln. Sein Körper war frei von Tattoos oder Piercings; unterhalb des Halses sah ich noch nicht einmal eine Narbe.
Offensichtlich hatte er sich entschieden, die Selbstverstümmelung auf sein Gesicht zu beschränken, oder vielleicht hatte er einfach nicht lange genug gelebt, um auch den Rest seiner menschlichen Leinwand in Angriff zu nehmen.
Im Kontrast zu seinem sauberen und nackten Körper stach Tollivers aufgeschlitzte Kehle stark hervor, obszön und gewalttätig. Der Schnitt ging tief genug, um Tollivers Kopf fast vollständig von seinem Körper abzutrennen. Zwischen dem Blut und den Muskeln sah man weiße Knochen und Knorpel glänzen.
Sam neben mir würgte.
Ich klopfte ihm auf die Schulter und zeigte in Richtung Spülbecken. Er schluckte schwer, schüttelte dann den Kopf und blieb neben dem Tisch stehen. Ravi stocherte eine Weile in der Wunde herum, bevor sie etwas sagte.
»Ich habe noch nie einen Schnitt wie diesen gesehen, Gemma. Genauer gesagt glaube ich gar nicht, dass es sich überhaupt um einen Schnitt handelt.«
Ich starrte sie an. »Das verstehe ich nicht. Wenn es kein Schnitt ist, was ist es dann?«
»Ein Riss. Heute um die Mittagszeit hat jemand buchstäblich die Kehle dieses armen Jungen aufgerissen.«
Zwei Stunden später hatte Ravi ihre vorläufige Untersuchung der Leiche beendet. Abgesehen von der Wunde, den Tattoos und den Piercings im Gesicht gab es keine neuen Überraschungen. Der Gründlichkeit halber würde sie jedoch eine komplette Obduktion vornehmen und die inneren Organe untersuchen, was auch immer bei der Ermittlung hilfreich sein könnte. Ihr Assistent, der Mann mit dem langen, bleichen Gesicht und der ruhigen Ausstrahlung, nahm Tollivers Fingerabdrücke. Wenn er ein Straßenkind gewesen war, bestand eine gute Chance, dass er irgendwann schon einmal beim Ladendiebstahl oder Autoknacken erwischt worden war.
Wenn die Fingerabdrücke registriert waren, könnten wir vielleicht Angehörige finden.
»Ein Neomycin-Baby«, schlussfolgerte Ravi, als sie ihre Handschuhe in den Mülleimer neben der Tür warf. Sam sah sie überrascht an, und Ravi fuhr fort.
»Jemand hat sich um diesen Jungen gekümmert. Sie haben ihn gefüttert, behütet und ihn vermutlich davon abgehalten, Wettkampfsport auszuüben. Sie haben abgeschürfte Knie bandagiert und das Antibiotikum Neomycin aufgetragen, um eine Narbenbildung zu verhindern, und seine schiefen Zähne wurden mit einer Zahnspange gerichtet. Er war nicht immer ein Straßenkind. Irgendjemand, irgendwo da draußen, hat ihn mal geliebt.«
Ravi begleitete uns zurück zu den Umkleideräumen.
»Wenn ich etwas Neues habe, rufe ich dich an. Du bist jetzt bestimmt erschöpft«, sagte sie.
Ich nickte. Es war fast neunzehn Uhr, und ich war seit vier Uhr wach. Momentan schlief ich nicht gut.
Draußen hatte es sich abgekühlt, und Sam und ich fuhren schweigend zurück zum Revier, jeder in seine eigenen Gedanken vertieft. Ich parkte den Jeep dicht am Haupteingang. Er brauchte eine Weile, um seine Sachen zusammenzusammeln, und im Deckenlicht des Jeeps wirkte er etwas mitgenommen.
Ich sagte mir, es wäre zu seinem eigenen Besten: Wenn er ein Cop werden wollte, dann sollte er sich besser an den Anblick fürchterlicher Dinge gewöhnen. Es ging nicht immer nur um Mut und Ehre, manchmal beschäftigten sie sich auch mit ziemlich ekeligem Kram.
Ich wollte mich gerade wieder auf den Weg nach Hause machen, den Canyon hoch, als Sam vom Haupteingang winkte und mich aufhielt. Ich fuhr einen Bogen zurück und kurbelte das Seitenfenster herunter.
»Dr. Hussen ist am Telefon. Sie sagt, es sei dringend.«
Das war flott. Ich parkte den Jeep und eilte hinein.
»Ravi?«
»Gemma, wir haben Fingerabdrücke zurückerhalten«, sagte sie. Ihre Stimme war tonlos und wirkte verhalten.
Ich drehte mich um und wandte mich von der Rezeptionistin ab. »Das ging schnell, Ravi. Wie kommt das?«
Sie flüsterte. »Zuerst haben wir sie durch die Datenbank des Bundesstaates laufen lassen, nicht durch den nationalen. Ich dachte, wir sollten mit Colorado anfangen, wegen der geringen Wahrscheinlichkeit, dass es ein einheimischer Junge ist. Und ich wusste, dass wir so außerdem schneller Ergebnisse bekommen würden.«
Sie machte eine Pause, dann sagte sie: »Gemma, es ist Nicky Bellington.«
Ich registrierte ihre Worte, doch mein Verstand brauchte einen Moment, um ihr zu folgen.
»Verdammte Scheiße«, sagte ich.
Hinter mir kicherte die Rezeptionistin. Ich ignorierte sie und massierte meine Schläfen, die plötzlich pochten.
»Du sagst es«, flüsterte Ravi.
7. Kapitel
Das schwache Licht, das unter der Tür von Chief Angel Chavez’ geschlossener Tür hervorsickerte, war weich und gelblich. Eigentlich sollte er zu Hause sein und seiner Frau Lydia dabei helfen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben beendeten, und sie dann in die Badewanne stecken. Ihre Arbeitstage bei der Wohlfahrt waren zu lang, nur um dann zu den vier Kleinen mit ihren Nöten und Forderungen nach Hause zu kommen.
Chavez gestand bereitwillig ein, dass seine Frau von ihnen beiden den härteren Job hatte.
Mir war klar, dass der Chief nicht vor Mitternacht zu Hause sein würde, nachdem ich ihm erzählt hatte, was er wissen musste. Ich entschuldigte mich in Gedanken bei Lydia, klopfte leise an die Tür und schob sie auf. Der Raum war schwach beleuchtet, das einzige Licht kam von einer Tiffany-Lampe, die an der Kante seines Schreibtisches aus Eichenholz stand.
Chavez saß da, das Kinn in die Hände gestützt, einen Ordner und einige Akten vor sich ausgebreitet. Auf der Wand hinter ihm, hoch oben, stand in Messingbuchstaben der lateinische Satz: Familia Supra Omnia. Dieser Satz war mir seit dem ersten Tag eingebläut worden: Die Familie geht über alles. Man kann ihn interpretieren, wie man will, im Revier bezieht er sich auf die Bruderschaft der Polizisten. Es bedeutete Loyalität, Ehre und das Wohl der Gruppe über sein eigenes zu stellen. Ich dachte wieder an Finns leichtsinniges Verhalten in dem Fall von Hausfriedensbruch, eine Handlung, die im harten Kontrast zu dieser Loyalität stand, zu dieser Bruderschaft, und ich spürte wieder, wie der Ärger in mir aufstieg. Ich schob ihn zur Seite, jetzt war keine Zeit dafür.
Der Chief schaute von seinem Schreibtisch auf; während ich mir nur vorstellen konnte, welch eine Miene auf meinem Gesicht lag, reichte ihm der Anblick, um aufzustehen und das Zimmer zu durchqueren.
»Gemma? Was ist los?«, fragte er.
Er stand dicht vor mir, als dächte er, ich könnte gleich zusammenbrechen. Plötzlich fühlte ich mich sehr müde und setzte mich auf den Stuhl, den er mir anbot. Es war ein wundervoller antiker Stuhl, die Holzschnitzereien genauso filigran wie das Flechtwerk, doch so furchtbar unbequem, dass ich sofort wünschte, ich wäre stehen geblieben.
»Schließen Sie die Tür, Chief. Und dann setzen Sie sich besser auch.«
Ich wartete, bis er beides getan hatte und holte dann tief Luft. Ich hasste das, was ich ihm nun eröffnen würde. Chief of Police in einer kleinen Stadt in den Bergen zu sein, ist manchmal ein undankbarer Job, aber Chavez war ein guter Vorgesetzter und, noch wichtiger, ein guter Mensch. Gerahmte Zeitungsartikel und Anerkennungsschreiben säumten die Wände seines Büros. Wenige davon handelten von Chavez selbst; nicht, weil es nie um ihn ging, sondern weil es für ihn inspirierender war, an die Erfolge seines Teams erinnert zu werden, die es im Laufe der Jahre erzielt hatte.
»Ravi Hussen hat die Fingerabdrücke von Reed Tolliver mit der bundesstaatlichen Datenbank abgeglichen«, sagte ich. »Wie Sie wissen, wird die Datenbank sowohl nach registrierten Tätern als auch nach vermissten Kindern und Erwachsenen abgesucht. Sie hatte einen Treffer. Ich habe sie gebeten, die Fingerabdrücke erneut durchlaufen zu lassen, und ihre Ergebnisse waren dieselben.«
Ich hob die Hand, als er zum Sprechen ansetzte. »Ich weiß, ich weiß … aber ich wollte absolut sicher sein.«
Chavez nickte und lehnte sich zurück. »Und?«
Ich wusste, dass alles, was in den nächsten paar Stunden, Tagen und Wochen passieren würde, ein Resultat dessen war, was ich dem Chief jetzt erzählte. Und er würde diesen Augenblick nie mehr vergessen, diesen Moment, in dem ich die Türen der Hölle öffnete und die Dämonen freisetzte.
»Reed Tolliver existiert nicht«, sagte ich. »Die Leiche ist Nicky Bellington.«
Chavez atmete laut aus. »Das ist nicht witzig, Gemma. Wenn das irgendein kranker Witz sein soll …«