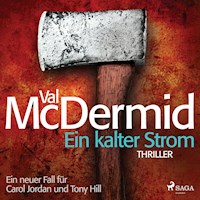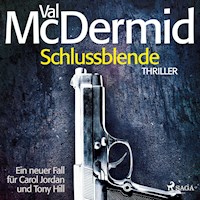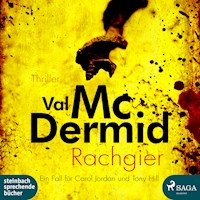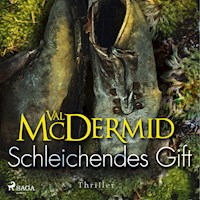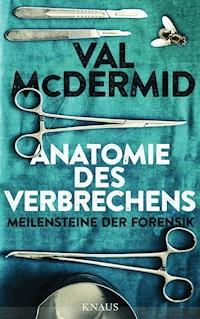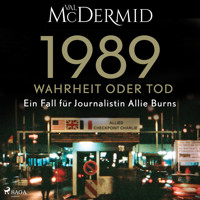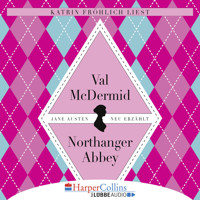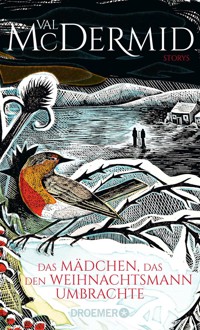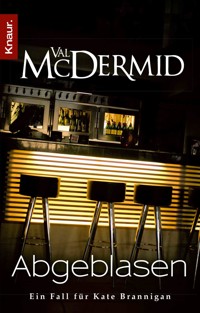
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kate-Brannigan-Reihe
- Sprache: Deutsch
In ihrem ersten Fall durchkämmt Kate Brannigan die Popmusikszene in Manchester nach einer verschwundenen Songwriterin. Nach einiger Laufarbeit weiß Kate: Die Gesuchte hat einen Totalabsturz hinter sich und wäre an einem Comeback sehr interessiert. Doch dann bläst ihr jemand mit einem Tenorsaxofon das Lebenslicht aus …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Val McDermid
Abgeblasen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In ihrem ersten Fall durchkämmt Kate Brannigan die Popmusikszene in Manchester nach einer verschwunden Songwriterin. Nach anfänglichen Schwierigkeiten weiß Kate: Die Gesuchte hat einen Totalabsturz hinter sich und wäre an einem Comeback durchaus interessiert. Doch dazu kommt es nicht, denn vorher bläst ihr jemand mit einem Tenorsaxofon das Lebenslicht aus ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Zweiter Teil
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Für Lisanne und Jane.
Meine Lieben, können wir ihnen das wirklich erzählen?
Erster Teil
1. Kapitel
Irgendwann bringe ich ihn um. Ehrenwort! Wen? Meinen Nachbarn Richard Barclay, seines Zeichens Rockjournalist und ein großes Kind. Da stolpere ich total erledigt über die Schwelle meines Bungalows, erfüllt von dem doch bestimmt nicht allzu unbescheidenen Wunsch, ein paar Stunden zu schlafen, und finde Richards Nachricht. Finde? Es darf gelacht werden. Er hatte sie mit Tesafilm an die Innenseite der Glastür geklebt, so dass sie mir, giftig bunt wie der Wunschzettel für den Weihnachtsmann, buchstäblich ins Auge sprang. In krakeligen Druckbuchstaben stand da mit breitem Leuchtstift auf die Rückseite der Pressemitteilung einer Plattenfirma gemalt: »Heute Abend Jetts Gig und hinterher Party. Nicht vergessen! Muss dich unbedingt dabeihaben. Also bis acht.« Das unbedingt war dreifach unterstrichen, aber was mir den Blutdruck hochtrieb, war dieses unverschämte Nicht vergessen!
Richard und ich sind erst seit neun Monaten zusammen, aber inzwischen kenne ich seine Formulierungen so gut, dass ich sie zu einem kompletten Berlitz-Sprachführer zusammenstellen könnte. Im Klartext heißt Nicht vergessen: »Ich hab dir absichtlich nicht gesagt, dass ich für uns beide eine Einladung angenommen habe (weil du freiwillig garantiert nicht hingegangen wärst), aber wenn du jetzt nicht mitkommst, bringst du mich in die größte Verlegenheit.«
Ich zog den Zettel ab und besah mir seufzend die Tesafilmspuren auf dem Glas, die wieder mal den Einsatz eines Reinigungsmittels erforderlich machten. Von Reißzwecken hatte ich Richard mittlerweile abgebracht, aber auf Selbstklebezettel war er bisher noch nicht umgestiegen. Ich ging durch meine kleine Diele zum Telefon. Das Hausbuch, in das Richard und ich normalerweise alles Wichtige eintragen, war aufgeschlagen. Unter dem heutigen Datum stand in schwarzem Filzstift und in Richards Schrift: »Jett: Apollo, dann Holiday Inn.« Es war nicht derselbe Stift wie auf dem Zettel an der Tür, aber der scharfe Blick von Supernase Kate Brannigan ließ sich dadurch nicht täuschen. Ich wusste ganz genau, dass die Notiz noch nicht da gewesen war, als ich eine Stunde vor Morgengrauen aus dem Haus tappte, um mich wieder einmal auf die Spur von zwei Markenwarenfälschern zu setzen.
Kindische Verwünschungen ausstoßend, verzog ich mich ins Schlafzimmer und pellte mich aus Daunenjacke und Jogginganzug. »Ich wünsche dir, dass deine Karnickel dahinsiechen und deine Streichhölzer nass werden. Und dass du das Mayonnaiseglas nicht aufbekommst, wenn du dir dein Hühnersandwich machen willst.« Noch immer fluchend, ging ich ins Badezimmer und stellte mich dankbar unter die heiße Dusche.
Dort fing ich trotz aller Selbstbeherrschung aus lauter Selbstmitleid doch an zu heulen. In der Dusche sieht dich keiner weinen. Diese Weisheit erkläre ich zu einem der großen Aphorismen des zwanzigsten Jahrhunderts, gleich nach: »Liebe ist, wenn man nie sagen muss, dass es einem leidtut.« Hauptsächlich aber heulte ich vor Müdigkeit. Seit zwei Wochen bearbeitete ich einen Fall, bei dem ich fast täglich kreuz und quer durchs Land fahren und mich vom Morgengrauen bis Mitternacht vor Wohn- und Lagerhäusern auf die Lauer legen musste. Zur Stärkung war ich auf den Fraß von Raststätten und Imbissbuden angewiesen, denen meine Mutter glatt die Lebensmittelkontrolleure auf den Hals gehetzt hätte.
Wäre so was bei der Firma Mortensen & Brannigan an der Tagesordnung gewesen, hätte ich mich wohl nicht so schwer damit getan. Normalerweise sitzen wir bei unserer Arbeit gemütlich vor dem Computer, trinken jede Menge Kaffee und telefonieren wie die Weltmeister. Doch diesmal ging es darum, im Auftrag eines Konsortiums angesehener Uhrenhersteller zu ermitteln, woher die erstklassigen Kopien ihrer Markenuhren kamen, die, von Manchester ausgehend, den Markt überschwemmten. Und mir war – wen wundert’s! – die Drecksarbeit zugefallen, während Bill im Büro hocken blieb und muffig seine Monitore beäugte.
Zugespitzt hatte sich die ganze Geschichte nach einem Einbruch bei Garnett’s, dem größten noch selbständigen Juwelier der Stadt. Den Safe und die gesicherten Schaukästen hatten die Diebe nicht angerührt, dafür hatten sie sich großzügig aus einem Schrank im Büro des Geschäftsführers bedient. Sie hatten die grünen Lederbrieftaschen mitgehen lassen, die Käufer einer echten Rolex als kostenlose Zugabe bekommen (wie die Käufer von Waschmitteln ein Plastikkrokodil), die Kreditkartenetuis von Gucci und Dutzende leerer Schachteln für Uhren von Cartier und Raymond Weil.
Dieser Diebstahl war für die Hersteller ein Alarmzeichen. Das Geschäft mit gefälschten Markenartikeln war offenbar in eine neue Phase eingetreten. Bisher hatten sich die Gauner damit begnügt, ihre Ware über ein kompliziertes Netz von Kleinhändlern als Kopien zu verkaufen. Das hatte die Firmen zwar erbost, ihnen aber keine schlaflosen Nächte bereitet, weil Kunden, die in einem Pub oder an einem Marktstand vierzig Pfund für eine falsche Rolex hinlegten, einfach nicht in derselben Liga spielten wie Typen, die ein paar Tausender für das Original lockermachten. Jetzt aber versuchte die Fälscherriege, die wirklich sehr gelungenen Kopien als echt zu verhökern, und das war nicht nur ein Verlustgeschäft für den Einzelhandel, sondern auch rufschädigend für die Hersteller von Luxusuhren. Plötzlich fanden die hohen Herren, dass es sich wohl doch lohnte, eine gewisse Summe zu investieren, um den Gaunern das Handwerk zu legen.
Dass wir den Auftrag an Land gezogen hatten, obwohl Mortensen & Brannigan nicht zu den Top Ten britischer Detekteien gehören, hatte zwei gute Gründe. Eigentlich sind wir auf Computerkriminalität und Sicherheitssysteme spezialisiert, trotzdem dachten die Leute von Garnett sofort an uns, weil Bill ihnen eine elektronische Alarmanlage eingebaut hatte, an die entgegen seinem Rat der bewusste Schrank nicht angeschlossen war. In dem Ding ist doch nichts, was Langfinger reizen könnte, hatten sie damals gesagt. Der zweite Grund war, dass wir eine der wenigen Spezialdetekteien mit Standort Manchester sind. Wir kennen das Revier.
Eigentlich hatten wir damit gerechnet, den Auftrag in wenigen Tagen abschließen zu können, aber wir hatten den Umfang des Unternehmens unterschätzt. Bis ich einen Überblick gewonnen hatte, war ich ziemlich fertig. Seit ein paar Tagen aber spürte ich so ein merkwürdiges Flattern in der Magengrube – sicheres Zeichen dafür, dass ich es so gut wie geschafft hatte. Ich hatte das Werk ausfindig gemacht, in dem die gefälschten Uhren hergestellt wurden. Ich wusste, wie die beiden Typen hießen, die den Großhandel belieferten, und wer ihre wichtigsten Mittelsmänner waren. Wenn es mir jetzt noch gelang, die einzelnen Stationen ihres Vertriebssystems ausfindig zu machen, konnten wir einen abschließenden Bericht an unseren Klienten geben. Dann würden wohl in den nächsten Wochen die Männer, denen ich so hartnäckig auf den Fersen geblieben war, peinlichen Besuch von der Polizei und der Handelsaufsicht bekommen, und das bedeutete für Mortensen & Brannigan außer einem recht ansehnlichen Honorar noch eine hübsche Belohnung.
Weil alles so gut lief, hatte ich mir einen wohlverdienten und dringend benötigten beschaulichen Abend gönnen wollen. Abends um sechs war ich Jack »Billy« Smart, meinem Topverdächtigen, zu seinem neogotischen dreistöckigen Haus in einer stillen, baumbestandenen Vorortstraße gefolgt, das er mit zwei Flaschen Schampus und einem Stapel Videos aus dem Laden um die Ecke betreten hatte, vermutlich zu einer Knutsch- und Schmusesitzung mit seiner Freundin. Vor lauter Begeisterung hätte ich ihn selber knutschen mögen. Jetzt konnte ich heimfahren, rasch duschen, mich vom Chinesen mit Lecker-Fernöstlichem frei Haus beliefern und von der Glotze mit einer Seifenoper berieseln lassen. Danach würde ich mir eine Gesichtspackung verpassen und ein langes, genüssliches Bad nehmen. Nicht, dass ich unter Waschzwang leide, aber unter die Dusche gehe ich nur, um den Schmutz des Tages loszuwerden, während ein Bad ernsthaften Vergnügungen vorbehalten bleibt – der Lektüre von Besprechungen der Abenteuerspiele in Computerzeitschriften etwa und Träumen von dem PC, den ich mir leisten werde, falls Mortensen & Brannigan mal an das ganz große Geld kommen sollten. Wenn ich Glück hatte, war Richard mal wieder unterwegs zu einem Konzert, und ich konnte mich ungestört mit einem kühlen Longdrink in der Wanne aalen.
Von alldem war nur eins geblieben: Richard wollte tatsächlich zu einem Konzert, und zwar mit mir. Das war das Aus für meine schönen Pläne. Heute Abend war ich viel zu kaputt, um mit Richard zu streiten. Außerdem saß ich am kürzeren Hebel. Vorige Woche hatte er sich mir zuliebe schick in Schale geworfen und mich zu einem Arbeitsessen begleitet. Einen ganzen Abend lang hatte er diverse Versicherungsleute samt Anhang, Spinatquiche und Vollkornbrot ertragen, und jetzt war ich wohl dran, etwas für ihn zu tun. Aber stumm würde ich nicht leiden, das nahm ich mir fest vor.
Als ich gerade Shampoo in meinem wilden roten Haar verteilte, traf ein kalter Luftzug meine Wirbelsäule. Ich drehte mich um und sah das, was ich vermutet hatte: einen bänglich lächelnd durch die offene Tür der Duschkabine lugenden Richard. »Hi, Brannigan! Machst du dich schön für unsere Party? Hab doch gewusst, dass du es nicht vergessen würdest.« Mein finsteres Gesicht war ihm offenbar nicht entgangen, denn er schob nur noch nach: »Okay, ich warte im Wohnzimmer auf dich«, und machte schnell die Tür wieder zu.
»Komm sofort wieder her«, rief ich ihm nach, was er wohlweislich überhörte. Das sind die Situationen, in denen ich mich vergeblich frage, wieso ich ganz gegen meine sonstigen Grundsätze einem Mann gestattet habe, sich in meinem Privatleben breitzumachen.
Dabei hätte ich es eigentlich besser wissen müssen. Alles hatte so harmlos angefangen. Ich hatte einen jungen Systemanalytiker observiert, dessen Arbeitgeber ihn in Verdacht hatte, Informationen an die Konkurrenz zu verkaufen. Ich war ihm zum Hacienda Club gefolgt, wo viele der Bands angefangen haben, denen Manchester seit den frühen neunziger Jahren seinen Ruf als kreatives Zentrum der Musikszene verdankt. Ich war nur ein-, zweimal da gewesen, weil ich in meiner kostbaren Freizeit Besseres zu tun habe, als mich mit einer schwitzenden Masse Mensch in einem Raum zusammenzudrängen, in dem jegliche Unterhaltung ein Ding der Unmöglichkeit ist und man allein vom Luftholen high wird. Wie viel schöner ist es da, am Computer zu sitzen und interaktive Abenteuergames zu spielen.
In der Hacienda bemühte ich mich, möglichst wenig aufzufallen, womit man sich gar nicht so leichttut, wenn man die entscheidenden fünf Jahre älter ist als die anderen Gäste. Plötzlich stand dieser Typ neben mir und wollte mich unbedingt zu einem Drink einladen. Ich fand ihn nett – sicher auch deshalb, weil er immerhin alt genug war, um sich rasieren zu müssen. Er hatte vergnügt blitzende Augen hinter einer Schildpattbrille und ein wirklich sehr aufregendes Lächeln, aber ich war schließlich im Dienst und konnte meinen kleinen Systemanalytiker nicht aus den Augen lassen. Der Typ mit dem aufregenden Lächeln ließ sich nicht abwimmeln, und ich war deshalb ganz froh, als meine Zielperson zum Ausgang marschierte.
Für einen Abschied blieb keine Zeit. Ich sauste hinterher und glitschte wie ein Aal durch die Menge. Als ich endlich auf der Straße stand, sah ich die Rücklichter seines Wagens aufleuchten. Herzhaft fluchend raste ich um die Ecke zu meiner Kutsche, setzte mich ans Steuer, legte den Gang ein und schoss aus der Parklücke. Als ich um die Ecke bretterte, stieß ein aufgemotzter VW-Käfer rückwärts aus einer Seitenstraße. Ich riss das Steuer herum, um meinen Nova vor dem Totalschaden zu retten, und es gab einen dumpfen Knall.
Sekunden später war alles vorbei. Ich stieg aus, stinksauer auf diesen Vollidioten, der mich nicht nur um mein Zielobjekt gebracht, sondern auch noch meinen Wagen demoliert hatte. Wutschnaubend ging ich auf den Käfer zu, entschlossen, den Typ so fix und fertig zu machen, dass er seine Eier in einem Plastikbeutel nach Hause tragen konnte. Denn wer so fuhr, musste einfach ein Mann sein.
Durchs Wagenfenster sah ich ein Paar besorgte Kinderaugen: der Typ mit dem aufregenden Lächeln! Ehe ich dazu kam, mich angemessen zu seinen Fahrkünsten zu äußern, lächelte er mich entwaffnend an. »Wenn Sie unbedingt meinen Namen und meine Telefonnummer haben wollten, hätten Sie das vorhin ruhig sagen können«, meinte er unschuldig.
Erstaunlicherweise habe ich ihn in dem Moment nicht umgebracht. Ich habe gelacht. Das war mein erster Fehler. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, ist er mein Nachbar und mein Lover: Richard, ein total lieber, lustiger Typ, geschieden, mit einem fünfjährigen Sohn in London. Immerhin hatte ich mir noch so viel gesunden Menschenverstand bewahrt, dass ich nicht mit ihm zusammengezogen war. Als zufällig der Nachbarbungalow zum Verkauf stand, sagte ich zu Richard, mehr Nähe wäre bei mir einfach nicht drin. Er griff sofort zu.
Eigentlich hatte er sich eine Verbindungstür zwischen den beiden Bungalows gewünscht, aber ich hatte ihm klargemacht, dass das erstens wegen der tragenden Wände nicht ginge und wir zweitens nach so einem Umbau unsere Häuser nie mehr loswerden würden. Und weil ich in unserer Beziehung fürs Praktische zuständig bin, fügte er sich. Stattdessen haben wir – das war meine Idee – als Verbindung zwischen den beiden Häusern einen großen Wintergarten anbauen lassen, von dem Glastüren in die beiden Häuser führen. Sollten wir mal umziehen, lässt sich ohne weiteres eine Zwischenwand einbauen. Und wir haben uns beide das Recht vorbehalten, unsere Türen abzuschließen. Ich jedenfalls. Vor allem deshalb, um in aller Ruhe Ordnung machen zu können, wenn Richard wieder mal mein gepflegtes Heim in eine Chaosbude verwandelt hat. Und er kann sich bis zum Morgengrauen mit seinen Rockkumpels vergnügen, ohne dass ich genötigt bin, im fahlen Dämmerlicht durchs Wohnzimmer zu tappen und bissig zu murmeln, dass es auch Leute gibt, die morgens zur Arbeit müssen.
Während ich mein Haar trockenrubbelte und meiner müden Haut reichlich Feuchtigkeitscreme zukommen ließ, verfluchte ich mein weiches Herz. Irgendwie bekommt er mich immer wieder rum. Mit diesem aufregenden Lächeln, einem Rosenstrauß und einer flapsigen Bemerkung, eine Masche, gegen die eine clevere, abgebrühte Person wie ich eigentlich gefeit sein müsste. Immerhin habe ich ihm beigebracht, dass es in jeder Beziehung gewisse Regeln gibt. Ein Verstoß dagegen ist verzeihlich, beim zweiten lasse ich früh um drei die Schlösser auswechseln und werfe – vorzugsweise bei Regen – seine Lieblingsplatten aus dem Wohnzimmerfenster in den Vorgarten. Und in Manchester regnet es fast immer.
Zuerst hat er mich daraufhin behandelt wie eine gemeingefährliche Irre. Inzwischen hat er offenbar begriffen, dass es sich mit den Regeln sehr viel angenehmer leben lässt als gegen sie. Natürlich ist mein Lover trotzdem alles andere als perfekt. So bringt er mir gern kleine Geschenke mit. Weil er aber farbenblind ist, schleppt er zum Beispiel eine scharlachrote Vase an, die zu meiner Inneneinrichtung in Blaugrün, Pfirsich und Magnolie passt wie ein Braunbär an den Nordpol. Oder schwarze Sweatshirts mit Bildern von total unbekannten Bands, weil Schwarz zurzeit so angesagt ist, obgleich ich ihm schon hundertmal gesagt habe, dass ich in Schwarz aussehe wie eine Leiche auf Urlaub. Jetzt deponiere ich diese Liebesgaben einfach in seinem Haus und bedanke mich herzlich für seine Aufmerksamkeiten. Aber er ist dabei, sich zu bessern. Ehrlich. Jedenfalls versuchte ich mich mit diesem Gedanken von den Mordgelüsten abzulenken, die sich angesichts des vor mir liegenden Abends in mir regten.
Noch immer vergrätzt, ging ich ins Schlafzimmer und überlegte, was ich anziehen sollte, das heißt, was wohl von mir erwartet wurde. Für das Konzert hätte es überhaupt keine Rolle gespielt, da fiel ich unter den Massen kreischender Fans, die Jett in seiner Heimatstadt einen triumphierenden Empfang bereiten würden, überhaupt nicht auf. Das Problem war die Party. Wohl oder übel musste ich mir Rat von Richard holen. »Was für eine Party ist es denn klamottenmäßig?«
Er schaute zur Tür herein und machte ein Gesicht wie ein junger Hund, der es gar nicht fassen kann, dass man ihm die Pfütze auf dem Küchenfußboden so rasch verziehen hat. Seine eigene Garderobe half mir nicht weiter. Er trug einen schlabbrigen stahlblauen Zweireiher mit breiten Schultern, ein schwarzes Hemd und einen Seidenschlips in Neonfarben, der aussah wie ein psychedelisches Plattencover aus den Sechzigern. Er zuckte mit den Achseln und beglückte mich mit dem bewussten Lächeln, bei dem mir immer noch die Knie weich werden. »Du kennst ja Jett«, sagte er.
Das war maßlos übertrieben. Wir waren uns nur einmal begegnet, vor einem Vierteljahr bei einem Wohltätigkeitsdinner, da hatte er mit uns an einem Tisch gesessen und war wortkarg und vergrübelt gewesen. Aufgetaut war er erst, als Richard über Fußball sprach. Manchester United, zwei Worte, die von Santiago bis Stockholm in jeder Sprache verständlich sind – das war die Zauberformel, die Jett geradezu umgekrempelt hatte. Er hatte sich für sein geliebtes Manchester-Team in die Bresche geworfen wie ein Italiener, der die Ehre seiner Mutter bedroht sieht. Vielleicht hätte er sich gefreut, wenn ich im Streifentrikot gekommen wäre. »Nein, Richard, ich kenne Jett nicht«, entgegnete ich nachsichtig. »Was kommen denn so für Leute?«
»Kaum Traceys, jede Menge Fionas.« Das war unser Geheimcode. Traceys sind süße Motten in der Nachfolge der Groupies: blond, vollbusig, verrückt nach dem neuesten Modetrend. Bloß gut, dass es bei ihnen meist mit der Intelligenz ein bisschen hapert, sonst könnten sie gefährlich werden. Fionas weisen ähnliche Merkmale auf, stammen aber eher aus bestbetuchter Oberschicht. Auf Rockstars stehen sie, weil sie Spaß daran haben, jede Menge Geschenke zu bekommen, sich zu amüsieren und gleichzeitig ihre Eltern gründlich zu schockieren. Wenn Jett mehr auf Fionas stand, waren Designerklamotten angesagt, und die sind in meiner Garderobe nur recht spärlich vertreten.
Ich schob missgelaunt einen Bügel nach dem anderen beiseite und entschied mich schließlich für ein weites, langes Baumwollshirt in Oliv-Khaki, Beige und Terrakotta, das ich voriges Jahr im Urlaub auf den Kanarischen Inseln gekauft hatte, und terrakottafarbene Leggings. An meiner prallen Körperlichkeit war eindeutig der Fast-Food-Fraß aus den Raststätten schuld, die Polster mussten schleunigst wieder weg. Zum Glück überspielte das Shirt die ärgsten Wülste. Ich komplettierte das Outfit mit einem breiten braunen Gürtel und hochhackigen braunen Sandaletten. Mit knapp eins sechzig ist man schon auf ein bisschen Nachhilfe angewiesen. Jetzt noch ein Paar auffällige Ohrringe und goldfarbene Klunkerketten – dann ein prüfender Blick in den Spiegel. Das Endergebnis war nicht sensationell, aber immer noch besser, als Richard es verdiente. Wie aufs Stichwort sagte er: »Super siehst du aus, Brannigan. Wenn die dich sehen, haut es sie glatt um.«
Hoffentlich nicht, dachte ich. Heute Abend wollte ich den Beruf endlich mal zu Hause lassen.
2. Kapitel
Die Hektik einer Parkplatzsuche am Apollotheater blieb uns erspart, weil wir in fünf Minuten zu Fuß hinkamen. Es war ein unerhörter Glücksfall, dass ich in meinem ersten Jahr als Jurastudentin an der Manchester University diese Siedlung entdeckt hatte. Sie ist auf drei Seiten von Sozialwohnblocks umgeben, an der vierten liegt der Ardwick Common. Mit dem Rad brauche ich fünf Minuten zur Uni, zur Bibliothek, nach Chinatown und zu meinem Büro, zehn Minuten bis zur Stadtmitte. Und mit dem Wagen ist man in null Komma nichts auf der Autobahn. Als ich diesen Schatz entdeckte, waren die vierzig Häuser noch im Bau und kosteten – wohl wegen der etwas anrüchigen Gegend – lächerlich wenig. Wenn ich meinen Vater dazu bewegen kann, für eine hundertprozentige Hypothek geradezustehen, sagte ich mir, und wenn ich mir eine Studentin als Untermieterin nehme, zahle ich nicht viel mehr als für meine miese Bude im Studentenheim. Ich legte mich mächtig ins Zeug, und Ostern konnte ich einziehen. Ich habe es nie bereut. Das Haus ist super, man darf nur nicht vergessen, die Alarmanlage zu aktivieren.
Als wir ankamen, hatte die Vorgruppe gerade die erste Nummer hinter sich. Wir hätten sogar von Anfang an dabei sein können, wenn die Veranstalter nicht die Gästeliste einem Analphabeten in die Hand gegeben hätten. Zu den Negativposten der Beziehung mit einem Rockjournalisten gehört es, dass man die Vorgruppen nicht zu dem nutzen kann, wozu sie eigentlich gedacht sind, nämlich als Hintergrundgeräusch für ein paar entspannte Drinks vor dem Auftritt des eigentlichen Stars. Rockjournalisten tun sich die Vorgruppen echt an, wenn auch nur, um zu demonstrieren, wie profimäßig sie drauf sind, mit Bemerkungen wie: »Ja, doch, ich erinnere mich noch an die Sowiesos (folgt der Name einer Band, die inzwischen längst vergessen ist), sie waren in der City Hall von Newcastle die Vorgruppe …« Zwei Stücke ertrug ich tapfer, dann ließ ich Richard sitzen und ging zur Bar.
Ungefähr so wie die Bar im Apollo stelle ich mir die Hölle vor: grellrot glitzender Mosaikfußboden, Hitze, Rauch, stinkige Alkoholschwaden. Ich drängte mich durch die Menge und schwenkte eine Fünf-Pfund-Note, bis eine der gelangweilten Bedienungen geruhte, Notiz von mir zu nehmen. Im Apollo ist die Getränkeauswahl dürftigst, die Drinks haben Körpertemperatur, werden im Plastikbecher serviert und schmecken eigentlich alle gleich. Nur die Farben sind unterschiedlich. Ich bestellte ein Lager, das abgestanden war und wie eine Urinprobe aussah. Ich kostete mit der gebotenen Vorsicht. Wie heißt es so schön: Sehen ist glauben. Als ich mich wieder zum Ausgang schob, entdeckte ich in einer Ecke etwas so Interessantes, dass ich unvermittelt stehen blieb. Prompt lief der Typ hinter mir in mich hinein und schüttete die Hälfte von meinem Bier meinem Nebenmann auf die Hose.
Während ich mich ausgiebig entschuldigte und ebenso eifrig wie vergeblich versuchte, mit einem Papiertaschentuch die Bierflecken zu tilgen, war ich abgelenkt, und als ich danach wieder in die bewusste Ecke blickte, standen dort drei wildfremde Leute. Gary Smart, Billys Bruder und Partner, war verschwunden.
Vergeblich schaute ich mich in der überfüllten Bar nach ihm um. Er hatte mit einem großen, hageren Mann zusammengestanden, von dem ich nur den Rücken hatte sehen können. Von der Unterhaltung hatte ich nichts mitbekommen, aber der Körpersprache nach war es um Geschäfte gegangen. Gary hatte den anderen irgendwie unter Druck gesetzt. Es sah nicht aus, als hätten sie über Jetts bestes Album diskutiert. Ich ließ ein paar saftige Flüche vom Stapel. Die Chance, etwas Aufschlussreiches aufzuschnappen, war dahin.
Ich zuckte mit den Achseln, trank den schäbigen Rest von meinem Bier aus und verzog mich. Am Verkaufsstand im Foyer sah ich mir die T-Shirts, Sweatshirts, Anstecker, Programme und Platten an. Das mache ich immer, denn wenn mir was gefällt, kann Richard es meist kostenlos abstauben. Aber die Sweatshirts waren schwarz und die T-Shirts scheußlich, und so ging ich denn durch den halbleeren Zuschauerraum und setzte mich wieder zu Richard, während die Vorgruppe die letzten beiden Titel herunterhämmerte. Dann zog sie ab, es gab dünnen Beifall, im Zuschauerraum wurde es hell, und ein Stück aus der aktuellen Hitliste dröhnte vom Band. »Gequirlte Scheiße«, meinte Richard lakonisch.
»Heißt die Gruppe so, oder war das eine kritische Anmerkung?«, wollte ich wissen.
Er lachte. »Als Name für die Band wär’s durchaus passend, aber ich glaube, so selbstkritisch sind die nicht. So, und jetzt haben wir endlich einen Augenblick Zeit für uns. Erzähl mal, wie es dir heute ergangen ist.«
Er zündete sich einen Joint an, und ich legte los. Mir hilft es immer sehr, mich bei Richard auszusprechen. Er beurteilt Menschen und Situationen eher intuitiv und liegt dabei meist richtig. Es ist die ideale Ergänzung zu meiner analytischen Betrachtungsweise.
Doch noch ehe er sich zu meinen neuesten Abenteuern mit den Gebrüdern Smart hatte äußern können, wurde die Beleuchtung wieder gedimmt. Inzwischen war der Zuschauerraum bis auf den letzten Platz besetzt. »Jett«, brüllte es aus dem Publikum. »Jett, Jett …« Sie ließen die Leute eine Weile rufen, dann bohrten sich gleißende Scheinwerferbahnen durch die Dunkelheit, und Jetts Band kam auf die Bühne. Ein hellblauer Spot richtete sich auf den Drummer, der leise über seine Snare-Drum strich. In einem lila Lichtkegel akzentuierte der Mann am Bass den Beat. Der Keyboarder ließ einen schwirrenden Akkord vom Synthesizer folgen, mit weichem Ton setzte das Saxophon ein.
Unvermittelt richtete sich ein grellweißer Spot auf Jett, der aus den Kulissen trat, schmal und zerbrechlich wie immer. Seine schwarze Haut glänzte im Scheinwerferlicht. Er trug Lederhosen und ein beigefarbenes Seidenhemd, seine Markenzeichen, und hatte eine Akustikgitarre um den Hals hängen. Die Fans übertönten in ihrer tobenden Begeisterung fast die Band. Kaum aber hatte Jett den Mund geöffnet, wurde es totenstill im Saal.
Seine Stimme war besser denn je. Schon als Fünfzehnjährige fand ich Jett toll, als er zum ersten Mal mit einer Single in die Charts kam, aber einordnen kann ich seine Musik heute noch ebenso wenig wie damals. Sein erstes Album war eine Sammlung von zwölf Songs, hauptsächlich zur Akustikgitarre gesungen, manche aber auch mit einer raffinierten Begleitung, vom Saxophon bis zum Streichquartett. Inhaltlich reichten sie vom schlichten Liebeslied bis zu dem hymnenartigen To Be With You Tonight, dem Überraschungshit des Jahres, der eine Woche nach Erscheinen die Spitze der Charts erklommen hatte und dort acht Wochen geblieben war. Seine Stimme war wie ein Musikinstrument, das sich mühelos jedem Arrangement anpasste. Als unglücklich verliebter Teenie konnte ich mich mit Haut und Haar an seine sehnsuchtsvollen Lieder mit ihren anrührenden Texten verlieren.
Acht weitere Alben waren diesem ersten gefolgt, aber sie hatten mich immer weniger begeistern können. Vielleicht lag es daran, dass ich selbst mich geändert hatte. Was ein Teenager als tiefsinnig und sehr zu Herzen gehend empfindet, wirkt ganz anders, wenn man Mitte zwanzig ist. Die Musik fand ich immer noch kraftvoll, die Texte aber waren seicht geworden und strotzten vor Klischees. Vielleicht spiegelten sie auch die Einstellung zu Frauen wider, die man Jett nachsagte. Es fällt schwer, aufgeklärte Liebeslieder über jene Hälfte der Menschheit zu schreiben, von der man glaubt, sie sei nur dazu geschaffen worden, um barfuß herumzulaufen und Kinder in die Welt zu setzen. Die Leute im ausverkauften Apollo teilten offenbar meine Ansicht nicht. Sie schrien sich vor Begeisterung die Kehle wund. Für Jett war es gewissermaßen ein Heimspiel. Er war ein Sohn dieser Stadt. Er hatte den Traum vieler Leute aus dem Norden wahrgemacht, hatte den Sprung von einer Sozialwohnung im Getto von Moss Side zu einem Herrenhaus in Cheshire geschafft.
Als versierter Showstar brachte er zum Abschluss des neunzigminütigen Auftritts als dritte Zugabe seinen ersten Megahit, auf den wir alle schon gewartet hatten. Der alte Trick im Showbusiness: Man muss so aufhören, dass die Leute am liebsten gar nicht gehen wollen. Noch ehe die letzten Akkorde verklungen waren, war Richard aufgesprungen und steuerte den Ausgang an. Ich folgte ihm rasch, ehe das allgemeine Gedränge einsetzte, und holte ihn draußen ein, wo er ein Taxi heranwinkte.
»Nicht schlecht«, sagte Richard, als das Taxi anfuhr. »Gar nicht schlecht. Als Showstar kommt er immer noch toll rüber, aber für das nächste Album muss er sich was Neues einfallen lassen. Die letzten drei hören sich alle gleich an, und der Umsatz war nicht überwältigend. Pass auf, da werden heute Abend manche Leute die Nase kraus ziehen. Nicht nur die Kokser.«
Er zündete sich eine Zigarette an, und ich nutzte die Gelegenheit zu der Frage, warum ich eigentlich unbedingt hatte mitgehen sollen. So ganz hatte ich die Hoffnung, heute mal früh ins Bett zu kommen, noch nicht aufgegeben.
»Wird nicht verraten«, sagte er geheimnisvoll.
»Komm, sei nicht so. Wir fahren nur fünf Minuten, ich hab keine Zeit, dir die Fingernägel einzeln auszureißen.«
»Du bist grausam, Brannigan«, jammerte er. »Immer im Dienst, wie? Also meinetwegen. Du weißt ja, dass ich Jett seit einer halben Ewigkeit kenne …« Ich nickte. Richard verdankte seinen ersten Job bei einer Musikzeitschrift einem Exklusivinterview mit dem normalerweise sehr pressescheuen Jett. Damals war Richard bei einer Lokalzeitung in Watford gewesen und hatte über das Pokalspiel gegen Manchester City berichtet. Zu jener Zeit fungierte Elton John als Präsident des FC Watford, der Jett an dem Tag als Ehrengast eingeladen hatte. Nach dem Sieg von Manchester City hatte Richard sich an Jett herangemacht, der sich in seiner Begeisterung bereitfand, ihm ein Interview zu geben. Dieses Interview war für Richard zum Sprungbrett in die Musikszene geworden. Seither waren sie Freunde.
In diese Erinnerungen hinein verkündete Richard: »Jetzt möchte er seine Autobiographie schreiben lassen.«
»Meinst du nicht Biographie?« Ich weiß, ich bin in diesen Dingen zu pingelig.
»Nein, das Buch soll in der ersten Person geschrieben werden, und deshalb braucht er einen Ghostwriter. Bei dem Dinner damals hat er mich darauf angesprochen, und ich habe natürlich sofort mein Interesse angemeldet. Ein Megaseller wie bei Jagger oder Bowie wird’s nicht werden, aber es könnte dennoch ganz schön was einbringen. Und als er mich dann für heute Abend einlud und unbedingt wollte, dass du mitkommst, bin ich natürlich hellhörig geworden.«
Er tat sehr beiläufig, aber ich merkte, dass er fast platzte vor Stolz und Aufregung. Ich zog seinen Kopf zu mir herunter und gab ihm einen Kuss auf seine warmen Lippen. »Toll!« Ich freute mich ehrlich für ihn. »Wirst du viel Arbeit damit haben?«
»Glaub ich nicht. Ich lass ihn einfach auf Band sprechen und bring die Story dann hinterher in Form. Und da er in den kommenden drei Monaten sowieso zu Hause bleiben und an seinem neuen Album arbeiten will, ist er immer greifbar.«
In diesem Moment hielt das Taxi vor der Schnörkelfassade des Holiday Inn Midland Crowne Plaza, einem der letzten Denkmäler der industriellen Revolution, die an Manchesters erste Wohlstandsphase erinnern. Ich kenne es noch aus der Zeit, in der es schlicht und einfach das Midland hieß und ein großes, ungemütliches Eisenbahnhotel war, Andenken an eine Epoche, in der die Reichen noch kein schlechtes Gewissen hatten und die Armen draußen blieben. Dann war der Dinosaurier von der Holiday-Inn-Kette aufgekauft und zu einer Spielwiese der neuen Geldbringer von Manchester geworden, der Sportler, Geschäftsleute und Musiker, durch die Ende der achtziger Jahre die Stadt wieder aufblühte.
In den Neunzigern war London plötzlich nicht mehr angesagt. Wer sich nur in einer Szene wohl fühlte, wo der Bär steppt und die Post abgeht, musste sich jetzt in den sogenannten Provinzstädten umsehen. Manchester stand für Rockmusik, Glasgow für Kultur, Newcastle für Shopping. Durch diese Schwerpunktverschiebung war auch Richard vor zwei Jahren in Manchester gelandet. Eigentlich hatte er nur ein Interview mit dem Kulthelden Morrissey machen wollen, aber nach zwei Tagen war er überzeugt davon, dass Manchester für die neunziger Jahre das werden würde, was Liverpool für die Sechziger gewesen war. In London hielt ihn nichts, die Scheidung war gerade ausgesprochen worden, und als freiberuflicher Journalist sitzt man da am besten, wo die interessantesten Storys sind. Und deshalb war er, wie so viele andere, hier hängengeblieben.
Was Richard mir erzählt hatte, war wie ein Adrenalinstoß für mich. Jetzt war ich richtig in Partystimmung. Bis Jett und sein Gefolge kamen, gingen wir an die Bar.
Ich genoss meinen Wodka-Grapefruit. Als ich ins Schnüfflergeschäft eingestiegen war, hatte ich es mit Whisky versucht. Ich wusste schließlich, was man diesem Image schuldig ist. Nach zwei Gläsern musste ich den Geschmack mit meinem gewohnten Drink runterspülen. Ich bin wohl nicht der Typ für die »Flasche Whisky und ein neues Bündel Lügen«, um mit Mark Knopfler zu sprechen. Mit halbem Ohr hörte ich zu, wie Richard seine Vorstellungen von Jetts Autobiographie entwickelte. »Die klassische Geschichte: vom Tellerwäscher zum Millionär. Eine miese Kindheit in den Slums von Manchester, ein langer Kampf, bis er die Musik machen konnte, die er in sich spürte. Die Anfänge im Gospelchor der Baptistengemeinde, in den seine strenge Mutter ihn förmlich prügeln musste. Seine erste Chance. Und dann die Wahrheit über das Zerbrechen der Partnerschaft mit Moira, seiner Texterin. Tolle Möglichkeiten«, schwärmte er. »Lässt sich vielleicht sogar als Serie an eine große Sonntagszeitung verkaufen. Das wird ein großer Abend für uns, Kate.«
Nach zwanzig Minuten gelang es mir, seinen Redestrom zu stoppen. Es wurde langsam Zeit, dass wir uns auf der Party sehen ließen. Sobald wir aus dem Aufzug kamen, wies uns lautes Stimmengewirr den Weg zu Jetts Suite und überdeckte den Schmuse-Sound seines letzten Albums, das irgendwo vom Band lief. Ich drückte Richard die Hand. »Ich bin stolz auf dich«, sagte ich leise, und dann stürzten wir uns ins Getümmel.
Ganz hinten hielt Jett Hof. Er sah so frisch aus, als käme er eben aus der Dusche. Die Frau an seiner Seite war eine typische Fiona: blondgelockte Löwenmähne, blaue Augen, perfektes Make-up, hautenges Glitzerkleid, wahrscheinlich von Bill Blass.
»Komm mit zu Jett«, sagte Richard aufgekratzt. Als wir an dem Tisch vorbeigingen, auf dem die Getränke standen, legte sich plötzlich eine Hand auf Richards Schulter.
»Barclay!«, dröhnte eine tiefe Stimme. »Was zum Teufel machen Sie denn hier?« Der Sprecher entpuppte sich als ein mittelgroßer Typ mit mittelprächtiger Figur und leichtem Bauchansatz.
Richard machte ein dummes Gesicht. »Neil Webster!«, sagte er ohne besondere Begeisterung. »Dasselbe könnte ich Sie fragen. Immerhin bin ich Rockjournalist und kein rasender Reporter. Was führt Sie nach Manchester? Waren Sie nicht in Spanien?«
»Ist mir da unten ein bisschen zu heiß geworden, haha.« Neil Webster grinste. »Und weil hier offenbar inzwischen enorm viel läuft, hab ich mich eben mal wieder im guten alten Manchester umgetan.«
Ich betrachtete das neueste Exemplar für meine Sammlung »Journalisten aus aller Welt«. Neil Webster hatte diesen leicht verruchten Touch, den viele Frauen – ich bin da wohl eine Ausnahme – unwiderstehlich finden. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig, allerdings schien das Journalistenleben seinen Alterungsprozess stark beschleunigt zu haben, was man Richard, diesem ewigen Jungen, wahrhaftig nicht nachsagen kann. Neils braunes Haar, an den Schläfen mit einem interessanten Silberschimmer, wirkte etwas zerwühlt, die helle Baumwollhose und das Chambray-Hemd hatten Knitterfalten. Die braunen Augen waren verhangen, um die Augen waren Lachfältchen weiß in die braune Haut gekerbt. Über dem üppigen graumelierten Schnauzer bog sich eine Adlernase, die Kinnlinie zeigte erste Anzeichen von Erschlaffung.
Ich merkte, dass er mich seinerseits gründlich musterte. »Und wer ist diese bezaubernde Frau? Entschuldigen Sie, meine Liebe, dieser Rüpel, mit dem Sie da gekommen sind, scheint seine Kinderstube vergessen zu haben. Ich bin Neil Webster, ein echter Journalist – im Gegensatz zu Richard mit seinen Schmalspurstorys. Und Sie …?«
»Kate Brannigan.« Ich schüttelte ziemlich lustlos die Hand, die sich mir entgegenstreckte.
»Was trinken Sie, Kate?«
Ich ließ mir einen Wodka-Grapefruit mixen, Richard angelte sich an ihm vorbei eine Dose Schlitz und sagte: »Jetzt haben Sie uns immer noch nicht verraten, was Sie hier machen, Neil.« Ich schnappte nach Luft. Nicht nur, weil Neil Webster es mit dem Wodka etwas zu gut gemeint hatte, sondern weil ich von seiner Antwort so geplättet war. »Ach so, ja … Die Sache ist die: Ich habe den Auftrag, Jetts offizielle Biographie zu schreiben.«
3. Kapitel
Richard wurde erst dunkelrot und dann kalkweiß. Es war ein schlimmer Schlag für ihn. Ich konnte ihm die bittere Enttäuschung nachfühlen. »Soll das ein Witz sein?«, fragte Richard kalt.
Neil lachte. »Da staunen Sie, was? Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass sie sich dafür einen Spezialisten suchen. Einen wie Sie«, setzte er genüsslich hinzu. »Aber Kevin wollte unbedingt mich haben. Was sollte ich machen? Kevin und ich sind alte Kumpel. Wer seit zehn, zwölf Jahren einen Topstar wie Jett managt, wird wohl wissen, was gut für ihn ist.«
Richard drehte sich wortlos um und versuchte, die dichter werdende Menge zu durchbrechen, die sich vor der Bar drängte. Ich wollte ihm folgen, aber Neil versperrte mir den Weg. »Warum ist er denn so sauer? Na, egal, geben Sie ihm ruhig ein bisschen Zeit, sich abzuregen, und erzählen Sie mir was über sich.«
Ich ließ ihn stehen und ging zu Jett hinüber. Dort hörte ich gerade noch Richard zornig sagen: »Du hattest es mir so gut wie versprochen. Der Typ ist doch eine Flasche. Was hast du dir bloß dabei gedacht?«
Die bewundernde Menge, die Jett mit Glückwünschen überhäufte und versuchte, den Saum seines Gewandes zu erhaschen, war bei Richards Attacke zurückgewichen. Drohend hatte er sich vor Jett aufgebaut. Seine Fiona genoss die Szene sichtlich.
Jett selbst machte ein unglückliches Gesicht. Seine sanfte Stimme klang angestrengt. »Komm, Richard, reg dich nicht so auf. Ich wollte, dass du das Buch schreibst. Ehrlich. Aber dann hat Kevin diesen Typ angeschleppt und behauptet, dass er der beste Mann für den Job ist. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Kevin hat den Vertrag schon abgeschlossen. Wenn ich mich querlege, kostet uns das eine Menge Geld.«
Richard hatte stumm und mit unbewegtem Gesicht zugehört. Ich hatte ihn noch nie so wütend erlebt, nicht mal, als seine Ex-Frau ihm Ärger wegen des Sorgerechts für Davy gemacht hatte. Vorsichtshalber hielt ich seinen rechten Arm fest. Ich kenne seine Frustreaktionen. Die Gipskartonwand seiner Diele ist schon voller Löcher.
Richard stand da und sah Jett lange an. Dann sagte er erbittert: »Und ich habe gedacht, du bist ein Mann.« Er schüttelte meine Hand ab und ging zur Tür. Es war unheimlich still geworden, alle Gäste hatten der Auseinandersetzung gelauscht. Auch nach Richards Abgang dauerte es eine Weile, bis sich der Geräuschpegel wieder normalisierte.
Natürlich wäre ich am liebsten Richard nachgelaufen, um ihn zu trösten, obwohl ich wusste, dass das im Augenblick ziemlich sinnlos war. Zunächst aber musste ich wissen, welche Rolle mir in diesem Spiel zugedacht war. Ich wandte mich an Jett. »Es war eine furchtbare Enttäuschung für ihn. Er hat gedacht, du hättest mich eingeladen, um den Buchvertrag mit uns zu feiern.«
Zu Jetts Gunsten muss ich sagen, dass er sehr verlegen dreinschaute. »Es tut mir wahnsinnig leid, Kate, ehrlich. Ich wollte es Richard selbst sagen, damit er es nicht von anderen erfährt. Er hätte bestimmt ein gutes Buch geschrieben, aber mir sind die Hände gebunden. Du glaubst ja gar nicht, wie wenig Einfluss man in meiner Situation hat …«
»Und was wolltest du heute Abend von mir?«, fragte ich. »Dass ich bei Richard Händchen halte, damit er nicht ausflippt?«
Jett schüttelte den Kopf. »Hol dir doch noch einen Drink, Tamar«, sagte er zu seiner Fiona.
Die Blondine lächelte mir katzenfreundlich zu und glitt von der Couch. Sobald niemand in Hörweite war, sagte Jett: »Ich habe einen Auftrag für dich. Die Sache ist mir sehr wichtig, ich brauche dafür eine Vertrauensperson. Richard hat mir viel von dir erzählt, und ich glaube, du bist die Richtige. Mehr kann ich heute Abend nicht sagen. Komm morgen zu mir, dann können wir alles besprechen.«
»Soll das ein Witz sein?«, fuhr ich auf. »Nachdem du Richard derart gedemütigt hast …«
»Ich habe dich eigentlich so eingeschätzt, dass du Geschäft und Privatleben auseinanderhalten kannst.«
Die seidenweiche Stimme konnte einem ganz schön unter die Haut gehen. Jeder Mensch braucht seine Schmeicheleinheiten. Ich bin da leider keine Ausnahme. »Unsere Firma übernimmt aber nicht alles«, wandte ich zögernd ein.
Rasch, scheinbar beiläufig, sah er sich um, dann sagte er leise: »Ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Kein Wort zu Richard, verstanden?«
»Selbstverständlich. Für Mortensen & Brannigan hat die Vertraulichkeit dem Kunden gegenüber stets Vorrang.« Ich merkte selbst, wie gestelzt das klang.
Er strahlte mich an. »Dann erwarte ich dich also morgen um drei«, sagte er und kam offenbar gar nicht auf den Gedanken, dass ich widersprechen könnte.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, Jett … Vermisstenfälle machen wir normalerweise nicht.«
»Auch nicht für einen Freund?«
»Wenn ich an den Gefallen denke, den du Richard vorhin getan hast …«
Das hatte gesessen. »Ich weiß, dass ich mich nicht richtig verhalten habe, Kate. Ich hätte Richard keine Hoffnungen machen dürfen, ohne die Sache mit Kevin zu besprechen. Es ist nun mal so, dass er über alle meine Verträge entscheidet. Geschäftlich ist er der Boss. Aber hier geht’s um eine Privatsache, die mir sehr wichtig ist. Hör dir doch wenigstens an, was ich zu sagen habe. Bitte«, fügte er hinzu. Ich hatte den Eindruck, dass er dieses Wort lange nicht mehr benutzt hatte.
Ich nickte zögernd. »Okay. Um drei. Falls ich es nicht schaffe, rufe ich an, dann müssen wir einen anderen Termin ausmachen. Aber versprechen kann ich nichts.«
Er sah aus, als wäre ihm ein ganzer Haufen Steine vom Herzen gefallen. »Ich bin dir wirklich dankbar, Kate. Und versuch Richard zu erklären, wie das alles gekommen ist, ja? Sag ihm, dass es mir leidtut. Ich kann es mir nicht leisten, den besten Freund zu verlieren, den ich bei der Presse habe.«
Ich nickte und wandte mich zum Gehen. Als ich mich durch die Menge bis zur Tür durchgedrängelt hatte, war Jett mit seinen Problemen schon zweitrangig geworden. Wichtig war jetzt, Richard durch diese Nacht zu helfen.
Als am nächsten Morgen der Wecker piepste, rührte Richard sich nicht. Ich stand leise auf. Wenn er sich ähnlich fühlte wie ich, brauchte er mindestens noch sechs Stunden Schlaf. In der Küche machte ich mir meinen bewährten Muntermacher: Paracetamol, Vitamin B und C, zwei Zinktabletten, Orangensaft und Proteine. Wenn ich Glück hatte, fühlte ich mich wieder einigermaßen menschlich, bis ich vor Billy Smarts Haus angekommen war.
Ich duschte, zog mich an und griff mir auf dem Weg zur Haustür noch eine Flasche Mineralwasser. Armer Richard, dachte ich, während ich mich ans Steuer setzte. Am vergangenen Abend hatte ich ihn im Foyer eingesammelt, wo er ungeduldig herumstand und auf ein Taxi wartete. Auf der Heimfahrt hatte er sich in düsteres Schweigen gehüllt, aber nachdem er einen Viertelliter Southern Comfort und Soda intus hatte, legte er los. Ich hatte, weil mir nichts Besseres einfiel, zur Gesellschaft mitgetrunken. Jett hatte ihn schäbig behandelt, da gab es nichts zu beschönigen, und deshalb schlug mir wegen meiner Verabredung mit dem Rockstar auch heftig das Gewissen. Zum Glück war Richard so mit seiner eigenen Enttäuschung beschäftigt, dass er nicht fragte, was ich nach seinem stürmischen Abgang noch so lange auf Jetts Party gemacht hatte.
Ich fuhr durch die noch menschenleeren Straßen und legte mich wie immer ein paar Türen vor Billys Haus auf die Lauer. Dass die Leute so selten merken, wenn sie beobachtet werden, überrascht mich immer wieder. Allerdings erwartet wohl auch niemand einen Vauxhall Nova als Observierungsfahrzeug. Das 1,4-SR-Modell, das ich fahre, sieht total harmlos aus – eben einer dieser Kleinwagen, wie die Männer sie ihren Ehefrauen als rollende Einkaufstasche schenken. Aber wenn ich Gas gebe, geht er ab wie die Feuerwehr. Ich hatte Billy Smart immer im Blick, wenn er in einer bestimmten Garage alle drei Tage seine Leihwagen austauschte, ich war hinter ihm, wenn er im Mercedes oder BMW quer durchs Land gondelte, und bin nach wie vor davon überzeugt, dass er keine Ahnung davon hatte. Dabei habe ich nur ein Problem. Ein typisch weibliches. Männer sind gut dran, die können zum Pinkeln eine Flasche nehmen.
Zum Glück ließ mich Billy heute nicht lange warten. Ich blieb ungeduldig stehen, bis er einmal um den Block gefahren war, weil er sehen wollte, ob er verfolgt wurde, und setzte mich in einigem Abstand auf seine Spur. Dann passierte dasselbe wie am vergangenen Mittwoch: Er holte Bruder Gary ab, der in einem Hochhausblock über dem Arndale-Einkaufszentrum wohnte, und sie fuhren zusammen zu der kleinen Hinterhoffabrik in dem schäbigen Bezirk, der von dem hohen backsteinroten Wasserturm der Strafanstalt Strangeways beherrscht wird. Nach einer halben Stunde kamen sie mit mehreren sperrigen schwarzen Cordsamtbündeln wieder heraus, in denen, wie ich wusste, Hunderte gefälschter Uhren steckten.
Ich musste mich dicht hinter dem Leih-Mercedes halten, während wir uns durch den dichter werdenden Verkehr schlängelten, aber inzwischen kannte ich ja meine Pappenheimer. Wieder fuhren sie über die M 62 in Richtung Leeds und Bradford. Ich folgte ihnen noch bis zu ihrer ersten Anlaufstelle, einer Einzelgarage in Bradford, dann machte ich Schluss. Es war immer wieder der gleiche Trott, und die nötigen Fotos hatte ich schon im Kasten. Zeit für ein Gespräch mit Bill. Auch über Jetts Auftrag wollte ich mich mit ihm beraten.
Gegen Mittag war ich im Büro. Wir haben drei kleine Räume im sechsten Stock eines Bürogebäudes, das einer Versicherung gehört, nur ein paar Schritte von den BBC