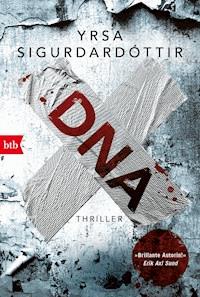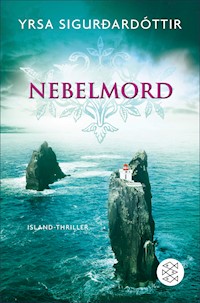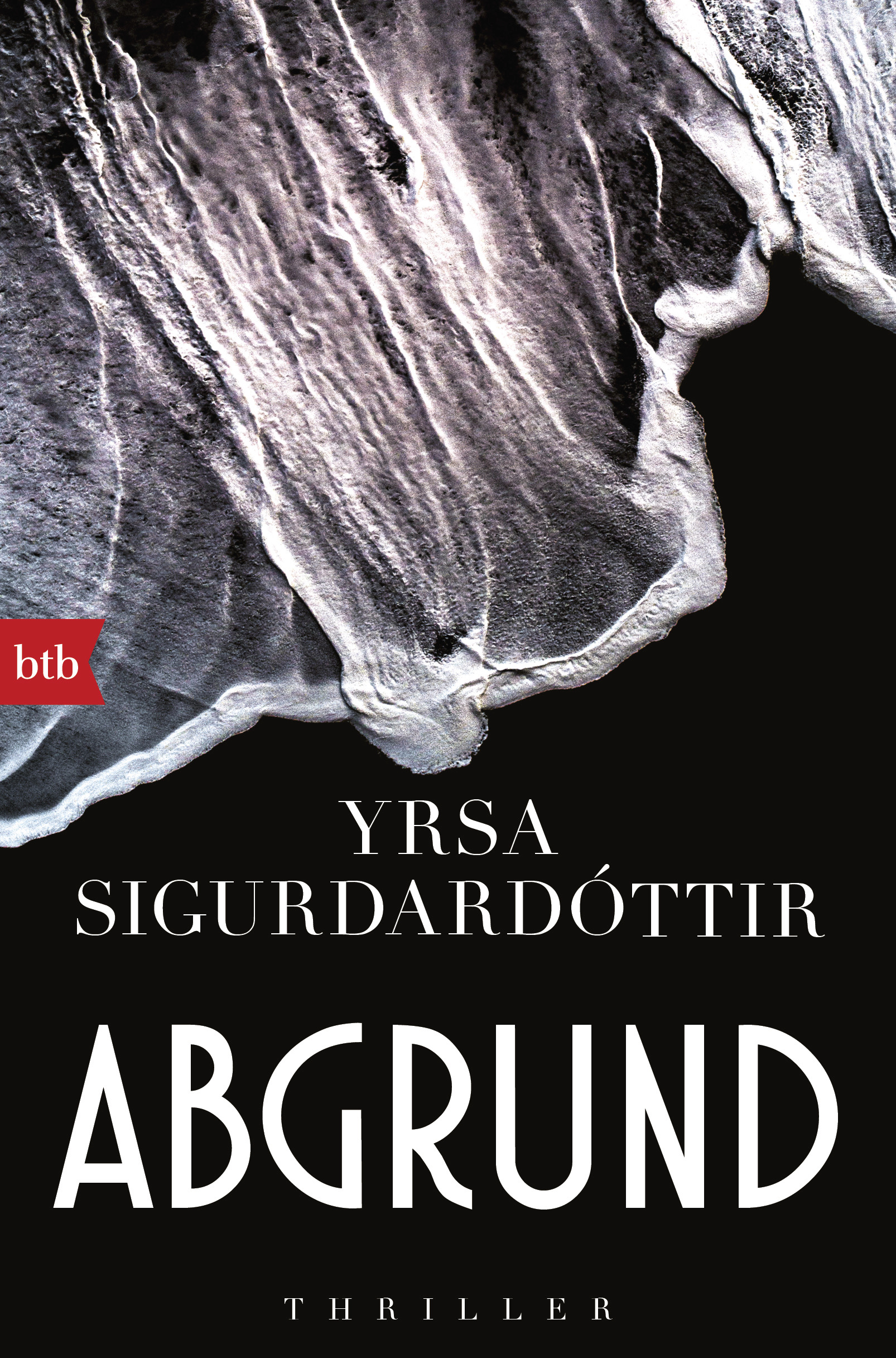
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Huldar und Psychologin Freyja
- Sprache: Deutsch
Ein Toter im Lavafeld. Eine verschwundene Mutter. Abgrundtiefe Grausamkeit – Der neue Thriller von Bestsellerautorin Yrsa Sigurdardóttir!
Ein Toter, erhängt auf einer alten Hinrichtungsstätte in einem Lavafeld nahe des Präsidentensitzes. Eine ominöse Nachricht, mit einem Nagel in dessen Brust gerammt. Ein kleiner Junge, den man schließlich in der Wohnung des Toten findet. Schwer traumatisiert. Ohne jegliche Erinnerung.
Band 4 der Erfolgsreihe: Kommissar Huldar und Psychologin Freyja auf der Spur eines schwer zu fassenden Verbrechens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Ein Toter im Lavafeld. Eine verschwundene Mutter. Abgrundtiefe Grausamkeit. Ein Toter, erhängt auf einer alten Hinrichtungsstätte in einem Lavafeld nahe des Präsidentensitzes. Eine verschwundene Nachricht, mit einem Nagel in dessen Brust gerammt. Ein unbekannter Junge in der Wohnung des Toten, von den Eltern keine Spur … Kommissar Huldar und Psychologin Freyja ermitteln, um die Eltern des Jungen lebend zu finden. Hoffentlich rechtzeitig, denn seine Mutter ist im Begriff, ein Kind zur Welt zu bringen …
Zur Autorin
Yrsa Sigurdardóttir, geboren 1963, ist eine vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin, deren Thriller in über 30 Ländern erscheinen. Sie zählt zu den »besten Kriminalautorinnen der Welt« (Times). Sigurdardóttir lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Reykjavík. Sie debütierte 2005 mit »Das letzte Ritual«, der Erfolgsserie von Thrillern um die junge Rechtsanwältin Dóra Gudmundsdóttir. »Abgrund« ist nach den SPIEGEL-Bestsellern »DNA«, »SOG« und »R.I.P.« der vierte Teil der Thriller-Serie um Kommissar Huldar und Kinderpsychologin Freyja.
Yrsa Sigurdardóttir
Abgrund
Thriller
Aus dem Isländischen von Tina Flecken
Die isländische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Gatið« im Verlag Veröld, Reykjavík.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage Copyright der Originalausgabe © 2017 by Yrsa Sigurdardóttir Published by agreement with Salomonsson Agency Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by btb Verlag, Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © Michael Schauer/Getty Images Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-641-24969-4V001www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag
Dieses Buch ist Fiktion. Personen und Handlung sind von der Autorin frei erfunden.
Dieses Buch ist den Traplord$ gewidmet. Yrsa
1. KAPITEL
Da war ein knirschendes Geräusch, wie von Reifen auf einer Schotterstraße. Dann ein plötzliches Rucken, als der Wagen zum Halten kam, und Helgi wurde über die Rückbank geschleudert, seine Wange schrammte über das stinkende, raue Polster. Das konnte nicht sein Auto sein. Er öffnete ein Auge und registrierte, dass es dunkel war. Dann schaltete der Fahrer die Deckenleuchte ein, und Helgi sah die Unordnung auf dem Boden: zerdrückte Getränkedosen, eine zusammengeknüllte Chipstüte, schmutzige Servietten, zwei zerbrochene Zigaretten und eine Hot-Dog-Verpackung. Taxis waren heutzutage wirklich furchtbar dreckig. Oder war das gar kein Taxi? Hatte er eine Mitfahrgelegenheit genommen? War er in der Innenstadt in irgendein Auto gestiegen? Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass er im Suff genau das Gegenteil von dem tat, was er nüchtern tun würde.
Helgi konnte nicht weiter nachdenken. Er bekam heftige Kopfschmerzen, und sein Magen krampfte sich zusammen. Wenn er sich aufgesetzt hätte, wäre ihm die Galle hochgekommen und er hätte auf den Sitz gekotzt. Dem Geruch nach zu urteilen, war das in diesem fremden Auto schon öfter passiert. Womit hatte er sich abgefüllt? Normalerweise rührte er widerliches Gesöff, das solche Folgen hatte, nicht an. Aber es lag am Alkohol, keine Frage. Dieses apathische Gefühl und die Unfähigkeit, die eigene Situation zu begreifen, kannte er nur zu gut. Das war ihm seit Jahren nicht mehr passiert.
Als der Schwall kam, schaffte Helgi es auf wundersame Weise, den Kopf bis zum Sitzrand vorzuschieben, sodass sein saurer Mageninhalt auf dem Boden landete. Nach dieser Beigabe war der Müllhaufen noch ekelhafter, und Helgi schloss die Augen. Vom Vordersitz hörte er jemanden aufstöhnen und laut fluchen. Auch wenn er nicht klar denken konnte, begriff er, warum. Niemand wollte sich das Auto vollkotzen lassen.
Dann hörte das Fluchen auf, die Fahrertür öffnete sich mit einem metallischen Quietschen und knallte wieder zu. Erneut knirschte der Schotter, diesmal leiser als vorhin. Als die Tür neben Helgis Kopf aufging, wehte ihm frische, kühle Luft um die Nase. Die Übelkeit ließ nach, und auch die Kopfschmerzen wurden weniger. Ein wundervolles Gefühl. Doch es währte nicht lange. Jemand packte ihn fest an der Schulter und schüttelte ihn rüde. Helgi wollte rufen, so lasse er nicht mit sich umgehen, bekam aber kein Wort heraus, als wären die Nerven zwischen seinem Sprachzentrum und seiner Zunge gekappt. Seine Gedanken wurden immer wirrer und verstrickten sich zu einem einzigen großen Knoten.
Eine barsche Stimme befahl ihm auszusteigen. Bestimmt wollte der Fahrer ihn wegen der Kotzerei loswerden. Zu seiner eigenen Verwunderung gehorchte er. Er wollte eigentlich gar nicht aufstehen, aber seine Gliedmaßen und Muskeln bewegten sich mechanisch, und nach einem kollektiven Kraftakt stand er neben dem Wagen. Er atmete tief ein – die frische Luft war hier draußen noch besser als durch die geöffnete Autotür. Es war Vollmond bei klarem Himmel und in der frostigen Nacht völlig windstill. Das Leben war schön. Helgi legte den Kopf in den Nacken und wollte den Sternenhimmel bewundern, verlor dabei das Gleichgewicht und schwankte. Dieselbe Hand, die ihn geschüttelt hatte, stützte ihn jetzt, wenn er nach vorne oder hinten zu kippen drohte. Helgi wusste diese Hilfe zu schätzen, denn der Schotter, den er verwirrt anstarrte, war grob, und es würde bestimmt wehtun, hinzufallen.
Als er einigermaßen aufrecht stehen konnte, wurde er angestoßen und sollte losgehen. Wieder gehorchte Helgis Körper, obwohl er sich nicht bewegen wollte. Er war überrascht, dass der Mann nicht über das Erbrochene schimpfte. Das Ganze war höchst merkwürdig, aber er konnte sich einfach nicht genug konzentrieren, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ob er sich in einem dieser Träume befand, bei denen man im selben Moment aufwacht, wenn man gerade in einen Abgrund stürzt? Die Welt der Träume war voll von so was.
Der grobe Schotter unter seinen Füßen wurde von einem Schafpfad abgelöst, der durch scharfkantige, bewachsene Lava führte. Helgi starrte auf den Boden, in Gedanken noch immer bei dem grauenerregenden Abgrund. Er konnte sich kaum auf dem schmalen Pfad halten, so wackelig war er auf den Beinen. Der Mann hatte ihn vorgeschickt und folgte ihm dicht auf den Fersen. Jedes Mal, wenn Helgi Anstalten machte, auf das Lavafeld hinauszutappen oder stehen zu bleiben, um sich auszubalancieren, wurde er wieder angeschubst. Helgi wollte diesem Mann sagen, dass er das nicht absichtlich machte, aber er durfte nicht sprechen.
Der Weg führte eine Zeit lang bergauf und dann wieder bergab, durch grüne Mulden, von Lavawänden eingerahmt, im Sommer perfekte Picknickplätze, doch jetzt unheimlich und trostlos. Helgi hatte das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein, und schaute sich verstohlen um. Er sah, dass das Lavafeld nicht weit von ihnen ans Meer grenzte; im Dunkel der Nacht war es schwarz und schimmerte nur leicht im Mondschein. Die Küstenlinie weckte eine Erinnerung an seine Kindheit, als er mit seinem Großvater zu einem Strand hinuntergewandert war, der diesem ähnelte. Vielleicht war es sogar derselbe. Sie hatten zwei Eiderenten aufgescheucht, und der Großvater war zu der Stelle gegangen, an der die Vögel gesessen hatten, und hatte ein Nest entdeckt. Zwei große bläuliche Eier auf bräunlichen Daunen. Helgi hatte die Daunen vorsichtig berührt, und sie fühlten sich eher an wie ein leichter Lufthauch als etwas Greifbares. Dann wies der Großvater ihn auf die Möwen hin, die sie in einem großen Ring umkreisten. Sie waren noch zu weit entfernt, um eine Bedrohung darzustellen, kamen aber immer näher. Als der Großvater ihm erklärte, warum die Vögel sich so verhielten, hätte Helgi sie am liebsten mit Steinen beworfen.
Es war eine schreckliche Pattsituation, und er war leider Gottes gerade alt genug, um sie zu verstehen. Wenn sie dort stehen blieben, kämen die Möwen nicht an die Eier, aber die Eiderenten auch nicht. Die Eier würden auskühlen und die Küken sterben. Wenn sie weitergingen, konnten die Eiderenten zurückkehren, aber das Nest wäre zu lange ungeschützt und würde trotzdem von den Möwen geplündert. Am Ende ließ sich Helgi von seinem Großvater überreden, weiterzugehen, und bewegte sich vorsichtig rückwärts, in der Hoffnung, dass die Eiderenten schnell angeflogen kämen, um ihre Eier zu retten. Doch sie waren nirgends zu sehen, bis sie die Stelle aus den Augen verloren hatten. Helgi erfuhr nie, was aus den Eiern geworden war.
Aber jetzt war Winter, und an keiner Küste gab es Nester mit Eiern. Oder Daunen. Sie waren alle eingesammelt, gereinigt, in Bettdecken gestopft und an reiche Ausländer verkauft worden. Erst als Helgi brutal geschubst wurde, merkte er, dass er stehen geblieben war, um übers Meer zu schauen. Er trottete weiter über den sich schlängelnden, bergauf führenden Pfad und erhielt kurz darauf den Befehl, anzuhalten, was er auch tat. Wie unterwürfig er auf einmal war.
Als er den Kopf hob, erblickte er zwei hohe schwarze Felsen, die aussahen wie eine Kulisse aus Herr der Ringe. Zwischen den beiden Lavakegeln lag ein dickes, stabiles Brett, wie eine Brücke. Hatte sein Traum ihn nach Mordor geführt? Bevor sein begrenztes Gehirn eine Antwort finden konnte, wurde er erneut angestoßen, jetzt auf einen der Felsen zu. Er war mit verdorrtem Gras aus dem vergangenen Sommer bewachsen, sodass man hinaufkraxeln konnte, und Helgi machte es wie befohlen. Er blieb auch auf Befehl stehen und erklomm einen Felsvorsprung, der ein Stück in die enge Schlucht zwischen den Felsen hineinragte, bevor man den Gipfel erreichte. Dort stand er und betrachtete das schöne Meer, das ruhig vor ihm lag und ganz unschuldig wirkte. Die perfekte Illusion.
Helgi kam auf seinen unsicheren Beinen ins Schwanken und begriff, dass er am Ende runterfallen würde. Doch aus irgendeinem Grund machte ihm das keine Angst. Es war ja nicht so furchtbar hoch, und außerdem war das ein Traum oder etwa nicht? Die Abgründe in seinen Träumen waren bodenlos. Da konnte man nicht auf eine vertrocknete Wiese mit ein paar Lavazacken hinunterschauen, so wie hier.
Helgi wurde umgedreht, sodass er seinem Begleiter nun gegenüberstand. Er blickte ihm ins Gesicht, konnte aber nicht viel erkennen, weil der Mann sich einen Schal um die untere Gesichtshälfte gebunden hatte. Nur seine Augen waren zu sehen, die Helgi so hasserfüllt anstarrten, dass er schnell den Blick senkte. Er bemerkte ein Werkzeug in der rechten Hand des Mannes, das teilweise schwarz, teils heller war, möglicherweise gelb. Die linke Hand griff nach Helgis Mantel und zog ihn zu sich. Dann knöpfte der Mann den obersten Knopf auf, zog ein weißes beschriftetes Blatt Papier aus der Tasche und hielt es an Helgis Brust. Helgi schaute an sich hinunter und versuchte, die paar Zeilen auf dem Blatt zu lesen, aber die Buchstaben standen auf dem Kopf. Der Mond war so hell, dass er sie vielleicht hätte entziffern können, wenn er nicht so benommen gewesen wäre. Doch bei seinen Bemühungen, den Text zu lesen, lichtete sich urplötzlich der Nebel in seinem Kopf. Er erinnerte sich an ein Papier, das er hatte unterschreiben müssen. Aber auf dem hatte mehr Text gestanden … Er hatte ihn gut lesen können und wusste noch, dass der Inhalt bedeutungsschwer gewesen war. Aber im positiven oder negativen Sinne? Der Nebel verdichtete sich wieder, und er konnte sich nicht mehr erinnern.
Das Werkzeug erschien vor seinen Augen und wurde an das Blatt auf seiner Brust gehalten. Helgi runzelte die Stirn und wartete ab, was passieren würde. Er verspürte keine Angst, nur Neugier. Er besaß keine Werkzeuge, und auch wenn er ein paar kannte, war ihm dieses Gerät fremd. Wozu sollte es gut sein?
Helgi sah, wie sich die Finger um den Schaft zusammenzogen, und ein lauter Knall hallte in der stillen Landschaft. Darauf folgte ein stechender Schmerz im Rippenbogen, und ihm blieb die Luft weg. Fast wäre er hintenübergekippt und von dem Felsvorsprung gestürzt, doch der Mann hielt ihn fest. Trotz dieser abscheulichen Tat fühlte sich Helgi erleichtert. Der Mann wollte ihm bestimmt nichts Böses, wenn er ihn vor dem Fall rettete. Zumindest nichts wirklich Böses.
Der Mann stülpte ihm etwas über den Kopf, und er sah ein dickes Seil auf seiner schmerzenden Brust liegen wie eine klobige Halskette. Vermutlich würde sich sein Begleiter nun um die Sicherheitsaspekte bei dieser seltsamen Wanderung kümmern. Wenn er an dem Felsen festgebunden war, würde er nicht stürzen. Doch dann zog sich der Strick um seinen Hals zu. Helgi wollte anmerken, dass man ihm das Seil vielleicht besser um die Taille binden sollte, brachte aber wieder kein Wort heraus. Wegen der Schmerzen in der Brust konnte er nicht richtig atmen. Er konnte nichts sagen.
Aber das machte nichts. Es war ja ein Traum. So musste es sein. Wenn er fiel, würde er fliegen. Bald würde er aufwachen, und dann verschwänden der Schmerz und diese unwirkliche Stimmung, die der Nebel in seinem Kopf verursachte.
Während Helgi den Anweisungen seines Begleiters lauschte, der irgendwo hinter ihm stand, starrte er aufs Meer, das sich jetzt leicht kräuselte. Jenseits der Bucht sah er ein bekanntes weißes Haus mit rotem Dach. Bessastaðir. Das war definitiv ein Traum. Sein träges Hirn dachte an ein Ereignis, das mit genau diesem Strand verbunden war. Er verdrängte den Gedanken, um sich nicht wieder übergeben zu müssen, und wandte sich dem Jetzt zu, der wunderschönen Umgebung und seinem fluchenden Begleiter.
Helgi bekam die Flüche und die Abscheu des Mannes nur halb mit. Die Aussicht war so magisch, dass selbst der Schmerz in seiner Brust nachzulassen schien, wenn er sich auf sie konzentrierte. Er ließ den Blick zum Präsidentensitz schweifen und betrachtete die Bucht. Die hypnotisierenden Wellen auf der schwarzen Wasseroberfläche fesselten ihn total. Ganz hinten am Horizont hing eine schwarze Wolkenbank, die mit dem Himmel darum wetteiferte, wer düsterer war. Helgi spürte, dass er ohnmächtig wurde. Was seltsam war, da er sich doch im Tiefschlaf befand.
Wieder wurde Helgi durch einen Stoß aufgeschreckt. Diesmal ins Kreuz, und zwar zum letzten Mal. Er stürzte von dem Felsvorsprung, schwebte für einen Sekundenbruchteil, bis ihn das Seil brutal zurückriss und seinen Fall stoppte. Am Ende hatte er doch nicht fliegen können. Aber das war ja auch kein Traum.
2. KAPITEL
Die Leiche schaukelte im Wind, drehte sich gemächlich im Halbkreis und wieder zurück. Huldar schaute weg, als das bläuliche Gesicht das nächste Mal auftauchte, mit schwarzer heraushängender Zunge, ein unschöner Anblick. Der Kopf hing dem Mann auf die Brust, als würde er verwundert auf seine Füße schauen, weil er einen Schuh verloren hatte. Der Schuh lag im Auto der Spurensicherung, eingeschweißt in eine Plastiktüte. Zwar rechnete niemand damit, dass er Licht auf diesen traurigen Selbstmord werfen würde, trotzdem befolgte man das übliche Prozedere der Beweissicherung am Tatort. Wobei die Sicherung des Schuhs diesmal fast das Einzige war, was nach Plan verlief.
Huldar ließ den Blick über das zerklüftete Gebiet von Gálgahraun schweifen. Der Lavastrom war vor Tausenden von Jahren geflossen, lange bevor irgendein Mensch Island betreten hatte, als der arktische Fuchs das Land noch uneingeschränkt beherrschte. Vor einigen Jahren hatte Huldar an einer Polizeiübung in der Gegend teilgenommen, bei der sie einen kurzen Einblick in die Geschichte des Lavafelds bekommen hatten. Die raue, ungleichmäßige Landschaft war entstanden, als sich ein glühender Lavastrom über ein sumpfiges Gebiet in Küstennähe ergossen hatte. Dabei begann der Sumpf zu kochen, und die halb erkalteten Lavadecken explodierten. Spalten, Krater, spitze Hügel und endlose durcheinandergewürfelte Lavabrocken und Höcker, so weit das Auge reichte. Selbst der Teppich aus Moos, der im Lauf der Jahrhunderte auf dem Lavafeld gewachsen war, konnte dessen Rauheit nicht überdecken. Es war eine trostlose, unruhige Landschaft.
»Schon sonderbar, sich hier zu erhängen, oder?« Huldar wandte sich von dem Toten ab und drehte sich zu seinem Kollegen Guðlaugur.
»Auch nicht sonderbarer als anderswo.« Guðlaugur starrte immer noch auf den Mann in der Schlinge. »Damit ist er sichergegangen, dass ihn kein Angehöriger findet. Ich denke mal, das ist der Grund.«
»Hm, vielleicht.« Huldar war nicht überzeugt. Die Tat hatte einiges an Vorbereitung bedurft. Der Felsen lag ein ganzes Stück von der Straße entfernt, und das Brett, das als Galgen diente, war schwer und unhandlich. Huldar war gelernter Tischler und kannte sich mit so was aus. Er würde seine letzten Atemzüge jedenfalls anders verbringen, als ein dickes Brett durch die Gegend zu schleppen. Aber er behielt seine Meinung für sich. Der junge Kollege war an diesem Sonntagmorgen auffallend verkatert, hatte rot unterlaufene Augen, sah mitgenommen aus und steckte sich andauernd Lakritze in den Mund. Momentan kam er, wenn er überhaupt mal etwas sagte, nur mit Zustimmung klar.
Huldar drehte sich wieder zu den beiden Lavakegeln und verfolgte, wie seine Kollegen sich beratschlagten, wie man den Mann am besten runterholen könnte. Das Seil war um das Brett geknotet, und alle Versuche, es durchzuschneiden, würden vermutlich dazu führen, dass der Tote ein paar Meter tief fallen oder an den scharfen Lavafelsen entlangschrammen würde. Natürlich war es trotz allem wünschenswert, ihn möglichst unversehrt zu bergen. Erla stand unter der Leiche, zeigte nach oben und rief den Kollegen, die raufgeklettert waren, etwas zu. Sie bemühten sich, ihre Anweisungen zu befolgen, aber es war etwas anderes, von unten Befehle zu erteilen, als sie oben an der Felskante auszuführen. Erla war kurz davor, die Geduld zu verlieren, zu ihnen hochzuklettern und ihnen zu demonstrieren, wie man das machen musste. Falls sie dann unverrichteter Dinge wieder herunterkäme, wäre sie noch schlechter gelaunt.
Das Brett knackte und knirschte, als ein Polizist versuchte, auf dem Bauch darüber zu robben. Es war unklar, was er vorhatte, er würde den Toten ja wohl kaum raufziehen und mit ihm zurück zu dem Felsvorsprung kriechen können. Bei den Geräuschen des Bretts gab er seinen Plan schnell wieder auf. Erla konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen und stöhnte laut, denn das war ihr Vorschlag gewesen.
»Wäre es nicht klüger, sich von der Feuerwehr ein Sprungtuch zu leihen? Dann könnten wir die Leiche einigermaßen unversehrt runterholen.«
Huldar lächelte, ehe er sich umschaute. Er kannte Línas Stimme, eine junge Frau von der Universität Akureyri, die ein Berufspraktikum bei ihnen machte. Sie war die erste Hochschulstudentin der Polizeiwissenschaft in der Abteilung. Auch wenn es niemand laut äußerte, hatten die meisten ihr gegenüber Vorurteile – die typische Angst vor dem Neuen. Was sollte aus ihnen werden, wenn plötzlich jeder zweite Polizist mit einem Uni-Zeugnis winkte? Wären sie dazu verdammt, zwischen den Touristenmassen paarweise den Laugavegur rauf- und runterzumarschieren, Ruhestörungen zu verhindern und Geldstrafen für Kinkerlitzchen zu verhängen?
Huldar war das so was von egal. Wenn es für ihn bei der Polizei keinen Job mehr gäbe, könnte er jederzeit wieder tischlern. Außerdem hatte er einen diebischen Spaß an der Studentin, vor allem daran, wie sie den Leuten mit ihrer pedantischen Art auf die Nerven ging.
Sie wies ständig auf Dinge hin, die nicht exakt nach Lehrbuch verliefen, korrigierte Begriffe und leierte Fachwissen aus wissenschaftlichen Artikeln oder Büchern herunter. Wenn das in Erlas Anwesenheit passierte, schnaubte die Chefin immer entnervt. Huldar konnte sich dann genauso wenig das Grinsen verkneifen, wie wenn Línas Bemerkungen Guðlaugur auf die Palme brachten.
»Wir haben keine Zeit, bei der Feuerwehr ein Sprungtuch zu holen, Lína. Ist aber ’ne gute Idee.« Huldar sah, wie Lína bei seinem Lob lächelte. Sie war klein und reichte ihm nur bis zur Brust, hatte rote Haare und elfenbeinweiße Haut. Zwischen ihrem Gesicht und ihren Zähnen gab es kaum einen Farbunterschied, wenn sie, so wie jetzt, aufblitzten. Doch sie machte sofort wieder ein ernstes Gesicht und konzentrierte sich auf die Geschehnisse oben auf den Felsen.
Huldar hatte Erla in Verdacht, Lína nicht mitgenommen zu haben, um ihr die Polizeiarbeit am Tatort näherzubringen, sondern damit der jungen Frau bei dem grauenhaften Anblick schlecht würde oder sie sich sogar übergeben müsste. Doch weit gefehlt. Lína hatte sich in die vorderste Reihe gestellt, zu der baumelnden Leiche hinaufgestarrt und sie begutachtet wie einen Kronleuchter in einem Lampengeschäft. Nachdem sie den Kopf wieder gesenkt hatte, musterte sie die Umgebung und kritisierte Erla dafür, den Tatort nicht abgesperrt zu haben. Erlas lapidare Entgegnung, dafür hätten sie keine Zeit, brachte Lína nicht zum Schweigen, sodass Huldar sie am Ende beiseitenehmen und ihr erklären musste, es handele sich um eine Ausnahme, und es stünde bestimmt auch in ihren Lehrbüchern, dass in bestimmten Situationen wegen Zeitdrucks von der üblichen Routine abgewichen würde. Doch Lína schnitt nur eine Grimasse. Sie fand den Grund für die Hektik total lächerlich.
Mit dieser Meinung stand sie allein da. Allen anderen im Team war vollkommen klar, dass Eile angesagt war. Eine Meldung über einen Leichenfund in Bessastaðir war schließlich nicht an der Tagesordnung. Unter normalen Umständen wären zwei Mann plus einer von der SpuSi losgeschickt worden, aber jetzt wimmelte es von Leuten. Bei der ganzen Aufregung war fast jeder verfügbare Polizist zum Tatort beordert worden, ein paar sogar aus ihrem freien Wochenende heraus. Dadurch wollte man den Abtransport der Leiche wohl beschleunigen, aber letztendlich hatte es den gegenteiligen Effekt. Die meisten hatten nichts zu tun und standen den anderen nur im Weg.
Erlas Handy klingelte, und Huldar sah, wie sie ranging. Sie schloss die Augen und massierte ihre Stirn, während sie augenscheinlich eine Tirade aus der Chefabteilung über sich ergehen ließ. Die drehten bestimmt total am Rad. Natürlich wollten sie vor den Sicherheitsleuten einer ausländischen Großmacht nicht schlecht dastehen. Huldar grinste bei der Vorstellung, hatte seine Gesichtszüge aber sofort wieder im Griff, als Erla ihm einen Blick zuwarf, auflegte und das Handy in die Tasche steckte.
»Schneidet das Seil durch! Die Zeit ist um!«, rief Erla den Männern auf dem Felsen zu. »Der Autokorso ist unterwegs und kommt in einer halben Stunde nach Bessastaðir. Dann müssen wir weg sein. Wir können es auch nicht ändern, wenn die Leiche Schaden nimmt. Dem Toten dürfte das egal sein.«
Huldar sah, wie Lína empört den Mund aufklappte. Vermutlich wurden Staatsbesuche aus dem Ausland in ihren Lehrbüchern über die Beweissicherung am Tatort nicht erwähnt. Er legte ihr die Hand auf die Schulter und flüsterte in ihr zierliches weißes Ohr: »An deiner Stelle würde ich jetzt nichts sagen. Du änderst sowieso nichts daran.«
Lína presste die Lippen aufeinander. Sie war nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn sie wenig Erfahrung hatte. Sie hatte Erlas kurze Ansprache vor der Abfahrt gehört und kannte die Hintergründe. Dennoch blickte sie über die Bucht auf das gegenüberliegende Bessastaðir und sah alles andere als glücklich aus. Huldar war sich ziemlich sicher, dass Guðni Th. bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht mit ihrer Stimme rechnen durfte, obwohl er gar nichts dafür konnte. Seine Rolle bestand lediglich darin, zum Auftakt des offiziellen Staatsbesuchs einen Empfang für den chinesischen Außenminister auszurichten. Die Sicherheitsleute des Politikers hatten den Ort im Vorfeld inspiziert und dabei die zwischen den Lavafelsen baumelnde Leiche auf der anderen Seite der Bucht Lambhúsatjörn entdeckt. Die Bewohner und Angestellten des Präsidentensitzes hatten sie hingegen noch gar nicht bemerkt, zumal seit dem Morgen dichter Nebel über dem Gebiet gehangen hatte.
Der Leichenfund hatte im Außenministerium natürlich großen Wirbel ausgelöst, und man hatte alle Hände voll zu tun, die Delegation und die Sicherheitsleute davon abzubringen, das Flugzeug des Ministers zurückzuschicken. Am Ende schaffte man es, die Chinesen davon zu überzeugen, dass es sich nicht um eine Protestaktion der Falun-Gong-Sekte handelte, sondern lediglich um ein tragisches Unglück und reinen Zufall. Das Programm wurde fortgesetzt, natürlich unter der Bedingung, dass die Leiche entfernt würde, bevor der Minister einträfe, da Leichen nicht als sonderlich feierlich gelten. Weder in Europa noch in Asien.
Doch die Leute aus dem Außenministerium hatten offenbar geglaubt, die Polizei würde schneller agieren, als es realistischerweise möglich war. Als der Fall auf Erlas Tisch landete, befand sich die Maschine des Außenministers bereits im Landeanflug auf Keflavík. Die Anweisung lautete, dass die Leiche und das gesamte Einsatzteam von der Halbinsel Álftanes verschwunden sein müssten, sobald der Autokorso dort einträfe – unabhängig davon, dass der Leichenfundort von der Straße aus gar nicht einsehbar war. Man konnte ihn von Bessastaðir aus sehen, und das reichte. Es durfte auf keinen Fall dazu kommen, dass der Präsident dem chinesischen Außenminister erklären müsste, was auf der anderen Seite der Bucht los war, falls dieser den Aufmarsch zufällig durchs Fenster erspähen würde. Selbst wenn Island nach diesem Fiasko garantiert keinen Pandabären mehr geliehen bekäme, bestand doch noch die Hoffnung, dass der Besuch wenigstens die Handelsbeziehungen ankurbelte.
Huldar und Lína beobachteten den Einsatz der Kollegen auf den Felsen aufmerksam. Die Männer bildeten zwei Gruppen, und einer versuchte jetzt, mit einer Schere an das Seil heranzukommen und es durchzuschneiden. Das stellte sich als undurchführbar heraus. Erla verfolgte die Bemühungen nervös, checkte auf ihrem Handy die verbleibende Zeit und rief dann, sie sollten das Brett einfach samt Seil und Leiche runterschmeißen.
Mit gemeinsamer Anstrengung schafften es die Männer, das Brett mit der Leiche an den Enden anzuheben und den ganzen Kladderadatsch fallen zu lassen.
Unterdessen stieß Huldar den blassen Guðlaugur an, und sie holten die Bahre, die neben dem Schafpfad lag, der zu den Felsen führte. Kurz bevor der Tote runterkrachte, kamen sie zurück und gingen dann zu der Leiche, die zusammengekrümmt unter dem schweren Brett lag. Weitere Kollegen kamen hinzu und halfen ihnen, das Seil durchzuschneiden und das wuchtige Brett zu entfernen. Guðlaugur und ein Kollege drehten den Toten um, und ein paar Leute bezogen neben der Leiche Stellung, um sie auf die Bahre zu wuchten. Huldar trat einen Schritt zur Seite, weil er nicht scharf darauf war, mitzuhelfen. Es hatte ihm schon gereicht, die Todesfratze des Mannes aus der Ferne zu sehen.
»Stopp!« Línas Stimme klang so, als wäre sie es gewohnt, dass man ihr gehorchte. Ein Witz angesichts ihres jungen Alters und ihrer geringen Erfahrung. Huldar hatte ihren Lebenslauf überflogen und gesehen, dass sie bisher nur in typischen Sommerjobs gearbeitet hatte. Grünpflege für die Stadtverwaltung in Akureyri, an der Kasse im Supermarkt, in einer Fischfabrik und in einem Kino. Schwer zu sagen, in welchem dieser Jobs sie sich den herrischen Ton angewöhnt hatte. Vielleicht wenn sie den Kinobesuchern vor Beginn der Vorstellung befohlen hatte, die Handys auszuschalten.
»Du gibst hier keine Befehle!« Erlas Gesicht war rot vor Wut. Sie winkte den Männern, die um die Leiche herumstanden, und wies sie an, den Toten auf die Trage zu heben.
»Aber …«
»Was soll der Scheiß? Hast du mich nicht verstanden, verdammt noch mal?« Erla stresste die ganze Sache ziemlich, und wie es nun mal ihre Art war, äußerte sich das in Fluchen.
Huldar sah Lína scharf an, damit sie den Mund hielt, aber sie schaute gar nicht zu ihm und machte unverdrossen weiter: »Seht ihr denn nicht? Auf seiner Brust?« Aufgeregt zeigte sie auf die Leiche.
Den meisten war klar, dass Erla noch wütender würde, wenn sie hinschauten, aber die Verlockung war zu groß. Einer nach dem anderen blickte auf die Brust des Toten, wo ein winziges Metallplättchen aus der Kleidung lugte. Mit fragenden Gesichtern traten sie näher heran. Huldar wusste genau, was er da sah. Es war ein Nagelkopf. Wahrscheinlich 4 Zoll. Darunter sah man einen Fetzen Papier, als hätte jemand mit dem Nagel einen Notizzettel an dem Mann befestigt.
Erla schien es auch gesehen zu haben, denn sie stöhnte laut.
Das konnte kein Selbstmord sein. Wer würde sich selbst mit einem scharfen Nagel durchlöchern? Und dann auch noch die Brust. Sie befanden sich ganz offensichtlich am Schauplatz eines Mordes und waren wie blutige Amateure damit umgegangen. Bei der ganzen Hektik war noch nicht einmal ein Rechtsmediziner zum Tatort bestellt worden. Zum ersten Mal seit Beginn ihres Praktikums hatte Lína allen Grund, ihrer Empörung Luft zu machen.
»Tretet zur Seite.« Erla klang besonnen, obwohl das sicher nicht der Fall war. »Deckt den Mann mit irgendwas zu, damit man ihn von Bessastaðir nicht sehen kann. Auch nicht mit einem Fernglas. Bedeckt ihn von mir aus mit Gras oder was auch immer, damit er sich in die Landschaft einfügt.« Resigniert rieb sie sich die Augen. »Und dann machen wir, dass wir wegkommen und warten, bis dieser affige Staatsempfang vorbei ist.«
3. KAPITEL
Baldur kam zurück zu ihrem Tisch und roch nach Zigarettenqualm. Er war rausgegangen, um eine zu rauchen, obwohl sie sich gerade erst gesetzt hatten. Freyja wunderte das nicht, denn ihr Bruder war erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte sich noch nicht wieder daran gewöhnt, tun und lassen zu können, was er wollte – oder jedenfalls fast. Er war in einer Resozialisierungseinrichtung für Haftentlassene untergebracht und musste zwar bestimmte Regeln bezüglich nächtlicher Anwesenheit und Arbeitszeiten befolgen, durfte sich aber ansonsten frei bewegen. Kein Wunder, dass er nicht stillsitzen konnte.
Baldur strubbelte seiner Tochter Saga, die in einem Hochstuhl zwischen ihnen saß, durch die Haare. Die Kleine knabberte seelenruhig weiter an einem Stück Schinkenspeck, das Baldur ihr gegeben hatte, weil sie das klein geschnittene Obst auf ihrem Teller nicht mochte. Vater und Tochter kamen gut miteinander klar, obwohl sie sehr unterschiedlich waren. Er war immer gut drauf, während Saga das ernsteste Kind war, dem Freyja je begegnet war. Baldur war ein hellhäutiger Typ und laberte ununterbrochen, Saga hatte einen dunklen Teint und einen angeborenen Schmollmund und war sehr still. Baldur war immer schick angezogen, während Freyja Saga kaum in etwas anderes bekam als Gummistiefel, Leggings und T-Shirt. Die Mutter des Mädchens schaffte es hingegen, sie in Kleidchen und süße Schuhe zu stecken. Hin und wieder steckte sie ihrer Tochter sogar ein Klämmerchen ins Haar – das ging aber nur, wenn Saga Handschuhe anhatte. Sobald sie sich der Handschuhe entledigt hatte, flog die Haarklammer in die Ecke.
Baldur blinzelte seiner Tochter zu, und sie blinzelte mit beiden Augen zurück, weil sie noch zu klein war, um nur ein Auge zukneifen zu können. Mit einem breiten Grinsen drehte Baldur sich zu Freyja und sagte: »Gibt es ein süßeres Kind?«
Freyja zwang sich, zurückzulächeln. Während seiner Haftstrafe war sie für ihn eingesprungen und hatte sich um die Kleine gekümmert. Sie vergötterte und liebte Saga wie ihr eigenes Kind. Aber süß war nicht unbedingt das passende Wort. Dennoch freute sich Freyja, dass ihr Bruder so glücklich mit seiner Tochter war, obwohl sie bisher nur wenig Kontakt hatten. Es schien ihm überhaupt nicht schwerzufallen, eine Verbindung zu ihr herzustellen – und umgekehrt genauso. Vielleicht war es ja hilfreich, dass sie beide seltsam waren, jeder auf seine Weise.
»Ach, hör mal! Jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen!« Baldur schob seinen kaum angerührten Teller beiseite und zog die Kaffeetasse zu sich. Freyja hatte vorgeschlagen, zu dritt zu Mittag zu essen, aber vergessen, ihn nach seinen aktuellen Essvorlieben zu fragen. Sie hatte einfach einen Tisch in einem Restaurant bestellt, das für altmodischen Sonntagsbrunch bekannt war. Doch Eier und Schinken waren bei seinem momentanen Gesundheitstick anscheinend nicht erlaubt. Höchstwahrscheinlich würde aber genau das der Hauptbestandteil seines nächsten Ernährungsfimmels sein. Was das anging, fiel er von einem Extrem ins andere. »Dabei wollte ich dir das eigentlich schon im Auto erzählen.«
»Was denn?« Freyja erwartete keine großartigen Neuigkeiten. Baldur verhielt sich zurzeit sehr ruhig, um seine Bewährung nicht zu gefährden.
»Ich hab dir ’ne Wohnung besorgt.« Baldur hielt Saga noch ein Stück Schinken hin, woraufhin sie das erste Stück auf den Boden fallen ließ und nach dem neuen grabschte. Sie streckte ihre kleine rosa Zunge heraus und lutschte den Schinken wie ein Eis am Stiel.
Freyja legte die Gabel auf den Teller, und das Rührei, das sie sich gerade in den Mund stecken wollte, rutschte wieder herunter. »Was?« Ihr Bruder wollte sie doch wohl nicht auf den Arm nehmen? Das wäre gemein, er wusste doch, wie besorgt sie wegen ihrer Wohnsituation war. Sie wohnte immer noch in seiner Wohnung, aber das würde nicht mehr lange so weitergehen. Es kam nämlich überhaupt nicht in Frage, mit ihm zusammenzuziehen, wenn er aus der Einrichtung entlassen wurde. Sie würde niemals auf dem verschlissenen Sofa im Wohnzimmer schlafen, während er mit seinen wöchentlich wechselnden Freundinnen im Schlafzimmer zugange war. Und die Vorstellung, selbst mit einem Lover auf dem Sofa zu liegen, während Baldur im Nebenraum schlief, war auch nicht gerade verlockend. Doch bisher hatte ihre Wohnungssuche nichts gebracht. Die freien Mietwohnungen waren entweder zu teuer oder der Vermieter entschied sich für jemand anderen. Freyja dachte schon ernsthaft darüber nach, aufs Land zu ziehen oder sogar ins Ausland. »Bitte, verarsch mich nicht!«
»Ich verarsche dich nicht.« Baldur nahm Sagas Glas und hob es an ihre Lippen, um ihr einen Schluck Orangensaft einzuflößen, aber sie drehte so lange den Kopf weg, bis er das Glas wieder auf den Tisch stellte.
»Wieso kriegst du einfach so eine Wohnung? Ich versuche es seit über einem Jahr, und es funktioniert überhaupt nicht.« Das war mal wieder typisch Baldur. Die Leute wollten ihm immer alles recht machen. Bei einer Wohnungsbesichtigung drängte der Vermieter ihm garantiert direkt vor Ort den Mietvertrag auf. Aber Baldur konnte nicht für sie Wohnungen besichtigt haben, dafür war er erst zu kurz aus dem Gefängnis draußen.
»Erinnerst du dich an Tobbi?«
»Tobbi?« Der Name klang vertraut, aber Freyja hatte kein Gesicht dazu vor Augen.
»Ja, mein Freund Tobbi. Erinnerst du dich nicht an ihn?«
»Dunkel.« Baldur hatte viele Freunde, einer skurriler als der andere. Und er unterschied nicht zwischen Freunden und Bekannten, sondern teilte die Leute in zwei Gruppen ein: Freunde und Idioten. In der ersten Gruppe waren wesentlich mehr Personen, weil für Baldur jeder, der ihn anlächelte, automatisch ein Freund war. Idioten waren alle, die irgendwie verhinderten, dass er Spaß im Leben hatte. Freyja gehörte zu keiner der beiden Gruppen, sie war lange Zeit seine einzige enge Verwandte gewesen, bis Saga dazugekommen war.
»Jedenfalls hat Tobbi ’ne Wohnung, die er dir vermieten will.« Baldur wischte einen Brotkrümel vom Tisch, bevor er seinen Arm darauflegte. Er kam frisch vom Friseur und trug neue Klamotten, die ein Vermögen gekostet haben mussten. Woher das Geld stammte, war Freyja ein Rätsel, aber manche Dinge sollte man lieber nicht wissen.
»Mir? Warum ausgerechnet mir?«, fragte sie mit verhaltener Begeisterung. Das Angebot klang total absurd. Und Baldur war Spezialist für Absurditäten.
»Weil ich ihm gesagt hab, dass du ’ne Wohnung suchst. Er hat irgendwas erzählt, von wegen er hätte Schwierigkeiten, einen guten Mieter zu finden, und da hab ich dich halt erwähnt. Er will dich unbedingt haben.«
Freyja runzelte die Stirn und sah aus dem Augenwinkel, dass Saga sie nachäffte. »In Reykjavík hat niemand Schwierigkeiten, einen guten Mieter zu finden. Man muss nur ein briefmarkengroßes Zu-vermieten-Schild ins Fenster hängen, und die Leute stehen bis um die nächste Ecke Schlange. Oder ist seine Wohnung gar nicht in der Stadt?«
»Doch. Die ist in Reykjavík. Mehr oder weniger.«
»Mehr oder weniger? Was soll das heißen?«
Baldur verdrehte die Augen. »Sie ist draußen in Seltjarnarnes. Fast neu. In einem schicken Haus und so.«
»Ich kann mir keine hohe Miete leisten, das weißt du doch, Baldur.«
»Die Miete ist nicht hoch. Ganz normal halt.« Die Summe, die er nannte, passte eher zu einer Garage als zu einer Wohnung.
»Wie groß ist sie denn? Oder ist das nur ein Eckchen in einer Abstellkammer?«
»Nein. Sei doch nicht immer so negativ! Ich dachte, du würdest dich freuen«, entgegnete Baldur, jetzt nicht mehr lächelnd, sondern schon fast eingeschnappt.
Freyja legte ihre Hand auf seine. Sie hielten zusammen. Immer. Wenn er ihr irgendeine dubiose Wohnung anbot, dann war das bestimmt gut gemeint. Er wollte ihr nur helfen. »Entschuldige. Ich bin einfach nur misstrauisch, weil ich schon so lange vergeblich suche. Die Miete ist total niedrig. Da muss doch irgendein Haken dran sein.« Vermutlich schuldete dieser Tobbi ihrem Bruder Geld oder einen großen Gefallen. Und der hatte sicherlich nichts mit legalen Dingen zu tun.
Baldur beugte sich zu Saga, hielt ihr die Ohren zu und sagte: »Tobbi muss in den Knast. Für fast anderthalb Jahre.« Baldur ließ die Hände wieder sinken, bevor Freyja ihn darauf hinweisen konnte, dass seine Tochter das Wort Knast noch gar nicht kannte. »Er will nicht an Fremde vermieten, weil er seine Möbel und seine Sachen dalassen möchte. Er kennt mich und vertraut auf meine Empfehlung. Das wäre eine echte Win-win-Situation.«
Das klang doch gar nicht so übel. In diesem Moment klingelte Freyjas Handy in ihrem Anorak auf dem Stuhlrücken. Sie schaute kurz aufs Display. »Mist! Ich muss los. Die Arbeit.« Sie machte Anstalten, aufzustehen. »Aber ich würde gern mal mit deinem Freund reden. Könnten wir uns die Wohnung nicht zusammen anschauen? Möglichst bald?«
Baldur bejahte und schien noch etwas hinzufügen zu wollen, verabschiedete sich aber dann mit dem Versprechen, sie am Abend anzurufen.
Freyja küsste ihn auf die Wange und Saga auf den Kopf. Dann bezahlte sie die Rechnung und machte sich mit beschwingten Schritten auf den Weg, weil endlich eine Wohnung in Aussicht war. Falls etwas daraus würde. Bei Baldur konnte man nie wissen.
* * *
Freyja drückte auf die Klingel, diesmal fester und länger als beim ersten Mal. Das Klingeln drang bis in den Gang, doch sobald sie den Finger wegnahm, war es wieder totenstill. Das Einzige, was sie bisher aus der Wohnung gehört hatten, war das schrille Türklingeln und das Schellen des Telefons, an das niemand rangegangen war.
»Soll ich es noch mal probieren?«, fragte Freyja ihren Kollegen, einen großen, schlanken jungen Mann mit Wikingerbart, goldenem Nasenring und müden Augen. Sie waren ungefähr gleich alt, aber er hatte wesentlich mehr Erfahrung mit solchen Fällen. Er war beim Jugendamt Reykjavík fest angestellt, wo sie, zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob im Kinderhaus, einzelne Abend- und Wochenendschichten übernahm, um Geld für ihre zukünftige Miete zu sparen. Wenn Baldurs Freund sich nicht als totaler Chaot entpuppen würde und seine Wohnung in Ordnung war, bräuchte sie diesen Zweitjob vielleicht nicht mehr. Doch nun stand sie hier, bei einem Einsatz in einem absurd breiten Gang in einem der schicken Hochhäuser in Reykjavík. Selbst wenn sie rund um die Uhr arbeiten würde, könnte sie sich hier keine Wohnung leisten.
»Versuch’s noch mal. Kann sein, dass das Kind sich nicht zur Tür traut. Oder eingeschlafen ist.«
Freyja drückte noch einmal lange auf die Klingel, um das Kind zu wecken, falls es eingeschlafen war. Ohne Erfolg. »Bei diesem Lärm kann doch niemand schlafen.«
»Vielleicht nicht. Aber wer weiß …« Der junge Mann namens Diðrik trat näher an die Tür und klopfte fest. So fest, dass Freyja meinte, seine Knöchel rot anlaufen zu sehen. Vielleicht hatte sie sich aber auch nur verguckt, denn seine Arme waren von den Jackenärmeln bis zu den Handrücken mit bunten Tätowierungen verziert, sodass die natürliche Hautfarbe seiner Hände schwer auszumachen war.
In diesem Moment ging die Tür der Nachbarwohnung auf, und eine Frau mittleren Alters steckte den Kopf durch die Öffnung. Als sie Diðrik sah, erschrak sie, wahrscheinlich weil sie ihn für einen Geldeintreiber oder Kriminellen hielt. Bestimmt nicht für einen Mitarbeiter vom Jugendamt. Da die Frau keine Anstalten machte, etwas zu sagen, grüßte Freyja sie freundlich. »Bitte entschuldigen Sie die Störung. Wir sind von der Stadt Reykjavík. Uns wurde gemeldet, dass sich in dieser Wohnung möglicherweise ein Kind ohne Aufsicht befindet, das in Schwierigkeiten sein könnte. Haben Sie bei uns angerufen?«
Da es bei der Stadt am Wochenende keinen Telefondienst gab, war der Notruf kontaktiert worden. In solchen Fällen wurde normalerweise zuerst die Polizei geschickt, aber heute schien kein Polizist verfügbar zu sein, deshalb war die Sache am Ende bei Diðrik gelandet. Weil der Hilferuf zunächst zwischen diversen Stellen hin- und hergeleitet worden war, wusste er nicht, wer die Meldung gemacht hatte.
Die Frau machte ein pikiertes Gesicht, als hätte Freyja sie einer unmoralischen Tat bezichtigt, und schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe nichts bemerkt.« Ihre sorgfältig geschminkten Augen huschten zu einer großen Vase mit schwer identifizierbaren Blumen, die im Gang an der Wand stand, genau zwischen ihr und ihnen. Ihr Blick war erwartungsvoll, als markiere die Vase eine unsichtbare Linie, die von nichts Bösem überschritten werden konnte. Sie verschränkte die hageren Arme vor der Brust und sagte: »Kann es sein, dass Sie im falschen Haus sind?«
Freyja zögerte und überlegte kurz, ob das der Fall sein konnte. Vielleicht befand sich das arme Kind, dem sie helfen sollten, im nächsten Haus oder in der nächsten Straße. In Häusern wie diesem gab es nur selten kindesschutzrelevante Fälle, was nicht an der edlen Ausstattung lag, sondern daran, dass die meisten Bewohner schon zu alt für Kinder waren.
Diðrik mischte sich ein und sagte mit Nachdruck: »Nein. Wir sind im richtigen Haus.«
Die Frau hob die Augenbrauen. »Seltsam … nebenan wohnt kein Kind. Es sei denn, es ist neu eingezogen. Mein Nachbar ist alleinstehend. Sie müssen sich vertan haben. Meines Wissens wohnt im ganzen Haus kein einziges Kind. Die Wohnungen hier sind für Familien mit Kindern ungeeignet, besonders die, in die Sie reinwollen. Das ist die teuerste Wohnung im ganzen Haus.«
»Vielleicht ist das Kind ja zu Besuch hier oder beim Babysitter.« Freyja verkniff es sich hinzuzufügen, dass Kinder durchaus schon mal ihre eigenen Wohnungen verließen. Ab und zu sogar Wohnungen der teureren Sorte betraten. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Diðrik das Ohr an die Tür legte, als hätte er etwas gehört. Sie meinte, ein Geräusch wie das eines Weckers zu hören, aber das konnte auch aus der Wohnung der Nachbarin kommen.
Da die Frau nicht stutzte und das Geräusch nicht zu bemerken schien, handelte es sich wohl nicht um ihren Wecker. »Mein Nachbar ist kein Babysitter-Typ.«
»Mag sein, aber wir müssen solchen Hinweisen natürlich nachgehen.« Freyja presste ein Lächeln hervor, wohl wissend, wie unnatürlich es wirkte. Die Frau zuckte ähnlich herzlich mit dem Mund.
Diðrik hörte auf, an der Wohnungstür zu lauschen, die fast bis unter die Decke reichte, als hätte der Architekt des Hochhauses den Bewohnern die Möglichkeit bieten wollen, Giraffen als Haustiere zu halten.
Freyja wandte sich von der sauertöpfisch dreinschauenden Frau ab. Das Geräusch des Weckers, das sie gehört zu haben meinte, war verstummt.
Diðrik klingelte noch einmal und trommelte gegen die Tür. Dann sahen sie plötzlich, wie sich die Türklinke bewegte. Ganz langsam ging die Tür einen Spaltbreit auf. »Guten Tag!«, sagte Diðrik durch den Türspalt. »Mein Name ist Diðrik, ich bin von der Stadt Reykjavík. Wir haben den Hinweis erhalten, dass sich in dieser Wohnung ein Kind in Schwierigkeiten befindet. Könnten wir kurz mit Ihnen sprechen?«
Keine Antwort. Diðrik räusperte sich und wiederholte sein Sprüchlein. Als es weiterhin still blieb, hob er die Brauen und schaute zu Freyja. Er signalisierte ihr, dass sie es probieren sollte, und trat zur Seite. »Hallo, mein Name ist Freyja. Würden Sie uns mal aufmachen? Wir möchten uns nur vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Dann gehen wir wieder.«
»Ich will nach Hause.« Es war eine Kinderstimme. Daran bestand kein Zweifel. Schwer zu sagen, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelte und in welchem Alter das Kind war. Freyja tippte auf drei bis sechs Jahre.
»Wir helfen dir, nach Hause zu kommen. Aber erst musst du die Tür richtig aufmachen, damit wir dich sehen können.«
Der Türspalt verbreiterte sich im Zeitlupentempo. Ein Haarschopf erschien zwischen Rahmen und Tür, und große Augen schauten Freyja unter einem blonden Pony heraus ängstlich an. Es war ein kleiner Junge, schätzungsweise vier Jahre alt. Er hatte einen grünen Anorak an, obwohl nichts darauf hindeutete, dass es in der Wohnung kalt wäre. Zudem trug er klobige Winterstiefel mit Klettverschlüssen, als wäre er gerade reingekommen oder auf dem Weg nach draußen. »Ich will nach Hause.«
»Natürlich. Wir helfen dir, nach Hause zu kommen.« Freyja ging behutsam in die Knie, sodass sie sich auf Augenhöhe befanden. »Wie heißt du denn?«
»Siggi.«
»Hallo Siggi. Ist ein Erwachsener bei dir, mit dem wir sprechen können?«
»Nein. Ich bin allein, ich will nach Hause. Ich wohne hier nicht.«
Freyja tat so, als wäre es völlig normal, dass sich ein kleiner Junge mutterseelenallein in einer Wohnung aufhielt, in der er gar nicht wohnte. »Wo wohnst du denn?«
»In Island.«
Freyja lächelte ihn an. »Ich auch! Wo denn in Island?«
»In Reykjavík. Das ist eine Stadt. Mit einem Bürgermeister.«
»Das ist ja super.« Freyja deutete hinter sich. »Das ist Diðrik. Der arbeitet für den Bürgermeister. Machst du mal auf, damit wir drinnen weiterreden können? Diðrik kann dir ein Bild von einem Adler zeigen, das hat er auf dem Arm.« Bei ihrem letzten Einsatz mit Diðrik hatte der einen kleinen Jungen unter dem Bett hervorgelockt, indem er den Ärmel hochgekrempelt und ihm seine Tattoos gezeigt hatte. Den Jungen hatte der Adler mit den ausgebreiteten Flügeln inmitten der bunten Abbildungen am meisten fasziniert.
Der blonde Junge in dem grünen Anorak überlegte angestrengt. Er starrte auf Diðriks tätowierte Handrücken und knabberte an der Oberlippe. Dann öffnete er vorsichtig die Tür, bis sie weit offen stand. Freyja richtete sich auf und schaute in die geschmackvoll eingerichtete Wohnung. »Wer wohnt denn hier? Dein Papa?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Ein Freund oder eine Freundin von deiner Mama?« Wieder wippte der blonde Schopf hin und her. »Deine Tante vielleicht? Oder dein Onkel?«
»Ich weiß nicht.«
»Macht nichts. Man kann ja nicht alles wissen.« Freyja und Diðrik traten in die Wohnung und ließen die Nachbarin ohne weitere Worte im Gang stehen.
Die Wohnung sah nicht so aus, als würden ihre Bewohner beim Discounter einkaufen. Der Flur ging in ein imposantes Wohnzimmer mit schicken Möbeln über, alles aus Edelstahl, der frisch poliert aussah. An einer Wand stand ein riesiger Gaskaminofen, an den anderen hingen abstrakte Gemälde. Die bunten Pinselstriche implizierten gewiss bedeutende Aussagen über die Welt und die zerbrechliche Existenz des Menschen, aber Freyja konnte damit herzlich wenig anfangen. Die Möbel fungierten eher als Kunstwerke denn als Gebrauchsgegenstände, und Freyja musste zugeben, dass sie noch nie eine coolere Wohnung betreten hatte.
Die Fensterfront des Wohnzimmers schien frisch geputzt zu sein, obwohl sie sich im elften Stock befanden. Die angrenzende Wand war ebenfalls bodentief verglast und entpuppte sich als Tür zu einer großen Terrasse mit Aussicht über die Bucht Faxaflói. Freyja ging zu der Glaswand und blickte hinaus. Die Terrasse war mit geschmackvollen Gartenmöbeln ausgestattet, auf denen die Polsterauflagen fehlten. Wahrscheinlich wurden sie nur im Sommer benutzt. In einem Land, das am Meer lag, gab es nur selten gleichzeitig gute Aussicht und Windstille.
Wohin man auch schaute, nichts deutete darauf hin, dass hier jemand wohnte. Keine Post auf der Anrichte beim Eingang, geschweige denn halbvolle Gläser auf den Tischen, eine aufgeschlagene Zeitung oder ein Buch auf dem Sofa, Socken auf dem Boden oder sonst etwas, das auf normales Wohnen schließen ließ.
Während Freyjas Blick durch das große Wohnzimmer schweifte, zog Diðrik seine Jacke aus, hockte sich neben den Jungen und zeigte ihm seinen Arm. Freyja gab ihm zu verstehen, dass sie abchecken würde, ob sich außer dem Kleinen tatsächlich niemand in der Wohnung befand. Diðrik nickte, während er dem neugierigen Jungen erlaubte, mit dem Zeigefinger vorsichtig über die Tattoos zu streichen.
Freyja ging zuerst in die offene Küche am Ende des Wohnzimmers. Hier war es genauso ordentlich, nur auf dem Küchentisch thronte ein großes buntes Paket mit Geschenkband, das sich üppig an den Seiten hinabkräuselte. Freyja trat näher und warf einen Blick auf das Schildchen. Für Hallbera – von Helgi. In einer femininen Handschrift.
Die Arbeitsflächen wirkten wie frisch abgewischt, die leere, glänzende Edelstahlspüle hatte keinen einzigen Kratzer, und die wenigen Gegenstände standen alle am richtigen Platz. An einer Wand befanden sich drei Backöfen untereinander, die alle aussahen, als wären sie noch nie benutzt worden, sowie ein Einbau-Kaffeevollautomat, der ebenfalls nagelneu war. Wer auch immer hier wohnte, er musste einen ganzen Putztrupp engagiert haben, während andere von einer Putzhilfe für zwei Stunden in der Woche träumten. Freyja zügelte ihre Neugier und schaute nicht in den Kühlschrank und die Schränke. Da konnte sich schließlich niemand verstecken, und sie sollte ja nur sichergehen, dass außer dem Jungen niemand in der Wohnung war – dabei hätte sie so gern ihre Vermutung bestätigt, dass die Schränke nach einem penibel durchdachten System eingeräumt waren.
Als Nächstes ging sie in den Flur, an dem sich ein Schlafzimmer mit Ankleide, ein Bad und ein Arbeitszimmer befanden. Es gab auch noch ein zweites Schlafzimmer mit einem kleinen Bad. Welche Tür sie auch öffnete, überall herrschte pedantische Ordnung. Die Ankleide war am interessantesten, weil man sehen konnte, dass hier ein alleinstehender Mann wohnte. Wahrscheinlich besagter Helgi, der Hallbera ein Geschenk machen wollte. Jedenfalls war klar, dass sie nicht hier wohnte, denn es gab keine Frauenkleidung. Auf der einen Seite waren reihenweise teure Anzüge, die alle gleich aussahen, gestärkte Hemden und jede Menge schicke Lederschuhe in gedeckten Farben. In den Regalen auf der anderen Seite lag alltagstauglichere Kleidung. Jeans, T-Shirts und Pullover, Turn- und Straßenschuhe. Freyja beherrschte sich, die Schubladen eines riesigen Möbelstücks aufzuziehen, das in der Mitte des Raums stand und als Tisch und Kommode fungierte. Sie ahnte, was darin war. Aufgerollte Seidenkrawatten, Ledergürtel, bunte Socken und so weiter. Sie hatte schon genug Filme über reiche Junggesellen gesehen. Der einzige Unterschied war, dass sich hier hinter den Klamotten kein Geheimraum mit gefälschten Pässen, Stapeln von Dollarscheinen und waffengeschmückten Wänden befand.
Obwohl das Gesamtbild makellos war, fand Freyja die Wohnung seelenlos und unpersönlich. Selbst der Schreibtisch in dem modernen Arbeitszimmer war bis auf einen Computerbildschirm, eine kabellose Tastatur und eine dazu passende Maus leer. Wie in der gesamten Wohnung war auch hier kein Staubkörnchen zu sehen. Die einzige menschliche Spur war die eingedrückte Bettdecke im Schlafzimmer. Das Bett war frisch bezogen, aber auf der Türseite war eine Kuhle von einem Körper. Von einem kleinen Körper, wahrscheinlich dem des Jungen. Neben der Kuhle lag ein altmodischer Wecker, und auf dem Nachttisch stand eine halbvolle Flasche Orangenlimonade. Zwei Wachsmalstifte, ein roter und ein grüner, lagen neben der Flasche.
Freyja ging zurück ins Wohnzimmer, suchte Diðriks Blick und schüttelte den Kopf. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, wandte er sich wieder dem kleinen Jungen zu, der in seinem billigen Anorak und seinen klobigen Winterstiefeln auf keinen Fall hier zu Hause sein konnte.
»Bist du schon lange allein hier?«, fragte Freyja.
»Weiß nicht.«
»Erinnerst du dich, wer dich hergebracht hat? Deine Mama oder dein Papa?«
»Nein.«
»Wer denn sonst?«
»Ein Mann.«
»Ein Mann, den du kennst?«
»Nein.«
»Wohnt der Mann hier?«
»Weiß nicht.«
»Heißt er Helgi?«
»Ich weiß nicht.«
»Kennst du eine Frau oder ein Mädchen, das Hallbera heißt?« Siggi schüttelte nur den Kopf, und Freyja fragte weiter. »Bist du heute Morgen oder gestern hergekommen?«
»Weiß nicht.«
Diðrik richtete sich auf und sagte: »Was meinst du, sollen wir mal gehen und dir einen Hotdog oder ein Eis kaufen? Oder hast du keinen Hunger?«
»Doch.«
»Danach können wir in mein Büro fahren und deine Mama suchen.«
Der Junge riss die Augen auf und wurde ganz aufgeregt. »Ist sie da? Und versteckt sich?«
»Nein.« Lächelnd zog Diðrik seine Jacke an. »Aber da können wir telefonieren und meinen Computer benutzen, um sie zu finden. In meinem Computer steht ganz viel über alle Leute. Auch über dich und deine Mama. Genug, um sie zu finden.«
Freyja hielt Siggi die Hand hin, doch genau in dem Moment, als er seine kleine Hand hineinschieben wollte, ertönte die vertraute Türklingel. Der Junge zog die Hand zurück und starrte erschrocken zur Tür. Freyja und Diðrik hatten auch einen Schreck bekommen und tauschten einen entsetzten Blick, als hätte man sie bei einem Einbruch ertappt. Als es wieder klingelte, ergriff Freyja die Initiative und ging zur Tür.
Davor stand eine kleine junge Frau mit roten Haaren in einer Polizeiuniform.
Und hinter ihr kein anderer als Huldar.
4. KAPITEL
Huldar sah aus dem Augenwinkel, wie Freyja den Strohhalm aus der Plastikhülle drückte, ihn in das Päckchen mit dem Trinkkakao steckte und es dem kleinen Jungen gab. Er saß auf Huldars Schreibtischstuhl und baumelte mit den Beinen. Der Kakao schien genau das Richtige zu sein, er saugte ihn gierig aus dem Päckchen, bis es sich in der Mitte zusammenzog. Zwar hatte man ihm einen Hotdog versprochen, aber solche Köstlichkeiten waren bei der Polizei nicht im Angebot, und alle waren viel zu beschäftigt, um kurz rauszugehen und einen zu holen. Stattdessen hatte der Kleine aus der Kantine Kekse, Weißbrot mit Käse und einen Kakao bekommen. Das Brot und die Kekse hatte er keines Blickes gewürdigt, das Getränk aber bereitwillig angenommen.
Trotz der schlechten Bewirtung schien sich der Junge auf der Polizeiwache ziemlich wohlzufühlen. Jedes Mal, wenn jemand in Uniform hereinkam, machte er große Augen, reckte den kurzen Hals und schaute ihm hinterher. Er wirkte so entspannt, dass Huldar schon befürchtete, er würde seinen Arbeitsplatz okkupieren. Als er mit den Snacks aus der Kantine zurückgekommen war, hatte der Hipster von der Stadt Reykjavík gerade ein Bild, das der Junge gemalt hatte, an die Wand hinter seinem Schreibtisch geklebt. Darauf waren drei Strichmännchen mit einfachen Gesichtern: ein gerader Strich für den Mund und zwei schiefe Kreise für die Augen. Ein Männchen war viel kleiner als die anderen, und eines der beiden größeren breiter als das andere. Vielleicht gar nicht schlecht, dass es dem Jungen auf der Wache so gut gefiel – er würde bestimmt kein Maler werden.
Laut Vorschrift hätte Huldar das Bild sofort wieder abhängen müssen, denn persönliche Deko war an den Arbeitsplätzen nicht erlaubt. Aber der Kleine war so stolz, dass er es aufhängen durfte, außerdem war Freyja genau in dem Moment zurückgekommen, als Huldar ihm das Essen brachte, und da kam es natürlich nicht in Frage, rumzunörgeln und kleinlich zu sein. Besonders als er registrierte, dass sie sich auf der Toilette die Lippen geschminkt hatte – hoffentlich für ihn.
»Würdest du das noch mal wiederholen?!« Erla war auf hundertachtzig. Der Tag hatte schon schlecht angefangen und war nur noch schlimmer geworden. Sie stand unter Beschuss. Sie trug die Verantwortung vor der Polizeidirektion, die gegenüber anderen Behörden auf keinen Fall schlecht dastehen wollte. Als sie gezwungen gewesen war, ihren Chefs mitzuteilen, dass die Leiche des Mannes aus dem Lavafeld am Fundort zurückgelassen worden war, hatte sie sofort einen Anschiss bekommen. Während der Polizeitrupp auf dem Parkplatz an der Tankstelle in Hafnarfjörður gewartet hatte, bis der Besuch des chinesischen Außenministers in Bessastaðir vorbei war, hatte man sie mit Anrufen traktiert. Huldar hatte Mitleid mit ihr gehabt, denn sie hatte kaum zwei, drei erklärende Worte zu der Situation hervorbringen können, als am anderen Ende der Leitung schon losgebrüllt wurde.
Dabei bezweifelte niemand im Team, dass Erla richtig gehandelt hatte. Bis auf Lína natürlich. Sie hätte die Spurensicherung lieber fortgeführt, unabhängig von dem Staatsbesuch. Die Polizeidirektion hätte es hingegen vorgezogen, dass die Leiche fortgeschafft würde, ob es sich nun um einen Mord handelte oder nicht. Erla hatte sich für den Mittelweg entschieden: die Spurensicherung auf Eis gelegt, solange der Staatsbesuch andauerte, und die Leiche verdeckt, damit sie nicht auffiel. Doch wie so oft, wenn man versuchte, unterschiedlichen Standpunkten gerecht zu werden, war niemand mit der Lösung zufrieden.
»Wir haben sie in der Wohnung des Verstorbenen angetroffen«, erklärte Huldar noch einmal. »Freyja, den kleinen Jungen und diesen Typen von der Stadt. Den Hipster.« Er nickte in Richtung des Mannes, der sich mit Freyja um den Jungen kümmerte. Er hatte Huldar zwar nichts getan, aber er mochte ihn trotzdem nicht, schon allein deshalb, weil er Freyja zu gefallen schien. Womöglich hatte sie den Lippenstift sogar für ihn aufgelegt. Huldar runzelte die Stirn, weil er selbst kaum noch Chancen bei Freyja hatte. Aber man konnte ja träumen, und dieser Kerl passte einfach nicht in seine Fantasien. Zumal er ihr jetzt auch noch die Hand auf die Schulter legte und ihr was ins Ohr flüsterte. Huldar drehte sich wieder zu Erla. »Die beiden waren wegen eines Notrufs da. Der Junge hat ihnen die Tür aufgemacht, und soweit ich weiß, hat er keine Ahnung, was los ist. Er kennt den Eigentümer der Wohnung nicht und kann auch nicht erklären, warum er dort war.«