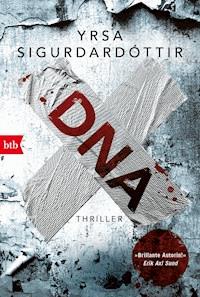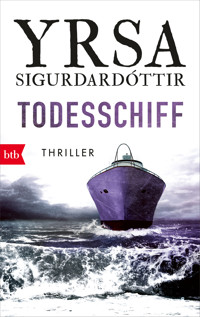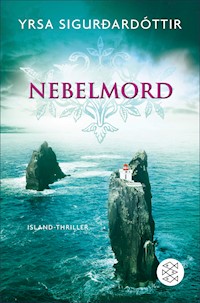13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was zwang die Freunde, sich mitten im harten Winter im isländischen Hochland zu bewegen, in Dunkelheit und Schneestürmen? Und warum verließen sie das kleine Obdach, das sie hatten, kaum bekleidet und den harten Bedingungen vollkommen ausgeliefert? Ein Rettungsteam wird in die abgeschiedene Gegend geschickt, um nach den Vermissten zu suchen. Währenddessen gehen an der einsam gelegenen Radarstation in Stokksnes seltsame Dinge vor sich. Nichts ist so, wie es scheint: Sei es die Blutlache, die im unberührten Schnee fernab der Zivilisation entdeckt wird, oder der kleine Kinderschuh, der Jahrzehnte nach der Vergrabung wiedergefunden wird …
Angesiedelt in der grandiosen isländischen Landschaft, beschreibt Yrsa Sigurdardóttir überzeugend, wie das Gehirn uns in Ausnahmesituationen täuschen kann. Die Ikone des skandinavischen Thrillers beherrscht das Spiel mit der Imagination, der schmalen Grenze zwischen Einbildung und Realität, perfekt und zeigt mit »SCHNEE« ihr ganzes Können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Was zwang die Freunde, sich mitten im harten Winter im isländischen Hochland zu bewegen, in Dunkelheit und Schneestürmen? Und warum verließen sie das kleine Obdach, das sie hatten, kaum bekleidet und den harten Bedingungen vollkommen ausgeliefert? Ein Rettungsteam wird in die abgeschiedene Gegend geschickt, um nach den Vermissten zu suchen. Währenddessen gehen an der einsam gelegenen Radarstation in Stokksnes seltsame Dinge vor sich. Nichts ist so, wie es scheint: Sei es die Blutlache, die im unberührten Schnee fernab der Zivilisation entdeckt wird, oder der kleine Kinderschuh, der Jahrzehnte nach der Vergrabung wiedergefunden wird …
Angesiedelt in der grandiosen isländischen Landschaft, beschreibt Yrsa Sigurdardóttir überzeugend, wie das Gehirn uns in Ausnahmesituationen täuschen kann. Die Ikone des skandinavischen Thrillers beherrscht das Spiel mit der Imagination, der schmalen Grenze zwischen Einbildung und Realität, perfekt und zeigt mit »SCHNEE« ihr ganzes Können.
Zur Autorin
Yrsa Sigurdardóttir, geboren 1963, ist eine vielfach ausgezeichnete Bestsellerautorin, deren Bücher in über 30 Ländern erscheinen. Die Ikone zählt zu den »besten Kriminalautorinnen der Welt« (The Times). Sie debütierte 2005 mit »Das letzte Ritual«, der Erfolgsserie um die junge Rechtsanwältin Dóra Gudmundsdóttir. Ihre Thriller um Kommissar Huldar und Kinderpsychologin Freyja wurden allesamt SPIEGEL-Bestseller. Mit »SCHNEE« erreicht Yrsa Sigurdardóttir ein neues Niveau und beweist ihr ganzes Können. Sie lebt mit ihrer Familie in Reykjavík.
Yrsa Sigurdardóttir
SCHNEE
Thriller
Aus dem Isländischenvon Tina Flecken
Die isländische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Bráðin« im Verlag Veröld, Reykjavík.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe September 2022
Copyright der Originalausgabe © 2020 Yrsa Sigurdardóttir
Published by Agreement with Salomonsson Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-28286-8V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Ein besonderer Dank für die Unterstützung an:
Sigurjón Björnsson und Guðmundur Ólafsson von der Radarstation in Stokksnes. Jóhann Hilmar Haraldsson, Kriminalpolizist in Höfn. Laufey Guðmundsdóttir von Glacier Journey. Ásgeir Erlendsson und Ásgrímur L. Ásgrímsson von der Küstenwache. Bryndís Bjarnarson von der Gemeinde Hornafjörður. Gunnar Ásgeirsson und Hjalti Þór Vignisson von der Fischereifirma Skinney-Þinganes hf.
Dieses Buch ist Fiktion. Die Figuren und Ereignisse sind die Erfindung der Autorin und haben nichts mit den in der Danksagung genannten Personen zu tun. Für alle Fehler ist die Autorin verantwortlich. Ortskundige und Einwohner von Hornafjörður werden auf einige Details stoßen, die für die Geschichte verändert wurden. Die Berghütte Thule ist erfunden.
Dieses Buch widme ich meinem VaterSigurður B. Þorsteinsson.
Prolog
Die Frau auf der Treppe sah ganz anders aus, als Kolbeinn sie sich am Telefon vorgestellt hatte. Die tiefe Stimme passte nicht zu ihrer schlanken Figur und ihrer freundlichen Ausstrahlung. Er hatte eine viel verlebtere Person erwartet, mit Zigarette im Mundwinkel und einem Wodka-Flachmann in der Jackentasche. Die Frau, die vor seiner Haustür stand, trank bestimmt lieber Spinat-Smoothies als Alkohol und rauchte garantiert nicht. Als sie ihren Namen sagte, bestand jedoch kein Zweifel, dass es sich um die Frau handelte, die ihn angerufen hatte.
»Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte erst jetzt was in der Stadt zu erledigen.« Sie gab ihm einen schweren, ausgebeulten Pappkarton, wahrscheinlich voller Bücher. »Wir haben ihn, wie gesagt, auf dem Dachboden gefunden. Hinter einem Stapel alter Dämmplatten. Deshalb haben Sie ihn bestimmt übersehen, als Sie das Haus leergeräumt haben.«
Kolbeinn entschuldigte sich dafür, dass sein Bruder und er den Dachboden nicht genauer durchforstet hatten. Die Frau nahm es ihm nicht übel und entgegnete, das sei doch kein Problem. Sie hätte selbst ein Fahrrad im Fahrradkeller vergessen, als ihr Mann und sie aus ihrer alten Wohnung ins Haus seines Vaters gezogen seien. So was passiere jedem mal.
Der Karton war ganz eingestaubt, und Kolbeinn stellte ihn ab. Auf der Vorder- und Rückseite prangte der Schriftzug einer Margarinenmarke, die nicht mehr auf dem Markt war oder die er jedenfalls noch nie im Laden gesehen hatte. Der Karton musste vor Jahrzehnten gepackt worden sein.
Plötzlich fiel der Frau noch etwas ein. »Ach ja, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber den wollte ich nicht wegschmeißen.« Sie zog eine kleine durchsichtige Plastiktüte mit einem braunen undefinierbaren Gegenstand aus ihrer Anoraktasche und hielt sie ihm hin. »Das ist ein Schuh. Wir haben ihn im Herbst gefunden, als wir für unsere Terrasse im Garten ein Loch ausgehoben haben. Der gehörte bestimmt Ihnen oder Ihrem Bruder.«
Wenn man genau hinsah, konnte man in der Plastiktüte einen Schuh ausmachen, und zwar einen braunen Schnürschuh aus Leder für Kleinkinder. Wobei nicht erkennbar war, ob es sich um seine ursprüngliche Farbe handelte, vielleicht war er mal schneeweiß gewesen. Die Schnürriemen hatten sich jedenfalls verfärbt und waren jetzt braun wie die Erde, in der er gelegen hatte.
Unabhängig von der Farbe galt für den Schuh dasselbe wie für die Margarinenmarke: Kolbeinn hatte ihn noch nie gesehen. Was nicht viel besagte, denn er hätte einem Kind von höchstens drei oder vier Jahren gepasst, und Kolbeinn erinnerte sich an nichts aus dieser Zeit. Womöglich hatte der Schuh tatsächlich ihm gehört, jedenfalls bestimmt jemandem aus der Familie oder einem Kind, das bei ihnen zu Besuch gewesen war. Seine Eltern hatten das Haus gebaut, und der Schuh hatte ja wohl nicht auf dem Grundstück gelegen, als sie es übernahmen.
Kolbeinn hob den Kopf und blickte der Frau ins Gesicht. »Danke, das ist ja witzig.« Er hatte den Eindruck, dass sie enttäuscht war, weil er nichts weiter zu diesem antiken Fund zu sagen wusste. Vielleicht hatte sie eine spannende Geschichte darüber erwartet, wie der Schuh verloren gegangen war, aber die gab es nicht. Kolbeinn bemühte sich, noch etwas Freundliches hinzuzufügen. »Der wurde bestimmt lange gesucht. Damals hatten wir noch nicht so viele Klamotten und Schuhe.« Er drehte die Plastiktüte in der Hand und musterte den Kinderschuh. »Wie ist der bloß in den Boden gekommen? Als mein Bruder und ich aufwuchsen, war der Garten längst bepflanzt.«
Die Frau nickte. »Ja, schon seltsam. Andererseits auch nicht, wir haben ihn nämlich direkt neben dem Fahnenmast gefunden. Wahrscheinlich ist er in das Loch für das Fundament gefallen, und niemand hat es bemerkt.« Sie warf ihm einen leicht panischen Blick zu. »Wir haben den Fahnenmast abgebaut. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung.«
Er grinste. »Ja, klar. Das Haus gehört jetzt Ihnen, und Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Der Fahnenmast war nicht besonders beliebt, zumindest nicht bei meiner Mutter. Sie hat mir mal erzählt, dass sie nur ein einziges Mal geflaggt haben, und zwar auf halbmast. Aus welchem Anlass, weiß ich nicht, aber sie meinte, sie hätte meinen Vater hundertmal gebeten, ihn abzubauen.«
Die Frau wirkte erleichtert. »Wenn er ihn selbst aufgestellt hat, verstehe ich gut, dass er ihn nicht wieder abbauen wollte. Wir brauchten einen kleinen Kran, um das Fundament zu entfernen, ein Ölfass mit Zement.«
Das überraschte Kolbeinn nicht. Sein Vater war bekannt dafür gewesen, keine halben Sachen zu machen, sowohl auf See als auch an Land. Wenn er einen Fahnenmast aufstellte, dann würde dieser Mast alle vorstellbaren Unwetter überstehen – und auch alle unvorstellbaren.
Sie plauderten noch ein wenig über dies und das. Er fragte sie, wie es ihr in Höfn gefalle, und sie sagte, sie sei sehr zufrieden. Dann fragte sie ihn, ob er vorhabe, noch mal in den Osten zu ziehen, und er antwortete, das könne er sich nicht vorstellen. Er sei längst zum Städter geworden, er sei ja schon als Kind nach Reykjavík gezogen, nach der Scheidung seiner Eltern.
Dann gingen ihnen die Gesprächsthemen aus. Ihre Wege hatten sich nur gekreuzt, weil sein Bruder und er dem Ehepaar das Haus ihres Vaters verkauft hatten. Während der Abwicklung hatten sie die Käufer kein einziges Mal getroffen und alle Formalitäten einem Immobilienmakler in Höfn überlassen. Möglicherweise wäre der Verkauf schneller über die Bühne gegangen, wenn sie sich intensiver darum gekümmert hätten, aber sie hatten es beide nicht eilig gehabt. Ihr Vater war recht wohlhabend gewesen, und es hatte keine Dringlichkeit bestanden, das Haus und die Wertgegenstände zu veräußern. Bei der Abwicklung hatten sie lediglich dem Verkauf zugestimmt und die Verträge unterzeichnet. Ihr Vater war tot, und ihre Mutter besaß keine Anteile mehr an dem Haus. Was allerdings nicht viel geändert hätte, denn sie konnte wegen ihrer fortgeschrittenen Demenz kaum noch etwas machen. Sie hätte noch nicht einmal gewusst, wie sie den Stift halten sollte, um den Kaufvertrag zu unterzeichnen, falls sie überhaupt noch ihren Namen schreiben konnte.
Nach einer kurzen, verlegenen Pause fragte Kolbeinn, ob er ihr einen Kaffee anbieten könne, aber die Frau lehnte dankend ab und sagte, sie habe eine lange Fahrt vor sich und müsse los, solange es noch hell sei. Er bedankte sich für den Karton und den Schuh, und dann verabschiedeten sie sich.
Kolbeinn blickte der Frau hinterher und winkte ihr aus der Türöffnung noch einmal zu, als sie ins Auto stieg. Dann zog er die Haustür zu, die Plastiktüte noch immer in der Hand. Es war nett von ihr gewesen, den Schuh nicht einfach wegzuwerfen, aber im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, wann er es selbst tun würde. Er machte sich nicht viel aus altem Krempel, und ein Kinderschuh, der jahrelang im Erdboden gelegen hatte, gehörte eindeutig in diese Kategorie.
Vielleicht konnte sein Bruder etwas damit anfangen, vielleicht war es ja sein Schuh gewesen. Sie hatten beide nicht viel aus dem Nachlass behalten, weil ihnen die Gegenstände und Möbel ihres Vaters nicht besonders wichtig waren. Nachdem sie mit ihrer Mutter nach Reykjavík gezogen waren, hatten sie nur gelegentlich Kontakt zu ihm gehabt und verbanden mit diesen Dingen kaum Erinnerungen. Das war ihnen klar geworden, als sie zusammen in den Osten gefahren waren, um das Haus leerzuräumen. Deshalb hatten sie auch entschieden, es zu verkaufen und den meisten Hausrat zu entsorgen.
Sie hatten ungefähr genauso viel behalten wie diese eine Kiste und nun diesen Kinderschuh.
Kolbeinn fischte den Schuh aus der Plastiktüte. Das eingetrocknete Leder verströmte einen modrigen Geruch nach Erde. Der Schuh war hart und die Schnürriemen steif, fast so, als wäre es der Abguss eines Schuhs. Kolbeinn drehte ihn hin und her, aber er kam ihm nicht bekannt vor. Erst als er in das Schuhinnere schaute, kam ihm eine Erinnerung an seine Kindheit.
Oberhalb der Ferse ließ sich ein Stoffschildchen erahnen, und mit genau solchen Schildchen hatte seine Mutter alle ihre Kleidungsstücke bis weit in die Teenagerzeit gekennzeichnet. Darauf standen ihre Namen, damit nichts verloren ging, wenn sie mal etwas vergaßen oder liegenließen.
Der Schuh gehörte also wahrscheinlich seinem Bruder oder ihm. Kolbeinn kratzte an dem Schildchen herum, in der Hoffnung, dass die roten aufgestickten Buchstaben zum Vorschein kämen, aber vergeblich. Dabei schabte der Schnürsenkel über den Schuh, und die ursprüngliche Farbe des Leders blitzte auf.
Kolbeinn zuckte zusammen. Wenn ihn nicht alles täuschte, war der Schuh rosa. Völlig ausgeschlossen, dass er seinem Bruder oder ihm gehört hatte. Auch wenn Kinder heutzutage nicht mehr unbedingt farblich nach Geschlecht eingekleidet wurden, war das in der Generation seiner Eltern noch anders gewesen. Besonders bei seinem Vater. Er hätte seinen Söhnen niemals rosafarbene Schuhe gekauft, zumal er wesentlich älter und noch altmodischer gewesen war als ihre Mutter.
Aber warum hatte seine Mutter die Schuhe eines fremden Mädchens markiert? Es war so gut wie ausgeschlossen, dass das jemand anders gewesen sein könnte. Seine Mutter war die Einzige, die Kleidung auf diese Weise kennzeichnete – andere Mütter schrieben, wenn überhaupt, mit Filzstift die Namen hinein. Das wusste Kolbeinn noch, weil sein Bruder und er in der Schule deswegen gehänselt wurden. Andere Mütter hatten etwas Besseres mit ihrer Zeit anzufangen, als die Namen ihrer Kinder auf winzige Stoffstreifen zu sticken.
Kolbeinns Neugier war geweckt. Er beschloss, die Erde von dem Schildchen abzuwaschen, vielleicht konnte man dann den Namen lesen.
Während er den Schuh im Spülbecken bearbeitete, wurde das Wasser immer bräunlicher. Seine Finger waren schon fast taub, als er endlich meinte, einen Teil der Schrift zu erkennen.
Der erste Buchstabe war eindeutig ein S. Dann kam entweder ein A, ein E oder ein O. Danach ein L, gefolgt von zwei undefinierbaren Buchstaben und am Ende wahrscheinlich ein R. Er brauchte nicht lange, um auf passende Frauennamen mit sechs Buchstaben zu stoßen, die mit S anfingen und mit R aufhörten. Im Namensverzeichnis im Internet standen nur zwei: Salvör und Sólvör.
Kolbeinn musterte den Schuh.
Salvör.
Der Name sagte ihm etwas. Doch trotz aller Bemühungen entglitt ihm die Erinnerung immer wieder, wenn er sie heraufbeschwor, so als wolle er Staub zu fassen bekommen.
Kolbeinn legte den Schuh auf die Abtropffläche und sah zu, wie das braune Wasser im Abfluss versickerte. Er hatte ein merkwürdiges Gefühl und versuchte alles zu verdrängen, was mit dem Namen zusammenhing. Wenn man sich nicht auf eine Erinnerung versteift, taucht sie manchmal von selbst wieder auf, wie ein Kind, das sich erst für einen interessiert, wenn man es einfach ignoriert.
In diesem Moment klingelte Kolbeinns Handy. Es war die Pflegerin aus dem Heim seiner Mutter. Sie beschwor ihn, sofort zu kommen, seine Mutter habe vermutlich einen Herzinfarkt gehabt, und es sei unklar, wie es weitergehe.
Das Leben seiner Mutter war schon lange nicht mehr annähernd so, wie man es sich als gesunder Mensch wünschte, und in den letzten Monaten war es stetig bergab gegangen. Trotzdem hatte Kolbeinn einen solchen Anruf auf keinen Fall gewollt. Er stammelte etwas, während er um Fassung rang, und sagte dann, er sei schon unterwegs.
»Informieren Sie Ihren Bruder?«
Als Kolbeinn bejahte, fügte die Pflegerin noch hinzu: »Und Ihre Schwester. Ihre Mutter möchte unbedingt, dass sie kommt. Man kann sie zwar schwer verstehen, aber seit dem Infarkt wiederholt sie das immer wieder. Bitte informieren Sie also auch Ihre Schwester.«
»Meine Schwester?«
»Ja.« Die Krankenschwester stutzte. »Salvör. Sie möchte ihre Tochter Salvör sehen.«
1. Kapitel
Es gab keine menschlichen Spuren. Überall blendend weißer unberührter Schnee. Nichts Lebendiges war zu sehen, kein Wunder, denn an diesem öden Ort konnten mitten im tiefsten Winter nur wenige Tiere überleben. Das war überdeutlich geworden, als sie an einem Schafkadaver vorbeigekommen waren. Er steckte fast komplett im Schnee, und an dem bisschen Fell, das herausragte, hingen festgefrorene Schneeklümpchen. Die Schafe, die beim jährlichen Abtrieb im Herbst in dieser Gegend zurückblieben, hatten kaum eine Chance. Der Anblick war deprimierend, und sie blieben nicht lange stehen. Sie konnten für das arme Tier nichts mehr tun.
Mitten auf einer offenen, ungeschützten Fläche stand eine stattliche Holzhütte. Ihr verblichener Anstrich hatte schon bessere Zeiten erlebt, die Farben mussten einmal heller und leuchtender gewesen sein. Trotz ihres verwitterten Äußeren stach die Hütte ins Auge. Moosgrün und rostrot in einer vollkommen weißen Welt.
Jóhanna lauschte. Von der Hütte drang kein Laut herüber. Bis auf das Knirschen des Schnees unter Þórirs Sohlen herrschte absolute Stille. Nichts. Selbst der Wind hielt den Atem an, als hätte er bei den jüngst vergangenen Stürmen all sein Pulver verschossen. In den letzten Wochen hatten sich die Tiefs auf der Wetterkarte aneinandergereiht, eins folgte auf das andere. Irgendwann hatte Jóhanna den Fernseher ausgeschaltet, wenn der Wetterbericht kam. Dieser Mist frustrierte einen nur. Das Wetter machte einfach, was es wollte.
»Hier ist niemand.« Þórir von der Reykjavíker Rettungswacht war neben sie getreten. »Keine Spuren und keine Geräusche.«
Jóhanna sagte nichts. Das war überflüssig. Sie zeigte auf den schneebepackten Hang, der sich wie eine Schale um die Ebene mit dem Holzhaus zog. »Was hältst du davon?« Etwas weiter oben ragte ein Rentiergeweih aus dem Schnee. So schien es zumindest. »Ist das ein Geweih oder sind das Äste?«
Þórir zuckte die Achseln. Die Bewegung war wegen seines voluminösen Overalls kaum erkennbar. Jóhanna war genauso angezogen, auf der Vorder- und Rückseite ihres Overalls prangte das Logo der Rettungswacht Hornafjörður. »Keine Ahnung. Ein Mensch ist es jedenfalls nicht.«
Dem hatte Jóhanna nichts hinzuzufügen. »Wir sollten einen Blick in die Hütte werfen, wenn wir schon den weiten Weg hergekommen sind. Vielleicht sind sie ja trotzdem da, auch wenn man nichts hört. Vielleicht schlafen sie.«
»Oder sind total erschöpft.«
Die dritte Möglichkeit erwähnten sie beide nicht. Stattdessen stapften sie durch den verharschten Schnee auf die Hütte zu. Wenn es angebracht war, konnten sie beide schweigen, wofür Jóhanna dankbar war. Bei solchen Suchaktionen waren ihr schon oft Leute zugeteilt worden, die ununterbrochen redeten, selbst wenn sie nur einsilbig oder gar nicht antwortete. Dann quasselte die betreffende Person nur noch mehr, um Jóhannas Einsilbigkeit auszugleichen. Wenn sie von einer solchen Suche zurück nach Hause kam, klingelten ihr buchstäblich die Ohren – und ihrem Teampartner tat vermutlich der Kiefer weh, was die Sache auch nicht besser machte.
Jóhanna wusste, dass ihre Kollegen von der freiwilligen Rettungswacht glaubten, sie hätte den Schwarzen Peter gezogen, als ihr Þórir als Teampartner zugeteilt wurde. Er war zusammen mit Leuten von anderen Rettungsdiensten aus verschiedenen Landesteilen angereist, um sie bei der Suche zu unterstützen. Da er aus Reykjavík stammte und eine spezielle Ausbildung im Katastrophenmanagement hatte, hielt man ihn für einen Besserwisser, der die Rettungswachten auf dem Land nicht für voll nahm. Dieses Vorurteil beruhte lediglich darauf, dass der Mann offenbar gedacht hatte, er werde in der Kommandozentrale in Höfn eingesetzt. Dort gab es aber schon genug Personal, deshalb lieh man ihm kurzerhand einen Overall und schickte ihn mit auf die Suche. Bis auf dieses Missverständnis war Jóhanna nichts an ihm aufgefallen, was die Vermutung ihrer Kollegen bestätigt hätte. Im Gegenteil, der Mann hatte ihr sogar die Führung überlassen und war ihr kommentarlos gefolgt. Dennoch wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie unter Beobachtung stand und ihr Verhalten bewertet wurde.
Sie stiegen auf die Holzterrasse vor der Hütte, die wie alles andere mit Schnee bepackt war. Jóhanna ließ den Blick über die Vorderseite des Hauses schweifen und sah, dass die Fensterläden festgenagelt waren, was allerdings nicht viel aussagte. Wer im Winter in einer Wanderhütte Schutz suchte, würde daran nichts ändern. Wer wollte schon durchs Fenster schauen, wenn er nach einer anstrengenden Wanderung endlich in der Hütte angelangt war? Die Fensterläden boten zusätzlichen Schutz vor den Stürmen, die zu dieser Jahreszeit unentwegt tobten. Besonders in den letzten Jahren. Jóhanna konnte sich nicht erinnern, dass das Wetter in ihrer Kindheit so heftig gewesen war.
Über der Tür hing ein Holzschild mit dem Namen der Hütte: Thule. Sie starrten es an, sprachen aber nicht aus, was sie dachten. Diese Beschriftung der Amerikaner passte nicht in die isländische Wildnis. Gemeinsam räumten sie den Eingang vom Schnee frei und schippten danach noch ein bisschen im Türbereich herum. Niemand wollte aufmachen. Auch wenn nichts darauf hinwies, dass sich die Gruppe, nach der sie suchten, in der Hütte aufhielt, war ihnen beiden klar: Wenn die Leute da drin waren, dann lebten sie nicht mehr.
Als sich die Räumungsarbeiten peinlich in die Länge zogen, atmete Jóhanna tief ein. Es gab nichts mehr, was sie davon abhielt, die Tür aufzumachen. Die kalte Luft strömte in ihre Lungen, beflügelte sie aber nicht, sondern ließ sie erschauern. Sie redete sich ein, das hätte nichts mit der Stille in der Hütte zu tun.
»Hast du schon mal einen Toten gefunden?«, fragte Þórir, der auch nicht gerade erpicht darauf war, die Tür aufzumachen.
Jóhanna wollte in diesem Moment auf keinen Fall daran denken. Diese Erinnerungen verdrängte sie eigentlich immer, wenn sie sich bemerkbar machten. »Ja. Leider.«
Þórir schwieg kurz und fragte dann weiter: »Mehrere?«
Jóhanna stöhnte innerlich. Falls das ein Test sein sollte, dann war er miserabel. »Drei. Und schon viele Schwerverletzte.« Vor ihrem inneren Auge spulten sich Bilder von dem Busunglück auf der Hellisheiði ab, zu dem sie vor Jahren gerufen worden war, als sie noch in Reykjavík gewohnt hatte. Für drei Fahrgäste endete die Reise auf dem zerklüfteten Lavafeld, nachdem sie aus dem Bus geschleudert worden waren. Dann kamen die Bilder von ihrem eigenen Unfall. Wie sie am Straßenrand lag, zerschunden und kaum noch bei Bewusstsein. Es war knapp gewesen, und sie bemühte sich, ihre Gedanken in genau diese Richtung zu drängen. Vielleicht würde es den verirrten Wanderern genauso ergehen. Vielleicht würden sie gerettet, auch wenn es nicht gut aussah. Aber es gelang ihr nicht. Sie schloss die Augen und verzog schmerzhaft das Gesicht. Dann zwang sie sich zurück in die Gegenwart. »Und du?«
»Ja. Leider.« Þórir schien genauso wenig über seine Erlebnisse reden zu wollen wie sie. Möglicherweise hatte er ihr nur diese Frage gestellt, um herauszufinden, wie routiniert sie war und wie sie reagieren würde, falls sie in der Hütte Leichen fanden.
Aber er brauchte sich keine Sorgen zu machen, dass sie kollabieren würde. Jóhanna öffnete die Augen und straffte sich. »Ich vermute, dass die Hütte genauso leer ist wie im Herbst, als der Hüttenwart die Tür hinter sich zugezogen hat. Wir müssen mit nichts Ungewöhnlichem rechnen.« Dabei war sie davon gar nicht so überzeugt. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem trostlosen Ort am Rande des Hochlands. Hier sollte es eigentlich keine Menschen geben. Und auch keine Hütte. Hier sollte die Natur ihre Ruhe haben.
Unter dem Schnee, in der Ebene rings um die Hütte, lagen karge Wiesen. Sie waren angelegt worden, aber die Versuche, die Landschaft zu gestalten, hatten nicht viel gebracht. Jeden Sommer wurde neues Gras ausgesät, weil sich die Kahlflächen sonst immer weiter ausbreiten würden. Jóhanna war selbst letzten Sommer mit ihrem Mann hier gewesen und hatte dabei geholfen.
Diese Tour war ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen. Die Natur hatte sich von ihrer schönsten Seite gezeigt, und eine solche Farbenpracht wie in diesem einst aktiven vulkanischen Gebiet hatte Jóhanna noch nie gesehen. Hier brauchte man keine weite Entfernung, damit die Berge sich blau färbten. Dafür sorgten die geologischen Formationen, die nun unter dem Schnee lagen. Manche Hänge waren bunt wie Regenbogen. Sie hatten nicht nur die Hütte besucht, die jetzt vor ihnen stand, sondern auch ein paar andere. Es war eine Aktion zur Unterstützung der Rettungswacht gewesen, und die meisten Hüttenbesitzer hatten sich bereitwillig beteiligt und den Arbeitstrupp als Gegenleistung kreuz und quer durch das Gebiet geführt. Doch das körperliche Wohlbefinden und die mentale Ausgeglichenheit, die Jóhanna bei dieser Tour empfunden hatte, waren jetzt weit weg.
Das lag nicht nur an dem Winterkleid, das die unfassbare Schönheit der nackten Gesteinsschichten verhüllte. Es war vor allem die Suche selbst, die ihr nicht behagte. Es gab nämlich kaum Anlass für Optimismus, obwohl die Suchleitung sich bemüht hatte, vor dem Abmarsch Zuversicht zu verbreiten. Das hatte nicht gut funktioniert, zumal sie nicht viele Informationen bekommen hatten. Das Wenige, was die Rettungswacht überhaupt erfahren hatte, war höchst alarmierend.
Man suchte vier oder fünf Personen, alle Isländer, von denen es seit gut einer Woche kein Lebenszeichen mehr gab. Sie waren erst nach fünf Tagen vermisst worden, und wegen des Wetters konnte die Suche erst jetzt starten. Solange der Sturm anhielt, rekonstruierte die Polizei den Weg der Wanderer über deren Mobiltelefone. Sie waren bis zur Bergstraße Kollumúlavegur, die in das Naturschutzgebiet Lónsöræfi führte, noch im GSM-Netz gewesen. Dort waren die Verbindungen abgerissen.
Unklar war, ob eine fünfte Person dabei gewesen war. Die Handydaten stammten von vier Geräten, aber das allein war noch keine Bestätigung für die genaue Personenzahl. Die fünfte Person hatte möglicherweise kein Handy dabei oder es ausgeschaltet. Man vermutete, dass sie zu fünft waren, weil die beiden vermissten Paare nach Höfn geflogen waren und, soweit bekannt, weder einen Mietwagen genommen, noch sich ein anderes Fahrzeug geliehen hatten. Sie hatten eine Nacht in einem Hotel im Ort verbracht, und die Mitarbeiterin, bei der sie ausgecheckt hatten, hatte angeblich gesehen, dass vor dem Hotel jemand wartete, um sie abzuholen. Ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelte, wusste sie nicht.
Was die Sache verkomplizierte, war, dass neben den Straßen oder den befahrbaren Pisten ins Hochland kein Auto gefunden wurde. Falls es sich um einen erhöhten Geländewagen handelte, würde man ihn womöglich noch finden, aber vielleicht hatte auch jemand die Gruppe raufgebracht und war dann wieder nach Hause gefahren. In diesem Fall würde sich der Fahrer wahrscheinlich melden, wenn in den Nachrichten über die Suchaktion berichtet wurde.
Es war nichts Neues, dass sich Leute im Hochland verirrten. Und es kam auch nicht selten vor, dass sich Leute trotz schlechter Wettervorhersage ins Ungewisse stürzten. Aber dass eine Gruppe Isländer im Winter einen Trip in die Wildnis machte, war sehr ungewöhnlich. Wenn sich ausnahmsweise mal Einheimische bei solchen Bedingungen verirrten, handelte es sich meistens um eine Gruppe Freunde auf einer Motorschlitten- oder Skitour. Im Herbst kamen noch die Schneehuhnjäger dazu.
Doch in diesem Fall war es anders. Die Gesuchten waren, soweit man wusste, keine Wintersportler. Sie waren auch keine großen Outdoor-Fans oder bekannten Adventurer. Die beiden Männer hatten wohl schon mal Rentiere gejagt, aber die Jagdsaison war längst vorbei, und es gab keine Herden mehr in dieser Gegend. Die Frauen hatten nie eine Jagdlizenz beantragt. Sie waren alle Städter, zwei Paare um die dreißig, und ihre Pläne lagen im Dunkeln. Vielleicht waren sie auf der Jagd nach dem perfekten Instagram-Winterfoto.
Doch selbst diese Erklärung war fragwürdig. Der Südosten Islands besaß schließlich nicht das Alleinrecht auf winterliche Verhältnisse. Die Leute hätten nicht aus Reykjavík wegfliegen müssen, um in den Schnee zu gelangen.
Offenbar hatten sie im engsten Freundeskreis und auf der Arbeit angekündigt, dass sie eine knappe Woche fort sein würden. Auf einer Tour im Inland, außerhalb des Versorgungsbereichs und ohne Netz. Über den Zweck und das genaue Ziel der Tour sagten sie nichts. Nach Aussage einiger Freunde sprachen sie von einem Adventure-Trip. Die meisten dachten, es handele sich um eine organisierte Tour, die mit diesem Schlagwort Werbung machte.
Noch hatte man kein Reiseunternehmen ausfindig gemacht, dass mitten im Winter Adventure-Trips nach Lónsöræfi anbot. Zum Glück. Ein solcher Wahnsinn ließe sich kaum organisieren, geschweige denn verkaufen.
Der Wanderverein in Austur-Skaftafell hatte eine Anfrage für die Múlaskáli-Hütte bekommen, die von der Gruppe stammen konnte. Man hatte geantwortet, die Hütte sei in dieser Jahreszeit nicht bewirtschaftet, sie werde zwar zur Sicherheit nicht abgeschlossen, aber im Winter nicht vermietet. Der Mann, der die Anfrage entgegennahm, sagte, er hätte den Eindruck gehabt, dass der Anrufer sich nichts sagen lassen wollte und womöglich trotzdem in der Hütte übernachten würde.
Deshalb wurde ein Großteil des Suchtrupps dorthin geschickt, um rund um die Hütten Múlaskáli und Múlakot zu suchen. Letztere war eine Berghütte, in der der Ranger des Vatnajökull-Nationalparks den Sommer verbrachte.
Aber es gab noch mehr Hütten in dem riesigen Gebiet, und die übrigen Rettungsleute wurden in kleinere Gruppen aufgeteilt und jeweils zu einer geschickt. Kein weiterer Hüttenbesitzer hatte eine Vermietungsanfrage erhalten, aber es war nicht ausgeschlossen, dass die Wanderer in einer der Hütten Zuflucht gesucht hatten. Es handelte sich um eine Hütte beim Berg Eskifell, die in Privatbesitz war, zwei Hütten vom Wanderverein Fljótsdalshérað, davon eine beim Berg Geldingafell und die andere am See Kollumúlavatn, ein Hütte vom Wanderverein Djúpavogur bei Leirás und um die Hütte, die man Jóhanna und Þórir zugeteilt hatte. Außerdem wurden noch zwei Leute zu den verlassenen Höfen Eskifell und Grund im Víðidalur geschickt, falls die Vermissten dort auftauchen sollten.
Es war das Prinzip der Schrotflinten-Methode, weil man nichts über die Pläne der Gruppe wusste. Die Verstärkung war höchst willkommen, denn auch wenn die Rettungswacht personell gut aufgestellt war, konnte sie eine so umfangreiche Suche nicht alleine stemmen.
Die Thule-Hütte, die Jóhanna und Þórir überprüfen sollten, war im Besitz des US-Militärs gewesen, als die Amerikaner noch die Radarstation in Stokksnes betrieben hatten. Als die Radarstation von der Küstenwache übernommen wurde, gab es die Hütte als Bonus dazu. Soweit Jóhanna wusste, kam das Geschenk der Küstenwache eher ungelegen, denn dort hatte man bei der täglichen Arbeit schon genug Action und war nicht scharf darauf, in den Sommerferien auch noch Wanderungen ins Hochland zu unternehmen.
Jóhanna machte einen Schritt zur Tür, aber Þórir kam ihr zuvor. Wahrscheinlich wollte er die Ehre der Hauptstadtregion verteidigen. Vielleicht fürchtete er auch, sie würde ihn für einen Feigling halten, aber das stimmte nicht. Wer in einer solchen Situation keinen Respekt hatte, war bei der Rettungswacht falsch.
Jóhanna ließ Þórir den Vortritt und sah zu, wie er die Tür aufstieß und in die Dunkelheit starrte. An seinem verwunderten Gesicht konnte sie ablesen, dass dort etwas war, womit er nicht gerechnet hatte, aber es war bestimmt keine Leiche. Er wirkte eher irritiert als geschockt.
Jóhanna schob die Tür weiter auf und erkannte, was es war. Auf dem Boden hinter der Tür lagen Kleidungsstücke, ein Anorak, eine Überziehhose, Handschuhe, Winterschuhe und weitere normale Anziehsachen. Vom Eingang trat man direkt in einen großen Vorraum, der dunkel und verlassen aussah. Jóhanna nahm ihre Taschenlampe und leuchtete den Boden hinter dem Kleiderhaufen ab. In dem Staub, der über allem lag, waren ziemlich viele Fußspuren, aber es war schwer zu sagen, von wie vielen Personen.
»Sind das ihre Fußspuren?« Þórir drehte sich zu Jóhanna. »Und ihre Klamotten? Oder liegen die schon seit dem Herbst hier?«
Jóhanna wusste es auch nicht. Falls der Anorak und die Wanderschuhe jemandem aus der Gruppe gehörten, konnte er oder sie nicht weit sein. Es würde ja niemand ohne Jacke und Schuhe in den Schnee hinauslaufen.
Die Stille wurde noch drückender. Jóhanna steckte den Kopf durch die Türöffnung und atmete durch die Nase ein. Erleichtert stellte sie fest, dass es in der Hütte nicht wie in einem Mausoleum roch. Wobei das nicht viel besagte, denn drinnen war es fast genauso kalt wie draußen.
Sie betrachteten die bunten Kleidungsstücke, und Jóhanna hatte das dumpfe Gefühl, dass sie noch nicht lange dort lagen. Sie wirkten sauber, und auf ihnen hatte sich kein Staub gesammelt. Jóhanna und Þórir blieb nichts anderes übrig, als reinzugehen und die Hütte zu durchsuchen. Schließlich waren sie den langen beschwerlichen Weg hergekommen, um nach den Vermissten zu suchen. Sie hatten sich auf der Rückbank des Geländewagens durchschütteln lassen, waren in der Nähe des Wanderwegs rausgelassen worden und hatten sich durch den Schnee gekämpft. Waren durch Schneewehen gestapft und hatten schmale Schluchten durchquert, waren ausgerutscht und gestolpert. Umkehren kam überhaupt nicht in Frage.
»Lass uns die Hütte durchsuchen.« Jóhanna quetschte sich an Þórir vorbei, der ihr Platz machte, entweder aus Höflichkeit oder weil er nicht vorgehen wollte. Sie kniete sich neben den Kleiderhaufen und untersuchte die Sachen. »Der Größe nach müssten sie einer Frau gehören. Oder mehreren Frauen.« Sie seufzte. »Komm, wir gehen es systematisch an. Lass uns unten anfangen.«
Die Luft in der Hütte war abgestanden und muffig. Als Þórir die Eingangstür zuzog, wurde es hinter dem Schein von Jóhannas Taschenlampe stockdunkel. Das trübe Winterlicht drang nicht durch die dicken Fensterläden. Schnell öffnete er die Tür wieder, aber das Licht reichte nicht weit. Die Hütte war groß und hatte zwei Stockwerke.
Þórir holte seine Taschenlampe heraus, und die Lichtverhältnisse wurden etwas besser. Jóhanna wünschte sich, der Schein der Lampen wäre stärker und großflächiger, aber daran ließ sich nichts ändern. Sie traten in den Hauptraum und teilten sich auf.
Zwanzig Minuten später standen sie wieder auf der Terrasse, kein bisschen schlauer. Sie hatten alle möglichen Spuren von Leuten in der Hütte gefunden. In einem Zimmer lag ein umgedrehtes Sockenpaar unter dem Bett, das, anders als der Fußboden, nicht staubig war. In der Küche waren leere Lebensmittelverpackungen, und man konnte sehen, dass gekocht worden war. Den Verfallsdaten auf den Verpackungen nach zu urteilen, lagen sie noch nicht lange im Müll. Im Badezimmer stand ein Glas mit einer Zahnbürste und einer Zahnpastatube, und auf der Ablage über dem Waschbecken lag eine fast leere Packung Feuchttücher. In einem Mülleimer neben der Toilette waren Zahnseide und zerknüllte Tücher, mit denen Wimperntusche abgewischt worden war. Neben dem Waschbecken hing ein kleines Handtuch, das sich trocken anfühlte. Dasselbe galt für ein Geschirrtuch, das über dem Handgriff am Herd hing. Trocken, aber nicht staubig. Fast überall konnte man sehen, dass Leute in der Hütte gewesen waren.
Doch trotz ausgiebiger Suche hatten sie niemanden gefunden.
Jóhanna ließ den Blick von der Terrasse über die Landschaft schweifen. Überall nichts als weißer Schnee. Und das Rentiergeweih oben am Hang. Sie beschirmte ihre Augen mit der Hand, um es besser erkennen zu können. Eindeutig ein Geweih, kein verkrüppelter Strauch. Es sah aus wie eine knochige Kralle, deren Finger sich zum Himmel reckten. Unter dem Schnee schien etwas zu liegen, also war es vermutlich nicht nur ein Geweih, sondern ein ganzes Tier. Sie ließ die Hand sinken. Dieses Rentier konnte nichts mit der Wandergruppe zu tun haben. »Wo wollten sie eigentlich hin?«
Þórir zog die dunklen Augenbrauen zusammen. »Vielleicht wollten sie eine Wanderung machen und wurden von einem Unwetter überrascht. In den letzten Tagen hat es ununterbrochen geschneit, ihre Spuren sind längst verschwunden. Die Schneemengen in der letzten Zeit haben ja alle Rekorde gebrochen.«
Das stimmte und war wahrscheinlich die Erklärung. Die Gruppe hatte eine Wanderung gemacht und sich verirrt. Das Naturschutzgebiet Lónsöræfi war riesig, und es gab zahlreiche Wanderwege, die von der Hütte ausgingen. Es würde nicht leicht sein, die Leute zu finden, wenn ihre Leichen tief im Schnee vergraben lagen. Ein weiterer Sturm war im Anzug, und danach sollte es eine längere Frostperiode geben.
Hoffentlich hatten sie in einer anderen Hütte Zuflucht gefunden. Vielleicht hatte ein anderer Suchtrupp sie schon gefunden.
Doch Jóhanna konnte sich nicht lange mit diesem Gedanken trösten. Warum ließen die Leute einen Anorak, Schuhe und Überziehklamotten zurück, wenn sie zu einer Wanderung aufbrachen?
»Wir müssen schnell wieder los, bevor es dunkel wird.« Jóhannas Augen wanderten noch einmal hinauf zu dem Geweih. Das tote Tier oben am Hang ließ ihr keine Ruhe. Die Männer in der Wandergruppe waren Jäger. Wenn sie das Tier geschossen hatten, spielte das für die weitere Suche womöglich eine Rolle. Sie hatten nicht viel Zeit, aber sie konnten nicht zurückgehen, ohne das vorher abzuchecken. Falls der Grund für die Tour Wilderei gewesen war, und sie sich die Sache nicht näher anschauen würden, würde das einen schlechten Eindruck machen. Und Jóhanna war nicht bekannt für schlampiges Arbeiten. »Aber erst müssen wir uns noch das Rentier anschauen.«
Þórir hatte keine Einwände, und sie marschierten los, so schnell, wie sie es sich in dem tiefen Schnee zutrauten. Der Firn war unterschiedlich hart und an manchen Stellen hauchdünn. Stellenweise sanken sie bei jedem Schritt bis zu den Oberschenkeln ein. Das Waten wurde immer schwieriger, je höher sie den Hang hinaufstiegen. Als sie fast bei dem Geweih angelangt waren, blieb Jóhanna abrupt stehen. »Ich bin auf etwas getreten.« Sie starrte auf ihren rechten Fuß.
»Ein Stein vielleicht?« Þórir stemmte die Hände in die Hüften und schnitt eine Grimasse.
»Nein, das war kein Stein.« Jóhanna nahm den Fuß zur Seite und starrte in das Loch im Schnee. Sie atmete scharf ein und kämpfte damit, nicht das Gleichgewicht zu verlieren und rücklings den Hang hinunterzustürzen. »Oh Gott, um Himmels willen.«
Þórir kam näher, und als er neben ihr stand, wäre er selbst fast weggeknickt. Ganz unten in dem Loch sah man einen Teil von einem Gesicht. Und daraus glotzte sie ein weit aufgerissenes, starres Auge an.
2. Kapitel
Lónsöræfi – in der letzten Woche
Dröfn fühlte sich wieder fit. Endlich. Nach dem Aufstehen war ihr schlecht gewesen, aber die anstrengende Wanderung in der frischen Winterluft hatte ihre Übelkeit vertrieben. Allerdings zog es in ihren Waden, der Rucksack wurde immer schwerer, und ihre Oberschenkel brannten. Aber das war ein Klacks im Vergleich zu dem höllischen Kater. Das reinste Vergnügen.
Sie waren zu fünft, und Dröfn ging als Letzte. Ganz vorne ging Haukur, der die Tour leitete, und die anderen folgten ihm im Gänsemarsch. Die Strecke war anspruchsvoll, und sie waren nicht sehr geübt. Deshalb war es für alle sicherer, wenn sie in Haukurs Fußspuren liefen. Er hatte gesagt, es gebe hier fast überall nur schmale Pfade, sogar im Hochsommer. Ein falscher Schritt konnte übel enden.
Tjörvi, Dröfns Mann, ging direkt hinter Haukur und wollte ihm in nichts nachstehen. Dann folgten Bjólfur und seine Frau Agnes. Sie hatten genauso blass und angeschlagen ausgesehen wie Dröfn, als sie sich am Morgen gegen elf Uhr im Hotelfoyer getroffen hatten.
Die beiden hatten sich schon länger nicht mehr umgedreht, deshalb wusste Dröfn nicht, ob ihre Gesichter inzwischen wieder eine natürliche Röte angenommen hatten. Vermutlich schon. Jedenfalls ließen sie die Schultern nicht mehr so hängen wie beim Abmarsch. Da sie in einer relativ geraden Linie gingen, konnte Dröfn nicht sehen, wie es bei ihrem Mann war. Erfahrungsgemäß erholte er sich schneller von solchen Ausschweifungen als die anderen, vielleicht ließ er sich aber auch nur nicht so hängen. Sie waren seit acht Jahren ein Paar, und in dieser Zeit hatte er noch nie zugegeben, dass er einen Kater hatte – selbst wenn er kotzen musste und Schmerztabletten einwarf, als wären es Smarties. Er behauptete immer, es gehe ihm blendend.
Der Einzige von ihnen, der nicht zu viel getrunken hatte, war Haukur. Er hatte in einer Pension übernachtet, die günstiger war als ihr Hotel, worüber niemand ein Wort verlor. Er hatte nur ein Glas Rotwein getrunken und sich nach dem Essen verabschiedet, während sie zu viert weitermachten. Mehrere Gläser Rotwein zum Essen, ein zuckersüßer Dessertwein zum Nachtisch und ein Cognac zum Kaffee reichte ihnen nicht. Zurück im Hotel hielten sie es für eine gute Idee, in der Hotelbar weiterzutrinken. Diese Drinks hätten sie sich sparen sollen. Im Nachhinein betrachtet.
Haukur versuchte gar nicht erst, seinen Unmut zu verbergen, als sie sich am Morgen trafen. Er regte sich auf, weil die anderen nicht zur verabredeten Zeit da waren und einfach ausschliefen. Da sie es nicht gewohnt waren, zurechtgewiesen zu werden, schwiegen sie bei Haukurs Anschiss verbissen, zumal ein Kater eine schlechte Grundlage für Diskussionen und Rechtfertigungen war.
Dröfn wusste nicht, wie es den anderen erging, aber sie zählte leise vor sich hin, während Haukur sie zusammenstauchte. Es half, sich aufs Zählen zu konzentrieren, sonst wären ihre Kopfschmerzen bei Haukurs wütendem Gezeter nur noch heftiger geworden. »Was habt ihr euch dabei gedacht?«, »… lasst mich hier warten wie einen Idioten …« und »Am liebsten würde ich …« Der Druck und das Pochen in Dröfns Schädel verstärkten sich, aber wenn sie ihre Gedanken auf etwas anderes als die monotone Standpauke richtete, wurde es wieder besser.
Sie hörte gar nicht richtig zu, kriegte nur mit, sie hätten mit ihrem Schlendrian alle in Gefahr gebracht, und er denke darüber nach, die ganze Sache abzublasen und alleine zu gehen. Es bleibe nicht lange hell, und sie hätten keine Erfahrung. Dann ließ er sich darüber aus, dass er nicht verstehen könne, wie er überhaupt auf die Idee gekommen sei, sie mitzunehmen.
Die Wahrheit war, dass es gar nicht seine Idee gewesen war. Sie hatten sich ihm geradezu aufgedrängt. Die Tour erschien ihnen als perfekte Gelegenheit für eine kleine Abwechslung. Ohne dass sie es jemals thematisiert hätten, war ihr Leben ziemlich eintönig geworden. Allerdings war das Jammern auf hohem Niveau. In den sozialen Medien wirkte alles perfekt. Sie gingen ständig schick essen, kochten raffinierte Gerichte, tranken edlen Wein, reisten, besuchten tolle Events und hielten sich fit. Sie waren zwar nicht unbedingt Trendsetter, aber der breiten Masse immer voraus, wenn es etwas Hippes und Neues gab. Von außen betrachtet führten sie ein beneidenswertes Leben. Finanziell unabhängig, gut ausgebildet, schick und cool. Doch egal wie toll, schön oder spannend etwas ist – auf lange Sicht wird es immer langweilig.
Deshalb hatten sie zugeschlagen, als sich ihnen die Chance bot, eine ganz neue Erfahrung zu machen. Während eines gemeinsamen Abendessens bei einem dritten befreundeten Pärchen lernten sie Haukur kennen. Er redete nicht viel, aber wenn er mal das Wort ergriff, erzählte er aufregende Sachen. Unter anderem, dass er eine ziemlich krasse Expedition ins Naturschutzgebiet Lónsöræfi plane. Er müsse Daten von einem Messgerät ablesen, das am Rand des südöstlichen Teils des Vatnajökull-Gletschers stehe. Die Daten brauche er, um seine Doktorarbeit abzuschließen. Er erklärte, das Gerät sei schon länger nicht mehr abgelesen worden, und er könne nicht warten, bis es jemand anderes mache.
An diesem Punkt war der Abend schon weit fortgeschritten, und der Rotwein hatte die Grenzen des Machbaren ausgeweitet. Alles war möglich und nichts ausgeschlossen. Die Gastgeber zogen sich in die Küche zurück und räumten auf, womit sie höflich signalisierten, dass jetzt langsam Schluss sei. Doch selbst das hielt die anderen nicht davon ab, den Rotwein weiter kreisen zu lassen.
Niemand am Tisch interessierte sich auch nur im Geringsten für Haukurs Forschungen oder seine Doktorarbeit. Aber eine Expedition in ein Gebiet, das im Winter fast nie besucht wurde, war eine coole Sache. Das wäre bestimmt ein einmaliges Erlebnis, von dem man noch lange erzählen könnte.
Ach, du warst im Everest Base Camp? Tjörvi und ich wollten da auch schon mal hin, aber wir möchten keine unnötigen Flugreisen mehr machen. Klimawandel und so. Stattdessen waren wir in den Stafafell-Bergen in Lónsöræfi, mitten im Winter. Wirklich gigantisch. Anstrengend, aber lohnenswert. Echt lohnenswert. Es gibt nichts Faszinierenderes als Island.
Zu einer solchen Schilderung würde es natürlich nur kommen, wenn Haukur nicht dabei wäre, aber die Gefahr war gering. Er war neu in ihrem Freundeskreis und noch kein fester Gast bei gesellschaftlichen Events. Sofern ihn das überhaupt interessierte. Nach eigener Aussage war er so mit seinen Forschungen beschäftigt, dass er fast kein Privatleben hatte. Das Pärchen, das zu dem Abendessen eingeladen hatte, hatte ihn im Fitnessstudio kennengelernt, und Trainieren war das Einzige, was er trotz allen Stresses regelmäßig machte. Er erzählte, dieses Abendessen sei die erste Einladung seit einem halben Jahr, die er angenommen hätte, und sie würde wohl vorerst auch die letzte bleiben. Man konnte ihn wirklich nicht als Partylöwen bezeichnen.
Was sich gestern Abend bestätigt hatte. Wer selbst nicht gern feierte, konnte das bei anderen oft nicht nachvollziehen, das hatte seine Standpauke gezeigt.
Irgendwann hatte es Tjörvi gereicht. Er blaffte zurück, Haukur habe jetzt genug wertvolle Zeit mit seinem sinnlosen Genörgel verschwendet. Sie sollten endlich los und sich nicht länger über Dinge aufregen, die sich nicht mehr ändern ließen. Haukur hätte sie ja auch anrufen und wecken können, anstatt beleidigt im Auto zu warten, bis sie von selbst aufwachten.
Das wirkte, und Haukur hielt die Klappe. Seine Laune besserte sich allerdings kaum, und er war immer noch eingeschnappt, obwohl sie gut zwei Stunden gefahren und zwei weitere Stunden gewandert waren. Während der beiden Verschnaufpausen, die sie gemacht hatten, hatte er nur schweigend rumgestanden und es vermieden, die anderen anzuschauen. Im Auto bei der Anfahrt auch. Sie waren von Höfn Richtung Osten gefahren, an steilen Berghängen entlang, das Meer auf der rechten Seite. Bis auf die auffällige Radarstation in Stokksnes mit ihrem riesigen kugelförmigen Gebäude gab es nicht viel zu sehen. Kurz dahinter fuhren sie durch den Almannaskarð-Tunnel nach Lónssveit und nahmen dort die Abzweigung Kollumúlavegur, die in das Naturreservat führte. Alle Versuche, während der Fahrt Smalltalk zu halten, waren vergeblich, was allerdings nicht schlimm war, denn sobald sie die Nationalstraße verließen, verstummte ohnehin jedes Gespräch.
Der Weg war nicht geräumt, und als der höhergelegte Jeep über die nahezu unbefahrbare Piste ruckelte, wurden sie kräftig durchgeschleudert. Außerdem mussten sie mehrere fast ausgetrocknete Flussbetten durchqueren, die ein Gletscherfluss im Sommer in die Kiesfläche gegraben hatte. Das Fahren war die reinste Schleuderpartie, und der Jeep steuerte entweder senkrecht runter ins Flussbett oder senkrecht wieder raus.
Die ganz Fahrt ähnelte einer Schiffstour bei rauer See. Das langsame Schaukeln und Schlingern, bei dem der Kopf hin- und hergeschleudert wurde, belastete die Halswirbel. Selbst ohne die angespannte Stimmung wäre es unter diesen Umständen schwierig gewesen, sich zu unterhalten. Sie brauchten die Hälfte ihrer Kraft, um sich festzuhalten. Und die andere Hälfte, um sich nicht zu übergeben.
Es kam einem Wunder gleich, dass das niemandem passierte.
Aber jetzt war der Kater zum Glück nur noch eine schlechte Erinnerung. Die Anstrengung, der Sauerstoff, die saubere Luft und die erfrischende Kälte hatten Dröfn geholfen, ihn zu überwinden. Es gab nichts Besseres, als sich wieder fit zu fühlen, sei es nach einer Grippe, einer Magenverstimmung, Kopfschmerzen – oder einem Kater.
Schließlich war der Jeep nach einer halsbrecherischen Fahrt hangaufwärts, bei der Dröfn die Augen zumachen musste, auf einem Hügel zum Halten gekommen. Haukur verkündete, dass es ab jetzt nur zu Fuß weitergehe. Die Piste sei zu steil, zu rutschig und zu gefährlich. Niemand protestierte oder quengelte. Ihr Leben und ihre Gesundheit waren ihnen wichtiger. Haukur stellte den Wagen neben der Piste ab, schaltete den Motor aus und sprang raus. Die anderen folgten stumm seinem Beispiel.
Es war bereits erschreckend dämmrig, aber niemand sprach es an. Das hätte die Diskussion über ihre Verantwortungslosigkeit nur wieder befeuert, denn wenn sie rechtzeitig aufgestanden wären, hätte das trübe Winterlicht noch ausgereicht.
Immerhin half es, dass der Wanderweg schneebedeckt war. Die unberührte weiße Decke, die über allem lag, verbesserte die Sicht deutlich. Der Schnee war tief, und sie sahen kaum eine dunkle Stelle unter ihren Füßen. Das galt für die gesamte Umgebung. An den steilen Felswänden gab es ein paar schneefreie Flächen, ansonsten war alles weiß.
Trotz der Dämmerung waren sie von der spektakulären Aussicht überwältigt. Sie war anders, als Dröfn erwartet hatte, aber nicht minder beeindruckend. Die Fotos, die sie sich vor der Tour im Internet angeschaut hatte, waren alle aus dem Sommer. Sie zeigten die unglaubliche Farbpalette der Erdschichten in diesem Gebiet, die jetzt größtenteils bedeckt waren. Vereinzelt ragten Felsbuckel an den Hängen aus dem Schnee, doch ansonsten kleidete sich die Natur in ein monotones funkelndes Weiß. Trotzdem war die Landschaft gewaltig. Nur schade, dass sie die Aussicht nicht gebührend genießen konnten, weil sie immer nur ganz kurz vom Weg aufschauen durften.
Jetzt gingen sie über eine Ebene, und die Gefahr, auszurutschen und zu stürzen, war geringer. Vorher waren sie durch Schneefelder gestapft, durch Schluchten geklettert und über Geröll und Felsen gestiegen, den Blick stets nach unten auf den nächsten Schritt gerichtet.
Es war eine willkommene Abwechslung, sich ein bisschen erholen und richtig umschauen zu können. Dröfn saugte die Schönheit der Landschaft in sich auf, und in diesem Moment war nichts anderes mehr wichtig.
Auch wenn sie die sommerliche Landschaft auf den Fotos im Internet schöner fand, faszinierte sie der Anblick. Die schneeweißen unbezwingbaren Berge, die Steilhänge und Felsklippen waren majestätisch und wunderschön, aber auch furchteinflößend. Irgendwie paradox. Unter anderen Umständen wäre das unbefleckte Weiß ein Symbol für Reinheit und Unschuld gewesen, doch hier symbolisierte es etwas ganz anderes. Es verdeutlichte, wie bedingungslos sie dem Winter und dem Hochland ausgeliefert waren. Ohne die entsprechende Ausrüstung oder wenn etwas aus dem Ruder liefe, hätten sie keine Chance.
Dröfn durchfuhr ein Schauer, der nicht von der Kälte ausgelöst worden war. Sie schüttelte ihn ab und eilte weiter, denn sie war hinter der Gruppe zurückgefallen. Die anderen waren nicht langsamer geworden, um die Aussicht zu genießen. Vielleicht wollten sie warten, bis sie auf der Terrasse der Hütte standen, ihrem Nachtquartier. Was vernünftig war – nicht nur wegen des nachlassenden Lichts.
Es konnte nicht mehr weit sein. Als sie den Jeep stehen gelassen hatten, hatte Haukur gesagt, dass es bis zur Hütte ungefähr zwei Stunden dauere. Also noch eine halbe Stunde, vielleicht etwas mehr oder weniger.
Die morgige Strecke war länger, wenn sie überhaupt mitgehen würden. Sie konnten auch in der Hütte bleiben, während Haukur zum Gletscher ging, um die Messergebnisse abzulesen. Aber sie waren ja nicht mitgekommen, um in einer alten, runtergekommenen Hütte abzuhängen.
Dröfn sah, dass Haukur stehengeblieben war. Die anderen schlossen auf, und Dröfn bildete das Schlusslicht. Das überraschte sie, denn Haukur war nicht der Typ, der eine Pause einlegte, wenn es nicht mehr weit bis zum Ziel war. Vielleicht wollte er ein paar Worte an die anderen richten, bevor sie das Nachtquartier erreichten. Sich mit ihnen aussöhnen und das letzte Stück im Einvernehmen laufen. Sie hoffte es.
Bis sie sah, warum die anderen stehengeblieben waren. Im Schnee glitzerte etwas Rotes. Etwas Feuerrotes. Nachdem sie die ganze Zeit nur Weiß vor Augen gehabt hatte, wirkte die Farbe surreal. Fast so, als wären sie mitten in der frostigen Wildnis auf eine Bananenplantage gestoßen.
Tjörvi bückte sich und wischte mit seinem Handschuh den Schnee von dem Gegenstand. Dann griff er nach dem roten Stoff, zog ihn heraus und richtete sich wieder auf.
Es war eine Mütze. Haukur streckte die Hand nach ihr aus, und Tjörvi gab sie ihm. Haukur drehte sie forschend hin und her.
Soweit Dröfn sehen konnte, war es eine ganz normale Mütze. Nichts im Vergleich zu den schicken Wintermützen, die sie sich für die Tour gekauft hatten. Deshalb fand sie es merkwürdig, dass Haukur so interessiert an ihr war.
»Die liegt bestimmt seit dem Herbst oder dem Sommer da, oder?«, durchbrach sie die Stille.
Haukur schüttelte den Kopf. Sein Gesicht war gerötet, jedenfalls der kleine freie Bereich, den man sehen konnte. »Nein. Da lag nicht genug Schnee drauf. Dieser Winter war heftig, der Schnee ist hier mehrere Meter tief. Die Mütze kann noch nicht lange da liegen. Seltsam …«
Bjólfur und Tjörvi schwiegen und wirkten immer noch eingeschnappt, aber Agnes ergriff das Wort. Sie arbeitete als Personalleiterin und ließ sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. »Ist noch eine andere Gruppe unterwegs? Ich dachte, wir wären alleine in der Hütte.«
»Wir sind garantiert alleine in der Hütte«, entgegnete Haukur, ohne Agnes anzuschauen. »Hier ist keine zweite Gruppe unterwegs, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Nur ich Idiot. Mit euch.« Offenbar war er immer noch sauer.
Tjörvi verdrehte die Augen, beherrschte sich aber, etwas Saftiges zu entgegnen. »Lasst uns weitergehen. Es ist zu kalt für eine Pause.« Er nickte in Richtung der Mütze. »Welcher Schwachkopf zieht bei dieser Kälte seine Mütze aus?«
Alle starrten wortlos auf die Mütze, bis Haukur sie in die Tasche stopfte und wieder Bewegung in die Gruppe kam.
Während sie weiterliefen, gingen Dröfn die Worte ihres Mannes nicht aus dem Kopf. Wer verlor mitten im Winter im Hochland eine Mütze? Wer war zu dieser Jahreszeit überhaupt in einer solchen Gegend unterwegs? Ihr waren noch keine befriedigenden Antworten eingefallen, als sie in eine enge Schlucht zwischen zwei Anhöhen stapften, die zu dem Kessel führte, wo die Hütte stand.
Die Dämmerung war noch eine Haaresbreite davon entfernt, sich in Dunkelheit zu verwandeln, aber sie hatten sich inzwischen an die schlechter werdenden Lichtverhältnisse gewöhnt. Schwere Wolken türmten sich auf und bedeckten den Himmel. Der Mond kam nicht durch. Kein Schimmer drang durch die Wolkenbänke, und man konnte nicht sehen, wo sich der Mond auf seinem Weg über die Himmelskugel befand.
Sie blieben stehen und betrachteten die Hütte und die Umgebung. Sobald der Schnee nicht mehr unter ihren Füßen knirschte, war es vollkommen still. Kein Wind, kein Vogelgezwitscher, nichts. Es war, als hätte die Welt alle Geräusche ausgeschaltet.
Auch hier versank alles im Schnee, und an den Hängen rund um die Hütte stach kein Felsbuckel heraus. Eine winterlichere Landschaft konnte man sich kaum vorstellen. Schneeweiß und eintönig. Die Luft war geruchlos, und es herrschte absolute Windstille. Das Einzige, was die Sinne wahrnahmen, war Kälte. Alle spürten sie jetzt, da sie stehengeblieben waren. Die Kälte biss in die Wangen, drang durch Schuhsohlen und Handschuhe, umschlang die Finger und drückte zu.
In dieser Situation sah die Hütte viel besser aus, als sie war. Sie wirkte ziemlich abgenutzt, die Fenster waren zugenagelt, aber drinnen konnte man es warm machen, und das war in diesem Moment das Allerwichtigste.
Haukur drehte sich von der Hütte zu der müden, aber zufriedenen Gruppe. »Ihr habt gut durchgehalten.«
Dröfn lächelte. Das war eine Geste der Versöhnung. Tjörvi und Bjólfur klopften Haukur auf die Schulter und murmelten etwas von wegen, sie hätten ihm ja nur folgen müssen. Dröfn atmete erleichtert auf, rückte den schweren Rucksack auf ihrem Rücken zurecht und freute sich darauf, ihn loszuwerden und sich auf ein Sofa oder einen Stuhl fallen zu lassen.
Agnes war die Einzige, die die neu entfachte Kameradschaft ignorierte, was ihr gar nicht ähnlich sah. Sie stand da und starrte angestrengt auf die Hütte, so als würde sie die anderen gar nicht wahrnehmen. Dann drehte sie sich zu ihnen und sagte: »Steht die Tür offen?«
Alle blickten zur Hütte. Und tatsächlich: Die Tür stand einen Spalt breit offen. Ihre gute Stimmung bekam einen kleinen Dämpfer, sie gingen schweigend das letzte kurze Stück bis zur Hütte, stiegen auf die Terrasse, und Haukur öffnete die Tür ganz. Er rief in die Hütte, ob da jemand sei, bekam aber keine Antwort. Dröfn wunderte das nicht, denn im Schnee auf der Terrasse waren keine frischen Fußspuren.
Sie gingen in die dunkle, eiskalte, menschenleere Hütte. An einem Haken beim Eingang hing ein Anorak.
Ein roter Anorak, passend zu der Mütze.
Dröfns positive Stimmung verschwand im Handumdrehen, und ihr Magen zog sich zusammen. An Haukurs Gesicht konnte sie ablesen, dass er dasselbe dachte wie sie.
Ein Mensch, der weder einen Anorak noch eine Mütze trug, hatte an diesem Ort keine Chance. Falls er nicht in der Hütte war, brauchten sie sich über sein Schicksal nicht lange den Kopf zu zerbrechen.
Die drückende Stille und die Dunkelheit in der Hütte gaben keinen Anlass zu Optimismus.