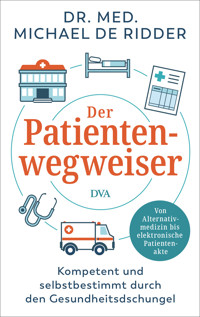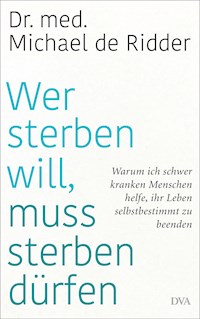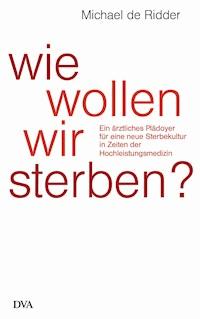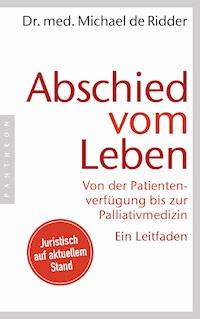
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mehr als ein Ratgeber ‒ ein Leitfaden für die schwierigsten Entscheidungen
Der Bestsellerautor und langjährige Mediziner Michael de Ridder erklärt die wichtigsten Begriffe zum Lebensende präzise und anschaulich. Sein Buch hilft dem Leser, sich in der kaum zu durchschauenden Welt des Sterbens zurechtzufinden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein Begleiter, ein Ratgeber – nicht nur für Betroffene und Angehörige, sondern auch für gesunde Menschen, die das eigene Lebensende nicht ignorieren.
Ausführliche Erklärung zu: Selbstbestimmung, Patientenverfügung, passive und aktive Sterbehilfe, Palliativmedizin, Sterbefasten, Wiederbelebung, künstliche Ernährung, Organspende, Koma und Wachkoma, Demenz, die letzten Tage und Stunden, Herztod und Hirntod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Wie muss eine Patientenverfügung aussehen? Wo liegen die Unterschiede zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe? Und was passiert in den letzten Stunden vor dem Lebensende? Michael de Ridder, Autor des SPIEGEL-Bestsellers Wie wollen wir sterben?, erklärt die wichtigsten Begriffe zum Sterben präzise und gleichsam differenziert. In ethischen, juristischen und pflegerischen Fragen verschafft er Klarheit, bei aller Sachlichkeit zeigt er aber ein hohes Maß an Empathie und Sensibilität gegenüber dem Patienten. Überdies macht er deutlich, wie wichtig es ist, frühzeitig den Dialog mit vertrauensvollen Personen zu suchen. Sein Buch ist ein Leitfaden für die schwierigsten Entscheidungen, ein Ratgeber im besten Sinne, der dem Leser die nötigen Kenntnisse an die Hand gibt, wenn der Abschied vom Leben unabwendbar geworden ist.
Zum Autor
Michael de Ridder ist seit mehr als dreißig Jahren im ärztlichen Beruf tätig, zuletzt als Chefarzt der Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses und als Geschäftsführer des von ihm mitbegründeten Vivantes Hospiz. Als Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin befasst er sich seit vielen Jahren kritisch mit dem Fortschritt in der Medizin und Fragen der Gesundheitspolitik und erörtert dies immer wieder in den Medien, unter anderem in DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Cicero. Für sein medizinisches Wirken wurde er vielfach ausgezeichnet. Bei Pantheon erschien zuletzt sein Buch Wie wollen wir sterben? (2011).
Michael de Ridder
Abschied vom Leben
Von der Patientenverfügung bis zur Palliativmedizin.
Ein Leitfaden
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Erste Auflage
August 2017
Copyright © 2017 by Pantheon Verlag, München,
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-20989-6V002
www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Einleitung
Selbstbestimmung
Selbstbestimmung – Kern der Menschenwürde
Selbstbestimmung am Lebensende
Selbstbestimmung und ärztliche Fürsorgepflicht
Einschränkungen der Selbstbestimmung
Selbstbestimmung im Spannungsfeld von vorausverfügtem und »natürlichem« Willen
Selbstbestimmung und ärztliche Indikation
Patientenverfügung
Vom Sinn einer Patientenverfügung
Voraussetzungen für eine verbindliche Patientenverfügung
Patientenverfügung und Organspende: kein Widerspruch!
Weitere Leitsätze zur Patientenverfügung
Bevollmächtigter und Vorsorgevollmacht
Weitere Hinweise zur Vorsorgevollmacht
Betreuer und Betreuungsverfügung
Abschließende Anmerkungen zur Abfassung einer Patientenverfügung
Gesundheitsvorausplanung
Passive und aktive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe
Aktive Sterbehilfe
Palliativmedizin
Heilung ‒ Linderung ‒ Zuwendung
Was ist »Heilung«?
Was ist Palliativmedizin und was leistet sie?
Hoher Versorgungsanspruch
Palliative Sedierung
Stationäres Hospiz und ambulanter Hospizdienst
Suizid und Beihilfe zum Suizid
Sterben wollen – Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen und Suizid
Ärztliche Suizidbeihilfe und Palliativmedizin: kein Widerspruch
Suizid und Suizidbeihilfe – die Verfassung schweigt aus triftigen Gründen
Ärztliche Suizidbeihilfe – Strafrecht und Berufsrecht im Widerspruch
Der neue § 217 StGB – »Förderung« der Selbsttötung
Gibt es für unheilbar Kranke ein Recht auf den Erwerb tödlicher Medikamente?
Ergänzende Empfehlungen für und Fragen an schwerstkranke Menschen, die erwägen, ihr Lebensende durch einen Suizid selbst herbeizuführen
Sterbefasten
Sterbefasten – ein friedliches Ende
Sterbefasten ‒ Akzeptanz in der Ärzteschaft
Vorgehen und Regeln für eine verantwortliche vorzeitige Herbeiführung des Todes durch Sterbefasten
Sterbefasten – die derzeitige Rechtslage
Wiederbelebung
Wiederbelebung – Erfolg und Misserfolg
Kreislaufstillstand: Voraussetzung einer Wiederbelebung
Ablauf einer Wiederbelebung
Ursachen eines akuten Herz-Kreislauf-Stillstandes (plötzlicher Herztod)
Aussichten nach einer Wiederbelebung
Verzicht auf Wiederbelebung
Wiederbelebung im Alter und bei schwerer chronischer Krankheit
Natürliche und künstliche Ernährung
Die PEG-Sonde – eine folgenreiche medizinische Erfindung
Verhungern und verdursten?
Künstliche Ernährung am Lebensende – was sagt die Wissenschaft?
Koma und »Wachkoma«
Formen des Komas
Vegetativer Status und Wachkoma ‒ Wachheit ohne Bewusstsein
Diagnostik des vegetativen Status
Ursachen des Wachkomas
Abgrenzung des Wachkomas vom Zustand minimalen Bewusstseins und anderen schweren Hirnschäden
Die Bedeutung bildgebender und anderer technischer Verfahren für die Diagnose des Wachkomas
Klinische Erscheinungsformen des Wachkomas
Das Wachkoma im zeitlichen Verlauf
Behandlung, Pflege und Fürsorge im Wachkoma
Fehlerquellen und Irrtümer in der Diagnostik schwerster Hirnschäden
Gewissenhafte Diagnostik
Behandlungsabbruch im Wachkoma – die Rechtslage in Deutschland
Entscheidend ist der erklärte oder mutmaßliche Wille des Patienten
Fortgeschrittene Demenz
Was ist unter Demez zu verstehen?
Demenz – eine Domäne palliativer Medizin und Versorgung
Häufigkeit und Lebenserwartung
Demenz – kein einheitliches Krankheitsbild
Risikofaktoren und Prävention
Behandlung
Formen der Demenz
Charakteristika und Symptome fortschreitender Demenz
Allgemeine chronische und begleitende Erkrankungen
Infektionen
Psychiatrische Symptome und Widerstand gegen Behandlung
Selbstbestimmung und fortgeschrittene Demenz
Die letzten Tage und Stunden
Schwierigkeit einer Definition der Sterbephase
Anzeichen des bevorstehenden Lebensendes
Grundsätze einer guten Versorgung Sterbender
Besondere Probleme und Ereignisse in der Sterbephase
Herztod und Hirntod
Herztod
Hirntod
Notwendigkeit eines einheitlichen medizinischen Todesbegriffs
Ist der Hirntod gleichbedeutend mit dem Tod des Menschen?
Organspende
Niedrige Organspendezahlen in Deutschland
Organspende – Wünschen und Wollen
Organspende ‒ Für und Wider
Organtransplantation ‒ heute ein Standardverfahren zur Rettung von Menschenleben
Gesetzliche Regelungen in Europa und Deutschland
Ablauf einer Organspende
Patientenverfügung und Organspende
Ausblick – Perspektiven auf die Zukunft des Sterbens
Anhang
Dank
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Statistische Angaben
Beratung und Hilfe für Patienten und Angehörige
Mustervorlagen
Register
Einleitung
Dieses Buch ist keines, das sich mit den weitläufigen anthropologischen, philosophischen, religiösen und spirituellen Fragen des Sterbens befasst. Es setzt vielmehr einen Schwerpunkt: Es hat medizinische, pflegerische, ethische und medizinrechtliche Fragen, die sich zum Lebensende eines Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung stellen, zum Gegenstand. Es möchte nicht allein Kranken und ihren Angehörigen, sondern auch gesunden Menschen, die das eigene Lebensende und das anderer nicht ignorieren, Orientierung, Rat und Hilfe anbieten – in einer Zeit, in der das Sterben manipulierbar geworden ist und viele Menschen den Möglichkeiten und der Macht der Medizin mit Skepsis oder Misstrauen begegnen.
Dabei ist mir bewusst, dass manche Fragen offenbleiben und manche der auf den kommenden Seiten aufgeworfenen Themen strittig sind und bleiben werden. Insofern ist das vorliegende Buch weit davon entfernt, »Wahrheiten zu verkünden«. Es will indes während langer Jahre auf dem Feld der »Lebensendemedizin« gewonnene medizinische Kenntnis und Erfahrung dem Leser ‒ in komprimierter Form – nahebringen, nach bestem Wissen und Gewissen.
Ein Leitfaden für das Sterben? Kann es für ein Ereignis, das so unvorhersehbar ist und sich so individuell vollzieht wie das Sterben, tatsächlich eine Art Anleitung geben? Und wenn dies so ist, könnte eine solche Anleitung angesichts der Unausweichlichkeit des Sterbens Zuversicht, ja Gelassenheit begünstigen, Angst und Leid des Sterbenden (und seiner Angehörigen) mindern? Mit anderen Worten: Kann ein Mensch lernen, zu sterben? Gibt es gar ein »richtiges«, ein »gutes« Sterben?
Nein ‒ erlernbar ist das Sterben nicht. Immer wieder werden wir von Verlegenheit und Scheu, wenn nicht gar von einem Fluchtreflex erfasst, sobald wir das drohende oder tatsächliche Lebensende eines Menschen erleben; um wie viel mehr erst, wenn wir selbst in aussichtsloser Krankheit das Nahen des Todes spüren: Niedergeschlagenheit, Deprimiertheit, Angst und Verzweiflung bemächtigen sich unserer Seele und Gedanken ‒ was hilft da ein Wissen um das Sterben, dem wir niemals werden entrinnen können?
Und doch – unser Sterben findet nicht in einem Vakuum statt. Nie war das Sterben seiner Natürlichkeit so sehr entkleidet wie heute, da es unter mehr oder weniger organisierten Bedingungen stattfindet, selbst im Hospiz. Nie war es enger umstellt von den Möglichkeiten der Medizin, es zu verhindern oder zu erleichtern; nie war es mehr eingebunden in ethische und rechtliche Rahmenbedingungen.
Und eben diese Gegebenheiten, von denen wir uns kaum mehr werden lossagen können, sind es, die, wenn sie auch schwerlich zu verändern sein mögen, doch einem tauglichen Wissen zugänglich sind. In der für Laien kaum durchschaubaren Welt des Lebensendes kann es Patienten und Angehörigen im Vorfeld des Sterbens wenigstens Orientierung bieten und gewisse Weichenstellungen ermöglichen, dem Willen eines Sterbenden zu entsprechen und endloses Siechtum zu verhindern.
Dieses Wissen in seinen Grundzügen zu vermitteln, präzise und doch differenziert, ist der ebenso klare wie bescheidene Anspruch des vorliegenden Buches. Es wendet sich an alle ‒ zumal an Patienten und den ihnen Nahestehenden ‒, die den Wunsch haben, sich im Labyrinth der Lebensendemedizin zurechtzufinden und in den mit ihr verbundenen medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragen und Problemen ein Mindestmaß an Klarheit zu verschaffen. Es versteht sich als ein Begleiter, der dem Leser Kenntnisse an die Hand gibt und ihm helfen will, einen eigenen Weg zu finden, wenn der Abschied vom Leben unabwendbar geworden ist. Die Erläuterung von Begriffen wie »Selbstbestimmung«, »aktive und passive Sterbehilfe«, »Palliativmedizin«, »Koma«, »Wiederbelebung«, »Suizidbeihilfe« und manch anderen, die in diesem Buch thematisiert und erklärt werden, will ihm ein Rüstzeug an die Hand geben, um im Dialog mit sich selbst und anderen unumgängliche Entscheidungen verantwortlich zu treffen.
Nicht allein unter Laien, auch unter Politikern und Juristen, ja selbst unter Ärzten und Pflegekräften als den unmittelbaren Akteuren herrscht in weiten Teilen Unkenntnis über sinnvolles und unangemessenes, über erlaubtes und verbotenes Handeln und Entscheiden am Lebensende. Einem Drittel der deutschen Betreuungsrichter ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe nicht bekannt, so eine Umfrage im Jahr 2015. Ein hochrangiger CDU-Politiker wandte sich gegen »jede Form der Sterbehilfe« – also auch gegen die passive und indirekte Sterbehilfe, die selbst der Heilige Stuhl in Rom akzeptiert? 93 Prozent der Bundesbürger glauben irrtümlicherweise, dass Suizidhilfe strafbar sei, auch 73 Prozent der Medizinstudenten sind in diesem Irrtum befangen. Selbst Ärzte werten vielfach das Abschalten der Beatmung gemäß dem Willen des Patienten immer noch als verbotene aktive Sterbehilfe. Ein Neurologe droht einer neunzigjährigen schwerstpflegebedürftigen Patientin mit einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie, wenn sie noch einmal äußern sollte, ihr Sterben durch Fasten beschleunigen zu wollen. Die Liste an Beispielen ließe sich leicht fortführen.
Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), angestoßen durch mutige anwaltliche Initiativen, entscheidenden Anteil daran hat, dass sich ein Wandel in der Medizin am Lebensende vollzogen hat. Ohne dessen richtungsweisende Urteile ist die heutige Palliativmedizin und Hospizbewegung nicht denkbar. Nicht die Ärzteschaft hat diesen Paradigmenwechsel initiiert und vollzogen, sondern Richter des BGH waren es, die bestehendes, im Grundgesetz niedergelegtes Recht erkannt und diesem zur Geltung verholfen haben. Dessen Kern ist, dass der Patientenwille oberste Richtschnur allen ärztlichen Handelns und Entscheidens zu sein hat. Wenn es der Wille des Patienten ist, darf der Arzt sein Sterben nicht verhindern.
Mag sich auch das in diesem Buch vermittelte Wissen für manchen Leser als nützlich und hilfreich erweisen: Jenseits allen Wissens um das Lebensende und den Möglichkeiten der Medizin, das Sterben zu erleichtern, jenseits auch des Glaubens vieler Menschen an Aufgehobenheit in einem religiösen Bekenntnis bleiben Einsamkeit und Verlassenheitsgefühl des auf sich selbst zurückgeworfenen Sterbenden. In der Begegnung mit diesem womöglich größten aller Übel im Abschied vom Leben hat ein Leitfaden, der wichtige Ereignisse, Umstände und Konstellationen erläutert, zwar einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert; doch gerade heute, da die Grenzen zwischen sinnvoller Lebensverlängerung und leidvoller Sterbeverzögerung mittels einer technisch und pharmakologisch hochgerüsteten Medizin allzu oft kaum mehr unterscheidbar sind, bleiben allein von Herzen kommende menschliche Zuwendung, Zuspruch, Berührung und Trost von Angehörigen und Behandlern und, nicht zuletzt, professionelle Pflege die tragenden Säulen der Hilfe im Sterben.