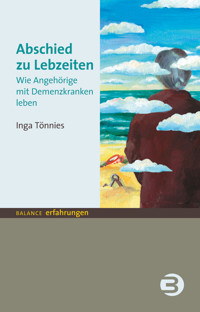
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch stellt die seelische Belastung von Angehörigen in den Mittelpunkt: Partner und Verwandte von demenzkranken Menschen schildern ihre Gefühle und Bewältigungsstrategien offen und ohne Tabus. Auf der Suche nach Literatur, die ihr bei der Bewältigung ihrer seelischen Belastung helfen könnte, stellte die Autorin fest, dass die vorhandenen Bücher zum Thema Demenz stets den kranken Menschen ins Zentrum stellen. Also führte sie Interviews mit Familienmitgliedern von Demenzkranken und fragte sie nach ihren Erfahrungen. Menschen, die ihre Väter, Mütter oder Partner rund um die Uhr pflegen, aber auch diejenigen, die »nur« Hausbesuche machen, schildern, was ihnen abverlangt wird. Ein bewegendes Buch, das Angehörigen hilft, ihre Gefühle von Trauer und Hilflosigkeit, von Scham, Kränkung und Wut zu akzeptieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inga Tönnies
Abschied zu Lebzeiten
Wie Angehörige mit Demenzkranken leben
Tönnies, Inga: Abschied zu Lebzeiten.
Wie Angehörige mit Demenzkranken leben.
5. Auflage 2013
© BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co. KG, Köln 2007
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint
der Psychiatrie Verlag GmbH, Köln.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlages vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
ISBN-ePub: 978-3-86739-852-7
ISBN-Print: 978-3-86739-007-1
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Originalausgabe: Psychiatrie Verlag, Köln 2004
Typografiekonzept: Iga Bielejec, Nierstein
Satz: BALANCE buch + medien verlag, Köln
Umschlagkonzeption: p.o.l: kommunikation design, Köln, unter Verwendung eines Bildes von ToumaArt, Leipzig
www.balance-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zur Autorin
Impressum
Geleitwort
Warum ich Angehörige demenzkranker Menschen interviewte
Die Interviews
Je länger das dauert, desto empfindlicher werde ich
Helga P. (52): Meine Mutter (84) ist seit dreizehn Jahren demenzkrank
Ich hatte noch nie im Leben eine so sinnvolle Aufgabe wie diese
Hartmut Tillmanns (70): Meine Frau (71) ist seit sechs Jahren demenzkrank
Wenn sie nichts sagt, das schnürt mir so die Luft zum Atmen ab
Sabine G. (44): Mein Mutter (81) ist seit vier Jahren demenzkrank
Die Krankheit bestimmt den Tag und nichts anderes
Rosemarie F. (54): Mein Mann (62) ist seit sieben Jahren demenzkrank
Mittlerweile freue ich mich schon, wenn er meinen Namen sagt
Lutz P. (38): Mein Vater (69) ist seit drei Jahren demenzkrank
Durch die Arbeit, die zu tun ist, werde ich abgelenkt
Ferdinand K. (81): Meine Frau (78) ist seit zehn Jahren demenzkrank
Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann lebe ich nicht mehr mein Leben, sondern ihr Leben
Ulrike Storm (41): Meine Mutter (79) ist seit einigen Monaten demenzkrank
Mein großer starker Papa – und jetzt dieses Häufchen Mensch
Ulla B. (51): Mein Vater (87) ist seit drei Jahren demenzkrank
Ich habe immer noch das Gefühl, das ist meine Mutter
Irmtraut D. (45): Meine Mutter (76) ist seit drei Jahren demenzkrank
Ich habe eine Vision – und das wird auch etwas werden
Marlene Keilhack (69): Mein Mann (75) ist seit zehn Jahren demenzkrank
Von anderen Angehörigen lernen:Last abwerfen! Entlastungsmöglichkeiten nutzen
Anhang
Informationen zur Autorin
Geleitwort
In Deutschland leben gegenwärtig mehr als eine Million Demenzkranke; zwei Drittel von ihnen sind von der Alzheimerkrankheit betroffen. Jährlich treten mehr als 200 000 Neuerkrankungen auf. Nach Vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung wird die Zahl der Demenzkranken Jahr für Jahr um etwa 20 000 zunehmen und sich bis zum Jahr 2050 auf mehr als zwei Millionen erhöhen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.
Die Demenzkrankheit rückt also immer mehr ins öffentliche Interesse. Die Menschen werden älter, und damit steigt das Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Kaum eine Familie, die sich nicht damit konfrontiert sieht. Auch wenn in den letzten Jahren das Tabu, über die Existenz dieser Krankheit zu sprechen, aufgebrochen wurde, ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig – Aufklärung insbesondere darüber, was eine Demenz für Angehörige bedeutet. Demenz wird als Familienkrankheit oder als Krankheit der Angehörigen bezeichnet.
Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch Gedächtnis- und Orientierungsstörungen sowie Störungen des Denk- und Urteilsvermögens, die die Bewältigung eines normalen Alltagslebens immer schwieriger machen. Die Patienten sind auf zunehmende Hilfe und Unterstützung angewiesen. Dabei sind Demenzkranke keine einheitliche Gruppe, sondern Individuen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Kompetenzen und Defiziten, die in unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Situationen leben. Ebenso differenziert sind die jeweiligen Anforderungen an Betreuung, Pflege, Therapie und ärztliche Behandlung.
Es ist eine Erkrankung, bei der die Nahestehenden lernen müssen, mit ihr zu leben – die Kranken selbst müssen zusätzlich gestützt werden, denn sie sind vielfach nicht mehr in der Lage, sich selbst mit der Krankheit auseinander zu setzen, auch wenn sie es sind, die die Symptome als Erste wahrnehmen. Den Begleitenden oder Pflegenden wird auch sonst einiges abverlangt: Ihnen wird die enorme Belastung auferlegt, im Verlauf der Krankheit allumfassend für alle Lebensbereiche des Erkrankten verantwortlich zu sein. Ebenso müssen sie die mit der Demenz einhergehenden Wesensveränderungen verkraften – sie müssen einen Abschied zu Lebzeiten bewältigen.
In diesem Buch wird die Demenz nicht aus medizinischer oder pflegerischer Sicht betrachtet, sondern es kommen pflegende oder begleitende Angehörige (Töchter, Söhne, Partner) zu Wort. Sie berichten über ihre Gefühle, mit denen sie durch die Demenzerkrankung eines nahe stehenden Menschen konfrontiert werden. Auch häufig tabuisierte Gefühle wie Überforderung, Kränkung, Hilflosigkeit, Schuld, Wut, Scham und Trauer kommen zur Sprache. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, sich mit den Gefühlen auseinander zu setzen, die durch die Demenzerkrankung eines Angehörigen bei einem selbst ausgelöst werden können.
Das Buch richtet sich in erster Linie an die Angehörigen Demenzkranker. Beim Lesen der Interviews werden Sie feststellen, dass es anderen Menschen ähnlich geht, wie Ihnen selbst, Sie erleben im wahrsten Sinne des Wortes »Mitleidende« – und es entlastet, in einer solchen Situation nicht allein zu sein. Die Interviews machen deutlich, wie berechtigt und erlaubt die angeblich so negativen Gefühle sind. Zum Teil sind sie sogar notwendig, um sich mit der Krankheit auseinander setzen zu können. Und sie zeigen Ihnen möglicherweise, dass auch Sie unter der Krankheit leiden dürfen: Vielen Angehörigen macht die Demenz ihrer Nahestehenden sehr zu schaffen, aber häufig ist ihnen nicht klar, warum sie leiden, denn die Belastung ist nicht offensichtlich greifbar.
Auch für professionell Pflegende, wie Altenpflegerinnen und Altenpfleger in den Alten- und Pflegeheimen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegedienste, der Beratungsstellen oder der ambulanten Dienste ist das Buch wichtig. Es kann dazu beitragen, die häufig bestehenden Spannungen zwischen ihnen und den Angehörigen besser zu verstehen und aufzuweichen. Ebenso könnte ich mir die Interviews als Unterrichtsmaterial in Altenpflegeschulen vorstellen.
Weil Angehörige erzählen und weil nicht aus medizinischer oder pflegerischer Perspektive auf das Thema geschaut wird, wird die Krankheit auch für Menschen greifbar, die in keiner Weise von der Krankheit betroffen sind, die also weder an Demenz erkrankte Partner, noch Eltern oder andere Angehörige haben. Sie bekommen durch die Interviews einen Einblick in die Entwicklung der Demenzkrankheit, die Anforderungen und die Leistungen der pflegenden Angehörigen. Das Buch kann also auch ganz allgemein dazu beitragen, Aufklärung zu leisten – auf eine sehr persönliche Weise.
Heike von Lützau-Hohlbein
1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V.
Warum ich Angehörige demenzkranker Menschen interviewte
Meine Mutter ist dreiundachtzig Jahre alt und seit sechs Jahren demenzkrank. Die ersten Anzeichen deuteten wir als ganz normale, altersbedingte Vergesslichkeit, aber irgendwann war nicht mehr auszublenden, dass eine Demenz vorliegt.
Früher war sie eine sehr aufopferungsbereite Frau, die sich selbst immer stark zurücknahm, die aber doch eine »ruhige Stärke« besaß. Auch heute in der Demenz ist sie sehr »pflegeleicht«: Sie ist nicht aggressiv, nicht unruhig, sie läuft nicht weg, sie stellt keine Ansprüche, hat keine körperlichen Gebrechen und sie wehrt sich nicht dagegen, dass fremde Personen vom Pflegedienst oder aus sozialen Einrichtungen zu ihr in die Wohnung kommen. Diese Bedingungen trugen erheblich dazu bei, dass wir ihren Alltag nach dem Tod meines Vaters vor vier Jahren sehr schnell gut organisieren konnten.
Meine Schwester und ich werden durch einen sehr guten Pflegedienst und durch engagierte Frauen in der Betreuung unserer Mutter unterstützt. Objektiv betrachtet sind die Bedingungen also fast ideal.
Weil die persönliche Betreuung meiner Mutter und die Organisation, die erforderlich ist, um ihren Alltag zu regeln, dennoch einen Großteil meiner Zeit beansprucht, habe ich mich entschieden, momentan nicht erwerbstätig zu sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Lebenssituation habe, die das ermöglicht. Durch diese Bedingungen kann ich mir die Zeiten, die ich bei meiner Mutter verbringe, relativ frei einteilen. Ich muss die Betreuung nicht zeitlich getrieben und innerlich gestresst nach einem harten Arbeitstag leisten. Das macht die Situation leichter für mich. Alles wunderbar, könnte man denken. Aber trotz all der positiven Randbedingungen strengt mich die Betreuung häufig sehr an, und manchmal fällt es mir schwer, mir klar zu machen, woran das liegt.
Meine ehemals starke Mutter verwandelte sich von einer aktiven, kontaktfreudigen, einfühlsamen Frau in ein völlig willen- und antriebsloses Wesen und war plötzlich gar nicht mehr stark, sondern sehr hilfsbedürftig. Ohne Aufforderung würde sie weder morgens aufstehen noch ihre Körperpflege durchführen noch etwas zu essen für sich zubereiten. Sie würde den ganzen Tag im Bett liegen oder auf ihrem Stuhl sitzen, und essen würde sie zwischendurch mal ein paar Löffel Marmelade, Kekse oder was gerade zu finden wäre.
So, wie sie selbst ohne die täglichen Einsätze der Pflegepersonen verkommen würde, vernachlässigt sie auch alles um sich herum. Und dabei legte sie früher so viel Wert auf ihre eigene Gepflegtheit und es machte ihr immer viel Freude, Haus und Garten in Ordnung zu halten. Ihr (gesundes) Leben lang liebte sie Blumen so sehr – heute ist sie nicht mehr in der Lage, ihren Topfblumen Wasser zu geben, Schnittblumen vertrocknen in der Vase, wenn das Wasser verbraucht ist.
Diese Verwahrlosungserscheinungen zu ertragen ist sehr schwer für mich. An den unterlassenen Handlungen wird ihre Krankheit und die damit einhergehende Wesensänderung für mich besonders schmerzhaft deutlich.
Meine Mutter war sehr einfühlsam, früher, als sie noch nicht demenzkrank war. Durch die Demenz ging auch diese Fähigkeit verloren. Sie kann nicht mehr auf mich oder auf einen anderen Menschen eingehen, kann die Sorgen und Nöte anderer nicht mehr sehen. Das, was für sie und für mich das Selbstverständlichste war, geht nicht mehr.
Manchmal kann ich das so hinnehmen, aber manchmal, wenn es mir selbst körperlich oder seelisch nicht gut geht, kränkt mich die fehlende Anteilnahme.
Vor drei Jahren habe ich geheiratet, das erste Mal in meinem Leben, mit fast fünfzig Jahren habe ich mich getraut. Ganz häufig nahm meine Mutter die Einladungskarte in die Hand, guckte kurz drauf – um sie dann wieder aus der Hand zu legen, ohne zu Ende gelesen zu haben, ohne Kommentar. Wie sehr hatte sie sich gewünscht, dass ihre Töchter heiraten. Nun erfüllte ich ihr Sehnen, aber es erreichte sie nicht mehr. Das tat mir für uns beide Leid. Für sie, weil sie sich nicht mehr darüber freuen konnte, und für mich, weil es mich kränkte, dass sie mich bei dieser großen Entscheidung nicht mehr in meine Lebenswelt begleiten konnte.
Das, was meine Mutter einmal ausmachte, löst sich auf. Vor allem die Wesensänderungen sind es, die mir sehr zu schaffen machen, die mir das Gefühl vermitteln, dem langsamen Sterben meiner Mutter zuzusehen. Oft habe ich das Gefühl, es ist ein Abschied zu Lebzeiten, den ich bewältigen muss, und häufig geht mir diese schwere Aufgabe so sehr an die Substanz, dass ich mich damit überfordert fühle.
Auch das Verhältnis zu meiner Schwester hat sich durch die Demenz unserer Mutter erheblich verändert. Wir sind jetzt nicht mehr nur Schwestern, sondern haben eine gemeinsame Verantwortung für das Leben unserer Mutter. Wir müssen ein ganzes Leben organisieren und haben uns, in unserer Überforderung damit, häufig gestritten und uns gegenseitig Vorwürfe gemacht. Dass ich zusätzlich zu dem schleichenden Abschied meiner Mutter auch noch die Unbeschwertheit in der Beziehung zu meiner Schwester verlor, war nur schwer zu verkraften.
Ich brauchte ganz dringend Unterstützung. So ging ich in eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzkranken und stellte fest, dass es sehr gut tut, von anderen in ähnlichen Situationen zu hören. Ich ging zu vielen Vorträgen und machte die Erfahrung, dass es mir hilft, mich auch theoretisch mit dem Thema Demenz auseinander zu setzen.
Aber ich brauchte noch etwas, das ich jederzeit in die Hand nehmen konnte, das mir Trost gab, wenn ich ihn gerade nötig hatte. Gewünscht habe ich mir ein Buch, in dem benannt wird, was speziell den Leidensweg der Angehörigen Demenzkranker ausmacht. Auf der Suche nach Literatur stellte ich fest, dass alles, was ich zum Thema Demenz fand, eher auf der pflegerischen oder medizinischen Ebene bleibt, die psychologische Ebene jedoch nicht betrachtet, und dass die Literatur den kranken Menschen ins Zentrum stellt und nicht die Angehörigen mit ihren seelischen Belastungen. So entstand die Idee, Interviews mit Angehörigen von demenzkranken Menschen durchzuführen, und ich bat pflegende und begleitende Angehörige, über die Gefühle zu sprechen, mit denen sie durch die Demenz eines nahe stehenden Menschen konfrontiert werden.
Mein vordergründiges Anliegen war nicht, die allgemeinen Strapazen pflegender Angehöriger darzustellen. Auch ging es mir nicht darum, die Krankheit zu beschreiben, sondern darum, zu betrachten, welche Auswirkungen die Demenzerkrankung auf Angehörige haben kann – zu benennen, welche seelischen Belastungen sie durch die Ausprägungen der Demenz verkraften müssen.
Es war auch nicht mein Anspruch, repräsentativ zu sein. Die entstandenen Erfahrungsberichte sind Blitzlichter. Sie stellen am Beispiel dar, welche Gesichter die Krankheit haben kann und was den Angehörigen dadurch abverlangt wird.
Wesensänderungen sind ein Merkmal der Demenz, das den Angehörigen häufig sehr zu schaffen macht. Auch Angehörige, die nicht pflegen oder begleiten bzw. dies nicht durchgängig tun, müssen sich mit der Persönlichkeitsveränderung des erkrankten Menschen und den damit einhergehenden Abschiedsprozessen auseinander setzen. Darum habe ich nicht nur pflegende Angehörige interviewt, sondern auch Angehörige, die nicht oder nicht ständig in die Pflege oder Begleitung eingebunden sind.
Vielleicht kann man sogar nur dann, wenn die tägliche Pflege oder Begleitung des nahe stehenden Menschen einen nicht permanent aufreibt, Gedanken zur eigenen seelischen Belastung zulassen?
Davon ausgehend, dass es besonders schmerzhaft ist, die Wesensänderungen zu erleben, wenn man zu dem erkrankten Menschen lange vor Ausbruch seiner Krankheit eine intensive Beziehung hatte, wie Kinder sie zu ihren Müttern oder Vätern haben oder Partner zueinander, habe ich nur diese Personengruppen für die Gespräche gewählt.
Es war nicht schwierig, Interviewpartner und -partnerinnen zu finden. Das erste Interview führte ich mit meiner Schwester. Durch meinen nahen oder ferneren Bekanntenkreis wurden mir Menschen vermittelt, deren Mutter oder Vater demenzkrank ist. In einer Selbsthilfegruppe traf ich Frauen und einen einzigen Mann, deren Partner von dieser Krankheit betroffen sind. Weitere Angehörige Demenzkranker wurden mir von verschiedenen Pflegediensten genannt.
Die Befragten tauchten in diesen Gesprächen sehr intensiv in die Demenz-Problematik ein. Einigen ging das Thema so nahe, dass auch Tränen flossen.
Nach der Durchführung der Interviews bekam ich von einigen Gesprächspartnern und -partnerinnen die Rückmeldung, dass sie es als hilfreich empfanden, sich einmal »am Stück«, ohne Unterbrechung, mit ihren Gedanken und Gefühlen zum Thema Demenz auseinander zu setzen. Sie teilten mir mit, dass es ihnen gut tat, Fragen zu beantworten, die sie sich manchmal auch allein gestellt, aber nicht zu Ende gedacht hatten, weil sie durch den Alltag unterbrochen wurden oder sie nicht zu Ende denken mochten. Manche bemerkten, dass ihnen durch das Interview, durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, erstmalig bewusst wurde, was sie bisher geleistet hatten oder immer noch leisten. Durch die Fragen wurde einigen erst klar, was es bedeutet, mit einem demenzkranken Elternteil oder einem demenzkranken Partner zu leben.
Ich habe meinen Interviewpartnern sehr persönliche Fragen gestellt, auch – vielleicht – umstrittene Fragen wie: »Haben Sie sich schon manchmal gewünscht, dass Ihr kranker Angehöriger stirbt?« Dass bei der Pflege oder Begleitung eines nahe stehenden Menschen auch Gefühle auftauchen, wie Trauer, Wut, Scham, Hilflosigkeit, Überforderung, Schuld, Kränkungen etc. ist nicht verwunderlich. Oft hatte ich den Eindruck, dass meine Gesprächspartner erleichtert waren, endlich einmal nach ihren – in der eigenen Bewertung häufig unerlaubten – Gefühlen gefragt zu werden und diese dann aussprechen zu dürfen. Durch meine Fragen wurde anerkannt, dass es berechtigt ist, diese Gefühle zu haben, dass sie vorhanden sein dürfen – in einer solch belastenden Situation erst recht.
Die verschrifteten Gespräche zeigen aber nicht nur, wie sehr die Demenz eines nahen Familienmitglieds den Alltag der Angehörigen bestimmt und ihre Gedanken bindet, sondern auch, in welch hohem Maße Angehörige bereit sind, für ihre erkrankten Mütter, Väter und Partner da zu sein.
Das in den Gesprächen Gehörte ging mir oft sehr unter die Haut. Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich durch die Gespräche und durch das spätere Abhören und Verschriften der Interviews vieles von dem, was mich an der Erkrankung meiner Mutter bedrückte, verarbeiten konnte.
Ich danke allen Interviewpartnern und -partnerinnen ganz herzlich für ihre Bereitschaft, so ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen und über eine äußerst schwierige und belastende Situation in ihrem Leben so offen Auskunft zu geben.
Wenn andere Angehörige diese Offenheit genauso entlastet wie mich, dann hat dieses Buch seinen Zweck erfüllt.
Inga Tönnies
Die Interviews
Alle Interviewpartner erklärten sich damit einverstanden, dass das Gesagte auf Kassette aufgezeichnet und anschließend vollständig verschriftet wurde. Alle Angaben, die Rückschlüsse auf die befragte Person oder andere, namentlich genannte Personen ermöglichten, wurden anonymisiert, wenn die Befragten das wollten.
Die Gespräche begannen in der Regel mit der Eingangsfrage, die sich darauf bezog, wie sich die ersten Anzeichen der Demenz bemerkbar machten. Dann entwickelten sie sich entlang eines vorher erstellten Interviewleitfadens:
Wie fing es an, wie haben Sie die ersten Anzeichen gemerkt?
Wie ist die Pflege organisiert?
Welche Gefühle löst die Demenz Ihres Angehörigen bei Ihnen aus?
Haben Sie manchmal Schuldgefühle?
Empfinden Sie Trauer um verloren gegangene Selbstverständlichkeiten?
Wo bleiben Sie mit Ihrer Wut, Ihren Aggressionen?
Wie geht es Ihnen damit, wenn Ihr Angehöriger Sie nicht mehr erkennt?
Wie bewältigen Sie den Rollentausch?
Welche Gefühle werden bei Ihnen ausgelöst, wenn Sie den Verfall Ihres Angehörigen miterleben?
Worunter leiden Sie am meisten – an welchen Verhaltensweisen des Kranken?
Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Angehöriger etwas macht, was Ihnen auf die Nerven oder unter die Haut geht?
Ein Merkmal der Demenz ist ja, dass der Kranke sich einigelt. Macht es Ihnen manchmal Probleme, dass Sie nicht wissen, wie Sie zu ihm vordringen, wie Sie ihn erreichen können?
Symptomatisch für die Demenz ist ja auch, dass der Kranke nichts zurückgeben kann – keine Freude über Besuche, Geschenke oder Spaziergänge, keine Anerkennung, keine Anteilnahme. Wie werden Sie damit fertig?
Haben Sie sich schon manchmal gewünscht, dass Ihr Angehöriger stirbt?
Hat Ihre eigene Befindlichkeit (ob es Ihnen gut oder schlecht geht) Einfluss darauf, wie Sie die Krankheit bzw. die Veränderungen Ihres Angehörigen ertragen können?
Was gibt Ihnen die Kraft, Ihren Angehörigen zu pflegen und zu betreuen?
Was ist Ihre Motivation, Ihren Angehörigen zu pflegen?
Gibt es Ihnen auch etwas, Ihren Angehörigen zu pflegen und zu begleiten?
Gibt es auch beglückende oder erfreuliche Momente für Sie im Zusammensein mit Ihrem Angehörigen?
Fallen Ihnen auch witzige, kuriose Dinge im Zusammenhang mit der Demenz ein?
Gibt es auch etwas, was gut ist an der Demenz?
Wie war Ihre Beziehung zu Ihrem Angehörigen vor Ausbruch der Demenz?
Hat sich durch die Verantwortung für Ihren Angehörigen Ihr Verhältnis zu anderen Familienmitgliedern verändert?
Haben Sie manchmal Angst, dass Sie selbst auch demenzkrank werden?
Gelingt es Ihnen, Ihre eigenen Belastungsgrenzen zu beachten und mit sich selbst gut umzugehen?
Das Pflegeheim – der vorletzte Abschied. Welche Gefühle löste das bei Ihnen aus?
Man muss ja immer wieder neu entscheiden, wie oft man seine Angehörigen im Heim besucht, ob man jeden Tag hinfährt oder nicht. Fällt Ihnen das schwer?
Der eigene Alltag ist ja eigentlich gut ausgefüllt. Worauf verzichten Sie also oder was organisieren Sie anders, um Zeit für die Pflege oder Begleitung Ihres Angehörigen zu haben?
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre pflegerische Arbeit anerkannt wird?
Hatten Sie Zeit, mit der Krankheit zu wachsen?
Informieren Sie sich über die Krankheit, z. B. durch Fernsehen, Bücher? Wodurch sonst?
Können Sie sich auf irgendeine Weise Entlastung verschaffen? Wenn ja, wie?Wenn nein, was könnten Sie sich vorstellen, was Sie entlasten würde?
Was würden Sie Angehörigen, die in ähnlichen Situationen sind, raten, wie sie sich Entlastung verschaffen können?
Die Dauer der Interviews lag zwischen fünfundvierzig Minuten und eineinhalb Stunden.
Jedes Interview spricht für sich und ist so aussagekräftig, dass es weder kommentiert noch bewertet noch interpretiert wurde. Das Erzählte wurde lediglich geordnet, gekürzt und zusammengefasst. Angefangene Sätze wurden beendet, niemals aber die Aussage, der Sinn verändert. Alle Gesprächspartner haben die Druckfassung durchgesehen und autorisiert.
Je länger das dauert, desto empfindlicher werde ich
Helga P. (52): Meine Mutter (84) ist seit dreizehn Jahren demenzkrank
Helga P. ist Architektin, arbeitet aber nicht mehr in ihrem Beruf. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei fast erwachsenen Kindern in Zeven, einer kleinen norddeutschen Stadt. Helga hat eine Schwester, die in der Nähe von Rotenburg/Wümme wohnt, gut zwanzig Kilometer entfernt. Ihre Mutter lebte nach dem Tod ihres Vaters vor dreizehn Jahren noch acht Jahre allein in ihrer Wohnung in Zeven. Helga begleitete und versorgte sie zweimal in der Woche. Seit fünf Jahren lebt Helgas Mutter in einem Altenheim in Rotenburg.
Ja, meine Mutter war vergesslich. Und als mein Vater vor 13 Jahren starb, da haben wir erst so richtig gemerkt, dass sie mehr als nur tüdelig war. Irgendwann bin ich dann mit ihr zum Arzt gegangen, zum Nervenarzt. Es wurde Alzheimer diagnostiziert. Sie bekam auch irgendwelche Tabletten, aber ich weiß nicht mehr, welche es waren.
Ich hatte damals gedacht, ich teile mir die Betreuung mit meiner Schwester: Ich fahre zweimal die Woche hin und sie einmal, weil sie ja 20 Kilometer entfernt wohnt. Aber dann konnte sie nicht, weil irgendetwas im Fernsehen lief, weil dies war und das war. Ich hatte mit meiner Schwester abgesprochen, dass wir uns das Putzen teilen, aber das klappte auch nicht so gut. Ja, dann habe ich das alles irgendwie in die Hand genommen.
Am Anfang konnte ich noch mit meiner Mutter einkaufen gehen. Wenn sie alleine ging, war ich mir nicht sicher, ob die Verkäuferinnen da nicht ein paar Münzen mehr aus dem Portemonnaie genommen haben. Das ist ja auch verlockend. Sie wurde auch so ausgenutzt, finde ich.
Später habe ich gemerkt, dass sie gar nicht mehr richtig isst. Ganz ohne Antrieb. Sie hat immer lange geschlafen – es wurde immer länger.
Drei Zeitschriftenabonnements hat sie sich aufschwatzen lassen, unter anderem eine Zeitschrift, die sie bereits abonniert hatte. Der Vertreterin hat sie wohl erzählt: »Meine Tochter, die liest immer die ›Brigitte‹.« Die hat sie also auch noch abonniert. Und wir sind nicht rausgekommen aus den Abos.
Die Nachbarn meiner Mutter haben sich ganz tüchtig um sie gekümmert. Das sind ganz liebe, nette Leute. Die haben zum Beispiel darauf geachtet, dass sie morgens aufsteht. Ein anderer Nachbar hat ihren Rasen mit gemäht.
Wir haben immer versucht, meine Mutter noch in unsere Familie einzubinden. Als unsere Tochter heiratete, haben wir sie frühmorgens abgeholt. Irgendwann klingelte das Telefon. Am Apparat war ihr Nachbar, ganz aufgeregt: »Ihre Mutter ist nicht da.« Als ich ihm erklärte, was anliegt, sagte er völlig empört: »Ja, da müssen Sie mir doch Bescheid sagen.« Also, die waren ganz besorgt und verantwortungsbewusst.
Nur, meine Mutter rauchte, und je stärker die Krankheit voranschritt, desto mehr Zigaretten rauchte sie. Ich nehme an, sie hat einfach vergessen, dass sie gerade eine geraucht hatte, und sich gleich die nächste angesteckt. Ja, dann sah man überall Brandflecken, und da bekamen die Nachbarn natürlich Angst, dass sie das Haus in Brand setzt.
Irgendwann war sie mit dem Fahrrad hingefallen und hat so eine Geschichte erzählt, jemand hätte sie angefahren. Eigentlich wusste keiner genau, was passiert war. Aber sie hatte einen ganz blauen Arm.
Ich bin mit ihr zum Arzt gefahren. Es wurde ein leichter Haarriss festgestellt und der Arm wurde vergipst. Immer wenn ich mit ihr zur Kontrolle musste, hatte sie den Gips ganz abgepult. Sie war handwerklich so ganz geschickt. Und dann: neu vergipsen! Die Arzthelferin hat sie heftig ins Gebet genommen: »Frau K., das können Sie doch nicht machen. Versprechen Sie mir, dass Sie da nicht rangehen.« Ich werde das nie vergessen. Meine Mutter sagte mit aller Inbrunst: »Das verspreche ich Ihnen.« Und am nächsten Tag war der Gips wieder ab. Nachdem wir das dreimal hatten vergipsen lassen, habe ich zu der Arzthelferin gesagt: »Wissen Sie was, jetzt brauche ich eine Behandlung. Ich mach das nicht mehr mit. Ich fahr doch nicht jeden Tag mit ihr zum Vergipsen.« Und so ist der Arm dann auch geheilt – irgendwie.
Durch die Geschichte mit dem Arm sind wir überhaupt an die Sozialstation geraten. Meine Mutter bekam häusliche Pflege wegen des Bruchs. Das war auch gut so, denn das körperliche Pflegen ist mir sehr schwer gefallen. Nachdem der Arm wieder in Ordnung war, haben wir die Sozialstation behalten.
Eine Bekannte sagte: »Versuch doch mal, Pflegegeld zu bekommen.« Ich kannte eine Frau, die bei der Krankenkasse arbeitet. Die hat mir beim Ausfüllen der Formulare geholfen. Sie meinte, der geistige Verfall sei eigentlich gar nicht so wichtig in Bezug auf das Pflegegeld, sondern dass meine Mutter körperlich nicht mehr so recht kann, sei ausschlaggebend. Ich habe also Pflegegeld für sie beantragt.
Mit der Sozialstation hatte ich vereinbart, dass ich sofort anrufe, wenn der Gutachter da ist, damit einer kommt, um mich in dem Gespräch zu unterstützen. Es war ja so: Wenn man meine Mutter fragte: »Kochen Sie oder machen Sie dies und das«, sagte sie im Brustton der Überzeugung »Ja!« Sie machte ja angeblich noch alles. Aber die Ärztin vom Medizinischen Dienst, die als Gutachterin kam, die hat das schon so gesehen, wie es wirklich war.
Meine Mutter wurde in Pflegestufe eins eingestuft und bekam dieses kombinierte Pflegegeld, das heißt, der Teil, den die Sozialstation nicht für ihre Einsätze brauchte, wurde anteilig bar ausgezahlt.
Ich habe dann eine Frau zum Putzen organisiert und sie von diesem Geld bezahlt. Aber die hat dann doppelt kassiert, bei meiner Mutter und bei mir auch. Irgendwann kam ich mal überraschend, da saß diese Frau und las Zeitung. Ab dann hat meine jüngste Tochter bei meiner Mutter sauber gemacht, gegen Bezahlung. Wir haben gesagt, warum nicht.
Ich bin in der Zeit weiterhin so zweimal die Woche zu ihr gefahren, habe mit ihr eingekauft, bin mit ihr spazieren gegangen und habe die Arztbesuche mit ihr gemacht. Es war mir schon wichtig, darauf zu achten, dass sie noch rauskommt. Aber das körperliche Berühren ist mir sehr schwer gefallen. Wenn ich mir das überlege, was man alles so gemacht hat!
Manchmal mochte ich gar nicht hinfahren und habe es hinausgezögert oder ich habe es ganz schnell hinter mich gebracht. Oft habe ich es so eingerichtet, dass ich hinterher noch einen Termin hatte: Vorher eben schnell dahin und dann konnte ich sagen: »Ich muss jetzt los, ich kann nicht mehr hier bleiben.« Bin oft geflüchtet! Ich war ganz froh, als das vorbei war mit den zwei Nachmittagen.
Ja, bis vor fünf Jahren reichte die Betreuung so aus. Dann riefen die von der Sozialstation mich eines Morgens an: »Ihre Mutter macht die Tür nicht auf. Kommen Sie!« Ich bin mit meinem Schlüssel hin. Sie saß da und hatte nichts gehört. Wir dachten an einen Hörsturz. Ich bin mit ihr zum Ohrenarzt gefahren. Der hat ganz viel Dreck aus den Ohren geholt, deshalb konnte sie nicht hören.
Lauter solche Sachen sind passiert. Es war auch witzig teilweise. Wir hatten irgendwann entschieden, es hat auch etwas Komisches, sonst hält man das gar nicht aus.
Noch in derselben Woche war es, als mein Mann und ich bei meiner Mutter ankamen, und sie lag im Bett und sah aus, als wenn sie sterben würde. Das war am Sonnabend. Da kam dann die ganze Familie zusammen, meine Familie, meine Schwester und meine vier Nichten.
Unsere Mutter lag im Bett und wollte nicht aufstehen und war auch ziemlich verwirrt. Wir haben einen Arzt geholt, der meinte: »Grippe.« Es grassierte auch gerade die Grippe. Sie lag da und konnte überhaupt nichts mehr. Es war unmöglich, sie in der Situation allein zu lassen. Wir wollten unsere jüngste Tochter überreden, dazubleiben. Aber die sagte: »Das mag ich auch nicht.«
Meine Schwester hat eigentlich Platz genug, ein Haus mit vier Kinderzimmern, aber die wohnt 20 Kilometer entfernt. Ja, da haben wir gesagt, dann nehmen wir sie vorübergehend mit zu uns.
Eine meiner Nichten kannte die Leiterin eines Pflegeheims recht gut. Die waren damals gerade am Ausbauen, und so bekamen wir innerhalb einer Woche einen Pflegeplatz. Nur, diese Woche mussten wir halt überbrücken.
Wir konnten meine Mutter ja nicht fünf Minuten allein lassen, weil sie sich hier überhaupt nicht zurechtfand. Und wenn ich ein Brot vergessen hatte und dachte, ich fahre mal eben schnell ein Brot holen – man lebt ja so! –, dann fiel mir aber ein: »Ach, das kannst du ja nicht wegen Oma.«
In dieser Zeit haben wir erst gemerkt, wie nachtaktiv meine Mutter ist. Als sie noch allein in ihrer Wohnung lebte, war auch manchmal spät in der Nacht überall Licht an. Das haben wir hin und wieder gesehen, wenn wir von einer Feier kamen und da vorbeifuhren. Wir dachten dann nur: »Ach, die muss wohl mal auf die Toilette.«
Als sie hier bei uns war, wollte sie immer ganz früh ins Bett. Später ist sie dann wieder aufgestanden. Einmal – wir haben die Schlafräume oben – hat meine Jüngste sie auf der Treppe gefunden. Da war sie ein Stück die Treppe hinuntergefallen. Wir haben dann alles verbarrikadiert. Aber sie war immer sehr praktisch veranlagt, sie hat eben alles wieder zur Seite geräumt.
Eines Abends, als mein Mann ins Bett wollte, lag sie bei mir im Bett.
Meine Jüngste sagte: »Ich zieh hier aus. Ich will hier nicht mehr wohnen.«
Seit Sonnabend hatten wir sie also hier. Das Heim brauchte ja eine Bescheinigung, dass sie frei von Infektionskrankheiten ist. In der darauf folgenden Woche Donnerstag hatten wir den letzten Untersuchungstermin, Röntgen. Ich war davon ausgegangen, dass nun alles erledigt sei. Da sagte der Röntgenmensch zu mir: »Ja, am Montag kommt der Arzt und guckt sich die Bilder an.«
Ich war schockiert und habe gesagt: »Wissen Sie was – ich lasse Ihnen meine Mutter hier. Ich fahre nicht ohne diesen Zettel nach Hause. Es wird doch wohl irgendeinen Arzt geben, der sich das ansehen kann.« Ich habe das wohl auch so gesagt, dass der merkte, die kann nicht mehr. Ich war so fertig bei dem Gedanken: »Noch vier Tage!«
Also, meiner Mutter lag damals nicht viel am Leben – und jetzt wohl auch nicht –, aber das hätte ich ganz schrecklich gefunden, wenn sie bei uns zu Hause die Treppe hinuntergestürzt oder sonst irgendwie zu Schaden gekommen wäre.
Na, dann haben die mir das unterschrieben, und wir konnten sie noch am Donnerstag in das Pflegeheim bringen. Wir sind mit ihr dahin gefahren und haben sie gefragt: »Möchtest du hier bleiben?« Sie sagte ganz zögerlich: »Ja«, und dann hat sie unterschrieben.
Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, sie ins Heim zu geben. Mittlerweile ist sie diejenige, die am längsten dort ist. Am Anfang war sie noch viel unterwegs. Sie hatte eine Freundin, die sie jeden Tag neu kennen lernte. Die hatten sich gesucht und gefunden. Einmal sind die beiden von der Polizei aufgegriffen worden. Sie haben erzählt, sie wollten nach Zeven, was ja bestimmt 20 Kilometer entfernt liegt, meine Mutter wüsste, wo sie da wohnt. Diese Freundin ist inzwischen aber leider verstorben.
Am Anfang hat meine Mutter im Pflegeheim noch allein essen können, aber inzwischen geht das nicht mehr. Es wird immer schlimmer. Wenn ich sie besuche, fahre ich zu den Mahlzeiten hin. Ich denke immer, sie weiß sowieso nicht, dass ich da bin, dann soll mein Besuch wenigstens einen praktischen Wert haben, indem ich ihr beim Essen helfe. Sie nimmt den Löffel in die Hand, dann legt sie ihn wieder hin. Sie isst ihren Teller zwar leer, aber nur wenn man sich drum kümmert.
Kauen tut sie nicht mehr. Sie bekommt alles püriert, und alles, was ein bisschen grob ist oder ihr nicht schmeckt, spuckt sie so in die Gegend. Und das Rülpsen nach dem Essen – lautes Rülpsen!
Ja, dass sie sich so gehen lässt, das finde ich schrecklich. Wenn die Nase läuft und sie kein Taschentuch hat, nimmt sie den Ärmel, und dann nimmt sie die Zähne raus, dann die Zähne rein. Also teilweise ekelt mich das an. Ich mag sie gar nicht anfassen. Ja, das stimmt, ich mag sie überhaupt nicht anfassen. Überall sitzt der Schnott. Und da muss ich die Pflegerinnen bewundern, dass die das so können.
Dass ich sie nicht anfassen mag, liegt vielleicht an dem Verhältnis, das wir zueinander haben. Meiner Mutter ist nicht bewusst, dass wir ein schwieriges Verhältnis haben, und das war mir auch nicht bewusst. Das habe ich eigentlich auch erst im Laufe dieser Krankheit gemerkt. Als sie noch gesund war, hat sie immer zu mir gesagt: »Du wolltest schon als Kind nicht auf den Arm.« Ich habe selbst zwei Kinder und ein Enkelkind und habe nie erlebt, dass ein Kind nicht auf den Arm wollte. Aber ich wollte es angeblich nicht. Und so ist natürlich auch mein Verhältnis zu ihr. Deshalb ist mir auch dieses körperliche Pflegen ganz, ganz schwer gefallen. Ich habe mich, auch als sie noch zu Hause war, immer schon geekelt, weil sie ja auch so gesabbert hat. Und immer war sie voll gekleckert. Dieser Dreck, so diese ständig voll gekleckerte Kleidung und die Toilette, die nie gespült war.
Oft erkennt sie mich gar nicht. Wenn ich dann sage: »Ich bin doch die Helga«, sagt sie: »Ach, ja«, aber sie vergisst es ja sofort, dass ich es bin. Da kommt dann auch wieder diese verquere Beziehung durch, die wir haben. Kein schlechtes Verhältnis, aber es war einfach nicht innig. Und durch ihre Krankheit wird mir so vieles klar, dass ich zum Beispiel denke, mein Gott, ich hechle immer noch danach, dass sie mich nett findet. Irgendwann, das ist schon ein bisschen her, hat sie mir erzählt, ja, sie hätte zwei Töchter, und die jüngere – das bin ich –, das sei die Patentere. Das ging mir runter wie Öl. Und da merkte ich, ich möchte eigentlich immer noch, dass sie mich liebt.
Der Prozess, dass sie mich nicht mehr erkannt hat, ist langsam gegangen, ganz, ganz langsam. Eine Bekannte sagte neulich mal zu mir: »Wieso fährst du denn dahin? Sie weiß doch sowieso nicht, dass du da bist.« Aber ich brauche das einfach für mich selbst, damit ich das Gefühl habe, ich habe mich gekümmert. Beim letzten Besuch war ich gut drauf. Dann kann ich das auch alles besser ertragen. Ja, es ist davon abhängig, wie es mir geht. Wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, fahre ich da gar nicht mehr hin. Und je länger das dauert, desto empfindlicher werde ich. Und was mich auch kränkt, ist die Tatsache, dass es ihr immer schlecht geht. Ich weiß ja, dass sie nichts dafür kann, aber das halte ich ihr wirklich vor.
Wenn ich die anderen im Heim sehe, die lächeln. Da ist eine Süße, die guckt immer freundlich und die denkt immer, ich besuche sie, und sagt dann: »Das ist nett, dass Sie da sind.« Die hat so etwas Positives. Das hat meine Mutter nicht. Man sagte doch so: »Contenance bewahren«. Aber das ist ihr gar nicht gegeben. Sie tut sich nur selbst Leid. Und ich nehme an, ich könnte mit einem gebrochenen Fuß kommen und sie würde sich Leid tun. Ihr geht es schlecht. Und mein Leid wäre längst nicht so schlimm wie ihres.
Als das mit der Demenz losging, war ich unheimlich sauer, und das bin ich auch heute noch. Ich möchte immer sagen: »Mensch, reiß dich doch zusammen.« Das war so ein Spruch, den sie auch immer drauf hatte. Das musste man, sich zusammenreißen.
Zu Beginn der Krankheit hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich unheimlich hat gehen lassen. So nach dem Motto: Irgendjemand wird es schon machen. Ja, und jetzt, das schwankt so zwischen Mitleid und Zorn, und manchmal hat sie auch so etwas ganz Liebes.
Dass sie mich nicht trösten kann, das fehlt mir nicht. Das hat sie nie gemacht. Ist ja eigentlich traurig, nicht? Ich glaube, diese Trauerarbeit habe ich in vier Jahren Analyse geleistet, und da habe ich wirklich um alles getrauert. Und jetzt denke ich: Oh, Mensch, sie tut mir unheimlich Leid. Aber ich tu mir auch Leid. Ich merke, ich habe da so meine Grenze.
Ich habe sicher gelernt, ein bisschen ehrlicher zu sein. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann denke ich manches Mal: »Wenn du doch einschlafen würdest und morgens nicht wieder aufwachen.« Ich wünsche mir manchmal für sie, dass sie stirbt. Für mich natürlich auch. Ich habe im Laufe der Jahre schon meinen Frieden mit ihr geschlossen. Aber ich wünsche mir eigentlich auch für sie, dass es bald zu Ende ist, weil sie es an einigen Tagen so schwer hat, nur ihren Körper zu halten. Dann liegt sie da, den Kopf auf dem Tisch, oder ihr Oberkörper fällt im Sitzen vornüber, weil sie ihn nicht mehr halten kann.
Am Anfang haben wir schon noch so unseren Spaß gehabt, und da hatte ich auch das Gefühl, dass sie es genossen hat, wenn man ein bisschen mit ihr spazieren gegangen ist. Heute würde ich sagen, gibt es keine beglückenden Momente mehr, dazu ist die Demenz zu weit fortgeschritten.
Ich habe das Gefühl, die Demenz fing an, als mein Vater, der ihre große Liebe war, Rentner wurde und immer zu Hause war. Er hat sie tierisch genervt, nehme ich an, und sie auch ganz schön erdrückt. Nur, wie gesagt, sie liebte ihn doch, dann kann das ja nicht sein, dass er sie nervt. Ich glaube, sie wollte auch ihre Ruhe vor ihm haben. Er war ja immer da. Ich denke, ihr war nicht bewusst, dass sie nicht genug Freiraum hatte, und ich wüsste auch nicht, dass sie irgendwelche Interessen hatte. Ja, Kreuzworträtsel, aber ansonsten?
Ich glaube, den Tod meines Vaters hat sie abgeblockt. Das Sterben fing ja frühmorgens an. Zuerst hat man viel zu tun. Später hat meine Mutter sich hingelegt, weil sie müde und kaputt war, dann hat sie einmal geschluchzt, und das war’s. Das war alles! Sie hat auch nicht geweint.
Ja – und meine Schwester? Ich weiß nicht, wie oft sie jetzt ins Altenheim fährt. Wenn ihre Enkelkinder da sind, kann sie gar nicht. Und ich höre schon oft: »Ich konnte am Wochenende nicht.« Und dann nicht und dann nicht. Ich nehme an, sie resigniert jetzt.
Und ich resigniere auch. Am Anfang ... was hab ich über Demenz gelesen und mir Gedanken gemacht und mir Berichte im Fernsehen angeguckt. Dann sind wir mit meiner Mutter zu Blasmusik-Konzerten gefahren, die ich schrecklich finde. Aber sie liebte die doch so. Nur, das war alles nichts. Nein, das merke ich, ich habe keine Energie mehr.
Auch jetzt mit ihren Zähnen: Ich habe keine Lust, mit ihr zum Zahnarzt zu fahren. Ja, vielleicht so nach dem Motto: Sie dankt es einem ja doch nicht, sie würde die neuen Zähne wahrscheinlich nicht einmal einsetzen. Nein, ich denke, was soll das?
Mensch, was habe ich ihr für Schuhe gekauft. Und die waren so teuer. Man muss ja einen besonderen Schuh nehmen, weil sie so dicke Füße hat. Und inzwischen kann sie gar nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, wo diese Schuhe geblieben sind.
Ja, es gibt da so eine Pflegerin, die sagte neulich: »Sie müssen Ihrer Mutter mal was Schickes kaufen.« Aber meine Mutter hat ja gar nicht mehr viel Geld. Ich habe nur gedacht, mein Gott, früher hat sie immer gesagt: »Das ist doch noch gut.« Was soll ich sie da schick machen, nur damit der Pflegerin irgendwie wohler ist. Meine Mutter könnte auch immer im Bett liegen – im Grunde ist es egal.
Ich finde es eigentlich auch ein bisschen ungerecht, wenn ich so denke, jetzt habe ich meine Kinder groß, und wenn ich mit meiner Mutter durch bin, bin ich selbst alt. Doch, das empfinde ich wirklich als ungerecht.
Eigentlich ist es ja kein so großes Opfer, zu ihr ins Heim zu fahren, aber ich denke oft, das würde mir nicht fehlen.
Als sie noch zu Hause lebte, hatte ich auch nicht immer Lust, hinzufahren, aber da habe ich das als meine Aufgabe angesehen. Nur, ich merke, das kann man gar nicht über Jahre. Das geht ja schon länger als 13 Jahre!
Ich war jetzt vier Wochen nicht da. Dann denke ich schon, heute muss ich hinfahren. Dann gibt es auch wirklich keine Entschuldigung mehr. Aber bis zu vier Wochen ...
Ich fahre nach Möglichkeit alle zwei Wochen hin. Am Anfang bin ich jede Woche gefahren. Aber jetzt nicht mehr. Ich streike schon manchmal. In der dritten Woche, na ja, am einfachsten ist es, ein paar Tage zu überziehen. Das mache ich also hemmungslos. Aber danach finde ich es nicht mehr so gut. Ich fahre dann hin, weil ich genau weiß, jetzt bringt das Herauszögern nichts mehr. Ich habe dann so starke Schuldgefühle. Deshalb fahre ich hin. Wenn ich da bin, unterhalte ich mich oft mit der Leiterin oder mit den Pflegern.
Sicher bin ich nicht die typische Angehörige.
Ich hatte noch nie im Leben eine so sinnvolle Aufgabe wie diese
Hartmut Tillmanns (70): Meine Frau (71) ist seit sechs Jahren demenzkrank





























