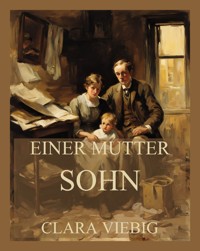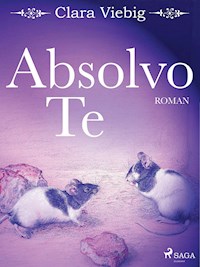
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"›Die Ratten, hu, die Ratten!‹ schrie die schöne Frau Tiralla, als sie mit der Magd im Keller war." So beginnt Clara Viebigs Psychodrama in Romanform und verweist sogleich auf die finsteren Schatten und Geschöpfe, die in Frau Tirallas Anwesen und in ihrer Seele hausen. Doch bald sind es nicht nur die Ratten, die sie in Angst und Schrecken versetzen, und dunklere Gestalten nagen an ihrem Gewissen ... Viebigs Roman über eine unglückliche Ehe, der sich die Frau durch einen Giftmord zu entziehen trachtet, gehört zu den eindrücklichsten Werken der wohl bedeutendsten naturalistischen Erzählerin Deutschlands. Der Roman war ein großer Erfolg und wurde später von der Autorin in eine Oper mit dem Titel "Die Môra" umgearbeitet, zu der ihr Sohn, der begabte Komponist Ernst Viebig, die Musik schrieb.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Absolvo te!
Roman
Saga
I
„Die Ratten, hu, die Ratten!“ schrie die schöne Frau Tiralla, als sie mit der Magd im Keller war. Sie wollten von dem eingemachten Kraut aus dem Fass in der Ecke zum Kochen heraufholen, die Magd hielt das Lämpchen, Frau Tiralla trug die irdene Schüssel. Aber nun liess sie diese mit einem gellenden Aufkreischen fallen und hob ihre Röcke so hoch, dass man ihre ganzen zierlichen Beine sah, die Füsse in den blanken Lederpantöffelchen, die buntgeringelten Strümpfe und die weissen Hosen mit der um die Kniee fallenden breiten Stickerei.
„Wo ist Ratte?!“ Die Magd lachte, dass man alle ihre breiten weissen Zähne sah. „Seh ich nicht Ratte. Hat sich nicht Ratte hier, Pani!“ Und dumm-verschmitzt blinzelte sie ihre Herrin von der Seite an. „Hat Pani wohl geträumt, is sich nichts Lebendiges in Keller, nur Pani und die Marianna. Kss, kss! Horch!“ Sie neigte für einen Augenblick lauschend den schwarzhaarigen Kopf, schüttelte ihn dann und lachte wieder. „Würden Ratten sonst trappeln — hört man nichts!“
Das Lämpchen hebend, leuchtete sie rundum. Huschende Schatten fielen auf die schwarzen, von Feuchtigkeit glitzernden Wände, zeigten die Sprünge und abgebröckelten Stellen im rohgefügten Mauerwerk und die tiefen Winkel, in denen dicke Spinnwebnester klebten. Es war der alte Keller eines alten Hauses, in dem die beiden Frauen standen, und ein ziemlich verwahrloster dazu. Er war nicht aufgeräumt. Wo das Sauerkrautfass stand, lagerten auch Torf und Kohlen, unordentlich durcheinander geworfen; zwischen den am Boden liegenden, noch vollen Weinflaschen trieben sich ebenso viele leere umher. Die Lattenregale, die einst bis zur halben Kellerhöhe an den Wänden hinauf gereicht hatten, waren zusammengebrochen zu einem Haufen faulenden Holzes; allerlei Gerümpel sielte sich zwischen den Kartoffeln, und zerbrochene Hacken, Besenstiele, Topfscherben ragten aus dem Sand hervor, in den man, um es so zu überwintern, hier und da nachlässig ein Bündel Suppengrün eingesteckt hatte. Ein fauliger Geruch erfüllte den nie gelüfteten Raum, der kein Fenster nach oben hatte, nur eine winzige, immer verschlossene Luke. Das Lämpchen brannte trübe, wie erstickt in der Moderluft; die beiden Gestalten, die derbe der Magd, die zierlichere der Herrin, waren von einem Flimmer dunstigen Nebels umzittert.
„Sind doch Ratten hier — siehst du — hörst du — hu!“ Wiederum laut aufkreischend und die funkelnden Augen in dem bleichen Gesicht weit aufreissend wie vor Entsetzen, packte Frau Tiralla den Arm ihrer Magd. „Da lief eine! Hu! Abscheuliches Tier!“ Sie schüttelte sich und sprang in die Höhe, als huschte ihr schon so ein langgeschwänztes Ungetüm unter die Röcke an ihren warmen Leib.
„Heilige Mutter!“ Die Magd, wie vom übertriebenen Entsetzen ihrer Herrin angesteckt, kreischte jetzt auch auf und liess das Lämpchen fallen, wie die andere vorher die Schüssel. Es klirrte in Scherben und erlosch; sie standen beide im Stockfinstern.
Die Herrin schrie nervös auf: „Frauenzimmer, dummes!“ und hob die Hand wie zum Schlage.
Die Magd, als sähe sie trotz der Dunkelheit die erhobene Hand, duckte sich und witschte zur Seite; bald hörte man ihr unterdrücktes Kichern in einem entfernten Winkel des Kellers. „Wenn Pani mich schlagen will — hihi — ich bleibe hier, hihi!“
„Dummheit — schlagen! Denk ich nicht daran,“ versicherte die Frau und versuchte einzulenken. „Komm nur her! Gib deine Hand!“
„O weh, Pani wird mich doch schlagen, nein, nein!“
„So gib deine Hand doch — sofort! Ich tue dir ja nichts, dummes Ding! He, Marianna, wo bist du?“
Die schöne Frau Tiralla schien jetzt von einer wirklichen Angst erfasst zu sein, von einer weit aufrichtigeren als vorhin. Ihre Stimme zitterte bang, ihre Brust hob und senkte sich rasch, sie wurde ganz kalt, und dann fühlte sie selber, wie ihr Kopf wieder brannte. Hu, war das dunkel hier — wie in der Grabesnacht! Es rieselte ihr eisig über den Rücken. Ah, war das schrecklich hier im Schwarzen, so ganz allein zu sein mit den Gedanken!
„Marianna,“ schrie sie hell auf, dass es von der Kellerwölbung widerhallte, „he, Marianna, wo bist du denn?!“
Keine Antwort.
„Marianna, ich werde dir auch meine seidene Schürze schenken, die dir so gefällt. Marianna, wo bist du nur?“
„Bin ich ja hier, bin ich ja nur zwei Schritt zur Seite getreten. Hier, Pani, hier!“ Die warme Hand der Magd umfasste die feuchtkalten, ganz geschwitzten Finger der Herrin. „Dass die Pani nicht anstosse,“ flüsterte sie geschmeidig.
So tappten sie beide Hand in Hand im Stockdunklen zur Kellertreppe.
„Gelobt sei Jesus Christus und seine Heilige Mutter Maria!“ lispelte Frau Tiralla, als sie die erste Stufe der schlüpfrigen Steintreppe unter ihren Füssen fühlte. Noch fünfzehn Stufen steil hinan, Gott sei Dank, dann war man oben! Dann hatte man wieder Licht. Und unten im Finstern blieben die finsteren Gedanken zurück! Jetzt, da sie bald oben war, fühlte sie kein Grauen mehr, kaum konnte sie sich eines Lächelns erwehren: da hatte sie aber der Marianna einmal ordentlich bange gemacht, nun glaubte die fest an Ratten. Darum wollte sie auch wegen der zerschlagenen Lampe nicht mit der Marianna zürnen. Jetzt hiess es, nur noch recht, recht viel von den Ratten reden und über sie klagen, damit bald alle sagten: ‚in Starydwór, in Anton Tirallas Haus, sind so viele Ratten, dass sie ihm über Bänke und Tische tanzen, dass sie ihm auf der Tenne den Weizen unterm Dreschflegel wegfressen, dass sie der Frau ihr schönes Kleid, das seidene, blaue, mit dem Spitzenbesatz, angefressen haben im Kleiderschrank.‘ Das würde gut sein — o ja, sehr gut!
Mit einem tiefen, erleichterten Aufseufzen presste Frau Tiralla die Hand des Mädchens: „Siehst du nun, du Ungläubige, dass da Ratten sind — oh, so viele!“
„Wenn Pani sagt: sind Ratten da, so sind Ratten da,“ sprach die Magd unterwürfig.
Frau Tiralla sah nicht das Lächeln, das dabei den breiten Mund unter dem Stumpfnäschen noch breiter zog, sah auch nicht den heimlichen, schlauen Strahl in den schmalen, tiefliegenden Augen aufblitzen.
Aha — die Magd lachte in sich hinein — hielt die Pani sie denn für so dumm?! Es sollten durchaus Ratten hier sein. Die Pani wünschte es, dass Ratten hier waren, die Pani wollte es glauben machen, dass Ratten hier waren — mochten Dümmere das glauben, sie, die Marianna Śroka, war viel zu schlau, ihr machte man nichts vor! Dabei hatte die Herrin wohl einen Grund, denn Ratten waren nicht da!
Aber der Herrin zum Munde redend und wie heimlich schaudernd, sprach sie, als sie oben ans Tageslicht traten: „Pani ist blass vor Schrecken. Psia krew, die abscheulichen Tiere! Sie werden uns noch fressen die Haare von Kopf!“
Frau Tiralla nickte. Und dann sagte sie: „Du kannst nachher zu mir in die Stube kommen, dass ich dir die Schürze gebe, die ich dir versprochen habe!“
„Und die Spitze,“ begehrte die Magd, „die Spitze, die mir die Pani neulich gezeigt hat. Ich werde sie an meine Schürze setzen!“
„Meine Spitze — an deine Schürze?!“ Frau Tirallas bleiches Gesicht wurde zornrot. „Bist du verrückt?“
„Ah, nur ein Endchen, ist sich ja nur kurzes Endchen! Was will die Frau mit kurzes Endchen anfangen, ist sich nicht Mühe wert aufzuheben!“ Und dann lachte die Magd ganz dreist laut heraus: „Werd ich dann sagen, hat mir Pani geschenkt, weil Ratten sonst doch auffressen. Ratten sind so viele — Ratten fressen alles hier!“
Es durchzuckte Frau Tiralla: die war ja so frech! Was ahnte die — was wusste die?!
Für ein paar Augenblicke sahen sich beide Frauen starr an, ohne ein Wort; es war, als wollten sie beide sich stumm bis auf den Grund der Seele erforschen. Dann lächelten sie beide zu gleicher Zeit, wie um sich gegenseitig zu beruhigen.
‚Die Pani kann sich ganz auf mich verlassen,‘ sagte das Lächeln der Magd. ‚Ich kann dumm sein, ich höre nichts, sehe nichts, weiss nichts, ganz wie die Pani will.‘
Und das Lächeln der Herrin sagte: ‚Die ist ja so dumm — nur keine Angst! Die merk nichts, die glaubt, was man ihr sagt; und merkt sie auch ’was, mit einer Schürze, mit einem Endchen Band, mit einem Schnippelchen Spitze, mit einem halben Gulden, wenn’s hoch kommt, ist die zu erkaufen!‘
„Marianna,“ sprach Frau Tiralla, „nun haben wir die Schüssel zerschlagen und kein Kraut zu Mittag!“
„Braucht Pani nicht sorgen!“ Die schwarzhaarige Dirne lachte, dass ihre schmalen, blitzenden Augen ganz hinter den starken Backenknochen verschwanden. „Werde ich noch einmal in Keller steigen mit andere Schüssel und Kapusta holen, ganz alleine, Pani braucht nicht Ratten fürchten. Und wenn er“ — sie winkte mit einem kurzen Kopfnicken hinüber zu der nächstliegenden Stubentür — „wenn er spricht: ‚warum Schüssel zerschlagen und Lämpchen zerschlagen?‘ werde ich sprechen: ‚ei, sprang Ratte über unsere Hand — gottverdammte Ratte — biss Pani in die Hand und mich in die Nase. Sind soviel Ratten in Keller hier, dass man nicht mehr hinabsteigen kann ohne Schaden!‘“
„Recht hast du!“ Frau Tiralla lächelte befriedigt. „Es ist ganz grässlich mit dem Ungeziefer in diesem alten Haus. Und Schwaben haben wir auch in der Küche und —“
„Sie bedecken abends die Wände,“ fiel die Magd eifrig ein. „Soll der Gospodarz nur kommen und sehen in meiner Küche nach, abends, wenn Licht ausgeblasen ist, wird er selber dann sprechen: ‚Hu!‘ An den Kopf fliegen sie einem, mitten ins Gesicht, gegen Nase, Augen, Ohren. Krabbeln sie hier, krabbeln sie da — hu!“ Mit einem gellenden Aufkreischen warf sie sich die Schürze über den Kopf.
„Psia krew, was für ein Lärmen! Frauenzimmer, verdammtes, kannst du nicht dein Maul fünf Augenblicke halten, nicht die paar Minuten, die ich schlafen will?!“
Die Stubentür war aufgerissen worden, mit zorniger Stimme schalt der Besitzer Tiralla auf seine Dienerin ein. Aber als er hinter der Magd seine Frau erblickte, wurde sein Ton milder, fast besorgt: „Was ist denn, was ist denn?“ Frau Tiralla hatte mit aufgeschrieen, wie in jähem Entsetzen. „Warum schreit ihr denn so? Mein Seelchen, warum schreist du, was ist denn geschehen, du bist ja ganz blass? Sage, Zoschchen, was ist dir geschehen?“
Man merkte dem grossen Mann mit dem starken Gliederbau und dem braunroten Gesicht die Besorgnis um seine Frau an. Mit einem heftigen Griff die heruntergerutschte Hose heraufziehend, denn Zoschchen mochte es gar nicht leiden, wenn er sich’s ein wenig bequem gemacht und die Hosenträger abgetan hatte — ‚Pfui, wie ein Bauer!‘ sagte sie dann — trat er ihr rasch näher. „Was ist denn geschehen, so sage doch!“
Die schwarzen Augen der Frau starrten ihn aus dem bleichen Gesicht an. „Heilige Mutter, wieder die Ratten,“ stammelte sie und griff um sich, als suche sie einen Halt.
Da lachte Herr Tiralla. „Ratten?! Aber, Frauchen! Ratten gibt’s überall, wo Schweine sind; warum nicht hier auf dem Hofe? Wenn’s weiter nichts ist!“ Er lachte gutmütig. „Ich dachte, ihr hättet die Kurze Pluckaa) gesehen oder unten im Keller den Babok, den schwarzen Mann. Warum sprachest du denn nicht: ‚Alle guten Geister loben Gott‘ — auch die Ratten wären davon entwichen!“
„Lästere nicht,“ sagte sie eisig. „Dass Gott dich strafe!“ Und als er sie schäkernd umfassen wollte, mit seiner riesigen behaarten Hand ihr unterm Kinn herfahren, wich sie zurück und brach in Tränen aus. Da sie, sich die Rechte vor die Augen haltend, mit der Linken an ihrem Kleid herumtastend, nicht gleich das Taschentuch fand, hielt sie nun ihr Schürzchen vor. Sie schluchzte heftig.
Vergebens suchte er ihr die Schürze vom Gesicht wegzuziehen; sie hielt sie fest vorgepresst. Ihre schlanken, für eine Landfrau merkwürdig wenig verarbeiteten Finger hatten eine eiserne Widerstandskraft.
Er war ganz bestürzt. „Seelchen, Täubchen! Aber Zoschchen, was hast du denn?“ Vergebens suchte er einen Blick in ihr Gesicht zu erhaschen. „Verdammtes Frauenzimmer, was grinsest du?“ brüllte er plötzlich die Magd an, die noch immer auf demselben Fleck stand und breit lachte. „Dass der Teufel dich hole, du, nur du allein hast die Herrin geärgert!“
„Nein, nein, Panje, ich nicht! Sind es die Ratten gewesen, kann ich beschwören. Mag der Gospodarz nur selber in Keller steigen, wird er sehen, wie sie laufen an Boden, wie sie springen an Wänden. Und in meiner Küche mag er die Schwaben sehen, hunderttausend, hunderttausend Millionen — werden sie noch fallen in Essen von Pan Tiralla. Wird der Herr ja sehen!“
„Untersteh dich!“ Tiralla hob die schwere Hand gegen die Magd, aber sie wich ihm so geschickt aus wie vorhin der Herrin. Es war so drollig, wie sie sich hinter die Herrin duckte, diese wie ein Bollwerk benutzend, dass der ungefüge Mann in ein dröhnendes Lachen ausbrach. „Brauchst nicht Furcht zu haben, dummes Ding,“ sagte er gutmütig, „ich schlage nicht. Weiss ich zwar, dass du ein Satansbraten bist, aber du wirst mir doch keinen Unrat in den Teller schöpfen!“
„Nein, nein,“ versicherte sie treuherzig, „werde ich nicht tun,“ und kam hinter der Herrin vor.
Er kniff sie mit seiner behaarten Hand in die feste Wange. Es tat weh, seine derben Finger hinterliessen erst eine weisse, dann eine brennendrote Druckstelle, aber sie liess es sich ruhig gefallen: nein, der Gospodarz war nicht böse! Eigentlich war er viel besser als seine Frau! Marianna dachte auf einmal, dass es doch schade um ihren Herrn sei. Und sie drängelte sich ein wenig an ihn heran und warf ihm unter halbgesenkten Lidern einen verheissungsvollen Blick zu — wenn der Alte nur wollte, sie würde schon wollen!
Aber Tiralla hatte nur Augen für seine Frau. Er bettelte weiter um einen Blick von ihr. Es hatte etwas Lächerliches, wie dieser starke und schon ergraute Mann um die zarte, zierliche Frau sich mühte. „Aber, Zosia, Zochna, Zosieczka, was hast du denn? Sieh mich an, meine Taube, weine doch nicht!“
Nun war es ihm gelungen, ihr die Schürze vom Gesicht zu ziehen, liebkosend wollte er seinen Mund ihrer Wange nähern, da fauchte sie ihn an, mit sprühenden Augen, wie eine gereizte Katze: „Du hast mir weh getan, au! Pfui, wie du riechst, nach Mist, nach Tabak, und nach Schnaps dazu! Du stinkst, du Bauer!“ Sie spie aus.
„Zoschchen,“ sagte er ganz traurig, „wie du sprichst! Nur einen kleinen, wirklich nur einen einzigen, ganz kleinen Schnaps habe ich heute getrunken, ich schwöre es dir bei der Heiligen Mutter und ihrem Sohne!“
„Beflecke die Heilige Mutter nicht, wenn du sie anrufst,“ sagte sie schneidend. „Lästere sie lieber, dass sie dich eher zur Hölle fahren lasse, wohin du gehörst. Ich werde dir keine Träne nachweinen. Das schwöre ich dir!“
„Was — was — habe ich dir getan?“ stammelte der Mann, ganz erschrocken. „Ich tat dir doch nichts. Ich habe dir Kleider gekauft, so viele du wolltest; ich habe dich zum Balle gefahren, so oft du wolltest; ich habe dich tanzen lassen, mit wem du wolltest; ich habe nie ‚nein‘ gesagt, wenn du sagtest ‚ja‘ — und nun sprichst du so hässlich zu mir?! Du bist krank, meine Liebe, ich werde zum Doktor schicken!“
„Ja, krank!“ Sie schluchzte heftig auf. „Du hast mich krank gemacht! Du, du, du!“ Sie ging auf ihn los, als wollte sie ihm mit ihren Nägeln ins Gesicht fahren. „Ich mag dich nicht — ich verabscheue dich — ich, ich hasse dich!“ Gellend schrie sie das, in den höchsten Tönen; ihre Augen brannten, die Fäuste ballte sie und stiess sie sich vor die eigene Brust, und dann griff sie sich mit allen zehn Fingern in ihre schön-geglätteten Haare und zerraufte sie. Ihre zierliche Gestalt zitterte und schwankte; und nun erbleichte sie so tief, als würde sie gleich in Ohnmacht sinken.
Die Magd riss die Augen auf: was fiel der ein?! War die dumm, war die dumm! Warum es denn dem Herrn ins Gesicht schreien, wenn der’s nicht so merkte?! Ei, nun gab sie es ihm aber deutlich: ‚Ich hasse dich‘ — und er, der Arme, den Gott trösten möge, was tat er? War’s zum Lachen oder zum Weinen?! Marianna Śroka wusste selber nicht, sollte sie denken: ‚o du grunddummer Esel‘, oder sollte sie wünschen: ‚hätte ich ihn doch zum Manne, oder wenigstens zum Liebsten‘! Denn gut war der Gospodarz, wirklich von Herzen gut; der würde sie nicht knapp halten, sie und ihre zwei Kinderchen. Die Frau war doch zu garstig, die Frau war, bei Gott, den guten Mann gar nicht wert!
Und in einem plötzlichen Umschwung ihrer Gefühle, die sie vordem mehr zur Herrin hingezogen hatten, neigte sich die Magd nun ihrem Herrn zu. Eine Schande war’s, wie die Frau ihn behandelte! Die musste ihn geradezu behext haben, dass er sich so ’was gefallen liess! Seinen grossen Lederpantoffel mit dem Holzabsatz sollte er lieber vom Fusse nehmen und ihr den auf den Kopf schlagen, dass ihr Hören und Sehen verging, als dass er so bettelte und barmte. Ja ja, natürlich, da war kein Zweifel daran, der Herr war verrufen; den grossen, dicken Mann hatte die kleine Frau behext — diese magere Ziege! Die war eine Mora, die sich verwandeln kann in eine Katze, oder eine, die auf dem Besenstiel durch den Schornstein fährt. Das müsste der Herr Propst wissen, der würde ihr schon das Handwerk legen! Oder nein, — noch besser — sie, die Marianna, nahm selber die Sache in die Hand. Dann hatte sie den Dank von Pan Tiralla ganz für sich allein. Sie würde den Zipfel ihres Hemdes nehmen und dem Behexten dreimal damit über die Stirn wischen, dann wich der Zauber von ihm. Und wer weiss, was dann geschah, ob er dann nicht doch die Frau aus dem Hause jagte, die immer so garstig zu ihm war, die sich in einem besonderen Zimmer bettete und ihm die Türe vor der Nase zuschlug?! Ei, sie, die Marianna, würde die Türe nicht zuschlagen. Hatte er denn nicht Knochen wie ein Ochse, war er denn nicht noch ein ganz ansehnlicher Mann? Wenn er auch strubblige, schon ergraute Haare hatte und ein wenig wässrige Augen, er konnte noch immer seinen Mann stellen. Und Geld hatte er, ei, so viel Geld! Der Magd klopfte das Herz vor Begehrlichkeit. Alle Läden in Gradewitz konnte man dafür auskaufen, die in Gnesen auch, und wer weiss, ob nicht sogar die in Posen. Es war ein Jammer, dass diese Frau, diese Hexe einmal all das Geld kriegen würde, wenn er tot war! Einen schielenden Seitenblick, der ihr hübsches, derbes Gesicht hässlich machte, warf die Magd auf ihre Herrin.
Frau Sophia Tiralla stand noch immer und weinte. Als lägen alle Leiden der Welt auf ihr, so schlaff liess sie die Schultern nach vorn hängen, so tief neigte sie den Kopf. Ihr Mann hatte seine vergeblichen Annäherungsversuche aufgegeben, er stand da wie begossen und liess in einem verwunderten, ratlosen Staunen seine fahlblauen, verschlafenen Augen von der Frau zu der Magd wandern und wieder von der Magd zur Frau.
„Wenn ich nur wüsste, Zoschchen,“ sagte er endlich kleinlaut — „bei Gott, ich habe dir doch nichts in den Weg gelegt! Was ist dir wohl für eine Laus über die Leber gelaufen?!“
Die Magd prustete laut heraus. Das kam ihr so unendlich komisch vor, sie konnte sich gar nicht fassen vor Vergnügen: eine Laus, haha, eine Laus! Sie stopfte sich die Faust in den Mund und biss darauf, um ihr Lachen zu unterdrücken.
Ein zorniger Blick der Herrin traf sie. „Was unterstehst du dich? An die Arbeit! Dalej, dalej!“
Die Magd erschrak. Ei, guckte die Herrin böse, wie kalter Stahl trat der Blick! „Auf den Hund den bösen Blick!“ murmelte Marianna heimlich und schützte ihr Gesicht mit dem Ärmel. Und dann dachte sie: au weh, nun gibt sie mir die Schürze nicht, die seidene Schürze! Es war am Ende doch besser, sich mit der Herrin zu verhalten, die war doch diejenige, die allein alles hier zu sagen hatte. Und so lispelte sie denn entschuldigend: „Muss Pani verzeihen, war so drollig, dass Gospodarz, grosser, dicker Gospodarz, sich vergleicht mit klein-winziger Laus! Konnt ich nicht helfen, musst ich lachen!“ Und sie lachte ein spitzbübisches Lachen, in das diesmal Frau Zosia mit einstimmte. Es war etwas Erbarmungsloses in dem Lachen der beiden Frauen.
Herr Tiralla hörte das nicht heraus; er war froh, dass seine Zosia wieder besserer Laune war. Als sei nichts vorgefallen, nahm er sie jetzt bei der Hand und zog sie in die Stube.
Und sie liess sich ziehen. Wenn er denn nicht merkte, dass sie ihn nicht mochte, trotz allem und allem nicht, es sogar nicht merkte, wenn sie es ihm ins Gesicht schrie, so sollte er’s denn fühlen. Er wollte es ja nicht anders! Ein grausames Lächeln hob für einen Moment ihre kurze Oberlippe, und doch schossen ihr gleich wieder die Tränen in die Augen. Ha, wie sie ihn hasste!
Als sie nun drinnen in der Stube bei ihm sass — er hatte sie auf seine Kniee ziehen wollen, aber sie war ihm geschickt entwichen und sass nun eingeklemmt zwischen Tisch und Wand, dass er nicht so bequem an sie konnte — jagten Gedanken mit fürchterlicher Schnelligkeit durch ihren Kopf. Gedanken, die sie schon oft ausgedacht hatte, und die doch immer von neuem ihr Herz erzittern machten. Ganz stumm sass sie da.
Er verlangte auch weiter keine Unterhaltung. Wenn sie nur da war, wenn er nur das Gefühl hatte: so, nun brauchte er nur den Arm auszustrecken, sie mit seiner starken Hand zu erfassen, zu sich heranzuziehen, sie zu tätscheln, wenn sie auch nicht wollte — am Ende war er doch stärker. Herr Tiralla hatte sich auf die Ofenbank geworfen, der Länge nach; kaum brachte er seine massigen Glieder auf der Bank unter. Sie ragten in Länge und Breite ein Stück über. Er seufzte: da war er nun schon heute morgen über seine Äcker gestampft und hatte gesehen, dass die Wintersaat gut stand, hatte auch gehört, dass die Dreschflegel in der Scheune fleissig im Takt klappten, hatte eine ganze Weile im Stall den wiederkäuenden Kühen zugeschaut und den zwei stattlichen Rossen einen liebkosenden Klaps mit der flachen Hand gegeben — ei, das war fürwahr ein Tagewerk gewesen! Nun hatte er auch die volle Berechtigung, sich ein wenig auszuruhen. Zudem war Schnee in der Luft, eine grosse, dicke, graue Stille draussen, da lag sich’s in der warmen Stube so behaglich, bis der Barschtsch und das Kraut und die Wurst kamen, und nach dem Mittagessen lag sich’s behaglich weiter, bis es wieder ’was zu essen gab oder bis es an der Zeit war, in das Dorf hinein in den Krug zu gehen. Dort traf er dann die Honoratioren, zuweilen sogar den Herrn Propst; der verschmähte es auch nicht, ab und zu mit ihnen ein Glas zu leeren und die Neuigkeiten zu besprechen, wenn er es auch nicht haben mochte, dass man nachher von seiner Anwesenheit erzählte. Ein ganz umgänglicher Mann, der Propst, und lange nicht so streng wie die Zosia! Herr Tiralla fühlte sich gut Freund mit ihm. Der würde ihm nicht Gottlosigkeit vorwerfen! Ei, die Zosia übertrieb es wirklich! Ging er denn nicht jeden Sonntag ins Hochamt und jeden Feiertag auch? Die Frühmesse konnte man wirklich nicht noch von ihm verlangen; musste er denn nicht ohnehin Winter und Sommer allzufrüh aus dem Bette? Und hatte er nicht seinen Heiligen in der Stube hängen, und war er nicht allzeit willfährig, zu geben, was die Kirche verlangte? Man braucht darum doch kein Duckmäuser zu sein; und wenn man eine hübsche Frau besitzt, will man doch auch etwas von ihr haben. Deswegen würde es ihr schwer werden, ihn beim Propst anzuschwärzen; der wusste doch auch recht gut, was einem gesunden Manne zukommt!
Herr Tiralla dehnte sich mächtig, und dann streckte er die Arme aus: „Komm ’mal her, mein Seelchen!“
„Was willst du?“
Sein Unternehmungsmut schwand sogleich, als er diesen eisigen Ton hörte. „Warum sprichst du nicht freundlicher zu mir?“ sagte er kleinlaut. „Ich will ja nichts von dir. Ich — ich möchte dich nur fragen, ob du dir ein neues Kleid wünschest zum Stefanstag? Oder wie wäre es mit einem Paar Ohrringe? Oder hättest du Lust auf einen neuen Pelz, wenn wir werden nach Posen fahren zum Gesindemarkt?“
„Ich brauche nichts,“ antwortete sie in gleich kaltem Ton.
„Denk nur darüber, es wird dir schon noch etwas einfallen,“ ermunterte er. „Sage nur! Für dich wird mir nichts zu teuer sein. Komm, kleines Frauchen, komm doch her!“ Wieder streckte er die Arme aus.
Aber sie rührte sich nicht.
„Willst du kein neues Kleid? Ich sah wunderschöne Stoffe in Gnesen. Rosenthal hat ausgestellt in seinem Schaufenster — ei wei, eine Pracht! Kirschrotes Tuch und schwarze Borten zum Besatz. Die Landrätin trägt so eines zum Sonntag. Zoschchen, möchtest du nicht das gleiche haben?“
Ihre Augen begannen zu funkeln. Neue Kleider, ein Kleid wie eine vornehme Dame! Eine Lust darauf kam sie an, aber nur für Momente; der Glanz in ihren Augen erlosch jäh: was sollte ihr das Kleid neben so einem Manne?! Energisch schüttelte sie den Kopf: „Ich will keins!“
So kam er nicht zum Ziel! Herr Tiralla, der sich so ungern erheben wollte, sah wohl ein, er würde aufstehen müssen und sich neben sie hinter den Tisch zwängen oder sie hervorziehen müssen mit Gewalt. Wenn sie dann schrie, das holde Täubchen: ‚Geh doch, lass mich, du Swintuch‘, dann musste er ihr den Mund mit einem Kusse verstopfen. Mit Gewalt!
Fluchend setzte Herr Tiralla den einen schweren Fuss zur Erde. Er war ärgerlich, dass er so aus seiner Ruhe gestört wurde; aber er konnte nicht widerstehen, sie war zu reizend. Stöhnend erhob er sich vollends
Sie sah es mit Schrecken. O, nun würde er wieder seine Arme um sie schlingen, diese Arme, weiss und fett, mit dem haarigen Flaum darauf, diese Arme, denen ihre Mutter sie ausgeliefert hatte, als sie noch jung und harmlos war und nur an die lieben Heiligen gedacht hatte und an den Herrn Jesus und keine Lust gefühlt hatte zu einem anderen Manne! Nun war sie nicht mehr jung und harmlos und — ein plötzlicher Einfall durchzuckte sie — ha, wenn sie ihn dafür herumkriegen würde, Gift zu kaufen?! Rattengift! Sie hatte schon oft davon angefangen, aber er hatte immer nicht gewollt; er glaubte nicht an die Ratten. Und wenn sie ihm auch über die Nase springen würden, er schaffte kein Gift ins Haus, es widerstrebte ihm. Sie aber bekam Gift für das Ungeziefer auf dem Hofe nur gegen einen Schein, unterzeichnet von des Besitzers Hand.
Es überlief sie. Sie schüttelte sich wie in Grausen: „O, die Ratten!“ Und dann stand sie zögernd auf. Noch einmal setzte sie sich wie unschlüssig nieder, fast schwer fiel sie zurück auf ihren Platz, aber dann gab sie sich einen Ruck. Sie stand rasch wieder auf, ging hin zu ihrem Mann und setzte sich auf seine Kniee.
Er war schier verdutzt über diese Wandlung. Aber dann war er glückselig: so nett war sie lange nicht gewesen! Sie kraute ihm den Kopf, und er lehnte seine Stirn gegen ihre weiche Brust und fühlte deren Wogen.
„Dein Herzchen klopft sehr!“
Sie sagte kurz: „Das glaube ich!“ Und dann küsste sie ihn auf den strubbligen Schädel und schmeichelte ihm: „Mein Alter, mein Lieber! Du willst mir ein Kleid kaufen, also wirklich ein neues Kleid?!“
Er nickte heftig; zu wohlig war’s ihm, um zu reden.
„Ich möchte wohl,“ fuhr sie fort und drückte seinen Kopf immer fester an ihre Brust, „ich möchte wohl so ein Kleid tragen, kirschrot mit schwarzen Borten, wie unsre Landrätin eines trägt. Wenn sie mich darin sehen würden zu Gradewitz, oder deine Bekannte in der Stadt, würden sie da nicht sprechen: ‚Wie gut die Tiralla das Rot kleidet?! Welch hübsche Frau hat doch der Anton Tiralla‘!“
Er schmunzelte.
„Aber weisst du, was nutzt es mir,“ fuhr sie fort — ihre Stimme sank und wurde ganz tonlos — „die Ratten würden es ja doch fressen!“
„Zum Teufel mit den Ratten! Lass sie!“ Ärgerlich fuhr er auf trotz seiner Zärtlichkeit; sie hatte ihn schon allzu oft und allzu sehr mit ihren Ratten gequält. „Die Teufel mögen dich holen, dich und deine ewigen Ratten!“ Gift kam ihm nun einmal nicht ins Haus; lieber tausend Ratten als ein Giftkorn! Wie leicht konnte da ein Unglück geschehen! Bei Gift hat der Böse die Hand im Spiele!
Aber mit Kraft drückte sie seinen Kopf wieder an ihre Brust zurück. Er musste da liegen bleiben; es war, als ob ihre Finger, die auf seinem Schädel hin und her spielten, ihn bannten.
Er lallte wie ein Kind: „Lass die Ratten — gib mir einen Kuss — da — da!“ Wies hinter sein rechtes Ohr, hinter sein linkes Ohr, dahin, dorthin, und sie kniff die Augen zu und drückte ihren Mund in seine Haare, durch die schon da und dort die wenig saubere Kopfhaut durchschimmerte.
Sie holte tief und zitternd Atem, als ringe sie nach Luft. Die zusammengekniffenen Augen riss sie weit auf und stierte auf einen Punkt, immer auf einen Punkt — es musste sein! Und dann sagte sie, indem ihr Gesicht, das er nicht sah, sich vor Widerwillen verzerrte, mit einer Stimme, die doch wie lauter Schmeicheln klang: „Lieber, möchtest du schlafen? So — lehne dich in meinen Arm! Mag die Marianna draussen alleine schaffen, ich bleibe bei dir. Ach, mein Lieber, ich fürchte mich so!“
Und sie schmiegte sich dichter an ihn, so dicht, dass ihr warmer Körper ihn förmlich umschlängelte. „Die Ratten — ach!“ Sie stiess einen zitternden Seufzer aus. „Die abscheulichen Ratten! Lieber, nicht wahr, wir werden Gift legen — Rattengift — aber bald — sonst sterbe ich vor Angst!“
II.
Der Hof des Besitzers Tiralla lag weit draussen vorm Dorf am Przykop, dem tiefen Grund, bei den grossen Kiefern. Starydwór war ein stattlicher Hof. Da waren viele in Starawieś, die Frau Tiralla beneideten. Die war doch ein blutarmes Mädel gewesen, die Tochter einer Lehrerswitwe, hatte nicht mal sechs Hemden und einen Wagen voll Hausrat gehabt, und nun hatte sie soviel Geld! Aber keiner, und wenn er ihr noch so übel gewollt, hätte ihr nachsagen können, dass sie ihrem Alten nicht treu gewesen wäre.
Der Besitzer Tiralla war schon bei guten Jahren gewesen, als er sie geheiratet hatte, und er war ein Witwer dazu mit einem grossen Jungen. Leicht mochte das für das junge Ding auch nicht gewesen sein, sagten die, die Frau Tiralla wohl wollten. Aber sie hatte sich gut geschickt, wenigstens wurde Herr Tiralla dick und fett und sagte es allen, die ihn gewarnt hatten, die Siebzehnjährige zu freien, seine Zosia sei das süsseste Weibchen unter der Sonne, und er fühle sich so mollig wie die Made im Speck. Und das sagte er noch, jetzt, nachdem sie schon bald fünfzehn Jahre miteinander verheiratet waren. Sie hatte es ihm angetan. Ihre grossen Augen, die wie dunkler Samt aus dem weissen Gesicht glänzten, führten ihn am Narrenseil; er konnte ihr nicht böse sein, wenn sie ihn oft auch noch so sehr kränkte. Und wenn er’s recht überlegte: war’s denn nicht am Ende gerade schön, dass sie so spröde und zurückhaltend war? Weiber, die sich ihm an den Hals warfen, hatte der Besitzer von Starydwór genug in seinem Leben kennen gelernt; selbst seiner ersten Frau, der verstorbenen Hanusia, konnte er nicht gleiche Keuschheit nachrühmen.
Und hübsch war seine Zosia! Es schmeichelte dem Alternden gewaltig, dass man niemals nur von ihr als von ‚Frau Tiralla‘ sprach, sondern immer nur von der ‚schönen Frau Tiralla‘. Wenn er mit ihr durch Gradewitz fuhr — er auf dem Vordersitz, sie hinten in der Britschka mit Schleier und Federboa — staunte alles, was auf der Gasse war. Aber selbst in Gnesen stürzten die Herren Offiziere, die im Hotel zu Mittag speisten, ans Fenster und drängelten sich und machten lange Hälse, nur um die schöne Frau Tiralla vorbeifahren zu sehen. Dann knallte Herr Tiralla mit der Peitsche und fühlte sich sehr stolz; die mochten ihn ’mal beneiden! Die wussten es ja nicht — kein Mensch wusste es — dass er manchen Abend, wenn er sich ihr nähern wollte, einen Stoss vor die Brust erhielt, so kräftig, dass man ihn der zarten Frau nimmermehr zugetraut hätte. Seine Zosia war nun einmal nicht für die Zärtlichkeit, damit tröstete er sich. Sie war aber doch eine liebe Frau, eine schöne Frau, ein herziges Weibchen, von dessen Hand ihm das Essen noch einmal so gut mundete und noch einmal so gut bekam. Und schön war sie noch wie am ersten Tag. Schöner vielleicht jetzt in den Dreissigen als damals, wo sie noch gar so dünn, gar so klein war, keine hundert Pfund schwer, so leicht, zum Auf-der-Handtragen!
Er hätte sie gern behängt, bunt und auffallend wie ein Schlittenpferd, aber sie hatte den Geschmack wie eine Dame. Das kam daher: sie hatte Bildung. Sie sprach deutsch, dass es nur so floss, und konnte es auch schreiben ohne einen einzigen Fehler. Sie kannte ganze lange Gedichte auswendig; sie wusste von Berlin zu reden, obgleich sie noch niemals dort gewesen war. Und das imponierte Herrn Tiralla gewaltig. Gnesen und Posen und Breslau waren zwar auch grosse Städte, aber Berlin, Berlin! Herr Tiralla staunte seine Frau an. Er selber kam sich ihr gegenüber sehr unwissend vor, obgleich er seinerzeit die Ackerbauschule zu Samter besucht und ganz gut verstanden hatte, aus seinen vom Vater ererbten fünfhundert Morgen etwas herauszuwirtschaften. Die Kinder, der Sohn aus erster Ehe, und dann die kleine Rosa brauchten einmal nicht ihr Brot bei fremden Leuten zu verdienen; vor allem aber würde seine geliebte Zosia, wenn er vor ihr sterben sollte, sichergestellt sein. Er hatte, wie er es vor der Hochzeit der Mutter, der Lehrerswitwe, zugeschworen hatte, bald nach der Hochzeit einen letzten Willen zu ihren Gunsten gerichtlich aufgesetzt.
Frau Lehrer Kluge hatte völlig befriedigt über ihr Werk die Augen schliessen können. Sie, die einstmals aus besseren Kreisen, aus Breslau stammend, sich die Jahre ihrer Ehe mit dem Posenschen Schulmeister in den erbärmlichsten polnischen Nestern hatte herumdrücken müssen, hatte ihrer hübschen Tochter durch ihre Klugheit und Umsicht dies glänzende Los bereitet. Frau Kluge hatte nie gelitten, dass die kleine Sophia mit den anderen Kindern auf der Gasse spielte. Zosia trug immer Strümpfe und Schuhe; dafür hungerte man insgeheim lieber. Und als Zosia grösser wurde und in den Religionsunterricht für die erste heilige Kommunion ging, wurde sie des Herrn Propsts erklärter Liebling. Frau Kluge war eine fromme Christin, vielleicht die allerfrömmste in Gradewitz; bei ihrer Schneiderei für die Besitzerfrauen, mit der sie sich und ihr Kind ernährte, pflegte sie immer leise betend die Lippen zu bewegen. Durch diese Schneiderei hatte sie auch des Besitzers Tiralla Frau kennen gelernt — vielleicht auch durch ihre Frömmigkeit. Denn war es nicht wie eine Gegengewährung von Jesus Christus selber, dass beim letzten Kleid, das sie der schwangeren Frau Hanusia machte, der Besitzer Tiralla mit in die Stube kam? Er hatte seine Frau vorgefahren, es war bitterkalt, darum stieg auch er ab und liess das Pferd allein draussen warten. Kaum konnte er durch die niedrige Tür, und die kleine Stube war ganz voll von ihm. Das junge Ding, das der Mutter beim Anprobieren die Stecknadeln zureichte, bekam eine Mark von ihm und einen Blick, vor dem es errötete und die schwarzen Augen niederschlug, ohne zu wissen warum.
Sophia Kluge war sittsam; kein junger Bursche aus der Nachbarschaft konnte sich ihrer Gunst rühmen. Sie wusste nicht einmal, warum sich die Burschen und Mädchen an den Feierabenden hinaus in die Felder stahlen, warum ihr weicher Gesang sehnsüchtig aufstieg zum besternten Himmel. Sophia mit den schwarzen Augen und dem weissen Gesicht, das keine Sonne, keine Landluft gebräunt hatte, denn sie sass immer bei der Mutter drinnen in der Stube, war fromm; so fromm, dass der Propst, ein noch junger Mann mit einem Gesicht wie Jesus Christus selber, sich eingehend mit ihr beschäftigte. Er hatte schon die Elfjährige zu sich kommen lassen in seine Studierstube, die selbst seine alte Haushälterin nur dreimal im Jahre betreten durfte. Dort sprach er dem Kinde von den Freuden der Engel und der bald Mannbaren von dem himmlischen Bräutigam. Er berauschte sich und sie an den Bildern des Himmels, an den Strömen der Liebe, die das Herz der Heiligen durchflutet hatten.
Frau Kluge war eitel auf diese Bevorzugung ihrer Tochter, aber über deren Seelenheil vergass sie doch das irdische Teil nicht. Sie hatte genug der Entbehrungen und Entsagungen in ihrem armen Leben auf sich nehmen müssen, um ihrer Tochter nicht auch schon ein Geniessen auf Erden zu wünschen. Es dünkte ihr wie ein Fingerzeig der Heiligen, dass Frau Tiralla, ehe sie noch das neugeschneiderte Kleid angezogen hatte, zu früh niederkam und starb. Nun war Herr Tiralla wieder ein Freier, und als er selber bei der Schneiderin erschien, um ihr den noch ausstehenden Schneiderlohn für das nicht mehr getragene Kleid der Seligen zu zahlen, merkte die gescheite Frau den wohlgefälligen Blick, den der Witwer auf die junge Schönheit warf. Frau Kluge kannte die Schönheit ihrer Tochter und wusste sie zu bewerten. Als Herr Tiralla sagte: „Ihre Tochter ist verdammt hübsch,“ sagte sie: „Ach, die ist ja noch so jung!“ Und als Herr Tiralla wiederum vorsprach: „Psia krew, ist das traurig auf so einem öden Hofe allein zu sitzen,“ sprach die Gescheite: „Herr Tiralla muss wieder heiraten. Es gibt Witwen und ältere Mädchen genug, die den Herrn Tiralla gern nehmen würden!“ Das reizte ihn. Er wollte nicht Witwen noch ältere Mädchen, der Jüngsten begehrte er.
Klagend und weinend war Sophia in die Propstei geeilt, als ihre Mutter zu ihr gesprochen hatte: ‚Herr Tiralla will dich heiraten, freue dich!‘ Nein, sie wollte ihn nicht, nein, sie wollte überhaupt nicht heiraten!
Jetzt noch, nach fünfzehn Jahren noch, wenn Frau Tiralla nachts nicht schlafen konnte, übermannte sie die Bitterkeit, wenn sie daran dachte, wie man an ihr gehandelt hatte. Beschworen hatte die Mutter sie, unter Tränen gebeten: ‚Wir sind dann aus aller Not‘ — und als sie noch immer verneinend den Kopf geschüttelt, hatte sie Ohrfeigen bekommen, rechts und links, wohin es traf, und den strengen Befehl: ‚Du wirst Herrn Tiralla heiraten.‘ Und ihr Freund, der Herr Propst? Ah! Frau Zosia sah sich wieder in der stillen Stube, in der sie so manches Mal mit heissen Wangen, mit verzückten Augen den Legenden der Heiligen gelauscht hatte, auf den Knieen liegen. Sie fühlte wieder den Saum der schwarzen Soutane in ihren Händen, den sie mit ihren Tränen benetzt hatte. Sie hatte geweint, sich gesträubt: ‚Nein, ich will nicht, Hochwürden, ich kann nicht!‘ Hatte ihr der Herr Propst denn nicht immer gesagt, sie förmlich beschworen, eine Jungfrau zu bleiben, ehelos zu bleiben, sich so einen Stuhl im Himmel zu sichern?! Seine Hände hatte sie geküsst: ‚Helfen Sie mir, raten Sie mir!‘ — da — sie wusste selber nicht, wie es über sie gekommen war — da war sie plötzlich aufgefahren von ihren Knieen, verwirrt und zitternd, war zur Tür gestürzt, ihr Antlitz verbergend in einem Aufruhr ungeahnter Gefühle, die im jähen Ansturm sie fast betäubten. Auf einmal war sie kein Kind mehr; sie war eine, die bebend, glühend, fiebernd vor Verlangen sich ihrer selbst nun bewusst geworden war. Wie selig war es doch, eine — seine Erwählte zu sein! Das Leben lang in dieser stillen Stube bei den Heiligen zu sitzen! In wirren Träumen sah die junge Sophia die Gestalt ihres himmlischen Freundes sich mit der des irdischen mischen — ei, wie fein war er, und so schön! Seine Hände waren wie Elfenbein, seine Wangen wie Samt! Und sein Kuss — — —! Statt seiner war Herr Tiralla gekommen. —
Frau Tiralla hatte in ihrer Bettkammer einen Betschemel stehen unter dem Bild des Herrn Jesus Christus, der sein flammendes Herz vor sich auf der Hand trägt. Der Propst ihrer Jugend war längst aus Starawieś fort — er hatte sich aus der Gegend versetzen lassen — aber sie betete noch immer viel. Als sie heute morgen, nachdem Herr Tiralla sich gestern in der Freude über ihre langentbehrte Zärtlichkeit einen Rausch angetrunken hatte, aus dem Bette stieg, galt ihr erster Blick dem Bilde da drüben. Sie bekreuzte sich, und dann glitt sie auf blossen Füssen zum Schemel hin, kniete nieder und betete lange.
Herr Tiralla hatte ihr’s fest zugesagt, als er gestern in ihrem Arme lag, dass er heute würde den Schein ausfüllen und anspannen lassen und nach Gnesen fahren und selber das Gift holen für die Ratten. Dass sie so ruhig sein konnte! Sie wunderte sich selber darüber. Wenn ihr Herz jetzt klopfte, so klopfte es nicht aus Furcht, nur aus Erwartung wie vor etwas Gutem, Freudigem, Langersehntem. Fünfzehn Jahre — Jesus Maria, fünfzehn lange Jahre! Ihre Lippen, die, während ihre Gedanken schon ihren Mann auf dem Wege nach Gnesen sahen, ihn in die Apotheke begleiteten, mit ihm wieder herauskamen, sich fortgesetzt leise bewegt und Gebetesworte gemurmelt hatten, pressten sich jetzt fest aufeinander. So war ihr Mund ein unerbittlicher. Sie vergass, dass sie betete. Wilde Verwünschungen wälzten sich in ihrem Innern empor, wilde Anklagen. Ihre Mutter, die sie verkauft hatte — ja, verkauft wie ein junges Kalb, warum es nicht beim richtigen Namen nennen? — war tot. Lange hatte Frau Kluge sich nicht daran erfreuen können, dass ihr das Häuschen, in dem sie sonst zur Miete gewohnt, selber gehört hatte, dass sie nun nicht mehr für die ewig nörgelnden Besitzerfrauen Kleider zu machen brauchte um jeden Preis. Lange hatte sie das nicht genossen, und das war ihr recht geschehen!
In den Augen der Tochter flammte es auf wie Befriedigung: alles, was die Mutter sich von Herrn Tiralla ausbedungen hatte als Entgelt für die Tochter, hatte sie hierlassen müssen. Nun moderte sie längst. Aber der andere Schuldige — der Käufer? Ei, Herr Tiralla war dick und fett, der sah noch lange nicht so aus, als ob er bald daliegen würde, wo die Würmer nagen!
„Jesus Christus! Heilige Mutter!“ Die Betende hob die Hände höher. Sie wusste nicht recht, wie sie in Worte kleiden sollte, um was sie einzig zu bitten hatte — es klang doch zu scheusslich, wenn sie nun beten würde: ‚Lass ihn sterben, er muss sterben!‘ Das wäre ja so, als würde sie sich vor die Mutter Gottes hinstellen, ganz bloss, und vor Jesus Christus dazu. Nein, das ging nicht an!
Ratlos liess sie die Hände sinken: wie denn nun?! Aber dann fiel ihr ein: was brauchte sie den Heiligen denn alles zu sagen?! Warum die Heiligen selber bemühen?! Wenn sie sich nur deren Beistand zusicherte, indem sie betete: ‚Heilige Maria, reine Jungfrau, o, bewirke es durch deine göttliche Kraft und durch die aller Heiligen, dass er auch wirklich fahre! Dass er es endlich hole, das Gift, das Rattengift!‘ Und dann wandte sie sich auch an Mariä Sohn: „Jesus Christus auf dem höchsten Thron neben deiner Hochheiligen Mutter Maria, lass ihn nicht umkehren auf seinem Wege! Dass er sich nur nicht eines anderen besinne auf der weiten Fahrt! Ich bitte euch, ich flehe euch an!“
Sie rang die Hände und weinte heisse Tränen; sie schlug an ihre Brust, so heftig, dass sie sich weh tat. All das, was sie gelitten hatte unter Herrn Tiralla, und was sie immer wieder leiden würde, er liess sie ja nicht und — nein, sie mochte ihn nun einmal nicht, ihr ekelte vor seinen begehrlichen Händen, ach, hätte sie doch in ein Kloster gehen können, wie wohl wäre ihr da! — all das stürmte jetzt mit Entsetzen wieder auf sie ein. So entsetzt war sie gewesen an ihrem Hochzeitsabend, als der freudenerregte, halbtrunkene Mann sie umfing, so entsetzt, als sie sich wider Willen Mutter fühlte, so entsetzt, als ihr die Madra das kleine lebendige Mädchen an die Brust legte. Sie hatte sich zusammengenommen, es gelitten, obgleich es sie wie ein Strom eiskalten Wassers durchrann, als sie das suchende Mündchen an ihrer Brust fühlte. Aber als dann Herr Tiralla erschien, sich vor das Bett hinstellte, in dem sie so schwach, so hinfällig, so preisgegeben lag, und vergnügt schmunzelte: ‚Psia krew, das haben wir gut gemacht!‘ — da hatte sie sich nicht mehr bezwingen können. Einen Schrei hatte sie ausgestossen, einen schwachen, klagenden und doch durchdringenden Schrei, und sich so aufgebäumt mit letzter Kraft, dass das kleine Mädchen an ihrer Brust zu wimmern anfing, zu winseln wie ein junges Kätzchen. Ganz erschrocken war die Madra herzugeeilt und hatte ein Kreuz geschlagen: ‚Alle guten Geister!‘ Sie mochte wohl denken, die Krasnoludki, die bösen Zwerge, wollten das Neugeborene rauben. Hastig hatte sie dem Kindchen ihren Rosenkranz um den Hals geschlungen und das Bett der Wöchnerin mit geweihtem Wasser besprengt. Die junge Mutter aber war in Tränen ausgebrochen, in nicht endenwollende, fassungslose Tränen — Danach war Frau Tiralla sehr krank gewesen, so krank, dass der besorgte Herr Tiralla nicht nur den Doktor aus Gradewitz kommen liess, sondern auch den Kreisphysikus aus Gnesen. Beide Ärzte versicherten aber, dass keine Gefahr vorhanden, dass die junge Frau nur sehr schwach und nervös sei. Das hatte Herr Tiralla nicht verstanden. —
Frau Tiralla stand jetzt auf von ihrem Gebet. Nun war es höchste Zeit, ihren Mann anzutreiben, dass er sich auf die Fahrt machte. Womöglich lag der noch im Bette! In einer gewissen zornigen Hast kleidete sie sich an. Heute frisierte sie ihr volles Haar nicht so sorgfältig wie sonst, ihre Hände zitterten, sie hatte Eile. Ihr lauschendes Ohr fing kein Räderrollen auf. Noch wurde der Wagen nicht aus dem Schuppen gezogen, bei Gott, er schlief wirklich noch!
Den Rock hastig überwerfend, die Bluse nicht zuknöpfend, lief sie auf den Ziegelflur, hinüber in das Zimmer, in das sie als zitternde Braut eingezogen war, in dem das kleine Mädchen geboren worden war. Bei Gott, da lag er noch in dem breiten Bett und schnarchte!
„Steh auf!“ Sie packte ihn bei den Schultern und rüttelte ihn.
Seine grauen Haare sträubten sich wie Borsten über der Stirn. Sie fand ihn abscheulich, wie sie ihn so betrachtete. Und wie roch es denn hier im Zimmer? Nach Trinken! All der hässliche Dunst ging von ihm aus!
Kein Mitleid machte ihren Blick weich. Kerzengerade stand sie an seinem Bett, funkelnden Auges mass sie ihn vom Scheitel bis zur Sohle — da würde er nun bald wieder liegen!
Ein jauchzender Schrei wollte sich ihrer Brust entringen. Sie biss sich auf die Lippen — still, still! Was sollte die Magd, die neugierige denken, wenn sie also frohlockte?! Aber sie packte ihn wieder mit erneuter Kraft und rüttelte ihn so stark, dass er auffuhr.
Mit noch gänzlich blöden Augen starrte Herr Tiralla drein: wer war da? Warum liess man ihm denn nicht seine Ruh? Er wollte noch schlafen.
„Steh auf,“ schrie sie ihn an, „du musst fahren! Es ist Zeit! Allerhöchste Zeit!“
„Wer muss fahren? Ich nicht!“ lallte er und fiel schlaftrunken zurück aufs Kissen.
Er war so schwer, dass sie ihn nicht heben konnte, ihr Rütteln half ihr nichts, vergebens war ihr Schreien ‚Steh auf‘. Da goss sie ihm zornig eiskaltes Wasser ins Gesicht. Das half.
Plötzlich ermuntert öffnete er die Augen. „Ah, Täubchen, kommst du? Zärtlich streckte er die Arme aus.
Sie schlug auf die nach ihr langenden Finger. „Lass die Torheiten,“ sagte sie kalt. Aber dann wurde ihr Ton wärmer: „Du hast mir versprochen, nach Gnesen zu fahren — denke daran, es ist Zeit!“
„Nach Gnesen — Gnesen?! werde ich nicht fahren — was soll ich da?!“ Er hatte nicht eine Ahnung mehr. Was er gestern im Rausche versprochen hatte, war heute vergessen.
Verzweifelt sah sie ein, dass sie heute von neuem beginnen müsse. Und sie setzte sich auf sein Bett. Und sie schlang, die Zähne zusammenbeissend, die Arme um ihn, und sie quälte ihn: „Du hast es mir versprochen, du wolltest doch nach der Apotheke fahren — die Ratten — wegen der Ratten — denke doch dran — die Ratten!“
„Was gehen mich Ratten an?!“ Er lachte dröhnend. „Solange nicht Ratten kommen in mein Bett, stören mich Ratten nicht!“ Er küsste sie schmatzend.
Mit geschlossenen Augen litt sie’s, sie war totenblass. Plötzlich entwand sie sich seinen Armen; die schwarzen Augen fest auf ihn gerichtet, sah sie ihn starr an. „Wenn du jetzt nicht nach Gnesen fährst,“ sprach sie langsam — ganz leise, aber man verstand jede Silbe doch deutlich — „werde ich in den Przykop laufen. Ich werde mich ertränken in dem tiefen Tümpel, der dort unter den Fichten steht. Ich kann nicht leben so länger mehr. Gehst du nicht, dann gehe ich!“
Er war verdutzt: was sagte sie denn das mit so seltsamer Betonung, was meinte sie damit? Unsinn! Aber dann entschloss er sich doch. Schimpfend und fluchend erhob er sich: psia krew, was für ein Unsinn war es doch, der paar Ratten wegen Gift ins Haus zu schaffen! Die schlug man doch leicht mit dem Knüttel tot! Er stellte ihr das vor: eine ganze Nacht wollte er gern unten im Keller auf die Rattenjagd gehen.
Aber sie beharrte bei ihrer Forderung. „Du hast es mir versprochen! Geschworen hast du es mir! Nie werde ich dir wieder glauben, wenn du so meineidig wirst. Nie werde ich dir wieder erlauben, nur meinen Finger zu berühren, wenn du so gering ein Versprechen achtest!“
„Nun wohl, ja, ja, ich gehe ja schon,“ sagte er endlich. Was waren denn da noch so viele Worte zu machen? Missmutig und übelgelaunt fuhr er in die Stiefel.
Sie half ihm; diensteifrig hielt sie ihm den Rock hin.
Aber als er schon seine Arme in die Ärmel gesteckt hatte, zog er sie noch einmal zurück: „Ich werde doch nicht fahren. Wozu? Wir werden Fallen stellen, ja ja! Rufe den Jendrek, der mag gehen, Fallen kaufen. Zwei, drei, so viele not tun. Gleich mag er sie holen aus Gradewitz. Rufe ihn!“
Sie rührte sich nicht: sie war so erschrocken, dass sie zitterte: sollte er ihr so noch in letzter Stunde entschlüpfen?
Er stampfte mit dem Fusse auf: ging sie denn noch nicht, musste er selber den Knecht rufen? Unwirsch trampelte er zur Tür.
Da stellte sie sich ihm in den Weg, da fiel sie ihm an die Brust, halb bewusstlos, gänzlich erschöpft. „Ich — ich werde — wenn du mir dieses zu Gefallen tust — werde ich — ich — dir auch zu Gefallen sein!“
Herr Tiralla fuhr nach Gnesen. Frau Tiralla hatte selber mitgeholfen, das Pferd anzuspannen. Sie hatte es dabei zärtlich geliebkost. Dem Knecht wurde heiss und kalt und begehrlich bei den Schmeichelworten, die das schöne Weibchen an den dummen Gaul verschwendete.
„Laufe, mein Pferdchen, laufe,“ sprach sie schmeichelnd dem Tiere ins Ohr. Und dann stützte sie sich schwach gegen die Stallwand; noch immer konnte sie kaum feststehen, noch immer bebten ihr die Kniee, noch immer flatterte ihr Herz wie ein getäuschter Vogel, dem man das Türchen zur Freiheit geöffnet und im Moment, da er ausfliegen will, doch wieder verschlossen hat. Ihr war erst erträglich zumut geworden, als Herr Tiralla, gestiefelt und gespornt, aus der Haustür getreten war. Und während der Knecht das Pferd noch beim Kopf hielt, dass es nicht anruckte, bis Herr Tiralla aufgestiegen war, trat sie dicht an den Wagen heran und reichte ihm die Hand hinauf: „Fahre wohl!“ Es war etwas von wirklicher Anteilnahme in ihrem Ton, und ihre Augen, die so gleichgültig blicken konnten, sahen ihn an wie mit einer Verheissung.
Schnalzend trieb er das Pferdchen an: „Huj, het!“ Dass er nur bald wieder daheim war! Ermunternd knallte er mit der langen Peitsche. Wenn ihr Herz nun mal daran hing, konnte er ihr ja auch gern zu Gefallen fahren, sie war doch ein süsses Weibchen, seine Zosia!
Frau Tiralla hatte ihrem Mann lange nachgeschaut; zum ersten Mal in fünfzehn Jahren fühlte sie etwas wie Zuneigung für ihn, wie Zuneigung und Dankbarkeit. Aufatmend ging sie dann ins Haus zurück.
Da war es ganz still, so leer, als hätte Herr Tiralla mit seiner lauten Stimme und seiner Breite nie hier gewohnt. Die Magd holte vom Feld aus der Miete Kartoffeln herein, die Knechte waren in der Scheune, Rózyczka in der Schule. Sie war ganz allein.
„Ah!“ Mit einem tiefen Seufzer hob die Frau die Arme und lief durch die Stube, als durchflattre sie den Raum. Wie wohl war ihr, ach, wie Wohl! So wohl war ihr seit Ewigkeiten nicht gewesen. Sie ging durch die grosse Stube und musterte sie. Hier, wo sein Bett stand, hier stellte sie ein Sofa hin — dies war ja der grösste und schönste Raum im Haus, sie würde eine Besuchsstube daraus machen. Oder wenn Mikolai seine drei Jahre herum hatte und vom Militär heimkam, mochte der sie haben; sie beanspruchte die Stube nicht, sie war mit ihrer Bettkammer ganz zufrieden!
Träumerisch setzte sie sich auf einen Stuhl am Fenster und blickte hinaus in die schneeverhangene Weite. Vom Dorf, das sie sonst durch die offenstehende Hoftür mit seinen tief eingesunkenen Hütten unter den moosbehangenen Strohdächern und den neuaufgeführten Backsteinmauern des stattlichen Kruges wie in einem Rahmen sehen konnte, war heute nichts zu erspähen; alles war zugeweht von treibenden Flocken. Ei, war das ein Gestöber, viel Schnee, dichter Schnee! Wenn das so anhielt, würde sich Herrn Tirallas Fahrt verzögern, so rasch konnte er dann nicht wieder nach Hause kehren. Horch, klang da nicht ein Glöckchen schon, das Glöckchen des Pferdchens, das sie selbst angeschirrt hatte?! Erschrocken fuhr sie auf: er würde doch des Gestöbers wegen nicht umdrehen, nicht etwa unverrichteter Sache wieder nach Hause zurückkehren?!
Sie hielt beide Hände auf das pochende Herz gepresst; den Kopf vorgestreckt, lauschte sie scharf, aber dann lächelte sie beruhigt: ach, das war ja gar kein Glöckchen draussen, das klang ihr hier, hier innen in beiden Ohren! Da fing es jetzt an, förmlich Sturm zu läuten. Eine jähe Glut schlug ihr plötzlich zu Kopf, sie musste sich mit beiden Händen an die Stirn fassen und sie stützen und halten. O weh, wie wurde ihr so ängstlich jetzt! Was hatte sie getan — was wollte sie noch tun?!
Mit verängstigten Augen sah sie sich um, die Stille, die Leere entsetzte sie auf einmal. Was sollte sie denn sagen, wenn nun der Sohn vom Militär kam?! Was sollte sie ihm vorerzählen von seinem Vater? Würde er ihr auch glauben? Würde er nicht gehen und mit Fingern auf sie zeigen: ‚Die da, die da hat’s getan!‘ O, was war das für eine grosse Angst! Woher nur auf einmal diese Gedanken kamen? Sie hatte sich doch vorher keine gemacht!
Aufspringend vom Fensterplatz stürzte die Einsame aus der Stube in die Küche; die Leere jagte sie, quälte, peinigte sie so, dass sie es drinnen in Herrn Tirallas Stube nicht mehr aushalten konnte. Aber auch in der Küche war es leer, die Magd noch immer nicht zurück. Fröstelnd kauerte sich Frau Tiralla beim Herd zusammen — wie weit war er nun wohl schon? War er nun wohl schon in Gnesen? Nein, nein, so rasch lief das Pferdchen nicht — doch, doch, es war wohl möglich, halte sie dem Pferdchen denn nicht Zucker gegeben und ihm mit liebkosender Hand den Hals geklopft? Das lief schon wacker. Und wenn er nun schon in Gnesen wäre, wenn er nun schon in der Apotheke gewesen wäre, wenn er es nun gar schon bei sich trüge, das Gift, das Rattengift?! Sie konnte sich nicht helfen, sie musste laut aufschreien vor Angst. Was hatte sie getan?!
„Ach, ach!“ Wimmernd stützte sie den Kopf. Aber sie hatte ja noch gar nichts getan, noch gar nichts verbrochen, was fürchtete sie sich denn so?!
Aber sie würde es tun!
Mit einer zuversichtlichen Gebärde richtete sie sich aus ihrer Versunkenheit auf und strich sich die Haare aus der Stirn: sie würde es tun, denn sie hatte ja darum gebetet. Es gab kein Zurück mehr; die Heiligen hatten es gehört. Hatte ihr denn der Herr Propst nicht damals, als sie noch klein war, immer gesagt: ‚Was du betest, wird erhört‘?! Nun war ihr Gebet schon vor dem höchsten Thron. Daran war nichts mehr zu ändern. Es sollte so sein. Hätten die Heiligen es nicht so gewollt, so wäre Herr Tiralla ja nicht nach Gnesen gefahren trotz all ihres Drängens, trotz all ihrer Liebkosungen!