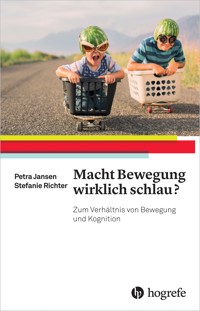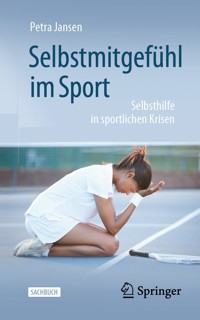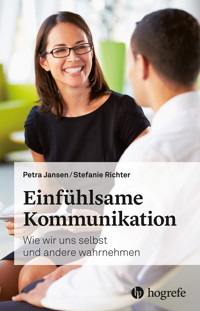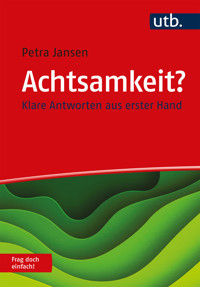
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Der Begriff Achtsamkeit ist derzeit in aller Munde. Dabei ist Achtsamkeit nicht neu, sie hat ihre Wurzeln in der buddhistischen Tradition. In ihrem Buch erklärt Petra Jansen, wie achtsames Verhalten aussehen kann und welche Auswirkungen dies haben kann. Daneben zeigt sie Chancen, aber auch Risiken der Achtsamkeitspraxis auf. Auch auf Anwendungsfelder, in denen eine achtsame Praxis sinnvoll ist, geht sie ein. Frag doch einfach! Die utb-Reihe geht zahlreichen spannenden Themen im Frage-Antwort-Stil auf den Grund. Ein Must-have für alle, die mehr wissen und verstehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Petra Jansen
Achtsamkeit? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
UVK Verlag · München
Prof. Dr. Petra Jansen ist Lehrstuhlinhaberin an der Fakultät für Humanwissenschaften an der Universität Regensburg. Schwerpunkte ihrer Forschungsarbeit sind die Verbindung von Motorik, Emotion und Kognition und die Rolle der Achtsamkeit bei verschiedenen psychologischen Outcomes.
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue – iStock
Abbildungen im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
Abbildung 1: © Blamb - shutterstock
Abbildung 3: privat
Autorinnenfoto: privat
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838561738
© UVK Verlag 2024— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6173
ISBN 978-3-8252-6173-3 (Print)
ISBN 978-3-8463-6173-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort
„Du kannst die Wellen nicht stoppen,
aber du kannst lernen zu surfen.“
Jon Kabat-Zinn
Dieses Zitat von Jon Kabat-Zinn, der vielleicht als der „Vater“ der Achtsamkeitsbewegung im Westen angesehen werden kann und der Entwickler des MBSR-Kurses ist, ist wohl eines der bekanntesten Zitate zur Achtsamkeit. Es beschreibt eine Facette der Achtsamkeit, nämlich die der Akzeptanz, der Fähigkeit, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Eine Grundvoraussetzung für diese Akzeptanz ist jedoch ein anderer wichtiger Aspekt der Achtsamkeit, nämlich die Fähigkeit im jetzigen Moment nichtwertend präsent zu sein. Wahrscheinlich hat Achtsamkeit in den letzten Jahren so viel Interesse auf sich gezogen, weil es uns zunehmend schwerfällt in unserer VUKA-Welt unsere Mitte zu wahren und den jetzigen Moment, so wie er ist, wahrzunehmen. Der Begriff VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) beschreibt die Unbeständigkeit, die Unsicherheit, die Komplexität und die Ambiguität unserer heutigen (Arbeits)welt. Wir brauchen einen Kompass, der uns führt, und von vielen Menschen wird Achtsamkeit als ein solcher gesehen. Wenn wir im jetzigen Moment ganz präsent sind, dann können wir uns keine Gedanken über die Vergangenheit machen, und wir machen uns auch keine Sorgen um die Zukunft, die uns vielleicht in unserem Handeln lähmen würde. Wir nehmen wahr, was im Moment ist, und akzeptieren es. All das lehrt uns die Achtsamkeitspraxis und das ist es vielleicht auch, was viele Menschen anzieht: In einer immer unsicheren und komplexeren Welt einen Anker im jetzigen Moment zu finden.
Mich selbst fasziniert das Thema der Achtsamkeit auf einer wissenschaftlichen und praxisnahen Seite. Ich habe eine Achtsamkeitslehrerinnenausbildung bei Jack Kornfield und Tara Brach gemacht und wissenschaftlich zahlreiche Arbeiten, die sich mit den Effekten eines Achtsamkeitstrainings bei Kindern, im Sport oder auf das Bewusstsein beschäftigen, publiziert. Diese Erkenntnisse versuche ich in der Lehre umzusetzen. Jedoch steht die Wissenschaft bei vielen Themen rund um das Forschungsgebiet der Achtsamkeit noch am Anfang und der mediale Hype geht dem wissenschaftlichen voraus.
Ich schreibe dieses Buch für alle Menschen, die einen kurzen Einblick in das Thema der Achtsamkeit erhalten wollen und dazu Fragen haben, die hier beantwortet werden. Dabei habe ich das Buch so konzipiert, dass zunächst verschiedene Definitionen gegeben werden und auf die Lernmöglichkeiten von Achtsamkeit eingegangen wird. Dann beschreibe ich, wie Achtsamkeit sich im Verhalten zeigen kann, wie sie für den Erhalt der Gesundheit hilfreich sein kann, wie sie sich im Alltag integrieren lässt und wo sie in bestimmten Anwendungsfeldern eine Rolle spielen kann. Die nächsten beiden Kapitel beschäftigen sich mit der Achtsamkeit und ihrer Beziehung zu den beiden großen Themen unserer Zeit, der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung. Abschließend gehe ich auf verwandte Konzepte zur Achtsamkeit ein und auch der Frage nach, ob denn Achtsamkeit ein Allheilmittel sein kann. Um es vorwegzunehmen: Nein! Achtsamkeit kann ein wichtiger Baustein zum inneren Frieden sein. Aber wir Menschen sind unterschiedlich, manche von uns finden diesen Frieden beim Wandern oder beim Lösen schwieriger mathematischer Gleichungen eher als in der Meditation.
Ich möchte Ihnen mit diesem Buch den Wert von Achtsamkeit in den verschiedensten Lebensbereichen aufzeigen, ohne die kritischen Stimmen zu unterschlagen. Allein Sie können für sich selbst entscheiden, ob Achtsamkeit für Sie bedeutungsvoll werden kann.
Wichtig vorab ist jedoch zu sagen, dass Achtsamkeit nicht dazu da ist, das eigene Ego aufzuplustern oder sich spirituell besser zu fühlen. Achtsamkeit ist ein Weg zur Erkenntnis, der richtig praktiziert mit Narzissmus nichts zu tun hat, sondern Sie zur Verbundenheit mit sich selbst und den anderen Menschen führen kann.
Kallmünz, im April 2024
Petra Jansen
Danksagung
Ich bin meinen Kollegen und Kolleginnen am Lehrstuhl für Sportwissenschaft an der Universität Regensburg sehr dankbar. Wir diskutieren seit vielen Jahren über die Bedeutung der Achtsamkeit bezogen auf die unterschiedlichen Facetten des menschlichen Lebens und Verhaltens. Weiterhin gilt mein Dank den Studierenden des Studienganges Motion and Mindfulness, die vieles kritisch hinterfragt haben und sich manchmal viel mehr Praxisnähe gewünscht hätten.
Besonders danke ich auch Dr. Florian Seidl, MBSR-Lehrer und Gründer der Regensburger Schule für Achtsamkeit, und Luca Hoyer für die kritische Durchsicht des Manuskriptes.
Gender-Hinweis | Bei Personenbezeichnungen im Plural habe ich versucht, möglichst die männliche und weibliche Bezeichnung zu erwähnen. Wenn es in Beispielen sinnvoller war, nur eine Form zu nutzen, habe ich versucht, das abzuwechseln.
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni verrät spannende Literaturtipps, Videos und Blogs im World Wide Web.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an, deren Antwort unbedingt lesenswert ist.
Die Lupe weist auf eine Expert:innenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
→
Wichtige Begriffe sind mit einem Pfeil gekennzeichnet und werden im Glossar erklärt.
↠
Der Pfeil mit der doppelten Spitze verweist auf weiterführende Fragen zu diesem Thema.
Zahlen und Fakten über Achtsamkeit
Achtsamkeit: Begriffsbestimmung und Verortung
Viele Menschen kennen den Begriff der Achtsamkeit. Dabei ist oft unklar, was Achtsamkeit genau ist. Dieses Kapitel soll grundlegenden Fragen zur Achtsamkeit nachgehen und klären, welche allgemeingültige Definition es gibt und wo die historischen Grundlagen der Achtsamkeit liegen.
Was bedeutet Achtsamkeit?
Achtsamkeit ist kein neuer Begriff, sondern im Buddhismus seit mindestens 2500 Jahren bekannt. Im Theravada-Buddhismus findet man in der Sprache Pali mit dem Begriff sati den ersten Hinweis auf den Begriff der Achtsamkeit. Das Wort sati stammt ursprünglich aus dem Verb sarati, sich erinnern. Es beschreibt eine Erfahrung und weniger eine reine Erinnerung, mehr das Wahrnehmen des Augenblickes mit der Erinnerung an das, was der Buddha lehrte. Im Buddhismus ist sati ein Aspekt eines spirituellen Weges, der letztendlich zur Beendigung alles menschlichen Leidens führt (Schmidt, 2014).
In der westlichen Auffassung findet man für Achtsamkeit keine einheitliche Definition. In einer groben Einteilung kann man unter Achtsamkeit eine bestimmte (Meditations-)Praxis verstehen oder auch eine Grundhaltung bestimmten Dingen gegenüber. Zur Definition von Achtsamkeit als Grundhaltung wird oft Jon Kabat-Zinn zitiert. Er beschreibt Achtsamkeit als die nichtwertende Präsenz im Moment (vgl. Kabat-Zinn, 2005). 2004 haben Bishop und weitere Fachleute (Bishop et al., 2004) sich zusammengefunden und Achtsamkeit durch die Hauptaspekte der Selbstregulation, der Aufmerksamkeit und der Erfahrungsorientierung beschrieben. Bei der Selbstregulation ist die so genannte Daueraufmerksamkeit wichtig, d. h. die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über einen bestimmten Zeitpunkt aufrecht zu halten. Aber auch die Fähigkeiten, zum einen die Aufmerksamkeit zu wechseln und zum anderen auf Relevantes zu reagieren und Irrelevantes zu unterdrücken, die so genannte → InhibitionsfähigkeitInhibitionsfähigkeit, spielen eine wichtige Rolle. Ebenso wichtig ist der so genannte AnfängergeistAnfängergeist, der die Fähigkeit bezeichnet, unvoreingenommen das wahrzunehmen, was gerade im jetzigen Moment passiert. Bei der Erfahrungsorientierung steht die Erfahrung im jetzigen Moment im Vordergrund und dabei diese Erfahrung so zu akzeptieren, wie sie ist.
Nach Tang (2017) umfasst Achtsamkeit die Aspekte
der Aufmerksamkeitskontrolle (z. B. Wie gelingt es uns, den Fokus auf ein Objekt zu halten?),
der → Emotionsregulation (z. B. Welche Strategien werden bei der Wahrnehmung, der Verarbeitung und beim Ausdruck der Emotionen angewandt?),
des Selbstgewahrseins (d. h. des Bewusstwerdens der eigenen mentalen Prozesse).
Die Erkenntnisse hat Tang aus neurowissenschaftlichen Untersuchungen gewonnen, bei welchen die Aktivität des Gehirns z. B. während achtsamer Meditationen untersucht wurde (↠ Kann man Achtsamkeit im Gehirn messen?).
Literaturtipp | Schmidt, S. (2014). Was ist Achtsamkeit? Herkunft, Praxis und Konzeption. Sucht, 60, 13-19. https://doi.org/10.1024/0939-5911.a000287
Gibt es eine einheitliche Definition von Achtsamkeit?
Neben der bereits oben erwähnten Definition von Achtsamkeit, initiiert von Jon Kabat-Zinn basierend auf der buddhistischen Tradition, als die nichtwertende Präsenz im jeweiligen Moment, definieren Ellen Langer und ihre Kollegin Achtsamkeit als eine aktive, sich anstrengende Form des bewussten Gewahrseins, die sich durch einen erhöhten Zustand der Beteiligung und Wachsamkeit auszeichnet (Langer & Moldoveanu, 2000). Ihre Definition, die nicht einer buddhistischen Tradition entspringt, impliziert, dass Achtsamkeit die Selbstregulation der Aufmerksamkeit integriert, die Fähigkeit, das Bewusstsein auf externe Stimuli zu richten und sich mit diesen Stimuli auf einer bewussten Art und Weise zu beschäftigen. Oftmals wird in dieser Theorie auch die achtsame Kreativität beschrieben, die im Zusammenhang mit dem „Flow-Konzept“ steht, des völligen Aufgehens in einer Beschäftigung. In der Definition von Jon Kabat-Zinn wird auch das Bewusstsein für innere Stimuli betont. Beide Herangehensweisen haben unterschiedliche Interventionen zur Erreichung der Achtsamkeit entwickelt: Kabat-Zinn entwickelte das Mindfulness-Based Stress Reduction-Programm (↠ Was ist das MBSR-Training?), welches sich über einen mehrwöchigen Zeitraum mit täglicher Praxis erstreckt und eher zu einer Veränderung der → dispositionalen Achtsamkeit, d. h. der Achtsamkeit als Eigenschaft, führt. Langer hingegen baute ein Programm mit kurzen Interventionen, die keine tägliche Praxis benötigen und eher eine Veränderung der Achtsamkeit als Zustand bedingen (Hart et al., 2013). Auch die Messung der dispositionalen Achtsamkeit nach Langer unterscheidet sich von der Messung nach dem Achtsamkeitsmodell von Kabat-Zinn. So integrieren Ellen Langer und ihre Kollegen und Kolleginnen in der Kurzform dieses Fragebogens die Skalen der Suche nach Neuheiten (z. B. „Ich bin sehr neugierig“), der Produktion von Neuheiten (z. B. „Ich leiste viele neuartige Beiträge“), und des Engagements (z. B. „Ich bin mir Veränderungen selten bewusst“) (Pirson et al., 2012). Nur die Subskala des Engagements misst achtsame Aufmerksamkeit bezogen auf den jetzigen Moment. Die anderen beiden Skalen messen eher kognitive Aspekte, die auch für das kreative Denken wichtig sind.
Literaturtipp | Hart, R., Ivtzan, I., & Hart, D. (2013). Mind the gap in mindfulness research: A comparative account of the leading schools of thought. Review of General Psychology, 17, 453-466. https://doi.org/10.1037/a0035212
Kann man Achtsamkeit im Gehirn messen?
Ja, Achtsamkeit lässt sich indirekt im Gehirn messen! Ganz grob gesprochen umfasst das menschliche Gehirn unter anderem das Großhirn und das Kleinhirn. Der Kortex bezeichnet die äußere Oberfläche des Gehirns und lässt sich in unterschiedliche Bereiche unterteilen, die verschiedene Funktionen haben. Darüber hinaus gibt es tieferliegende Strukturen, wie z. B. die Basalganglien, die mit motorischen und kognitiven Funktionen in Zusammenhang gebracht werden und z. B. das limbische System, welches für das Gedächtnis und die Emotionen von großer Bedeutung ist. Mit funktionellen bildgebenden Verfahren, wie z. B. der Positronen-Emissions-Tomographie oder der funktionellen Magnetresonanztomographie, wird die Aktivität des menschlichen Gehirns sichtbar gemacht. Die Aspekte der Achtsamkeit nach Tang (2017) lassen sich folgenden Gehirnbereichen zuordnen: Bei der Aufmerksamkeitskontrolle ist zu Beginn der Achtsamkeitspraxis der dorsolaterale präfrontale Kortex und zum Ende der → anteriore cinguläre Kortex und das Striatum involviert. Bei der → Emotionsregulation spielen der anteriore cinguläre Kortex, der mediale präfrontale Kortex und die limbischen Regionen eine bedeutsame Rolle. Das Selbstgewahrsein zeigt sich im → Default-Mode-Netzwerk, im anterioren-cingulären Kortex und in der → Insula. Die Abbildung 1 zeigt die Gehirnregionen, die bei den drei Aspekten involviert sind.
| Relevante Gehirnregionen bei der Achtsamkeitspraxis, mediale Ansicht (eigene Darstellung nach Tang, 2017, S. 18)
In einer neueren → Metaanalyse mit den Ergebnissen aus 25 Arbeiten wurde die Veränderung in der grauen Substanz, die vornehmlich Nervenzellkörper enthalten, nach achtsamkeitsbasierten Meditationen untersucht (Pernet et al., 2021). Dabei zeigte sich eine Zunahme der grauen Substanz konsistent über alle Studien in der rechten anterioren ventralen Insula. Dass nicht alle bildgebenden Arbeiten die gleiche Aktivität im Gehirn nach einer Achtsamkeitsintervention zeigen, liegt an vielen Punkten, wie z. B. unterschiedlichen experimentellen Designs und unterschiedlichen Auswertungsmethoden. Darüber hinaus haben die Studien oft eine geringe Power, d. h. es nehmen zu wenige Versuchspersonen teil, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen.
Linktipp | Die neuronalen Mechanismen, die durch die Achtsamkeitspraxis entstehen, sind sehr komplex und hier nur sehr kurz dargestellt. Einen tiefen Einblick gewährt meine sehr geschätzte Kollegin Dr. Britta Hölzel in einem sehr interessanten Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=0a5dvfL0-II&t=11s
Ist Achtsamkeit eine Eigenschaft oder ein Zustand?
In der wissenschaftlichen psychologischen Forschung unterscheidet man häufig zwischen einer Eigenschaft (trait) und einem Zustand (state). Als Eigenschaften einer Person kann man Verhaltenstendenzen beschreiben, die zeitlich überdauernd und unabhängig von einer spezifischen Situation sind. Ein Zustand ist eher eine sich verändernde Befindlichkeit einer Person, also ein Verhalten, welches von der Situation abhängen kann. Forscher und Forscherinnen gehen davon aus, dass es die Eigenschaft Achtsamkeit gibt, die unterschiedliche Facetten hat. Diese Facetten werden wiederum mit unterschiedlichen Messinstrumenten, d. h. Fragebögen, erfasst. Im deutschsprachigen Raum hat sich in den letzten Jahren der Fragebogen CHIME (Compehensive Inventory of Mindfulness Experiences) etabliert (Bergomi et al., 2014), welcher acht unterschiedliche Aspekte der Achtsamkeit misst. Nach dieser Modellvorstellung wäre also ein achtsamer Mensch jener, der die folgenden Eigenschaften besitzt. Er oder sie kann
die Dinge so akzeptieren, wie sie sind (Akzeptanz),
die Informationen des Momentes bewusst wahrnehmen (Gewahrsein),
Distanz zu den eigenen Gedanken und Reaktionen haben (Dezentrierung, Nicht-Reaktivität),
offen gegenüber dem sein, was kommt (Offenheit),
sich bewusst sein, dass alle Gedanken relativ sind und kommen und gehen (Relativität),
ein Bewusstsein für die inneren – körperbasierten – Prozesse haben (inneres Gewahrsein),
die Prozesse abseits der eigenen Person verstehen (äußeres Gewahrsein),
einsichtsvolles Verständnis zeigen (Einsicht).
Neben der Auffassung von Achtsamkeit als Eigenschaft kann sie auch als Zustand beschrieben werden, dies ist aber noch weniger untersucht als die Eigenschaftskomponente. Achtsamkeit als Zustand zu messen, kann dann sinnvoll sein, wenn Achtsamkeit als ein dynamischer Zustand in einer bestimmten Situation zu einer bestimmten Zeit untersucht werden soll. Sedlmeier (2022) beschreibt, dass es zu diesem Zeitpunkt nur drei Fragebögen gibt, die Achtsamkeit als Zustand erfassen. Der erste Fragebogen stammt von Brown und Ryan (2003). Sie adaptierten fünf Fragen aus dem von ihnen entwickelten Fragebogen für Achtsamkeit als Eigenschaft („MAAS“), indem sie die Fragen auf eine bestimmte Zeit bezogen („State-MAAS“). Die Teilnehmenden erhielten dann ein Signal und wurden aufgefordert, ihre Beurteilung abzugeben. Daneben existiert der Toronto-Mindfulness-Scale-Fragebogen („TMS“, Lau et al., 2006). Der Fragebogen besteht aus 15 Aussagen, die sich auf die Empfindung nach einer Meditation beziehen, wie z. B. „Ich war neugierig auf die Gedanken und die Emotionen, die ich habe“. Die Befragten sollen diesen oder ähnliche Sätze auf einer Skala von 0 bis 4 (trifft überhaupt nicht zu – trifft sehr zu) beurteilen. Darüber hinaus gibt es die State Mindfulness Scale (Tanay & Bernstein, 2013). Dieser Fragebogen besteht aus 21 zu beurteilenden Aussagen, die den beiden Faktoren, Achtsamkeit des Geistes und Achtsamkeit des Körpers, zugeordnet werden können.
Sedlmeier (2022) weist darauf hin, dass ebenso wie bei der theoretischen Fundierung der Achtsamkeit als Eigenschaft, die theoretische Fundierung von Achtsamkeit als Zustand unklar ist. Kiken und ihre Kollegen und Kolleginnen (2015) konnten zeigen, dass die Steigerung der Achtsamkeit als Zustand während der Meditationspraxis im Laufe der Zeit die Eigenschaft der Achtsamkeit erhöht, was sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Während einer achtwöchigen Intervention berichteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach einer kurzen Achtsamkeitsmeditation jede Woche über ihren Zustand der Achtsamkeit während der Meditation. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Individuen in ihren Veränderungsraten des Achtsamkeitsempfindens während der Intervention signifikant unterschieden und dass diese individuellen Trajektorien Veränderungen der Achtsamkeitseigenschaften und des Leidensdrucks vor und nach der Intervention vorhersagten. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass eine Zunahme der Achtsamkeit im Laufe wiederholter Meditationssitzungen, d. h. eine Zunahme der State-Achtsamkeit zu einer achtsameren Haltung, also zu einer Zunahme der Trait-Achtsamkeit, beitragen kann. Die individuellen Veränderungspfade können jedoch variieren.
Linktipp | Dieses Video erklärt sehr anschaulich den Unterschied zwischen Trait und State: https://www.youtube.com/watch?v=n4b_Mj7GndQ
Ist Achtsamkeit nicht nur eine Persönlichkeitseigenschaft?
Achtsamkeit kann als eine Eigenschaft, das heißt als eine überdauernde Facette einer Person aufgefasst werden. Unterscheidet sich aber nun die Eigenschaft der Achtsamkeit von Persönlichkeitseigenschaften, die in der Psychologie seit langem bekannt sind und untersucht werden? Zunächst einmal muss man auch hier festhalten, dass es zahlreiche Persönlichkeitstheorien gibt. Eine sehr bekannte Theorie ist die 5-Faktoren-Theorie oder mit einem anderen Namen, das Big-Five-Modell. In diesem Modell, in welchem ebenso wie in anderen Persönlichkeitsmodellen auf die motivationalen und emotionalen Komponenten der Persönlichkeit fokussiert wird, werden die folgenden fünf Eigenschaften differenziert (in Klammern jeweils Beispielitems aus dem NEO-Fünf-Faktoren-Inventar, Körner et al., 2002). Jede dieser Eigenschaften kann als Kontinuum aufgefasst werden, welches mehr oder weniger schwach innerhalb einer Person ausgeprägt ist. Die Eigenschaften sollen auf einer Skala von 1 (starke Ablehnung) bis 5 (starke Zustimmung) beurteilt werden:
Offenheit für Erfahrungen („Ich habe oft Spaß daran, mit Theorien und abstrakten Ideen zu spielen.“)
Gewissenhaftigkeit („Ich halte meine Sachen ordentlich und sauber.“)
Extraversion („Ich bin gern im Zentrum des Geschehens.“)
Verträglichkeit („Ich versuche stets rücksichtsvoll und sensibel zu sein.“)
Neurotizismus („Ich fühle mich oft angespannt und nervös.“)
Forscher und Forscherinnen kamen zu der Erkenntnis, dass viele Aspekte der Achtsamkeit als Eigenschaft schon in wohlbekannten Persönlichkeitsbeschreibungen gemessen wurden: Es zeigten sich Korrelationen zwischen Achtsamkeitsmessungen mit dem FFMQ (Five-Facet Mindfulness Questionnaire)