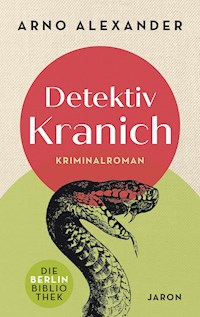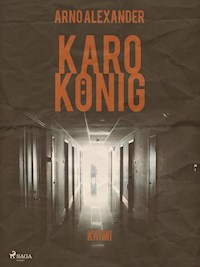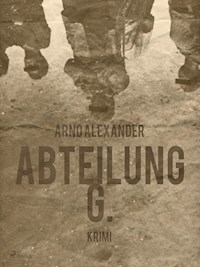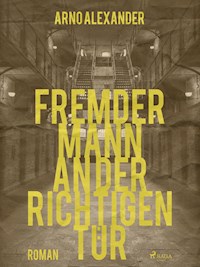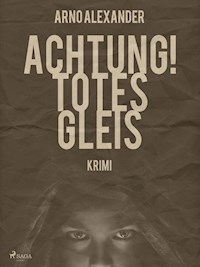
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wessley ist ein nicht nur seinem Vorgesetzten Stimson gegenüber manchmal ein wenig trottelig wirkender, aber dennoch keinesfalls zu unterschätzender junger New Yorker Polizist. Von Stimson erhält er den Auftrag, sich als Baron Steinitz aus Lichtenstein beim berühmten Musikprofessor und Komponisten Kisewetter vorzustellen und sich von ihm Klavierstunden geben zu lassen. Denn Kisewetter ist die einzige Spur, um womöglich einer Bande auf die Spur zu kommen, die sich auf Eisenbahnüberfälle mit großen Geld- oder Goldsendungen spezialisiert hat. Während seines verdeckten Einsatzes lernt Wessley eine geheimnisvolle junge Frau – Alice – kennen, die keine Bleibe mehr hat und die er darum (vorübergehend, wie er meint) bei sich zu Hause aufnimmt. Sie hat irgendetwas mit den Vorfällen um Kisewetter und die Bande zu tun. Aber was? Gehört sie dazu und wurde gezielt auf Wessley angesetzt? Ist sie Mitwisser? Oder doch nur unschuldiges Opfer? In jedem Fall hat sie irgendeine Verbindung zu Maising, und über Maising wiederum führt die Spur weiter zu Kisewetter. Aber Maising ist verhaftet worden. Nur: Wessleys Kollegen wissen überhaupt nichts von einer solchen Verhaftung. Aber wo ist der Verschwundene dann, wenn er nicht im Gefängnis ist? Und dann geschieht ein Mord. Und es bleibt nicht bei diesem einen Mord … Mit "Achtung totes Gleis" hat Arno Alexander einen ungewöhnlich spannenden und dabei auch außerordentlich unterhaltsam und vergnüglich zu lesenden Kriminalroman geschrieben. Unvergesslich auch sein durchtriebener Held Wessley, der – anders als so viele seiner Ermittlerkollegen – alles andere als perfekt ist, sondern gerade durch seine Fehler und Nachlässigkeiten außerordentlich realistisch und menschlich–sympathisch herüberkommt. Eine einzigartiger Lektüregenuss!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arno Alexander
Achtung! Totes Gleis
Saga
Achtung! Totes Gleis
© 1933 Arno Alexander
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711626030
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
„Also merken Sie es sich genau: Der Professor Kisewetter ist sozusagen unsere einzige Fährte. Er ist dringend verdächtig, dringend, ganz dringend! Vergessen Sie das keinen Augenblick: Dringend verdächtig, einzige Fährte.“
Stimson, Chefinspektor bei der New Yorker Kriminalpolizei, seufzte nach diesen Worten auf wie nach schwerer Arbeit. Langsam erhob er sich von seinem bequemen Sessel und stampfte auf das Fenster zu. Hier blieb er stehen, tat einen tiefen Zug aus seiner Zigarre und sah seinen Untergebenen prüfend und erwartungsvoll an.
Kapitän Wessley stand in ehrerbietiger und dabei doch freimütiger Haltung neben dem Riesenschreibtisch seines Vorgesetzten. Wessley war jung, jünger als alle Beamten, die je das Arbeitszimmer des Chefinspektors hatten betreten dürfen. Trotz dieser Jugend aber und trotz seinem geringen Dienstgrade hielt Stimson große Stücke auf ihn und betraute ihn oft mit recht knifflichen Aufgaben. Nie aber bekam Wessley ein freundliches Wort oder ein Lob von Stimson zu hören, denn nach der unerschütterlichen Überzeugung dieses hohen Vorgesetzten war bei den ihm unterstellten Beamten nur Strenge, Strenge und nochmals Strenge am Platz, — und bei Wessley ganz besonders! Dieser junge Kapitän sollte und mußte vergessen, daß er als Sohn des verstorbenen Jugendfreundes Stimsons hier eine Art bevorzugte Stellung einnahm. Leider aber dachte Wessley nicht im entferntesten daran, diesen für ihn günstigen Umstand außer acht zu lassen.
„Haben Sie die Stichwörter behalten?“ fragte Stimson ärgerlich, da der Kapitän, ohne zu antworten, über Stimsons Kopf hinweg durchs Fenster sah, wo hoch in den Lüften die halsbrecherischen Leistungen eines Flugzeugführers seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen.
Wessley verneigte sich.
„Ich habe sie mir gemerkt“, sagte er mit seiner jugendlich-frischen Stimme und wandte den Blick wieder seinem Vorgesetzten zu. „Dringend verdächtig, einzige Fährte.“
„Ausgezeichnet!“ knurrte Stimson und strich die Falten des Rockes über seinem Bäuchlein glatt. „Sie wissen, daß das Einprägen von Stichwörtern schon den halben Erfolg bedeutet. Man kann sich diese Kennworte gar nicht oft genug vorsagen. Also, ich wiederhole: Sie gehen noch heute zu dem Musikprofessor Kisewetter, stellen sich ihm als Baron Steinitz aus Lichtenstein vor und erklären, Sie hätten so viel Gutes über seinen Musikunterricht gehört, daß Sie unbedingt bei ihm lernen wollten. Sie geben an, schwerreich zu sein, und der Kostenpunkt beim Musikunterricht spielt bei Ihnen gar keine Rolle. Das bezahlt die Kriminalabteilung.“
„Das darf ich dem Professor aber nicht sagen“, mutmaßte der junge Beamte.
Stimson warf dem Kapitän einen vernichtenden Blick zu, der aber gleichzeitig forschend war. Es gelang dem Chefinspektor jedoch nicht, im Gesicht seines Untergebenen auch nur die Spur eines Lächelns zu entdecken.
„Sie haben mich wieder falsch verstanden“, sagte Stimson vorwurfsvoll. „Einem Kinde müßte es einleuchten, daß Sie dem Professor nicht weismachen, Sie seien schwerreich, um nachher zu erklären, Ihren Unterricht bezahle die Kriminalabteilung. Nun, sagen Sie mal, haben Sie auch einen anständigen Anzug?“
Prüfend blickte Wessley an seinem dunkelblauen Anzug hinab.
„Dieser Anzug ist erst zweimal chemisch gereinigt und nur einmal gewendet“, erwiderte er ernst. „Die paar Flecken, die im letzten Jahr daraufgekommen sind, sieht man nur bei Tageslicht.“
„Sie sind einfältiger, als es die Polizei erlaubt“, tadelte Stimson kopfschüttelnd. „Merken Sie es sich: Ein Baron Steinitz, der schwerreich ist, trägt keine gewendeten und chemisch gereinigten Anzüge. Ich werde Ihnen also einen Scheck ausschreiben, und Sie besorgen sich sofort einen guten Anzug. Eigentlich müßte er nach Maß gearbeitet sein, aber ... Na, das läßt sich nicht ändern. Wie steht es übrigens mit Ihrem Mantel, mit Hut, mit Schuhwerk? Hm?“
„Das ist alles auf den gereinigten und gewendeten Anzug abgestimmt“, antwortete Wessley gleichmütig, und sein Vorgesetzter merkte nicht, daß diese Antwort auch ein wenig hoffnungsvoll klang: Ein armer Kriminalbeamter hatte nicht oft Gelegenheit, sich auf einmal vollständig neu einzukleiden.
Seufzend füllte Stimson den Scheck aus.
„So, das genügt für alles“, sagte er. „Aber daß Sie mir nun auch einen Baron darstellen, wie er im Buche steht. Würde, Würde, mehr Würde, junger Mann! Merken Sie sich das Stichwort — es wird Ihnen nützen. Und Ihre Berichte erwarte ich nur durch den Fernsprecher oder schriftlich. Keinesfalls dürfen Sie mehr hierher kommen, solange die Angelegenheit nicht geklärt ist. Und noch eines: Vergessen Sie nicht, mit dem Professor deutsch zu sprechen. Er ist Deutscher und wird das zu schätzen wissen. Nur weil auch Sie aus Deuschland stammen, haben wir Sie für diese Aufgabe ausersehen. Bilden Sie sich ja nicht ein, Sie verdankten es Ihrer Tüchtigkeit, von der ich leider nie viel gemerkt habe. Auf Wiedersehen!“
*
Drei Stunden später hastete Kapitän Wessley mit Riesenschritten die Treppenstufen zu Professor Kisewetters Wohnung hinauf. Der junge Kriminalbeamte war wirklich wie ein sehr reicher Baron gekleidet, aber seine ungestüme Eile paßte wenig zu dem Bild, das sich Stimson von einem Baron machte. Es war jedoch schon so spät geworden, daß Wessley fürchtete, die Zeit zu versäumen, zu der ein lernbegieriger Baron einen Musikprofessor aufsuchen durfte. Daher hielt er seine Eile für unbedingt angebracht. „Hauptsache — die Stichwörter“, murmelte er heftig atmend. „Einzige Fährte, dringend verdächtig, schwerreicher Baron und — Würde, Würde, Würde!“ Als Kapitän Wessley zum drittenmal „Würde“ sagte, geschah ein Unglück. Mit einer Geschwindigkeit, die durchaus nichts Würdevolles an sich hatte, war er bis zur nächsten Treppenbiegung gekommen und sah zu spät, daß ihm entgegen mit noch viel größerer Schnelligkeit eine junge Dame die Treppe hinunterlief. Mit dem geübten Blick des Autofahrers erkannte Wessley sofort, daß ein Zusammenstoß unvermeidlich war.
Die beiden jungen Leute prallten mit einer Wucht zusammen, die es als Wunder erscheinen ließ, daß keiner von ihnen zu Boden stürzte. Mit hochroten Gesichtern standen sie sich jetzt gegenüber und betrachteten den angerichteten Schaden. Wessleys nagelneues Stöckchen, ohne das er sich einen Baron gar nicht denken konnte, war mitten durchgebrochen: Der Karton, den die junge Dame in der Hand gehalten hatte, war arg eingedrückt und lag am Boden. Wessley bückte sich, hob den Karton auf und reichte ihn der jungen Dame.
„Ein bißchen beschädigt ...“ murmelte er verstört, denn so zornig die Augen dieses Mädchens auch blitzten, er hatte doch erkannt, daß die Besitzerin des Kartons sehr hübsch war.
„Sie sind mir ja der Richtige!“ rief sie erzürnt aus. „Kommen wie ein Schuljunge die Treppen heraufgerannt, zerbrechen das Geburtsgeschenk für meine Freundin und halten es nicht einmal für angebracht, sich zu entschuldigen. Schämen Sie sich!“
„So, so ...“ knurrte Wessley verblüfft. „Und dieser zerbrochene Stock ... hm ... zählt wohl gar nicht? Und hatten Sie nicht ebenfalls mindestens ein Achtzig-Kilometer-Tempo, mein Fräulein?“
„Ich bin ganz langsam gegangen, mein Herr!“ erklärte sie entschieden. „Übrigens finde ich es einfach weibisch, wenn Sie jetzt die Schuld auf mich schieben wollen. Sie sind sehr ungezogen, mein Herr!“ Wessley atmete auf.
„Ich will Ihnen jetzt etwas Niederschmetterndes sagen“, versetzte er ernst. „Ich wollte Sie schonen, aber Sie haben es nicht anders verdient. Hören Sie: Vor Ihnen steht niemand anderes als Baron Steinitz aus Lichtenstein.“
„Wären Sie nur in Lichtenstein geblieben“, sagte sie, warf den Kopf stolz in den Nacken und ließ den jungen Mann einfach stehen.
Wessley gestand sich ein, daß er sich von der Ehrerbietung, die Baronen in Amerika entgegengebracht wurde, ein übertriebenes Bild gemacht hatte. Verstimmt hielt er die zerbrochenen Stücke seines neuen Stöckchens aneinander, aber er erkannte zu seinem Leidwesen, daß der Schaden durch Leimen nicht wieder gutzumachen sei. Er zuckte die Achseln, legte das Stöckchen am Treppenabsatz hin und stieg jetzt bedeutend würdevoller als vorhin noch zwei Treppen hinauf. Hier endlich erblickte er das Messingschild des Musikprofessors.
2
Professor Kisewetter war ein Mann in den fünfziger Jahren, groß und hager, mit durchdringenden und doch etwas schwermütigen Augen. Er empfing Wessley im Abendanzug, der so vortrefflich saß, daß der junge Kriminalbeamte einsah, wie sehr sein gewendeter Anzug hier aufgefallen wäre.
„Sie wünschen?“ fragte der Professor kurz und wies mit einer einladenden Handbewegung auf einen Sessel.
Wessley setzte sich, schlug die Beine geschickt übereinander und ordnete die nagelneuen Bügelfalten. Dann maß er den hageren Mann vor sich mit einem nachdenklichen, überlegenen und — seiner Meinung nach — außerordentlich würdevollen Blick.
„Mein Name ist Steinitz“, stellte er sich in deutscher Sprache vor. „Baron Steinitz aus Lichtenstein. Ich habe Sie aufgesucht, Herr Professor, weil ...“
„Entschuldigen Sie, bitte“, unterbrach ihn der Professor höflich, „aber vielleicht sprechen sie auch englisch?“
Wessley starrte den Hausherrn ganz entgeistert an. Er mußte sich erst besinnen, so sehr hatte ihn die Bemerkung des Professors aus dem Fahrwasser gebracht.
„Selbstverständlich, selbstverständlich“, stammelte er. „Aber ich dachte ... ich glaubte ...“
„Ich bin zwar in Deutschland geboren“, erklärte Kisewetter kühl, „aber ich lebe schon seit vierzig Jahren in den Staaten, und ich muß gestehen, ich spreche heute geläufiger englisch als deutsch.“
Eines der Stichwörter Stimsons hatte versagt! Nun, Wessley verlor nicht den Mut: er hatte ja noch mehr Stichwörter in Bereitschaft.
„Ich habe gehört“, begann er aufs neue und diesmal in englischer Sprache, daß Sie, Mr. Kisewetter, in geradezu bewundernswerter Weise Musikunterricht erteilen ...“
Kisewetter setzte sich Wessley gegenüber an seinen Schreibtisch und sah den jungen Mann forschend und fragend an.
„Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir verraten wollten, wer Ihnen das erzählt hat“, bemerkte er obenhin. „Hat mich Ihnen jemand empfohlen? Ich möchte das gern wissen.“
„Empfohlen? ... Nun, empfohlen ist vielleicht etwas zuviel gesagt“, wich Wessley aus. „Ich habe Ihren Namen des öfteren nennen hören ... im Kaffeehaus, bei Bekannten ... Ja, und zuletzt erzählte mir mein Onkel von Ihrem hervorragenden Unterricht. Richtig, mein Onkel war es.“
„Freut mich“, sagte Kisewetter ernst. „Grüßen Sie Ihren Onkel und sagen Sie ihm, ich danke sehr für die Empfehlung. Es ist mir in Anbetracht dieser Empfehlung fast peinlich, es einzugestehen, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige Unterrichtsstunde gegeben.“
Wessley atmete tief auf. Er fühlte einen ohnmächtigen Zorn gegen Chefinspektor Stimson in sich aufsteigen. Diese unseligen Stichwörter — eines so falsch wie das andere!
„Das ... ist aber sonderbar ...“ preßte Wessley hervor. Irgend etwas mußte er doch sagen, und wenn es das Dümmste war.
„Sehr sonderbar“, bestätigte der Professor ruhig. Er stand wieder auf, machte einen, zwei lautlose Schritte auf dem weichen Teppich, blieb vor dem geöffneten Flügel stehen und schlug in Gedanken ein paar Tasten an. Dann klappte er den Deckel hörbar zu, trat rasch wieder zu Wessley und sah ihn prüfend von oben bis unten an.
„Und jetzt, Mr. Steinitz“, erklärte er sachlich, „bitte ich Sie, mir zu sagen, was Sie eigentlich bei mir wollen.“
Wessley begriff, daß seine Aufgabe bei diesem Mann viel schwieriger war, als er sie sich gedacht hatte. Diesen Fall hätte man ganz anders anpacken müssen, viel vorsichtiger, viel durchtriebener. Der Kapitän kam sich vor wie ein Elefant im Porzellanladen: alles, was er bis jetzt hier versucht hatte, war fehlgeschlagen; er war an eine Aufgabe, die äußerst fein und durchdacht behandelt werden mußte, tolpatschig und schwerfällig herangegangen und hatte seiner Sache sehr geschadet. Schuld daran waren nur Stimsons Stichwörter!
„Ich will bei Ihnen Musikunterricht nehmen, Mr. Kisewetter“, erklärte er endlich hartnäckig. „Ob Sie nun Unterricht erteilt haben oder nicht, ist mir gleichgültig. Ihr Ruf als Größe in Ihrem Fach ist mir sichere Gewähr für einen Erfolg.“
Dem Professor war anzusehen, daß er seinem Besucher kein Wort glaubte.
„Wenn das alles ist, was Sie von mir wünschen“, erwiderte er trocken, „so wird unsere Unterredung sofort beendet sein. Ich bedauere, aber meine Zeit ist zu kostbar, um sie für Unterricht zu verwenden. Ich arbeite augenblicklich an einem umfassenden Werk über Musikgeschichte und brauche dazu jede freie Minute.“
„Ich verstehe das sehr gut“, versetzte Wessley. „Aber wir leben in Amerika, und hier hat jede Stunde bei jedem Arbeiter ihren Preis. Was verdienen Sie täglich mit Ihrem Geschichtswerk?“
Kisewetter runzelte ärgerlich die Stirn.
„Sie sprechen vom Arbeiten an einem wissenschaftlichen Werk wie vom Würstemachen. Um das zwecklose Gespräch aber zu beenden, will ich Ihnen sagen, daß ich täglich mindestens hundert Dollar verdiene.“
„Und wieviel Stunden täglich arbeiten Sie?“
„Mr. Steinitz, Sie sind wirklich ...“
„Ich zahle Ihnen zehn Dollar für die Stunde ... für die halbe Stunde, wenn Sie wollen“, sagte Wessley ruhig und dachte mit einer Art Schadenfreude an Stimsons Augen, wenn er ihm die Rechnung vorlegen würde.
Der Professor schüttelte verwundert den Kopf.
„Und Sie wollen sechsmal in der Woche je eine Unterrichtsstunde nehmen?“ fragte er unschlüssig.
„Siebenmal“, verbesserte Wessley. „Ich habe Sonntags immer meinen besten Tag.“
„Also gut“, sagte Kisewetter kühl. „Wann wollen wir beginnen?“
„Wenn es Ihnen recht ist — sofort.“
Zum erstenmal seit dieser Unterredung lächelte Kisewetter.
„Mr. Steinitz, Sie fangen an, mir zu gefallen“, meinte er anerkennend. Er sah nach der Wanduhr und nickte. „Ich habe gerade noch etwas über eine Stunde Zeit. Wir können also gleich beginnen. Was wünschen Sie nun eigentlich zu lernen, und besitzen Sie irgendwelche Vorkenntnisse?“
Nun wünschte Wessley schon seit Jahren brennend, Tanzschlager spielen zu lernen. Nie aber hatte er Zeit und Geld gehabt, diesen Wunsch zu verwirklichen. Und jetzt, wo er für sich selbst kostenlosen Unterricht bei einem berühmten Professor haben sollte, durfte er diesen Wunsch nicht äußern.
„Den tiefsten Eindruck hat auf mich die Musik Wagners, Tschaikowskys und Schuberts gemacht“, antwortete er sinnend. „Vorkenntnisse? Nein. Das heißt, ich habe im Chor zweite Stimme gesungen — ganz gut, bis auf die tiefen Töne. Die liegen mir nicht. Jedenfalls möchte ich Klavier spielen lernen, aber nur ernste, getragene Weisen.“
Kisewetter unterdrückte ein Lächeln und trat an den Flügel.
„Bitte!“ forderte er Wessley zum Nähertreten auf. Wessley erhob sich. Neben dem Flügel befand sich ein kleines Tischchen mit einem Blumenglas und einem Bild in vergoldetem Rahmen darauf. Unwillkürlich blieb Wessley stehen, als sein Blick auf das Bild fiel. Das war ja sie, seine Unbekannte, mit der er vorhin auf der Treppe so unliebsam zusammengestoßen war.
„Nun?“ fragte Kisewetter etwas ungeduldig, da Wessley noch immer vor dem Bild stand.
„Oh!“ sagte Wessley überrascht. „Ihr Fräulein Tochter, nicht wahr? Habe die Dame vorhin ganz zufällig kennengelernt ...“
Der Professor lächelte wieder, aber diesmal ein wenig spöttisch.
„Was Sie sagen, Mr. Steinitz? Aber wir wollen jetzt beginnen. Da die Stunde zehn Dollar kostet, können Sie sich ja unschwer ausrechnen, wieviel Sie für die Minute zu bezahlen haben.“
3
Jeremias Perkins, der Leiter und eigentliche Besitzer des großen Warenhauses „J. Perkins & Co.“ warf noch einen Blick auf die vor ihm auf dem Schreibtisch ausgebreiteten Papiere, dann schob er sie alle zusammen in eine Mappe und drückte auf einen der zahlreichen Klingelknöpfe.
„Schicken Sie sofort Mr. Allan hierher!“ schrie er so unwillig auf den herbeieilenden Sekretär ein, daß dieser die feste Überzeugung gewann, Mr. Allan würde für irgendein Vergehen sofort entlassen werden.
Mr. Allan nahm die ihm etwas boshaft mitgeteilte Nachricht von dem Wunsch seines Vorgesetzten mit gleichmütiger Ruhe entgegen. Er rückte seine altmodische Brille auf die Stirn, schneuzte sich in sein buntes Taschentuch, legte die Feder hinters Ohr und rutschte von seinem hohen Schemel herab.
„Ihnen droht ein Donnerwetter“, warnte der junge Sekretär beinahe freudig. „Beeilen Sie sich ein wenig.“
Mr. Allan war ein alter Mann, und nichts konnte ihn so sehr ärgern wie ein anmaßendes Benehmen junger Leute ihm gegenüber. Er blieb stehen, warf dem Sekretär einen giftigen Blick zu und duckte sich. Dadurch wurde sein Rücken so krumm, daß er Ähnlichkeit mit einem Buckel gewann.
„Sie Grünschnabel!“ sagte Allan zornig, und seine faltigen Hände zitterten vor Aufregung. „Donnerwetter? Nichts wird es geben! Der alte Allan macht keine Fehler. Der alte Allan versteht seine Sache noch immer besser als ihr ... junges Gemüse!“
Obwohl Mr. Allan etwas schwerhörig war, hörte er doch durch die sorgfältig hinter sich verschlossene Tür das Gelächter einiger Angestellten. Er wußte genau, welche es waren; er hätte ihre Namen aufzählen können, obwohl sie immer nur hinter seinem Rücken gelacht hatten. Mr. Allan war — und das vermutete keiner dieser „Grünschnäbel“ — ein sehr guter Menschenkenner, und es fiel ihm daher gar nicht schwer zu erraten, welche von den Angestellten einem dummen jungen Vorgesetzten zuliebe über einen alten Mann lachen würden.
Es schien fast, als hätte sich Allan heute ungeachtet seiner unzweifelhaften Menschenkenntnis doch etwas verrechnet: Jeremias Perkins empfing ihn tatsächlich mit einem Donnerwetter.
„Machen Sie die Tür zu!“ schrie er auf, sobald Allan sein Arbeitszimmer betreten hatte. „Ganz zu, zum Teufel! Ich habe mit Ihnen ein ernstes Wörtchen zu reden.“
Mr. Allan schloß die Tür. Er machte sie wunschgemäß „ganz zu“, und das bedeutete bei der schweren Polsterung dieser Tür, daß kein Wort einer noch so laut geführten Unterredung draußen verständlich sein würde.
Als sich Allan umwandte, war mit dem zornigen Chef eine sonderbare — allerdings nicht für Allan — Verwandlung vorgegangen. Er stand händereibend auf und eilte Allan mit einem liebenswürdigen Lächeln auf den Lippen entgegen.
„Bitte, Mr. Allan“, sagte er einladend und wies auf den bequemen Schreibtischsessel. „Es ist alles zur Durchsicht bereit.“
„Etwas Neues?“ erkundigte sich Allan zerstreut und ließ sich mit einer so ruhigen Selbstverständlichkeit am Schreibtisch nieder, daß ein Beobachter unschwer erraten hätte, er tue dies nicht zum ersten und auch nicht zum zwanzigstenmal. So nahm man nur Besitz von einem Platz, der ein angestammtes Recht darstellte.
„In gewissem Sinne — ja“, erwiderte Perkins zuvorkommend und öffnete vor seinem Buchhalter die Mappe mit den vorhin durchgesehenen Papieren. „Man hat einem neuen Kriminalbeamten Witterung gegeben.“
„Alle Unterlagen schon beigebracht?“
„Hier, bitte.“
Aufmerksam betrachtete Allan durch die wieder auf der Nasenspitze sitzende Brille drei Lichtbilder, die alle denselben jungen Mann darstellten. Zwei der Bilder zeigten ihn etwas dürftig gekleidet, auf der dritten Aufnahme dagegen sah er aus, als hätte er sich eben erst im Kaufhaus „J. Perkins & Co.“ vollständig neu eingekleidet.
„Name?“ fragte Allan. Er wußte, daß sich der Name sowohl auf der Rückseite der Bilder als auch auf sehr vielen der ihm vorgelegten Papiere finden ließe; aber Mr. Allan studierte eben die Gesichtszüge des abgebildeten Mannes und hatte daher keine Zeit, den Namen zu suchen.
„George Wessley“, antwortete Perkins. „Nennt sich jetzt Baron Steinitz aus Lichtenstein. Ging sofort spornstreichs zu Professor Kisewetter.“
„Wie heißt dieser Professor?“
„Kisewetter. Er ist Musikprofessor. Gewissermaßen eine Größe auf seinem Gebiet.“
Allan lächelte merkwürdig.
„Da wird George Wessley wohl Musikunterricht nehmen müssen“, brummte er hüstelnd. Dann griff er nach einem Bogen, auf dem er bereits alles Nähere über George Wessley vermerkt fand. Er ersah daraus, daß Wessley achtundzwanzig Jahre alt war und sich seit sieben Jahren im Dienste der Kriminalpolizei befand. Er hatte sich nie besonders ausgezeichnet, aber bei seinem geringen Dienstgrade war das auch kaum zu erwarten. Er war Vollwaise und anscheinend überzeugter Junggeselle. Liebesgeschichten von längerer Dauer waren jedenfalls nicht erwähnt. Zum Schluß des Berichtes stand der bedeutsame Vermerk: „Lebt vom Gehalt, hat nie Geld.“
„Ich halte den Mann nicht für gefährlich“, sagte Perkins nach einer Weile, da Allan immer noch in den Bericht starrte, den er doch längst zu Ende gelesen haben mußte.
„Ihr Urteil ist etwas verfrüht und natürlich ganz unbegründet“, tadelte Allan. „Haben Sie sich die Lichtbilder näher angesehen? Nicht dieses, auch nicht das hier ...“ Dabei warf Allan zwei Bilder achtlos beiseite. „Das dritte Bild — sehen Sie? — verrät mir einiges. Wie kommt es, daß ein Mensch auf zwei Bildern ganz bedeutungslose Gesichtszüge hat, auf dem dritten aber ... Oder nennen Sie das auch bedeutungslos?“
Perkins betrachtete das Bild aufmerksam.
„Ich habe gerade diesem Bild wenig Bedeutung beigemessen, da der Photograph selbst angab, es sei ganz unähnlich geworden.“
„Oh, diese Grünschnäbel!“ rief Allan vorwurfsvoll aus. „Dabei haben wir hier bestimmt Wessleys wahres Gesicht vor uns, vielleicht ein Gesicht, das noch keiner von seinen Vorgesetzten zu sehen bekam.“
„Also gut“, erklärte Perkins verdrossen. „Wenn Sie den Mann für so bedeutend halten, werde ich ihn beseitigen lassen.“
„Das werden Sie hübsch bleiben lassen. Thorntons Bande hat fünf Detektive hintereinander beseitigt, und dadurch fand der sechste dann ganz leicht die richtigen Spuren. Nein, so arbeitet der alte Allan nicht: Wessley darf kein Härchen gekrümmt werden. Er soll beobachtet werden — aus achtungsvoller Entfernung beobachtet werden. Niemand darf ihm so nahe kommen, daß Wessley ihn bemerkt. Die Beobachter sind täglich abzuwechseln.“ Perkins lachte gereizt auf.
„Ich glaube, wenn wir eine Versicherungsgesellschaft wären, und dieser Wessley hätte bei uns sein Leben hoch versichert, wir könnten ihn nicht sorgsamer betreuen. Ich möchte wissen, wie Sie seine Arbeit unschädlich zu machen gedenken, Mr. Allan?“
„Da gibt es noch andere Mittelchen“, versetzte Allan verschmitzt lächelnd. „Ein Weib muß uns helfen. Wessley ist in dem gefährlichsten Alter und hat noch keine ernsthaften Liebesgeschichten erlebt. Also? Sehr einfach. Sagen Sie mal, diese Smith, die an der Kasse siebzehn sitzt, gehört doch auch zu Ihren Auserwählten?“
„Sie weiß Bescheid“, erwiderte Perkins kurz. „Sie hat schon wiederholt sehr gute Arbeit geliefert.“
„Das paßt ja glänzend!“ rief Allan begeistert. „Sagen Sie mal ... Sehen Sie, ich verstehe da nichts mehr davon ... Aber hat ihre Nackenlinie nicht etwas Aufregendes für einen jungen Mann? Oder das schöne, blonde, gewellte Haar?“
Perkins lächelte verächtlich.
„Das Haar hat ihr Friseur sowohl schön als auch blond und gewellt gemacht. Und die Nackenlinie? Bedaure, aber ich habe noch nichts daran gefunden. Aber sie hat — wie man sagt — rassige Beine und einen seelenvollen Blick. Ob sie Seele hat, entzieht sich meiner Kenntnis.“
„Ist auch gar nicht nötig“, widersprach Allan. „Der Blick genügt uns doch vollkommen. Also geben Sie der jungen Dame noch heute den Auftrag. Wie sie Wessley kennenlernt, ist ihre Sache. Aber es muß schnell geschehen, sehr schnell.“
„Auf Ihre Veranwortung, Mr. Allan.“
„Nebenbei bemerkt — haben Sie etwas über XYZ erfahren?“
„Nichts, Mr. Allan.“
„Ein bißchen wenig, Mr. Perkins“, bemerkte Allan höhnisch. „XYZ raubt einen ganzen Eisenbahnzug aus, es vergehen zwei volle Wochen, und wir haben erfahren — nichts! Großartige Arbeitsleistung.“
„Aber die Polizei hat bis heute ebenfalls nichts erfahren.“
„Die Polizei?“ Allan lachte auf. „Die Polizei wüßte heute bestimmt mehr als wir, wenn sie sich nicht in die hübsche, aber irrige Ansicht verbohren würde, wir hätten diesen Eisenbahnzug ausgeraubt. Ausgerechnet wir! Und dabei hatten wir doch nur die Absicht, und XYZ tat es! Er muß entdeckt werden, verstanden? Der Mann muß seine Tat büßen. Wir lassen uns nicht ins Handwerk pfuschen, das sage ich Ihnen ein für allemal ...!“
Mr. Allan hatte sich richtig in Wut gesprochen. Perkins kannte das; seit zwei Wochen war es immer dasselbe, und doch konnte er nichts daran ändern. Es gab irgendwo in den Staaten einen Mann, den man hier XYZ getauft hatte, der ihnen ein Geschäft nach dem anderen verdarb; aber wo dieser Mann war und wie er in Wahrheit hieß, das hatte man bis jetzt vergeblich zu ergründen versucht.
Die Klingel des Fernsprechers gab ein schwaches Zeichen, und Perkins kam diese Ablenkung sehr gelegen.
„Hier Perkins“, rief er in die Sprechmuschel, und dann horchte er aufmerksam, wobei er sich auf einem Blatt Papier Vermerke machte.
„Die neueste Meldung über unseren Freund Wessley“, sagte er, nachdem er den Hörer wieder eingehängt hatte.
„Nun?“
„Er hat sich gestern abend, nachdem er die Wohnung des Professors verließ, einen Hund gekauft.“
Allan starrte den Sprecher ratlos an.
„Einen Hund —?“
„Einen Schäferhund“, ergänzte Perkins ruhig. „Er bezahlte dafür vierzig Dollar und blieb noch dreißig schuldig.“
„Einen Hund —?“ wiederholte Allan nachdenklich.
„Ja, es ist ein ehemaliger Polizeihund, der gewissermaßen aus dem Dienst entlassen wurde, weil er drei Schutzleute hintereinander gebissen hatte.“
„Und den hat Wessley gekauft?“ murmelte Allan verwundert. „Na, wohl bekomm’s.“
4
Der Bankbeamte John Flatter hatte im Gespräch seinem Freunde, dem Hotelkellner Friedrichsen, erzählt, daß am dreißigsten September mit dem Abend-Postzug für hunderttausend Dollar teils Bargeld, teils Wertpapiere nach Kansas geschickt würden. John Flatter hatte für diese Nachricht keinen Cent bezahlt bekommen, wohl aber dafür seinen Posten eingebüßt. Der Hotelkellner Friedrichsen gab die Nachricht seinem Bekannten, dem ehemaligen Taxilenker Merkulow weiter, erhielt dafür zehn Dollar und verlor demzufolge wenige Tage später ebenfalls seinen Posten. Merkulow, ein der Polizei durch mannigfaltige Vorstrafen bereits wohlbekannter Mann, verkaufte sein Wissen über die große Geldsendung für hundertzwanzig Dollar an den gewesenen Anwalt Sherbourgh, der nachher vor Gericht äußerte, Merkulow habe die Nachricht eigentlich „verschleudert“, und man müsse ihm, Sherbourgh, daher mildernde Umstände zubilligen, denn er hätte der Versuchung nicht widerstehen können.
Es war bekannt, daß Sherbourgh Beziehungen zu allem lichtscheuen Gesindel New Yorks unterhielt. Er vermittelte alles — angefangen mit Wohnungen in allen Vierteln New Yorks und Stellungen mit und ohne Sicherheitsleistung bis einschließlich Gelegenheiten zu Einbrüchen, Raubmorden und — Eisenbahnüberfällen. Diese letzte Art Vermittlung kam ihm trotz dem Geschick seines Anwalts am teuersten zu stehen — er wurde später dafür zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Gericht nahm mit Recht an, daß er im Gegensatz zu Flatter, Friedrichsen und Merkulow genau gewußt habe, zu welchem Zwecke er die Nachricht erst bezahlte und dann weiterverkaufte.
Sehr zum Leidwesen der Polizeigewaltigen gelang es nicht, den Weg, den die Nachricht über die Geldsendung genommen hatte, weiter zu verfolgen.
Sherbourgh hatte angegeben, sie „gesprächsweise“ einem Fremden gegenüber erwähnt zu haben. Der Fremde habe ihm dafür ein Päckchen Dollarscheine eingehändigt, das Sherbourgh vergessen habe nachzuzählen. Er beschrieb den Fremden sehr genau, aber — wie der Untersuchungsrichter bemerkte — paßte diese Beschreibung auf die halbe männliche Bevölkerung New Yorks.
„Der Mann mit dem schwarzen Hut“ — so nannte Sherbourgh den Fremden, und alles sprach dafür, daß Sherbourgh ihn wirklich nicht kannte, denn er hätte sonst kaum den verschiedenen Vorschlägen widerstanden, die ihm in verblümter Weise von der Polizei gemacht wurden und alle auf eine wesentlich verkürzte Zeitdauer seines Aufenthalts im Zuchthaus hinausliefen. Diesen „Mann mit dem schwarzen Hut“ gelang es der Polizei nicht zu finden, obwohl sie von ihm Abdrücke sämtlicher Finger und eine genaue Lebensbeschreibung besaß, und obwohl er sich keinesfalls vor der Polizei versteckte. Die Erklärung für diesen etwas eigentümlich anmutenden Umstand war sehr einfach: Die Polizei besaß zu viel Fingerabdrücke und Lebensbeschreibungen von Männern, die außerhalb des Zuchthauses gewöhnlich einen schwarzen Hut trugen.
Jim Crocks, der Mann mit dem schwarzen Hut, lehnte heute genau wie gestern und vor zwei Wochen gegen neun Uhr abends nachlässig am Schanktisch in der Bar. „Die schiefe Ecke“, hatte immer noch den schwarzen Hut auf und trank wie stets aus Ermangelung eines Besseren Himbeerlimonade. Eine dicke Zigarre zwischen den Lippen, stierte er vor sich hin auf die flinken Hände des Barfräuleins, das vor seinen Augen mit großer Geschwindigkeit die verschiedensten Getränke für eilige und müßige Gäste bereitete.
„Fräulein, der Mann hat um fünfzig Cent zu wenig bezahlt“, sagte Jim Crocks gemächlich. Dabei hatte er den Mann auch schon am Kragen festbekommen und ließ ihn erst los, nachdem ein blankes Fünfzigcentstück auf den Tisch fiel. Im übrigen waren Jim Crocks sowohl dieser Mann als das hübsche Fräulein furchtbar gleichgültig. Wenn er sich um diese Kleinigkeit kümmerte, geschah es nur aus Langeweile und einem angeborenen Gerechtigkeitsempfinden. Dieses Empfinden erstreckte sich aber keinesfalls auch auf Raubüberfälle bei Eisenbahnzügen und ähnliche „große Sachen“.
Nein, Jim Crocks kümmerte sich nicht um das hübsche Barfräulein, denn Jim Crocks hatte seit drei Monaten ein festes Verhältnis. Er war überzeugt, daß er sein Mädchen lieb hatte, und sie liebte ihn ganz bestimmt ebenso tief. Es war eine ruhige, anständige Liebe — nicht eine von der Art, die einem das Essen verleidete und den Geschäftsgang beeinträchtigte.
Ein Mann, klein und schmächtig, mit spärlichem, schwarzem Bärtchen, drängte sich an die Bar heran. Er begrüßte niemanden, und auch ihn grüßte niemand, obwohl ihn fast alle kannten, die hier verkehrten. Dieses Männchen lebte vom Zutragen nicht ganz ungefährlicher Nachrichten. Man nannte ihn Spitzel, da es ihm nicht darauf ankam, mal auch eine Nachricht der Polizei zuzutragen. Man verachtete ihn, aber hin und wieder brauchte man ihn auch. Hatte er einmal aufs neue der Polizei Nachrichten zugetragen, so wurde er in irgendeiner stillen Seitenstraße ruhig und ohne Aufhebens von mehreren Männern so lange geprügelt, bis ihm nach Ansicht der Strafvollzieher für absehbare Zeit die Lust verging, seine Beziehungen zur Polizei weiter auszubauen.
„Nun?“ fragte Crocks rauh, ohne von seinem Glas aufzublicken.
„Er wird kommen“, raunte das Männchen heiser.
Crocks fischte einen schmierigen Dollarschein aus der Tasche und warf ihn auf den Tisch.
„Aber Sie sagten doch, ich bekäme zehn ... zehn schöne Dollar“, wandte der schmächtige Mann schüchtern ein.
„Er ist noch nicht gekommen“, schnitt Crocks ab. „Wir reden später darüber.“ Plötzlich drehte er sich heftig dem Mann zu. „Was willst du noch? Scher dich zum Teufel!“
Das kleine Männchen zog sich erschrocken zurück und setzte sich in die äußerste Ecke an ein freies Tischchen. Von hier aus konnte man, ohne aufzufallen und ohne jemanden zu belästigen, alles beobachten, was an der Bar vorging.
Crocks rückte ein wenig beiseite, so daß er den Blick von nun an auf die Eingangstür gerichtet hielt. Es verging aber noch eine lange Zeit, bis er endlich den Mann erblickte, dessen Kommen ihm angekündigt worden war.
Es war George Wessley. Crocks wußte es sofort, als er ihn erblickte, obwohl er ihn noch nie im Leben gesehen hatte. Aber Wessley sah nicht nur genau so aus wie auf den Lichtbildern, die Crocks in der Tasche hatte, sondern er trug sogar denselben feinen Mantel und Hut wie auf einem der Bilder. Auch das Stöckchen fehlte nicht, denn Wessley hatte sich inzwischen ein neues gekauft.
Er war durch die hohe Drehtür getreten und sah sich suchend um. Bestimmt bemerkte er das kleine Männchen in der Ecke, das er ja kennen mußte, aber er beachtete es nicht, sondern schritt ruhig auf einen freien Tisch in der Nähe der Bar zu. Er legte den nagelneuen Hut neben sich auf einen Stuhl, zog die gelben Handschuhe aus, bestellte sich etwas zu essen und zu trinken und vertiefte sich ins Lesen einer mitgebrachten Zeitung.
Die vornehme Erscheinung Wessleys fiel in dieser Umgebung nicht auf, denn es verkehrten hier viele Männer, deren durch die Steuerbehörde nicht nachweisbares Einkommen eine ebenso feine Kleidung erforderlich machte. Aufgefallen wäre nur, wenn Wessley sich hier viel umgesehen und andere Leute beobachtet hätte; aber davor hütete sich der junge Kapitän, denn er wußte genau, in welcher Art Bar er sich befand.
Der Tip, den ihm der kleine schwarzbärtige Mann gegeben hatte, war gut. Es fragte sich nur, ob der Mann auch die Wahrheit gesprochen hatte. In dieser Bar sollte nach seinen Angaben Sherbourgh vor der Verhaftung viel verkehrt haben, und wenn das stimmte, war es nicht unwahrscheinlich, daß Sherbourgh hier auch den „Mann mit dem schwarzen Hut“ kennengelernt hatte. War es da nicht möglich, diesen Mann auch jetzt noch hier zu treffen oder etwas über ihn zu erfahren?
Wessley las seine Zeitung, und er las sie wirklich: Er wußte, daß die meisten Besucher dieser Bar es unschwer erkennen würden, falls er nur so tat, als lese er. Und Wessley war so sehr ins Lesen vertieft, daß er gar nicht bemerkte, wie und woher die Dame gekommen war, die jetzt mit einer schüchternen Entschuldigung an seinem Tisch Platz nahm.
„Oh, bitte, Sie stören mich gar nicht“, sagte der Kapitän freundlich und rückte ein wenig zur Seite. Mit dem geübten Auge des Kriminalbeamten betrachtete er unauffällig und doch aufmerksam das bleiche, etwas müde Gesicht des vielleicht zweiundzwanzigjährigen jungen Mädchens an seinem Tisch. Innerlich stellte er etwas befremdet fest, daß dieses Mädchen in keiner Weise hierher paßte. Weder konnte sie die Freundin eines der hiesigen Geschäftemacher sein, noch war es denkbar, daß sie zu jener Art Frauen gehörte, die sich um diese Zeit mit Vorliebe an den Tisch eines einsamen Herrn setzen.
Sie sah ängstlich aus, und ihre großen blauen Augen blickten mit einer stummen, erschreckten Frage bald den einen, bald den anderen der lebhaften und etwas auffallenden Gäste an. Sie trug ein graugestreiftes Jackettkostüm, das sie wohl vorzüglich kleidete, aber doch einen etwas abgetragenen Eindruck machte. Das fiel um so mehr ins Auge, als die meisten der anwesenden Damen in großer Abendkleidung waren.
„Was darf es sein?“ erkundigte sich der Ober bei der Fremden in einem so herablassenden Ton, daß Wessley an sich halten mußte, um eine scharfe Rüge zu unterdrücken.
„Kaffee“, sagte sie leise, kaum hörbar.
Fünf Minuten darauf brachte der Ober den verlangten Kaffee. Er stellte das Geschirr mit betonter Absichtlichkeit geräuschvoll und nachlässig auf den Tisch, wie es ein Ober nur dann tut, wenn er von vornherein die Hoffnung auf ein anständiges Trinkgeld aufgibt.
„Darf ich gleich um Kasse bitten?“ erkundigte er sich darauf gleichmütig und sah starr nach der Tür.
In das blasse Gesicht der Fremden stieg jähe Röte. Hastig nestelte sie an ihrer Handtasche und suchte ein Geldstück hervor.
Wessley räusperte sich drohend. Er war empört, aber er wollte in dieser Bar einen Auftritt nach Möglichkeit vermeiden. Schließlich befand er sich ja hier in dienstlicher Eigenschaft und durfte sich nicht die Aussichten auf den Erfolg seiner Nachforschungen mutwillig verderben.