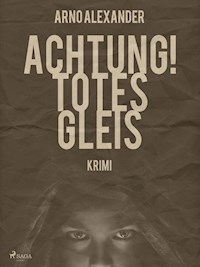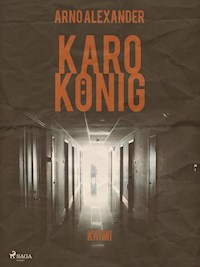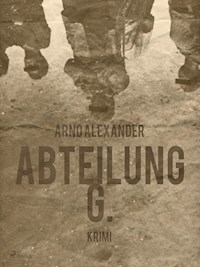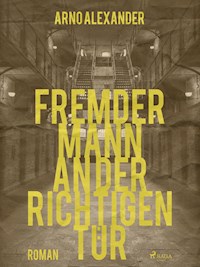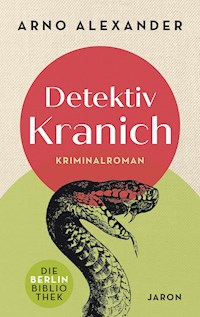
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Berlin-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Detektiv Kranichs aktueller Fall ist eine echte Herausforderung: Der Sohn des Kommerzienrats Sommerfeld soll seinen eigenen Bruder umgebracht haben. Kranich ist sicher, dass der junge Mann unschuldig ist – denn in Berlin treibt seit Jahren „die Viper“ ihr Unwesen, begeht Giftmorde und schiebt diese dann geschickt anderen in die Schuhe. Der Detektiv stürzt sich Hals über Kopf in die Ermittlungen … Die rasante Geschichte rund um den draufgängerischen Detektiv ist ein originaler Berlin-Krimi von 1932. Arno Alexander war damals einer der erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detektiv Kranich
Kriminalromanvon
Arno Alexander
Mit einem Nachwort von Mirko Schädel
Jaron Verlag
ARNO ALEXANDER wurde 1902 als Arnold Alexander Benjamin in Moskau geboren und starb 1937. Das ist fast alles, was man über den Autor weiß, der ab 1929 rund zwanzig Romane, vor allem Krimis, veröffentlichte. Der vorliegende Roman erschien 1932 in der Reihe »Goldmanns Kriminal-Romane« als Die Viper und 1933 unter dem Titel Detektiv Kranich als erster Band der Reihe »1 Mark Goldmann-Buch«.
Zu dieser Ausgabe:
Grundlage des Textes ist die Ausgabe, die 1933 in der Reihe »1 Mark Goldmann-Buch« im Wilhelm Goldmann Verlag, Leipzig, erschienen ist. Die Rechtschreibung wurde größtenteils der heute üblichen angepasst, offensichtliche Fehler wurden verbessert, manche Eigenarten und Altertümlichkeiten aber auch beibehalten.
1. Auflage 2022
Jaron Verlag GmbH, Berlin
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona
Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-95552-047-2
1
Der Geschäftsführer Hübner zupfte sorgfältig die Ärmel seines altmodischen, speckig glänzenden Gehrocks zurecht, rückte den dicken Knoten der immer schief sitzenden Krawatte gerade und betrat mit einem leisen Räuspern das Arbeitszimmer seines Vorgesetzten.
»Herr Direktor, Herr Direktor!«, raunte er leise.
Da die Vorhänge zugezogen waren und im Zimmer kein Licht brannte, vermochte er nicht gleich zu erkennen, ob sein Vorgesetzter anwesend war oder nicht.
»Herr Direktor!«, rief er wieder, diesmal etwas lauter.
Ein verschlafenes Grunzen, begleitet von unwilligem Schnaufen, war zunächst die einzige Antwort.
»Was ist los, Hübner?«, fragte nach einer Weile eine Stimme aus dem Dunkeln.
»Der Kommerzienrat ist da!«, wisperte Hübner.
»Ah!«, kam es erfreut zurück. »Ja, dann machen Sie doch endlich Licht …«
»Ja, ja, natürlich …«
Die Deckenbeleuchtung flammte auf.
Direktor Hirschfeld, Leiter und Inhaber der bekannten Berliner Privatdetektei »Jenns & Hirschfeld«, hob seinen schweren Kopf von der Schreibtischplatte. Die kleinen, in Fett verquollenen Äuglein blinzelten, seine gepflegte Hand fuhr hastig über die heiße Stirn und Glatze.
»Also, lassen Sie den Kommerzienrat herein«, sagte er, noch immer etwas benommen, mit schleppender Stimme.
»Um Gottes willen, Herr Direktor!«, ereiferte sich Hübner. »Unsere Vorbereitungen!«
Geschäftig flog der kleine, dürre Mann aus einer Ecke des Zimmers in die andere. Es war staunenswert, wie er es fertigbrachte, beinahe gleichzeitig dem Direktor Kragen und Krawatte anzulegen, die »Asbach-Uralt«-Flasche und die Gläser vom Schreibtisch unters Sofa zu befördern und die billigen Zigarren auf dem Rauchtisch mit dem Kistchen »für besondere Zwecke« zu vertauschen.
»Schon gut, schon gut, Hübner«, wehrte Hirschfeld ab, als der Geschäftsführer sich daran machte, ihm den Rock und die Weste abzubürsten.
»Geht nicht anders! Nur einen kleinen Augenblick Geduld, Herr Direktor! Sie müssen unser Geschäft doch sozusagen standesgemäß vertreten. Rock und Weste müssen sauber sein. Die Beinkleider können ja dreckig bleiben. Die sieht der Kommerzienrat nicht, da Sie ja doch hinter Ihrem Schreibtisch nicht hervorkommen. So! Jetzt noch den Hans – dann ist alles in Ordnung.«
Er stob zur Tür hinaus und kehrte gleich darauf mit einem Mann im Mantel zurück, der verlegen Zylinder und Lederhandschuhe in den Händen drehte.
»Hier!« Hübner suchte alle seine Westentaschen ab. »Aha! Hier haben Sie fünfzig Pfennig. Trinken Sie irgendwo ein Gläschen Bier. Aber erst die Sache richtig machen!«
»Ja, ja«, meinte der andere und schritt nach der Tür, aber Hübner sprang ihm nach und hielt ihn am Mantel fest.
»Wo ist der Scherben? He? Wo ist Ihr Einglas?«
»Das Ding verlier ich ja doch immer wieder …«
»Los, los! Macht rasch!«, drängte Hirschfeld.
Hübner seufzte.
»Na, schon recht; also ohne Einglas. Aber vergessen Sie nicht die Geschichte mit dem Vorschuss!«
Der Mann nickte und stieß die Tür auf.
Mit einem Schlage veränderte sich das Bild. Der Direktor war aufgestanden und verneigte sich höflich vor dem Mann mit dem Zylinder; Hübner aber katzbuckelte hinter ihm her durch die Tür.
»Habe die Ehre, Herr Baron«, murmelte er ehrfürchtig. »Wird alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt werden.«
Hans, der »Baron«, winkte gnädig mit der Hand.
»Schon recht, mein … Guter«, sagte er etwas unsicher. Plötzlich wandte er sich noch einmal um. »Ja, da fällt mir gerade ein, Herr Direktor«, rief er laut. »Brauchen Sie nicht noch einen kleinen Vorschuss?«
Der Direktor hob beschwörend beide Hände empor.
»Aber nein, Herr Baron! Die fünftausend Mark, die Sie letzthin zahlten, genügen vollkommen.«
Der »Baron« nickte freundlich und schritt, begleitet von Hübner, durch das Wartezimmer zum Treppenflur.
»In einer Stunde sind Sie wieder da«, flüsterte Hübner dem »Baron« hastig zu. »Heute müssen unbedingt noch die Fenster geputzt werden.«
Der »Baron« trollte davon, Hübner aber betrat wieder das Wartezimmer.
»Der nächste, bitte!«, rief er laut; und dann, als bemerke er den hageren, grauen Mann im Polsterstuhl erst jetzt, fuhr er fort: »Ah, der Herr Kommerzienrat! Habe die Ehre, die große Ehre … Bitte näherzutreten! Der berühmte Detektiv Hirschfeld, Max Hirschfeld, empfängt Sie natürlich sofort!«
Fünf Minuten später saß der Kommerzienrat dem Direktor gegenüber, und zwischen ihnen lag ein Häufchen Banknoten.
»Ich bin wirklich erstaunt, wie schnell Sie den Fall abgeschlossen haben, Herr Hirschfeld«, sagte der grauhaarige Kommerzienrat mit einem gewinnenden Lächeln. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir jetzt den genauen Betrag meiner Restschuld nennen wollten.«
»Sofort, Herr Kommerzienrat«, erwiderte Hirschfeld zuvorkommend und drückte auf einen Klingelknopf. Seit gestern war die Klingelanlage nicht in Ordnung, und Hirschfeld wusste das ganz genau; er hatte aber gute Gründe zu hoffen, dass das Klingelzeichen doch den gewünschten Erfolg haben werde: Hübner konnte es zwar nicht hören, dafür aber sehen – durchs Schlüsselloch.
Der Geschäftsführer erschien nicht gleich. Erst nahm er sich die Zeit, auf einem Bogen Papier geschickt einige Zahlen zu ändern – entsprechend der günstigen Stimmung des Kommerzienrats. Nun erst rannte er geschäftig ins Direktorzimmer – herein, heraus – wartete, bis die Tinte der neuen Zahlen ausgetrocknet war, und legte dann mit ehrerbietiger Miene den Bogen Hirschfeld vor.
»Unsere Restforderung, Herr Kommerzienrat«, erklärte der Direktor mit einem mitleidigen Lächeln, »ist entsprechend dem recht einfachen Falle auch recht gering.« Er schnäuzte sich umständlich die Nase. »Vierhundertneunundneunzig Mark und siebzig Pfennig. Hier ist die Abrechnung.«
Kommerzienrat Sommerfeld hob wortlos zehn Fünfzigmarkscheine von dem Päckchen ab, das vor ihm lag; mit einer lässigen Handbewegung schob er die Banknoten Hirschfeld zu und ließ merkwürdigerweise den Rest des Geldes auf dem Tisch liegen.
»Sagen Sie, bitte«, fragte er kühl, »haben Sie den Fall eigentlich selbst bearbeitet oder ihn durch Angestellte …« Er zögerte.
»Fast alle Fälle nehme ich mir selbst vor«, wich ihm Hirschfeld geschickt aus. »Wie sollte ich auch sonst das in mich gesetzte Vertrauen meiner Auftraggeber rechtfertigen? Meine Angestellten – übrigens nur allererste Kräfte – haben mich bei meiner Arbeit natürlich zu unterstützen. Sehen Sie, wenn …«
»Ihre Versicherung genügt ja vollkommen«, unterbrach ihn der Kommerzienrat etwas kurz und blickte nachdenklich auf den großen Siegelring, der seinen rechten Mittelfinger schmückte.
Direktor Hirschfeld lächelte; aber es war nicht das überlegene Lächeln, das er seinen Angestellten – den allerersten Kräften – gegenüber stets mit Erfolg anwandte. Er fühlte sich augenscheinlich nicht recht wohl in seiner Haut. Was wollte denn der Kommerzienrat noch von ihm? Die Aufgabe war gelöst, die Rechnung beglichen – der Fall also vollkommen erledigt. Was bezweckte der Besucher mit seiner sonderbaren Frage?
»Ich muss Ihnen ein Geständnis machen«, sagte der graue Mann ihm gegenüber langsam, und in seine kalten Augen trat ein Schimmer von Teilnahme. »Der ganze Fall, den Sie lösten, war – konstruiert.«
Er betrachtete sein Gegenüber mit Blicken, die forschend und spöttisch zugleich waren; und das Gesicht Hirschfelds war tatsächlich des Betrachtens wert.
»Ko… ko… konstruiert?«, stammelte er ratlos, und seine Glatze wurde zusehends röter. »Wie … was wollen … Sie damit sagen?«
»Nichts Kränkendes für Sie«, versicherte der Kommerzienrat. »Ich habe einfach einen Kriminalfall – mit Indizien, Alibis und allem, was sonst dazu gehört – aufgebaut, und dann habe ich fünf Privatdetekteien den Auftrag gegeben, diesen Fall zu entschleiern. Verstehen Sie nun?«
»Nein!« Diese Antwort war insofern bedeutsam, als Hirschfeld diesmal ausnahmsweise wirklich genau das sagte, was er dachte.
Der Kommerzienrat hob ein wenig gelangweilt die Augenbrauen.
»Ich wollte mir einen Geschicklichkeitsnachweis verschaffen, denn der Auftrag, den ich in Wirklichkeit zu vergeben habe, ist so schwierig und für mich so wichtig …«
Auch Hirschfeld hatte Augenblicke, wo der Geist über ihn kam.
»Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, Herr Kommerzienrat? Es plaudert sich dabei gemütlicher«, meinte er mit seinem verbindlichsten Lächeln, denn er hatte endlich begriffen, dass die fünfhundert Mark durchaus nicht gefährdet waren, und dass es eine Möglichkeit gab, noch viel mehr herauszuholen.
»Danke«, lehnte der Kommerzienrat ab. »Ich bin Nichtraucher. Aber bitte – rauchen Sie doch!«
Hirschfeld brannte sich etwas erregt eine Zigarre an.
»Sagten Sie nicht, Herr Kommerzienrat, dass Sie den Prüfungsfall – reizender Gedanke übrigens! – noch vier anderen Detektiven übergeben hätten? Mit welchem Erfolg, wenn ich fragen darf?«
»Sie sind der erste, der die Aufgabe löste. Ein Detektiv kam rascher, dafür aber zu einem falschen Schluss. Zwei haben noch nichts von sich hören lassen, und einer – Sie werden ihn wohl dem Namen nach kennen: Egon Friede – weigerte sich überhaupt, den Fall zu übernehmen.«
Hirschfeld lächelte geringschätzig.
»Friede – hm – ja, ein Anfänger … Kann natürlich etwas – hm – aber – nur leichte Sachen, wissen Sie …«
»Mir wurde gesagt, er hätte ein paar recht verzwickte Fälle gelöst …«
»Glück, weiter nichts.«
»Jeder Mensch, der vorwärtskommen will, muss Glück haben. Ein Detektiv ohne Glück taugt aber schon gar nichts …«
Hirschfeld rückte etwas gereizt auf seinem Sessel hin und her.
»Natürlich, natürlich! Ihre Anschauungen sind sehr beachtenswert, und Sie haben damit vollkommen recht … Ich meine aber, dass ein Detektiv noch besser ist, wenn er – wie ich – Glück hat und außerdem hier was …« Er tippte bedeutsam gegen die Stirn.
Nichts in den Mienen des Besuchers ließ erkennen, ob ihn die Worte Hirschfelds überzeugt hatten oder nicht. Nur der Ton seiner Stimme verriet etwas wie leises Unbehagen, als er jetzt sagte: »Wir wollen zur Sache kommen.« Dann hob er den Kopf und fragte mit leicht gefurchter Stirn: »Sie haben doch sicherlich von der Verurteilung meines Sohnes gehört?«
»Aber gewiss, Herr Kommerzienrat«, bestätigte Hirschfeld eifrig. »Der Fall hat ja in allen Kreisen sehr viel Staub aufgewirbelt …«
»Wie meinen Sie das?«, rief der Kommerzienrat plötzlich heftig. »Ich habe es mir ein kleines Vermögen kosten lassen, damit dieser Fall so wenig wie möglich besprochen würde …«
»Ich meinte natürlich nur die Fachkreise!«, rief Hirschfeld vorwurfsvoll.
»Also gut«, sagte der Kommerzienrat wieder ganz ruhig. »Diesen Fall – den Fall Peter Sommerfeld sollen Sie lösen. Ich lasse Ihnen alle diesbezüglichen Akten da, und wenn Sie mir bis morgen eine auch nur halbwegs vernünftige Schilderung des möglichen Sachverhaltes geben, erhalten Sie von mir endgültig den Auftrag. Geld spielt dabei keinerlei Rolle.«
2
Eine halbe Stunde später begleitete Hübner den Kommerzienrat hinaus und betrat gleich darauf das Arbeitszimmer seines Vorgesetzten.
»Sie haben natürlich alles gehört?«, fragte Hirschfeld gut gelaunt.
Hübner lächelte unterwürfig.
»Ganz zufällig, Herr Direktor. Wirklich ganz zufällig. Die Türen bei uns – hm – schließen so schlecht …«
»Schon recht«, wehrte Hirschfeld ab. »Sagen Sie mir lieber, wer von unseren Leuten den ›konstruierten Fall‹ behandelte.«
»Es war der Kranich, Herr Direktor. Georg Kranich, siebenundzwanzig Jahre alt, evangelisch-lutherisch, unverheiratet, kinderlos …«
Mit einer Handbewegung gebot der Direktor dem Redestrom Hübners Einhalt.
»Und wem, denken Sie, können wir den Fall Sommerfeld anvertrauen?«
Hübner zuckte ein paarmal ratlos mit den Schultern.
»Ich kann mir nicht helfen, Herr Direktor! Diesen Fall können wir niemand anderem als eben diesem Kranich übergeben. Die anderen … nein, die bringen hier bestimmt nichts zuwege …«
»Und Kranich? Er schafft’s?«
Wieder hob Hübner die Schultern.
»Bin ich ein Prophet, Herr Direktor? Kann ich weissagen? Nein, das kann ich nicht. Aber ich möchte meine schönste Krawattennadel wetten: Der schafft’s!«
Hirschfeld runzelte ärgerlich die Stirn.
»Sie wissen, ich kann den Menschen nicht ausstehen …«
»Herr Direktor, wir haben keine Wahl! Der Fall Sommerfeld ist eine ganz böse Geschichte. Wenn Sie ihn nicht dem Kranich geben wollen, dann lehnen Sie ihn lieber gleich ganz ab.«
»Also, dann schicken Sie ihn mal her«, rief Hirschfeld unwirsch, »und – halt! Wo rennen Sie denn hin? Machen Sie seine Abrechnung fertig. Aber es darf kein großer Überschuss zu seinen Gunsten verbleiben. Verstanden?«
»Soll ich lieber einen kleinen Überschuss zu unseren Gunsten machen, Herr Direktor?«
»Nein! Machen Sie es genau so, wie ich eben sagte.«
»Selbstverständlich, Herr Direktor!« Mit diesen Worten huschte Hübner zur Tür hinaus.
Einige Minuten später klopfte es.
»Herein!«, rief Hirschfeld kühl.
Der junge Mann, der freudig lächelnd die Schwelle überschritt, fand einen ganz anderen Hirschfeld vor, als ihn Kommerzienrat Sommerfeld vor einer Viertelstunde verlassen hatte. Jede Spur von Freundlichkeit war aus dem Gesicht des Direktors getilgt; kalt und streng blickten die Augen, und um die Mundwinkel zogen sich scharfe Falten.
»Guten Abend, Herr Hirschfeld«, begann Kranich, ohne sich um die ihm bereits wohlbekannten schlimmen Anzeichen zu kümmern. Seine Hand fuhr hastig über den blonden, etwas zerzausten Scheitel, dann strich er ein paarmal über die Rockaufschläge seines sauberen, aber recht mitgenommenen Anzuges. »Hübner sagte mir, dass der Kommerzienrat Sommerfeld da war …«
»Gestatten Sie vielleicht, dass ich zuerst rede?«, erkundigte sich Hirschfeld spöttisch.
Der junge Mann hielt erstaunt in seiner Rede inne. Nach kurzem Zögern erwiderte er etwas gekränkt: »Wenn Sie meinen, dass dies für unsere Unterhaltung von Vorteil sei, dann … dann gestatte ich es gern.«
Hirschfeld ließ ein wütendes Grunzen hören.
»Er gestattet! Hat man so etwas schon gehört?!«
Kranich schwieg. Da aber der Direktor jetzt ebenfalls schwieg, nahm er gleich darauf doch wieder das Wort: »Ich dachte, Sie wollten mir etwas sagen! Falls nicht, so kann ich ja inzwischen meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass der Kommerzienrat gezahlt hat. Gleichzeitig möchte ich diesen Freudenausdruck mit einer Bitte verknüpfen …«
»Ich rede jetzt!«, polterte Hirschfeld los und schlug mit der Faust auf den Tisch.
Kranich seufzte tief auf.
»Sie reden? Gut. Ich habe zwar nichts davon gemerkt, aber wir wollen uns nicht streiten. Sie haben recht, denn – der Schwächere gibt nach.«
»Wenn Sie jetzt nicht still sind«, zischte der Direktor. »Sie – ich weiß nicht, was ich dann tue!«
»Ich auch nicht«, sagte Kranich und lächelte sanft.
Das Klopfen Hübners enthob Hirschfeld der Antwort.
»Herein!«, brüllte er. »Ah! Die Abrechnung? So? Da! Sehen Sie das mal an, junger Mann!« Damit warf er Kranich das Papier über den Tisch zu.
In dem Gesicht des jungen Detektivs vollzog sich ein jäher Wechsel. Alles Freudige war daraus wie weggewischt. In seinen hellblauen Augen standen Tränen, und die fast mädchenhaft geschwungenen Lippen bewegten sich in vorwurfsvollem Selbstgespräch.
Plötzlich blickte er flehend auf.
»Ist es wahr, Hübner«, jammerte er. »Der Sommerfeld hat nur hundert Mark bezahlt?«
Hübner nickte eifrig.
»So wahr Gott lebt, er hat – ich meine: Der Kommerzienrat hat nicht mehr bezahlt!«
»Dann verbleiben mir nach Abzug aller Vorschüsse – sogar bei Berücksichtigung meiner Spesenrechnung – nur drei Mark?«
»Drei Mark dreißig Pfennig«, verbesserte Hübner.
»Aber das ist doch ganz unmöglich!«, rief Kranich verzweifelt aus.
»Bei uns ist nichts unmöglich«, erklärte Hübner, ohne sich des gefährlichen Doppelsinnes seiner Worte bewusst zu werden.
»Herr Direktor«, flehte der junge Mann. »Ich brauche unbedingt Geld …«
»Beruhigen Sie sich doch«, beschwichtigte ihn Hirschfeld. »Wir zahlen stets pünktlich. Sie können noch heute Ihre drei Mark dreißig Pfennig an der Kasse abheben. Nicht wahr, Hübner?«
»Selbstverständlich, Herr Direktor«, bestätigte der Geschäftsführer und verschwand nach einigen tiefen Bücklingen durch die Tür.
Kranich senkte traurig den Kopf. Er war nicht der Mensch, lange über ein Missgeschick nachzubrüten, aber in Augenblicken wie jetzt kam ihm der ganze Jammer seines Lebens zum Bewusstsein. Die Zimmervermieterin hatte heute zum dritten Male gemahnt, die Milchrechnung war auch noch nicht bezahlt, und die neubesohlten Schuhe lagen seit acht Tagen beim Schuster bereit – aber ohne Geld würde er sie wohl kaum herausgeben. Kranich hatte felsenfest auf diesen Kommerzienrat Sommerfeld gebaut. Dessen von ihm mit Glück und Geschick ausgeführter Auftrag versprach endlich einmal einen größeren Geldbetrag einzubringen. So überzeugt war Kranich davon gewesen, dass er gestern sogar für achtzehn Mark einen neuen feinen Hut mit bequemen Teilzahlungen erworben hatte.
»Sehen Sie mal an, Herr Kranich«, erklärte Hirschfeld in dem satten Ton eines Menschen, der am warmen Kaminfeuer Geschichten über Nordpolfahrer erzählt. »Sie verdienen bei mir wöchentlich dreißig Mark. Das ist eine Menge Geld. Außerdem erstatte ich Ihnen auch alle Ihre Unkosten – in vernünftigen Grenzen natürlich – und dann erhalten Sie noch für jeden Erfolg eine besondere Vergütung. Als ich in Ihrem Alter war«, er seufzte tief auf, »da ging es mir bedeutend schlechter. Ich war froh und dankte Gott, wenn ich genug Brot und wöchentlich ein Päckchen ›Schwan im Blauband‹ dazu hatte …«
»Die Marke ›Schwan im Blauband‹ kam erst neunzehnhundertsechsundzwanzig auf den Markt«, warf Kranich bescheiden ein.
»So …«, meinte Hirschfeld ein wenig verblüfft, doch hatte er sich gleich wieder gefasst. »Na, dann war es eben eine andere Marke. Jedenfalls darbte ich sehr.«
»Dasselbe erzählte mir mein letzter Vorgesetzter«, bemerkte der junge Mann sinnend. »Er ernährte sich ausschließlich von Pellkartoffeln …«
»Sehen Sie! Sehen Sie!«, fiel ihm Hirschfeld hastig ins Wort. Nun hielt er es aber doch für ratsam, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben: »Sie haben den letzten Auftrag soweit ganz gut gelöst. Sie entdeckten zwar nicht, dass es nur ein konstruierter Fall war; aber das will ich Ihnen nicht weiter verübeln …«
»Wieso ›konstruierter Fall‹?«, rief Kranich erstaunt.
Hirschfeld erklärte ihm mit knappen Worten, welche Bewandtnis es mit diesem Scheinauftrag hatte.
»Ich selbst hatte das natürlich gleich erkannt. Aber warum sollte ich nicht das gute Geld – es ist nicht viel, gar nicht viel – des Kommerzienrats nehmen? Gleichzeitig wollte ich dadurch Ihre Fähigkeiten prüfen. So, und nun ist hier ein Aktenstück, das Sie bis morgen noch genau durchsehen wollen. Wenn Sie morgen imstande sind, mir Ihre Mutmaßungen über diesen Fall zu entwickeln, und wenn Ihre Vermutungen dem wahren Sachverhalt – den ich so ziemlich durchschaue – entsprechen, dann soll Ihnen dieser Fall übertragen werden.«
»Und? Und wegen Vorschuss …«
»Sie können dann auch Vorschuss bekommen«, sagte Hirschfeld gnädig. »Wie immer zwanzig vom Hundert des uns bezahlten Betrages. Und der Kommerzienrat versprach – ehern – zweihundertfünfzig Mark zu bezahlen. Nehmen Sie also jetzt die Schriftstücke, gehen Sie nach Hause und machen Sie sich gleich an die Arbeit.«
Zwanzig Minuten später verließ Kranich das Geschäft. In der Tasche hatte er nur drei Mark dreißig Pfennig, im Herzen aber tausend große Pläne und Hoffnungen. Er strahlte übers ganze Gesicht und rannte so schnell, dass er an der nächsten Ecke heftig gegen einen alten Bettler anprallte, und beide zu Boden stürzten.
»Entschuldigen Sie, lieber Mann«, sagte Kranich höflich. »Es geschah wirklich nicht mit Absicht.«
Der Bettler brummte mürrisch etwas Unverständliches und half Kranich, die aus dessen Aktenmappe gefallenen Papiere zusammenzusuchen.
»Ich hab’ heute meinen guten Tag«, erklärte Kranich, nachdem er seinen Anzug sorgfältig abgestäubt hatte. »Hier haben Sie zwei Groschen Schmerzensgeld.« Mit einem freundlichen Nicken schritt er davon.
Der Bettler betrachtete eine Weile verblüfft die zwei Münzen in seiner Hand. Dann lachte er kurz auf und begab sich zu einer Fernsprechstelle. Mit Kranichs Geld bezahlte er zwei Ferngespräche, wobei er jedes Mal nur kurz meldete, dass sich die bewussten Papiere jetzt in Kranichs Aktentasche befänden.
3
Der berühmte Detektiv Egon Friede lag leise gähnend auf der Ottomane in seinem geschmackvoll eingerichteten Wohn- und Arbeitszimmer und blätterte ohne sonderliche Teilnahme in einer Bilderzeitschrift. Ab und zu tat er einen tiefen Zug aus seiner kurzen Pfeife und blies den Rauch in einer dichten grauen Wolke weit von sich.
Ihm schräg gegenüber saß an einem Schreibmaschinentisch Agnes Wieland, seine Stenotypistin. Sie war so hübsch, wie es die Stenotypistin eines Mannes von Geschmack unbedingt sein muss; ihre graublauen Augen strahlten stets so, als wenn deren Inhaberin gerade Gehaltserhöhung erhalten hätte; und ihre zierlichen Füßchen wippten so unternehmungslustig hin und her, wie man es bei anderen Stenotypistinnen nur abends und auch dann erst nach dem dritten Glas Wein beobachten kann.
»Wir brauchen Geld, Herr Friede«, sagte sie plötzlich und rückte die Papiere beiseite, an denen sie nun schon volle zwei Stunden gearbeitet hatte.
Friede hob kaum merklich die Augenlider. Die Blicke, mit denen er ihre geschmeidige Gestalt streifte, waren nachdenklich.
»Wer braucht Geld?«, fragte er langsam. »Sie oder ich?«
»Sie und ich!«, gab sie schlagfertig zurück und warf einen vorwurfsvollen Blick in die Gegend, wo sie hinter dem dicken Qualm sein Gesicht vermutete.
Friede gähnte laut.
»Bitte, verallgemeinern Sie nicht immer, Fräulein Agnes«, sagte er ruhig. »Also etwas genauer: Sie brauchen Geld. Wozu, geht mich nichts an. Wie viel?«
»Siebenhundertfünfzig Mark.«
»So viel auf einmal?«
Das Mädchen warf so geschickt ein Bein über das andere, dass ein guter Teil der seidenen Unterwäsche nunmehr deutlich zu sehen war.
»Es ist mein Gehalt für die letzten drei Monate«, sagte sie einfach. Alles Weitere sollten die Beine sagen.
»Schreiben Sie einen Scheck über diesen Betrag aus«, erklärte Friede kühl.
»Schecks werden kaum etwas nützen«, erwiderte sie trocken. »Wenigstens keine mit Ihrer Unterschrift, da Ihr Konto seit gestern gesperrt ist.«
Friede nickte.
»Stimmt, Sie sagten es mir schon gestern. Verstehe ich übrigens nicht. Ich habe doch erst kürzlich fünfzigtausend Mark verdient …«
»Es stimmt ganz genau«, unterbrach sie ihn sehr bestimmt. »Hier ist die Aufstellung: Dreihundertfünfzig Mark polizeiliche Strafen für zu schnelles Autofahren. Tausendachthundert Mark Schadenersatz für den umgefahrenen Schutzmann – der zweite war billiger: Den zahlte die Versicherungsgesellschaft aus. Ferner ein Damenpelzmantel für viertausend Mark. Der Kaufpreis für das Landhaus derselben Dame betrug achtzehntausendzweihundert Mark. Einen wildfremden schwindsüchtigen Arbeiter schickten Sie nach Davos – Kostenpunkt: neunhundert Mark. Ihre eigene Reise nach Monte Carlo kam auf rund zehntausend Mark. Weiterhin …«
»Genug!«, wehrte Friede ab. »Ich sehe, es hat schon seine Richtigkeit. Da muss etwas getan werden …«
»Sie hätten eben, wie ich Ihnen schon sagte, den Fall des Kommerzienrats Sommerfeld nicht ablehnen dürfen«, bemerkte Agnes.
»Davon verstehen Sie nichts«, gab Friede mit leisem Unmut zurück. »Bevor ich den Fall ablehnte, habe ich ihn überprüft. Der ganze Fall war gestellt, verstehen Sie? Der Kommerzienrat wollte meine Fähigkeiten prüfen. Ich habe ihm Bescheid gesagt und natürlich abgelehnt.«
»Das ändert die Sache allerdings …«
»Nein, mit solchen Fällen ist uns nicht geholfen. Ich muss etwas anderes versuchen … Nehmen Sie, bitte, jetzt das linke Bein vom rechten. Ich habe genug gesehen. Wollen Sie meine Geliebte werden?«
»Nein, aber …«
»Dann besorgen Sie jetzt die Briefe und trinken Sie irgendwo eine Tasse Kaffee. Ich habe eine wichtige Besprechung. Sie müssen heute aber auf alle Fälle noch einmal vorbeikommen. Auf Wiedersehen!«
Agnes stand noch im Vorzimmer und knöpfte ihre Handschuhe zu, als es plötzlich klingelte. Sie öffnete vorsichtig einen Türspalt und spähte hinaus. Schnell wollte sie die Tür wieder zuziehen, aber der zerlumpte Strolch, der draußen stand, hatte schon seinen Fuß dazwischengeschoben.
»Hier wird nicht gebettelt!«, rief Agnes ärgerlich. Angst hatte sie nicht. Wenn Friede in der Nähe war, fürchtete sie sich nie.
»Nu’ mach keine Zicken, Kleine«, rief der ungewöhnliche Besucher gemütlich. »Ich muss den Detektiv sprechen. Aber dalli!«
Durch das laute Gespräch herbeigelockt, steckte Friede den Kopf durch die Tür.
»Was ist denn hier los? Wie? Sie wollen mich sprechen?« Er machte eine einladende Handbewegung. »Kommen Sie herein, guter Mann. Ihr Schießeisen legen Sie hier auf den Tisch; Sie können es später wieder mitnehmen. Fräulein Agnes, lassen Sie sich nicht aufhalten.«
Er verabschiedete das Mädchen mit einer Kopfbewegung und schloss hinter ihr die Tür.
Der Strolch steckte wortlos die Waffe, die er eben erst gehorsam auf den Tisch gelegt hatte, wieder in die Tasche und betrat rasch Friedes Arbeitszimmer. Am Fenster blieb er stehen und starrte eine geraume Weile durch den Spitzenbesatz des Vorhanges auf die Straße.
»Bist du ihrer sicher?«, fragte er plötzlich in dialektfreiem Deutsch, warf sich in einen Sessel und streckte die mit völlig zerrissenen Schuhen bekleideten Füße weit von sich.
»Vollkommen«, erwiderte Friede kurz.
Der andere nickte.
»Stimmt. Sie hat das Haus sofort verlassen, hat keinen Versuch gemacht, mich zu fotografieren, und ging, ohne sich umzuwenden, die Straße hinunter. Immerhin … Man kann nicht vorsichtig genug sein.«
Friede zuckte die Achseln.
»Sie arbeitet seit einem Jahr bei mir. Ich habe sie sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. Während dieser Zeit hatte sie drei Liebschaften. Der erste Freund war ein Banklehrling und plünderte wie üblich die Portokasse, um ihr Geschenke zu machen. Sie ersetzte die unterschlagenen Gelder und schob ihn ab. Der zweite war Student. Er studierte ein halbes Jahr lang auf ihre Kosten, bis sie dahinter kam, dass er seine ›Studien‹ in Berliner Nacktlokalen betrieb. Aus. Der dritte, gegenwärtige, ist Schnürsenkelfabrikant und ›Kavalier‹. Er zahlt alles.«
»Deswegen kann sie dennoch …«
»Nein, denn ich habe noch mehr Beweise. Ein sehr netter junger Mann hat ihr in meinem Auftrag den Vorschlag gemacht, ihm bestimmte Abschriften aus meinem Briefwechsel zu verschaffen. Für schönes Geld, versteht sich’s. Sie weigerte sich.«
»Sie wird den Schwindel durchschaut haben. Natürlich hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als dir von der bestandenen Prüfung zu berichten.«
»Sie tat es nicht, mein lieber Metzner. Die Sache kam ihr bestimmt viel zu selbstverständlich vor.«
Der Besucher seufzte.
»Hoffentlich hast du recht. Vermutlich hängt mein Leben davon ab.«
»Ist es so schlimm? Aber erzähle endlich: Was hast du in den zwei Monaten deiner Abwesenheit ausgerichtet?«
»Deine Vermutung stimmt: Die Bande, deren Vorhandensein die Polizei abstreitet, besteht tatsächlich. Seit drei Wochen bin ich ihr Mitglied.«
Die Züge Friedes wurden bei diesen Worten gespannt. Mit keinem Wort unterbrach er den Bericht seines Helfershelfers.
»Man ist in jenen Kreisen sehr misstrauisch«, fuhr Metzner mit gleichförmiger, etwas müder Stimme fort. »Mich verwendeten sie bis jetzt nur als Fotografen. Erst als ich erwähnte, dass ich mit deinen Gewohnheiten und der Örtlichkeit hier vertraut sei, gaben sie mir einen gefährlicheren Auftrag: dir mit List oder Gewalt das Schriftstück ›R. Brand‹ zu entwenden.«
»Fauler Zauber«, sagte Friede bedauernd. »In diesem Schriftstück ist keine Zeile, für die es sich lohnen würde, sie geheim zu halten.«
»Ich ahnte es! Also haben die Kerle schon Verdacht geschöpft. Natürlich kehre ich jetzt nicht mehr zu ihnen zurück.«
Friede holte aus einem Fach seines Schreibtisches eine Weinbrandflasche, goss zwei Gläschen voll und trank Metzner zu.
»Hm …«, murmelte er sinnend. »Ich kann es dir nicht verdenken, wenn du deine Haut nicht länger zu Markte tragen willst. Dein plötzliches Ausbleiben würde die Leutchen aber erst recht stutzig machen, und dann …«
»Habe ich alles überlegt. Sobald wir das Nötige besprochen haben, rufst du die Polizei an und lässt mich festnehmen. Das Weitere lass meine Sorge sein. Zweifellos wird die Verhaftung von unseren Feinden beobachtet werden, und niemand wird mehr glauben, dass ich dein Kundschafter sei.«
»Der Gedanke ist nicht übel«, stimmte Friede zu. »Nun berichte aber, was du weißt. Wenn’s auch wenig ist – das Geringste kann hier wichtig sein.«
»Höre zu: Die Bande befasst sich eigentlich nur mit Giftmorden. Wenn je zu anderen Mitteln gegriffen wird, dann handelt es sich immer um ein unvorbereitetes, plötzlich notwendig gewordenes Verbrechen. Das Oberhaupt der Bande – man nennt es ›die Viper‹ – muss ein ganz gerissener Kerl sein; wie mir gesagt wurde, kennt ihn niemand. Die Arbeit ist genau verteilt: Einige haben nichts anderes zu tun, als Gifte zu beschaffen oder herzustellen; andere werden nur als Kundschafter verwendet; wieder andere – das sind die angesehensten – haben sich an die Leute heranzumachen, die von den Kundschaftern als ›geeignet‹ befunden wurden: an Leute, die auf den Tod eines Erbonkels, eines reichen Gatten oder Mündels warten und hoffen. In der Regel erklären sich diese Leute sehr bald bereit, für den Fall des plötzlichen Ablebens ihres Verwandten einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Bei diesen Abmachungen wird nie das Wort ›Mord‹ gebraucht, obwohl die Beteiligten genau wissen, worum es sich handelt. Die Beträge, die sie zu entrichten haben, sind …«
»… sehr hoch, kann ich mir denken!«
»Falsch geraten! Die Beträge sind sehr niedrig gehalten. Erst nach Antritt der Erbschaft werden die Leute richtig zur Ader gelassen – man erpresst ihnen etwa die Hälfte des geerbten Vermögens, dann aber haben sie für immer Ruhe.«
»Ein seltener Fall«, murmelte Friede. »Meist hat solch eine Erpresserschraube kein Ende.«
»Ein Beweis mehr für die Klugheit des Leiters dieser Bande. Er weiß genau, dass ein Mensch, dem man alles nimmt, sich leicht zu einer Anzeige entschließt.«
»Eine Frage«, unterbrach ihn Friede. »Kannst du erklären, wie es kommt, dass die Polizei von diesem Treiben noch nichts gemerkt hat; ja, dass sie auf mein Vorhalten das Vorhandensein einer solchen Bande mit allem Nachdruck abstritt? Sollten Polizeibeamte mitverwickelt sein?«
Der Besucher schüttelte den Kopf.
»Nein, das glaube ich nicht. Ich vermute, dass man ein bestimmtes Gift anwendet, das von den Ärzten nicht nachgewiesen werden kann …«
»Haben die Leute ein derartiges Gift?«, rief der Detektiv überrascht.
»Es wird jedenfalls nur selten angewandt. Wahrscheinlich ist seine Beschaffung oder Herstellung mit Gefahren verbunden. In den weitaus meisten Fällen arbeitet die Bande mit Rauschgiften. Die Polizei kann dann nur feststellen, dass der Betreffende sich selbst vergiftet habe, da er ja an demselben Gift stirbt, das er sich immer wieder beibrachte. Dann aber gibt es noch ein drittes, geradezu teuflisches Mittel …«
Friede hob die Hand und lauschte. Man vernahm das Aufschließen der Treppentür und leichte Schritte im Vorzimmer. Der Detektiv stand auf, nahm Flasche und Gläser in die Hand und winkte dem Besucher, ihm zu folgen.
»Meine Sekretärin ist wieder da«, erklärte er leise, und die beiden Männer begaben sich in einen Nebenraum. Nachdem Friede die Tür hinter sich zugezogen hatte, forderte er Metzner mit gedämpfter Stimme auf, in seinem Bericht fortzufahren.
»Wenn die Anwendung der erwähnten Mittel nicht möglich ist«, nahm jener seine Erklärungen wieder auf, »– angenommen, das ausersehene Opfer ist standhaft, und alle Versuche, es an ein Rauschgift zu gewöhnen, misslingen –, dann wählen die Kerle ein leicht nachweisbares Gift, bearbeiten den Fall aber so sorgfältig, dass die Polizei unbedingt einen Unschuldigen festnimmt. Beweggründe sind vorhanden, die Indizien lückenlos – der Unschuldige wird verurteilt, und wieder hat die Polizei keine Ursache, an das Bestehen einer Giftmischerbande zu glauben.«
Friede schwieg wie in Gedanken versunken. Zwischen seinen Brauen grub sich eine finstere Falte.
»Kannst du mir ein Beispiel nennen?«, fragte er endlich.
»Nein«, sagte Metzner sofort. »Alles, was ich dir erzähle, sind ja mehr oder weniger Mutmaßungen. Ich kann dir keinen Fall nennen, von dem ich weiß, dass er dem eben geschilderten entspricht; allerdings kenne ich einen aus neuerer Zeit, von dem ich das vermute.«
»Welcher Fall ist das?«, rief Friede gespannt.
»Der Fall des Brudermörders Peter Sommerfeld«, erwiderte Metzner ruhig.
»Verdammt noch mal!«, entfuhr es Friede, und er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ich war im Gerichtssaal, als er verurteilt wurde. Ich hatte tatsächlich nicht den Eindruck, einen Mörder zu sehen. Aber Eindrücke sind unzuverlässig, und darum ging ich der Sache auch nicht nach. Hm … Soviel ich mich entsinne, war die Verdachtsbegründung allerdings lückenlos …« Der Detektiv war aufgestanden und schritt langsam aus einer Ecke des Zimmers in die andere. »Neulich war der Kommerzienrat, der Vater des Verurteilten, bei mir – er wollte mir einen Scheinauftrag geben … Ich lehnte ab … hm … Fast bereue ich es jetzt …«
»Das ist sehr schade», stimmte der andere zu. »Ich glaube, dass der Fall Sommerfeld am ehesten eine Handhabe zum Überführen der Giftmischer geben könnte. Der Fall ist noch neu, die Spuren frisch …«
»Was mach’ ich nur«, grübelte Friede. »Ich habe den Kommerzienrat so kurz behandelt, dass ich mich ihm nun unmöglich nähern kann …«
In diesem Augenblick klopfte es.
»Herein!«, rief Friede.
Agnes steckte den Kopf durch den Türspalt.
»Der Kommerzienrat Sommerfeld ist wieder da, Herr Friede«, sagte sie leise. »Soll ich ihn abweisen?«
»Nein!«, riefen Friede und Metzner wie aus einem Munde.
4
Kranich hatte es eilig. Eigentlich hatte er es immer eilig – das lag einfach in seinem Wesen. Noch nie hatte ihn ein Mensch langsam gehen, nie mit Ruhe sein Mittagessen verzehren oder schläfrig und stumpfsinnig in dem überfüllten Wagen der Untergrundbahn sitzen sehen. Auf der Straße lief er, sein Mittagessen verschlang er, und in der Untergrundbahn las er Schriftstücke – sogar solche, die er beinahe auswendig kannte.
Auch heute machte er es nicht anders. Kaum hatte er in dem überfüllten Wagen einen Sitzplatz erobert, vertiefte er sich in das Lesen der Akten. Es kümmerte ihn wenig, dass neben ihm zwei junge Damen standen, die ihm vorwurfsvolle Blicke zuwarfen; auch der dicke Herr, der ihm bei jeder Wendung des Zuges auf die Füße trat, störte ihn nicht. Er hielt seine Papiere so nahe ans Gesicht, als wäre er plötzlich kurzsichtig geworden, und las und las. Das nannte er innerlich: »Auch unter den widrigsten Verhältnissen die Zeit zu nutzen.«
Heute waren die Schriftstücke ausnahmsweise weder trocken noch langweilig. Die Folge davon war, dass Kranich nicht wie sonst eine, sondern vier Haltestellen zu spät ans Aussteigen dachte. Traurig betrachtete er die Namensbezeichnung der Haltestelle, als wolle er diesen schwarzen Buchstaben einen Vorwurf machen; dann zuckte er die Achseln und wartete geduldig, bis er mit dem entgegenkommenden Zug zurückfahren konnte.
»Haben Sie endlich Geld?«, empfing ihn die Wirtin, als er schnell durch den dunklen Vorraum in sein Zimmer schlüpfen wollte.
»Gute Frau …«, begann Kranich.
»Also nicht«, erwiderte die »gute Frau«, die über genügend Menschenkenntnis verfügte und ganz genau wusste, dass ein Mieter sie nur dann »gute Frau« nannte, wenn er kein Geld mitbrachte.
»Also nicht«, bestätigte Kranich und blickte ihr treuherzig in die Augen.
Die Zimmervermieterin sah ihn an, und ein trauriges Lächeln huschte über ihr runzliges Gesicht. Sie war eine Vermieterin von der harmloseren Art; von der Art, die ihr Herz noch in der Brust und das Mietzinsbuch in der Kommode aufbewahren, und nicht umgekehrt.
»Aber morgen bestimmt, Herr Kranich«, warnte sie und drohte ihm mit dem Finger.
»Morgen bestimmt, gute Frau«, rief der junge Mann erleichtert. »Jetzt entschuldigen Sie mich aber bitte: Ich muss mich zum Abendessen umziehen.«