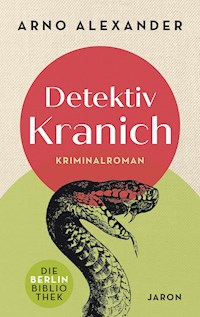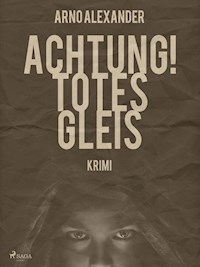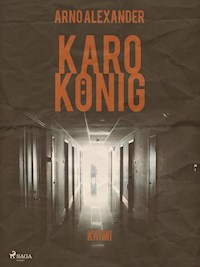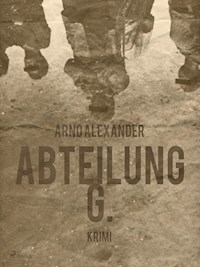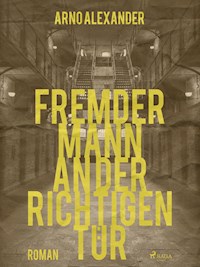Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem englischen Dampfer "Cardigan", der vom ägyptischen Alexandria aus Bremen ansteuert, ist eine bunte Gesellschaft mit nicht immer reiner Weste versammelt. Da ist etwa der Pole Ossip Prochorow, der verhindern will, dass auf dem Schiff Radiomusik gehört wird – offenbar will er vermeiden, dass eine bestimmte Meldung übertragen wird. Und da ist die junge Frau, die er begleitet, laut Passagierliste von Scotland Yard heißt sie Erika Meißner, Tochter eines deutschen Gutsbesitzers aus dem Rheinland, der Dritte Offizier Murphy weiß aber, dass sie in Wirklichkeit Meßner heißt und die Frau jenes Meßner war, dessen Selbstmord vor einigen Monaten in Kairo großes Aufsehen erregt hat und der wegen Opiumschmuggel von Scotland Yard gesucht wurde. Auf den jungen Deutschen Wolfgang Diersch, ein einfacher Zwischendeckpassagier, macht sie allerdings einen guten Eindruck und er setzt sich für die junge Frau ein. Besonders jetzt, nachdem der Rundfunkansager eine Meldung des Polizeipräsidiums Berlin durchgegeben hat: Es sei gelungen "durch schlagartigen Zugriff die größte bis jetzt entdeckte Devisenschieberbande zu verhaften. Lediglich das geistige Oberhaupt der Bande konnte nicht gefaßt werden. Für seine Festnahme wird eine Belohnung von 5000 Mark ausgesetzt. Es handelt sich um den polnischen Staatsangehörigen Ossip Prochorow ..." Auch wenn davon abgesehen wird, Prochorow, der auf dem Schiff ohnehin nicht fliehen kann, an Ort und Stelle in Gewahrsam zu nehmen, wird es sofort recht einsam um den Polen. Für Prochorow, der zudem eine stattliche Anzahl von Diamanten bei sich führt, steht fest: Das Schiff darf Bremen niemals erreichen. Allerdings weiß er, dass sein Vorhaben nicht leicht werden wird, denn auch Inspektor Leith, "der gefürchtetste Geheimpolizist Scotland Yards", befindet sich an Bord ... Ein spannender Schiffskrimi aus den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts – es tut sich noch viel auf dieser aufregenden Fahrt Richtung Nord-Nordwest ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arno Alexander
Nord-Nordwest mit halber Kraft
Roman
Saga
Nord-Nordwest mit halber Kraft
© 1936 Arno Alexander
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711625996
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1.
„Das geht leider nicht“, sagte Kapitän Grady ruhig, mit freundlicher Bestimmtheit, wie ein Mensch, der es gewöhnt ist, dass die Passagiere mit den sonderbarsten Anliegen zu ihm kommen. „Ich habe auf dieser Fahrt sechsundzwanzig Passagiere. Die meisten von ihnen wünschen ein wenig Ablenkung, etwas Musik ...“
„Aber das ist doch nicht mehr zum Anhören!“ rief der ältere wohlbeleibte Mann, der in seinem hellen karierten Anzug und mit den blitzenden Steinen an den Fingern einen sehr zahlungsfähigen Eindruck machte. „Die Dame, die in meiner Begleitung reist, leidet an Kopfschmerzen ... Die ewige Radiomusik macht sie einfach verrückt ... Und mich auch ... Im Rauchzimmer steht doch ein Klavier ... Lassen Sie jemand Klavier spielen, wenn Ihre sechsundzwanzig Fahrgäste unbedingt Musik haben müssen ...“
Der Kapitän stand mit dem Rücken gegen die Reling gelehnt und stopfte seine Pfeife. Es war nur die Andeutung eines Lächelns auf seinen Lippen, und der kleine graue Schnurrbart verbarg auch dieses kaum merkbare Verziehen der Lippen.
„Es muss ein merkwürdiger Kopfschmerz sein, an dem die Dame leidet, die in Ihrer Begleitung reist, Mr. Prochorow“, meinte er ruhig. „Klavierspielen verträgt sie, Radioübertragung nicht ...“ Er hatte sich halb umgewandt und sah über das Wasser zu den in der Ferne entschwindenden Türmen der Stadt Alexandria. Plötzlich wandte er sich dem Mann im karierten Anzug zu: „Wenn ich Sie recht verstehe, möchten Sie verhindern, dass uns durch Rundfunk eine bestimmte Nachricht erreicht?“
Prochorow schüttelte heftig den Kopf.
„Was ich verhindern will, habe ich Ihnen schon gesagt. Aber ... Machen wir es kurz und schmerzlos: Zwanzig Pfund, wenn Sie das Radio abstellen. Einverstanden?“
„Nein.“ Der Kapitän brannte sich, das Streichholz vorsichtig mit der Hand schützend, seine Pfeife an und sah dabei mit listigen, neugierigen Augen den aufgeregten Fahrgast an.
„Dreissig?“
„Nein.“
„Fünfzig? Es ist mein letztes Angebot.“
„Ein schönes Angebot, aber ich lehne es ab. Übrigens möchte ich Ihnen einen Rat geben — kostenlos. Es war ein merkwürdiges Gespräch, das wir beide da eben führten ... Ja, und ... Nun, unsere Reise hat vor zwanzig Minuten begonnen. Es dauert ziemlich lange, bis wir nach Bremen kommen. Wenn Sie solche merkwürdige Gespräche auch fernerhin führen, kommen Sie nie nach Bremen.“
„Aber erlauben Sie mal ...!“
Mit einem kleinen Ruck stiess sich der Kapitän von der Reling ab. Jetzt stand er nicht mehr in nachlässiger Haltung vor Prochorow, sondern militärisch gerade.
„Der Dampfer ‚Cardigan‘, auf dem Sie sich befinden, hat zwar auf dieser Reise eine sehr farbige Mannschaft — viel zu viel Malaien —, aber dieser Dampfer ist dennoch britisches Gebiet“, sagte der Kapitän. Dann griff er flüchtig an den Mützenrand und stapfte davon — sehr ruhig, sehr selbstbewusst und sichtlich mit sich zufrieden.
Mit zusammengekniffenen Augen starrte Prochorow dem Kapitän nach und blickte erst auf, als Ignatjew, sein Sekretär, seinen Arm berührte. Es war ein blasser, dürrer Mann, dessen Gesicht keine Schlüsse auf sein Alter zuliess: er konnte fünfundzwanzig Jahre alt sein oder auch vierzig.
„Nun?“ fragte Ignatjew. Seine Haltung war unterwürfig, doch der forschende Blick verriet, dass er seinem Herrn mehr war als nur Sekretär.
„Er will nicht“, antwortete Prochorow böse. „Dann eben nicht. Es ist ja sehr fraglich, ob die Deutschen durch den Rundfunk ...“
„Sie tun es bestimmt“, warf der Sekretär leise ein. „Wir hätten einen anderen Dampfer nehmen sollen ...“
Prochorow stampfte zornig mit dem Fuss auf.
„Schweigen Sie! Als ob ich das nicht selbst wüsste! Alle Steine waren doch schon an Bord, als wir das Telegramm bekamen ...“
Ignatjew schien immer noch nicht von der Richtigkeit der Handlungsweise seines Herrn überzeugt.
„Lieber ohne Steine nach Frankreich oder sonstwohin fahren als mit Steinen nach Deutschland ...“
„Nach Deutschland?“ Prochorow umspannte jetzt mit beiden Händen das eiserne Geländer, und sein Griff war so fest, dass die Finger eine weisse Färbung annahmen. „Wer sagt denn, dass wir nach Deutschland fahren?“
„Wir fahren Kurs Bremen ...“
„Ach?“ Jetzt lächelte Prochorow. Dieses Lächeln war erstaunt und höhnisch zugleich. „Und Sie meinen, ich hätte mich also auf einen Kahn gesetzt, der unmittelbar nach Bremen geht? Sie müssen mich für sehr dumm halten.“
„Aber der Kahn — wie Sie sagen — geht doch nach Bremen!“
„Stimmt: er geht! Aber er kommt nicht dort an. Wenigstens nicht mit uns. Wenn nämlich der Dampfer nicht vorher irgendwo anlegt, so dass wir aussteigen können, dann ...“ Er unterbrach sich und sah sich vorsichtig um.
„Was dann? Wir sind allein und völlig hilflos ...“
„Wir sind nicht allein, lieber Ignatjew. Wir haben einen Koffer mit Juwelen. Das ist ebenso gut oder besser als ein Koffer mit Sprengstoff. Ein paar von diesen Steinchen unter die Leute geworfen, und alle mühsam errichtete menschliche Ordnung ist zum Teufel ... Aber zur Sache: Depeschieren Sie an Pearson in London, ich würde in etwa vierzehn Tagen dort sein. Nach Paris müssen wir auch Nachricht geben ... Kommen Sie in den Rauchsalon — ich diktiere Ihnen die Telegramme ...“
*
Lautes Stimmengewirr, nur hin und wieder übertönt von einer leisen, durch Rundfunk übertragenen Tanzmusik, empfing die beiden im Rauchzimmer. Fast alle Tische waren besetzt, und viele Fahrgäste standen an den breiten Fenstern, um noch einen letzten Blick auf das entschwindende Ägypten zu werfen. Prochorow nickte einer elegant gekleideten blonden Frau zu, die etwas abseits von den übrigen am Fenster lehnte; dann setzte er sich mit seinem Sekretär in eine Ecke und zog ein dickes, abgegriffenes Notizbuch aus der Tasche. Ohne sich durch den Lärm und die Gespräche stören zu lassen, begann er mit dem Ansagen der Telegramme.
„Mein Mann ist wie ein Kind!“ rief plötzlich eine dicke, etwa vierzigjährige Dame. Sie rief es in schlechtem Englisch, aber als sie sah, dass dieses Englisch fast niemand verstanden hatte, wiederholte sie den Satz in fliessendem Deutsch. „Wenn er irgendwo einen Vogel sieht, den er noch nicht kennt, ist er ganz aus dem Häuschen ... Er ist Orni — tho — loge ...“ Sie stolperte über die Silben des Wortes. „Im Norden Eritreas hat er einen unbekannten Vogel entdeckt ... Leider können wir ihm nicht unseren Namen geben, denn wir heissen Kaufmann ...“
„Warum soll ein Vogel nicht Kaufmann heissen?“ fragte Mr. Scott, ein hagerer Engländer, und rührte emsig in seiner Kaffeetasse. Es war ihm nicht anzumerken, ob er sich über Frau Professor Kaufmann lustig machte.
„Aber ich bitte Sie, Mr. Scott ...“
„Sehr gutes Name für Vogel“, liess sich der Schiffsarzt, Dr. Pembroke, vernehmen. Er hatte Deutsch im Selbstunterricht gelernt und war besonders auf seine Aussprache stolz.
Eine schwarzhaarige junge Dame, sehr hübsch und sehr gut gekleidet, beugte sich zu ihm vor. Es war Maud Kassala, die Tochter eines hohen ägyptischen Beamten, von dem man behauptete, er hätte in der Politik ein Wort mitzureden.
„Wer ist der junge Mann an dem Fenster dort?“ fragte sie leise.
„Es heisst: an das Fenster“, verbesserte Dr. Pembroke mit ruhiger Bestimmtheit. Dann fuhr er in englischer Sprache fort, da seine „1000 Worte Deutsch“ zu dem beabsichtigten Satz nicht ausreichten. „Wolfgang Diersch, ein deutscher Ingenieur, hat vier Jahre lang in Kairo Häuser gebaut ... Dann ging das Bauunternehmen pleite ... Sechs Monate lang suchte er anderweitig Arbeit — vergebens. Man zog Engländer vor. Jetzt fährt er nach Hause ...“
„Very nice“, sagte Mr. Scott, der mit halbem Ohr zugehört hatte. „Steht das alles in der Passagierliste?“
„Nein“, antwortete der Schiffsarzt.
„Woher wissen Sie es dann?“ fuhr Mr. Scott beharrlich fort.
„Sie fragen sehr viel ... zu viel“, warf Dr. Pembroke nachlässig hin und machte sich an einer schwarzen Zigarre zu schaffen.
Maud Kassala hielt es für angebracht, Scotts Frage zu beantworten:
„Die ständigen Unruhen in unserem Land machen eine genaue Überwachung verdächtiger Elemente notwendig. Wahrscheinlich ist es bei diesem jungen Deutschen überflüssig gewesen, aber man kann das nicht vorher wissen ...“ Sie wollte in ihren Erklärungen fortfahren, aber Mr. Scotts gleichgültiges Gesicht machte sie verstummen.
„Oh“, rief der Schiffsarzt, „dieser junge Mann scheint auch anderen Frauen zu gefallen!“
In demselben Augenblick, als Dr. Pembroke diese Feststellung machte, schreckte Wolfgang Diersch jäh aus seiner Versunkenheit auf. Eine schmale Frauenhand hatte leicht seinen Arm berührt. Er sah auf, und auf seinem Gesicht zeigte sich deutlich das Erstaunen über die Schönheit dieser schlanken blonden Frau. Fast noch mehr überraschte ihn aber der angstvolle, erschrockene Ausdruck ihres Gesichts.
„Sprechen Sie deutsch?“, fragte sie hastig, sehr leise. „Bitte, sprechen Sie mit mir — irgend etwas ... Tun Sie, als unterhielten wir uns schon eine Weile ... Ich bitte Sie ...“
„Gnädige Frau, ich begreife nicht ...“
„Sehen Sie den Mann in der Uniform?“
„Den grossen, schlanken Schwarzhaarigen?“
„Ja. Er verfolgt mich ...“
„Gnädige Frau, Sie irren sich gewiss. Das ist der Dritte Offizier dieses Dampfers ...“
„Bitte, erzählen Sie etwas, ganz gleich was ... Dann kommt er nicht hierher ... Er wollte auf mich zukommen, da wandte ich mich an Sie ...“
„Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber diesem Mann werden Sie doch auf die Dauer unmöglich ausweichen können. Versuchen Sie doch, sich etwas zu beruhigen ... Was kann Ihnen denn hier geschehen, hier, unter soviel Menschen? Reisen Sie allein?“
„Nein, Herr Prochorow, ein Freund, begleitet mich ...“
Diersch unterdrückte die Frage, warum sie sich nicht an diesen Freund halte. Es war etwas an dieser Frau, was ihn nachsichtig stimmte. Vielleicht war es das Deutsche an ihr. Viereinhalb Jahre war er seiner Heimat ferngewesen. Er sehnte sich nach Deutschland und nach einer deutschen Frau.
„Waren Sie lange in Ägypten?“ fragte er.
„Seit fünfzehn Jahren“, sagte sie, und jetzt war an ihrer Haltung nichts mehr auszusetzen. Sie lehnte wieder nachlässig am Fenster und blickte hinaus, während sie mit ihm sprach. Es sah so aus, als unterhielten sich zwei einander sehr fremde Menschen über gleichgültige Dinge.
„So lange?“ fragte er. „Sie haben Deutschland fünfzehn Jahre lang nicht gesehen?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Aber Sie sind doch sicherlich in jedem Blutstropfen deutsch?“ fuhr er fort.
„Ich stamme aus dem Rheinland“, antwortete sie tonlos. „Vor fünfzehn Jahren musste mein Vater seiner Gesundheit wegen das Klima wechseln, und wir zogen nach Ägypten. Später, als er starb, fehlte es an Geld, und als mich vor einigen Jahren auch die Mutter für immer verliess, wurden meine Aussichten, Deutschland wiederzusehen, noch geringer.“
„Und jetzt? Wie ist es denn jetzt doch möglich geworden?“
Sie stutzte.
„Ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen ... Seien Sie mir nicht böse ...“
Er begriff sofort.
„Wir kennen einander ja noch gar nicht richtig — Sie haben recht. Gut, dann will ich Ihnen von mir erzählen. Ich habe gerade sechs Monate verzweifelte Arbeitssuche hinter mir. Man wollte mich oft anstellen, aber dann zerschlug sich die Sache doch immer, weil zuerst die Engländer Arbeit haben müssen. Sehen Sie mich nicht so mitleidig an — das liegt ja nun hinter mir. Und jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, nach Deutschland! Meinen Anzug dürfen Sie nicht so aufmerksam betrachten. Er ist nicht besonders, aber es war der billigste, den ich kaufen konnte ... Das Geld dazu bekam ich vom deutschen Konsulat ... Ich bin ganz arm, aber das macht nichts. Vielleicht hat mein Vater noch etwas Geld. Ich habe ihm vier Jahre lang fast meinen ganzen Verdienst nach Berlin geschickt, und davon hat er sich ein kleines Häuschen gekauft. Dort stehen zwei junge Birnbäume, und ein paar Hühner laufen da herum. Eine Ziege wollte Vater auch anschaffen, aber ich habe jetzt schon lange keine Nachrichten von ihm ...“
„Ich beneide Sie“, sagte sie leise. „Ich möchte noch einmal so jung und lebensfroh werden wie Sie ...“
„Ich bitte um Verzeihung!“ sagte eine harte Männerstimme dicht neben ihnen. Die Worte wurden in einwandfreiem Deutsch gesprochen.
Diersch und die Frau wandten sich um. Neben ihnen stand der Dritte Offizier. Sein Gesicht war eine glatte, kühle Maske.
„Dürfte ich den Herrn um die Schiffskarte bitten?“ fuhr er fort.
Diersch kramte in den Taschen seines wirklich wenig eleganten Anzugs.
„Aha! Hier! Bitte sehr.“
Der Offizier nahm den Schein mit einer knappen Verneigung in Empfang. Nach einem prüfenden Blick gab er ihn wieder zurück.
„Sie haben Zwischendeck“, sagte er gemessen und sah über den Kopf des jungen Mannes hinweg. „Fahrgäste des Zwischendecks haben zu den Gelellschaftsräumen keinen Zutritt.“
„Wieso? Ich ...“ Diersch stutzte. Sein Gesicht wurde plötzlich blutrot. „Das heisst wohl, ich soll von hier verschwinden?“
„Ganz recht, mein Herr“, antwortete der Offizier und verneigte sich wieder ein wenig. Seine Haltung war einwandfrei höflich, aber sie wirkte wie eine ausgesuchte Boshaftigkeit. „Der Herr befindet sich in meiner Gesellschaft“, mischte sich die Frau ein. „Ich denke, das genügt?“ Ihre Stimme zitterte ein wenig.
„Das genügt leider nicht“, widersprach der Offizier. „Wir haben sehr genaue Anweisungen ...“
„Gut“, lenkte Diersch ein. „Gegen Anweisungen ist nichts zu machen. Ich werde also gehen. Aber nicht eher, als bis ich meine Unterhaltung mit dieser jungen Dame beendet habe.“
Durch den Wortwechsel aufmerksam geworden, waren die Passagiere aufgestanden und drängten sich neugierig heran. Auch Prochorow eilte herbei, denn er hatte bemerkt, dass die Dame, deren Freund er war, sich im Mittelpunkt der Gruppe befand. Ein paar rasche Fragen, und er war unterrichtet.
„Erika“, rief er streng, „ich wünsche nicht, dass du dich mit Zwischendeckpassagieren abgibst ...“
„Mein Herr“, wandte sich der Offizier von neuem an Diersch, ‚Sie verursachen hier einen Auflauf. Bitte, verlassen Sie sofort diesen Raum.“
„Was kostet die Zuschlag zu der Fahrschein?“ fragte eine hohe, klangvolle Frauenstimme. Das war die Stimme Maud Kassalas.
Der Offizier wandte sich um.
„Sechseinhalb Pfund.“
Maud drängte sich vor.
„Ich gebe Ihnen eine Scheck“, erklärte sie ruhig. „Der junge Mann bleibt.“
Der Offizier verneigte sich mit eisigem Gesicht.
„Damit ist der Fall erledigt.“
„Halt!“ rief Diersch. „Das stimmt nicht. Ich danke der jungen Dame für ihr Eingreifen, muss aber die Hilfe leider ablehnen. Ich gehe. Jetzt ist der Fall erledigt.“
„Very nice“, warf Mr. Scott ein. „Würden Sie, Herr Diersch ... Verzeihen Sie, dass ich Ihren Namen schon kenne, aber ich kenne ihn eben ... Würden Sie mir gestatten ... als eine Art Sympathiekundgebung sozusagen, für Sie die sechseinhalb Pfund auszulegen? Würde es mir zur Ehre anrechnen.“
Plötzlich strahlte das Gesicht des jungen Mannes.
„Darf ich um Ihren Namen bitten?“
„Scott aus Liverpool.“
„Mr. Scott, ich habe keine Bedenken, von Ihrem Anerbieten Gebrauch zu machen. Sie geben mir Ihre Adresse ...“
„Gewiss. Gern. Der Herr Offizier wird vielleicht die Freundlichkeit haben, den Zahlmeister hierher zu bitten. Und nun finde ich, dass wir diese junge Dame und Herrn Diersch lange genug in ihrer Unterhaltung gestört haben ... Hm?“
Die Passagiere begaben sich mit belustigten Gesichtern wieder an ihre Plätze. Nur Maud Kassala und Ossip Prochorow schienen mit dem Ausgang der Sache nicht zufrieden zu sein. Und ihre Gesichter wurden auch nicht fröhlicher, als der Schiffsarzt sein Bierglas hob und laut in deutscher Sprache rief:
„Eine dreifache Hurrah auf der edle Mr. Scott!“
Alles stimmte begeistert ein, und niemand fiel es auf, dass Dr. Pembroke auf Diersch zueilte und ihm kräftig die Hand drückte.
„Sie hätten unbedingt ablehnen müssen“, sagte der Schiffsarzt. „Jetzt haben Sie sich eine Feindin geschaffen. Entschuldigen Sie sich bei der Kassala. Ich fürchte zwar, dass auch das nichts mehr nützt.“ Dieses Mal hatte Dr. Pembroke englisch gesprochen.
2.
Die Uhr war sieben. Der Steward lief eilig durch alle Räume und schlug auf seinen Gong. Einzelne Gruppen der Passagiere strebten bereits dem Speisesaal zu. Manche hatten sich zum Abendessen umgezogen, die meisten hielten dies bei der herrschenden Wärme nicht für angebracht.
Der Dritte Offizier war im Begriff, den Zweiten abzulösen, und wollte eben die Kommandobrücke erklettern, als ein Anruf des Kapitäns ihn zurückhielt:
„Mr. Murphy, auf ein Wort!“
Der Offizier griff schweigend an den Mützenrand und folgte dem Kapitän in dessen Kajüte. Grady knipste das Licht an, legte seine Mütze auf einen Stuhl und liess sich an den kleinen, mit Karten und Büchern bedeckten Tisch nieder.
„Sie hatten einen Wortwechsel mit einem Passagier“, fragte er und sah seinen Offizier prüfend an.
„Jawohl, Kapitän.“
„Nehmen Sie doch Platz“, sagte Grady, aber der andere blieb nach wie vor stehen, als wolle er damit betonen, dass er diese Unterredung als streng dienstlich auffasse. „Der Vorfall hat peinliches Aufsehen erregt“, fuhr Grady fort. „Sie hätten das taktvoller machen müssen ... Hm ...wenn überhaupt! Es ist zwar die erste Reise, die Sie mit mir machen, und ich kenne Sie daher wenig, doch sind Sie mir als ein sehr tüchtiger Seeoffizier empfohlen worden ... ja ... Als Offizier eines Dampfers, der Passagiere mitführt, haben Sie aber auch die Pflicht, diesen Passagieren den Aufenthalt auf dem Dampfer so angenehm wie möglich zu machen ... Ich wünsche nicht, dass die Fahrgäste sich auf unserem Frachtdampfer weniger wohl fühlen als auf den regelrechten Passagierdampfern. Ich bitte Sie, in Zukunft ... Na, kurz und gut: Sie haben mich verstanden?“
„Jawohl, Kapitän“, antwortete Murphy wieder. Die Unterredung schien damit beendet zu sein, aber der Offizier stand nach wie vor in sehr aufrechter Haltung an der Tür.
„Sie können jetzt gehen“, sagte Grady und stopfte sich seine Pfeife.
„Ich habe eine Bitte“, sagte der Offizier.
Der Kapitän sah kurz auf.
„Ja?“
„Dürfte ich die Passagierliste einsehen?“
„Gewiss, sie liegt im Rauchzimmer aus“, antwortete Grady.
„Ich meine die ... andere Liste“, erläuterte der Offizier.
Der Kapitän stand mit einem Ruck auf, nahm ein blaues Aktenheft von einem Regal und reichte es Murphy. Er sprach kein Wort, aber deutlicher als jedes Wort verriet sein Gesicht heftigen Unwillen.
Murphy las im Stehen. Er las sehr aufmerksam. Sechsundzwanzig Namen las er und unter jedem dieser Namen die genauen Angaben über den Zweck der Reise, die Pläne und Vermögensverhältnisse jedes einzelnen. Bei den meisten Namen stand der Vermerk „In Ordnung“, bei einzelnen ein längerer Bericht, der mit den zwei Worten „zu beobachten“ schloss. Der Offizier hatte die Liste auf den Tisch gelegt und sein Notizbuch aus der Tasche gezogen. Er schrieb nur einige Worte, dann klappte er sein Büchlein zu und gab dem Kapitän auch die Liste zurück.
„Nun?“ fragte Grady unmutig. Er wanderte langsam in dem engen Raum auf und ab.
„Ich glaube nicht, dass alle Passagiere Bremen erreichen werden“, sagte Murphy kühl. „Ausserdem stimmt die Liste nicht.“
„Bitte, die Liste Scotland Yards stimmt immer“, berichtigte der Kapitän.
„Lesen Sie bei Nummer 6 nach“, sagte Murphy achselzuckend.
Grady schlug das blaue Aktenheft auf und las laut:
„Erika Meissner, geb. Wundt, fünfundzwanzig Jahre alt, Tochter eines deutschen Gutsbesitzers aus dem Rheinland. Politisch unverdächtig. War verheiratet. Ihr Mann vor drei Jahren verstorben. Gesuch um Ausreise bewilligt. Reist in Begleitung von Ossip Prochorow (siehe Nr. 5). In Ordnung.“ Der Kapitän sah auf. „Nun, und?“
„Sie heisst nicht Meissner, sondern Messner. Sie ist die Frau jenes Messner, dessen Selbstmord vor einigen Monaten in Kairo grosses Aufsehen erregte. Scotland Yard war dahinter gekommen, dass sich der Mann mit Opiumschmuggel befasste. Sein Haus war bereits von Kriminalbeamten umstellt, Flucht unmöglich — da griff er zur Waffe ...“
„Was hat das alles mit der Frau und ihrer Reise zu tun?“
„Scotland Yard sucht die Frau seit Monaten, weil sie ihrem Mann bei seinen verbotenen Geschäften geholfen haben soll ...“
„Ist das bewiesen?“
„Scotland Yard wird es beweisen.“
Der Kapitän sagte eine Zeitlang nichts. Mit erregten Schritten ging er auf und ab. Dann blieb er vor Murphy stehen.
„Woher wissen Sie das?“
„Ich kenne die Frau.“
„So!“ Kapitän Grady stampfte wieder zwei, drei Schritte durch das Zimmer. „Ich fange an zu begreifen“, sagte er. „Es war doch diese Frau, mit der sich der Zwischendeckpassagier unterhielt? Sie wollten sie allein sprechen, nicht wahr? Sie wollten sie warnen? Sie wollten ihr sagen, sie möge vorsichtig sein, da auf dem Dampfer unerkannt Inspektor Leith, der gefürchtetste Geheimpolizist Scotland Yards, mitreist. Habe ich recht?“
„Nein, Kapitän“, versetzte der Offizier ruhig. „Ich habe keine Veranlassung, der Frau schon jetzt zu sagen, dass man sie in Bremen nicht von Bord lassen wird.“
„Wer wird sie nicht von Bord lassen?“ rief Grady heftig.
„Sie, Kapitän. Ich werde Sie zur gegebenen Zeit offiziell darum ersuchen.“
Grady stopfte das blaue Aktenheft mit einer wütenden Bewegung unter einen Stoss Papiere.
„Ich muss jetzt zum Abendessen“, sagte er kurz. „Sie haben Dienst, Mr. Murphy?“
„Jawohl, Kapitän.“ Murphy griff an den Mützenrand, drehte sich hart auf dem Absatz um und ging hinaus. Er hörte den grimmigen Fluch seines Kapitäns nicht mehr, aber er wusste genau, dass Grady jetzt fluchte.
*
Als der Kapitän den Speisesaal betrat, war man schon beim Braten angelangt. Grady wurde freudig begrüsst, und er enttäuschte auch nicht die allgemeine Erwartung. Auf seinen Wink hin brachten zwei neuangeworbene malaiische Stewards Sektflaschen und Gläser herbei, und obwohl sie aus Mangel an Übung mit diesen Dingen ziemlich ungeschickt umgingen, gelang es ihnen doch nach einer Weile, ohne ernsteren Zwischenfall vor jeden Tischgast einen gefüllten Sektkelch hinzustellen. Der Kapitän stand auf und hielt die Rede auf das Wohlgelingen der Fahrt, deren einzelne Worte er besser kannte als das Vaterunser. In nichts unterschied sich diese Rede von den vielen, die er an diesem Tisch schon gehalten hatte, als im Ton, der heute rauher war als sonst. Mehrmals sah er während der Rede Erika an, aber nicht einmal dann, als sie ihm freundlich zulächelte, kam er ins Stocken. Manchmal, bei einer scherzhaften Wendung, unterbrach ihn ein kurzes Gelächter, und die Gesichter der Gäste leuchteten beifällig freundlich, sichtlich zufrieden mit der rednerischen Leistung des Kapitäns. Hätte aber jetzt jemand Grady unterbrochen, so wäre er hilflos steckengeblieben, da er nicht wusste, bei welcher Stelle seiner schönen Rede er war. Seine Gedanken waren in Bremen. Er sah alle diese Fahrgäste mit frohen Gesichtern den Dampfer verlassen, und nur eine nicht ... Erika nicht ...
„Hoch, hoch, hoch!“, riefen die Passagiere und hoben ihre Gläser. Alle wollten mit dem Kapitän anstossen. Auch Erika kam auf ihn zu. Für eine Sekunde kreuzten sich ihre Blicke, dann drängten sich andere Menschen dazwischen, aber Kapitän Grady hatte plötzlich vom Anstossen genug. Er trank sein Glas auf einen Zug leer und setzte es allzu heftig auf den Tisch. Der Fuss brach ab, das Glas kippte um, und Scherben klirrten.
Frau Professor Kaufmann war es, die sofort äusserte, Scherben brächten Glück. Man nahm es ihr nicht übel, denn hätte sie die Bemerkung unterlassen, so wären zehn andere bereit gewesen, dieselbe wichtige Feststellung zu machen. Ausserdem war man jetzt in bester Stimmung, und der Abend versprach wirklich hübsch zu werden.
Einzelne Damen und Herren hatten Abendkleider angelegt, und auch die anderen, die das unterlassen hatten, machten einen festlichen Eindruck. Nur Wolfgang Diersch in seinem hellgrauen Anzug passte nicht recht zu dem Bild. Der Anzug sass schlecht, und die graue Farbe des Stoffs war nicht einheitlich, es schien fast, als hätte man an diesem Stoff neuartige Bleichversuche unternommen, die stellenweise auch durchaus gelungen waren. Mancher mitleidige Blick streifte den jungen Mann; er aber schien sich nicht im mindesten bemitleidenswert zu fühlen, denn sein Gesicht strahlte vor Glück. Die Ursache dieser Freude blieb niemandem verborgen: Wolfgang Diersch sass neben Erika, und diese Frau sah in ihrem dunkelblauen Abendkleid so verführerisch aus, dass mancher andere Mann Diersch um seinen Platz beneidete.
„Wissen Sie auch, dass ich diesen Zufall, Ihre Nachbarin zu sein, ganz entzückend finde?“ wandte sich Erika an Diersch und sah sich ein wenig vorsichtig um, ob ihr Nachbar zur Rechten, Ossip Prochorow, diese Worte nicht gehört hatte.
„Das freut mich riesig“, antwortete Diersch. „Aber Zufall ...? Wer sagt denn das? Ich habe ihm nachgeholfen! Drei Schillingstücke rollten in die sehnsüchtig geöffnete Hand eines Stewards, und schon gehörte mir der Platz ... Wie konnten Sie glauben, dass ich die Verleihung dieses Platzes einfach dem Zufall überlasse?“
„Aber Sie hätten für Ihre Schillinge sicherlich eine bessere Verwendung finden können ...“
„Ganz undenkbar“, widersprach er. „Und dann — wenn Sie recht hätten: ich habe ja noch fünf Schillinge ... “
„Ist das alles, was Sie noch haben?“ fragte sie erschrocken.
„Augenblicklich ja. Aber in Deutschland werde ich Arbeit bekommen und dann schnell reich werden ... Das heisst — ich will ja gar nicht reich werden, ich will nur, dass es mir gut geht ... Aber was haben Sie denn?“ Er sah sie erstaunt an, denn so deutlich wie ein Spiegel verrieten ihre Züge Verwirrung.
„Ach, nichts ...“, wehrte sie ab. „Bitte, sprechen Sie weiter. Also Sie wollen, dass es Ihnen gut geht ...“
Einen Augenblick lang sah er in ihr blasses Gesicht, aber es schien ihm jetzt ganz unbefangen zu sein. Wahrscheinlich hatte er sich vorhin getäuscht. Während er lebhaft von seinen nächsten Plänen erzählte, merkte er nicht, wie sich die Frau etwas nach der anderen Seite lehnte, und er spürte auch nicht, dass sie ihm eigentlich gar nicht mehr richtig zuhörte. So sehr sie sich aber bemühte, noch etwas von dem Gespräch Prochorows mit seinem Sekretär zu erlauschen, es gelang ihr nicht, die beiden sprachen zu leise. Nur die ersten Worte Prochorows hatte sie gehört: „Dieser Deutsche gefällt mir nicht. Der ist für uns gefährlich. Unser Plan —“ Mehr noch als diese Worte hatte ihr Ton sie verwirrt: es war ein herrischer, brutaler Ton gewesen, wie sie ihn an dem stets rücksichtsvollen Prochorow nicht gewöhnt war.
Ignatjew kannte diesen Ton bedeutend besser. Und auch die Worte selbst hatten ihn nicht verwundert. Im Innern gab er Prochorow recht. Eine Weile hatte er nicht geantwortet und nur nachdenklich mit dem Teelöffel in der Nachspeise herumgestochert. Dann endlich sagte er sehr leise, ohne aufzublicken:
„Sie müssten mit ihm bekannt werden.“
„Er scheint arm zu sein“, antwortete Prochorow, und auch er sprach jetzt leiser. „Vielleicht ist da mit Geld was zu erreichen; wenn nicht —“
„Versuchen Sie es“, riet Ignatjew.
Prochorow nickte. Die beiden hatten einander verstanden.
Das Abendessen war beendet, und die Stewards trugen leicht schwankend das Geschirr hinaus. Der Wellengang war mässig, und alle Passagiere befanden sich noch wohlauf. Die Gespräche, die am Tisch geführt wurden, neigten sich aber bereits bedenklich dem Hauptthema: Seekrankheit zu. Jeder wusste von einem unfehlbaren Mittel zu berichten, aber es fanden sich stets andere, die dieses Mittel längst versucht und als nutzlos befunden hatten.
„Ich habe immer einen Kirschkern in den Mund genommen“, behauptete Frau Professor Kaufmann, „und ich bin noch nie seekrank geworden ...“
„Sie hatten wohl immer gutes Wetter?“ erkundigte sich Scott mit seinem empörend gleichmütigen Gesichtsausdruck.
„Wie meinen Sie das?“, fragte sie spitz. „Soll das heissen. Sie glauben ...“
Der Kapitän wünschte keinen Streit, und er mischte sich lachend ein:
„Meine Damen und Herren, ich finde, wir sprechen viel zu früh von Seekrankheit. Von dem bisschen Schaukeln da wird kein Mensch krank ...“
„Meinen Sie wirklich?“ fragte Frau Professor Kaufmann und stand plötzlich beängstigend schnell auf. Ihr Gesicht war grünlich gelb, und ihr ganzes Streben ging im Augenblick dahin, rechtzeitig den Ausgang zu erreichen.
„Verlieren Sie den Kirschkern nicht!“ rief Mr. Scott freundlich. Dieser Satz trug ihm einen giftigen Blick des kleinen schmächtigen Mannes ein, der neben Frau Professor Kaufmann gesessen und bis jetzt geschwiegen hatte. Der Blick war so ausdrucksvoll, dass Mr. Scott sich höflich vorneigte und fragte: „Sagten Sie etwas?“
„Nein?“, erwiderte das Männchen böse. „Aber jetzt will ich Ihnen sagen, dass es unschön ist, wie Sie sich über diese kranke Dame lustig machen. Meine Frau ...“
„Sie sind Professor Kaufmann?“ fragte Scott erstaunt. Er hatte geglaubt, dieser Professor sei sonstwo, nur nicht hier. „Der Mann, der den Vogel gefunden hat?“
„Allerdings, und ich ...“
Frau Professor Kaufmann trat wieder ein, und der kleine Mann verstummte jäh.
„Ich muss mir den Magen verdorben haben“, meinte die Frau, deren Gesicht jetzt wieder einen rötlichen Schimmer zeigte. „Seekrankheit kann es nicht sein, denn der Kirschkern hilft immer ...“
Ein älterer Herr mit einem kleinen grauen Spitzbart, der schon längst in einem offenbar wissenschaftlichen Buch las, blickte auf.